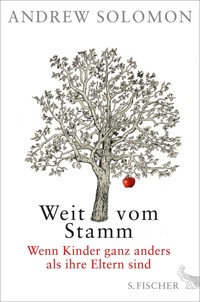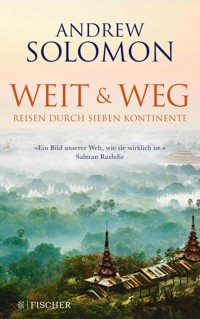
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Viel mehr als nur Reisereportagen – ein Porträt unserer Welt, von jemandem, der sie bereist hat.« Salman Rushdie »Weit und weg« versammelt Andrew Solomons Reportagen, die ihn an ferne Orte auf allen Kontinenten der Erde führen, die sich in einem dramatischen Wandel befinden. Er nimmt den Leser beispielsweise mit auf eine Reise nach Moskau, bei der er Künstler besuchte und das Ende der Sowjetunion unmittelbar miterlebte, nach Afghanistan, um dessen jahrtausendealte Kultur und die erschütternde Zerstörung durch die Taliban mitzuerleben, bis hin nach Myanmar, in die Mongolei und Antarktis oder nach Ruanda. Mit seinen zahlreichen farbenfrohen und lebendigen Geschichten zeigt Solomon dem Leser wie politische und gesellschaftliche Veränderungen zu einem Wandel der Welt führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1022
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Andrew Solomon
Weit und weg
Reisen durch sieben Kontinente
Über dieses Buch
»Viel mehr als nur Reisereportagen – ein Porträt unserer Welt, von jemandem, der sie bereist hat.«
Salman Rushdie
»Weit und weg« versammelt Andrew Solomons Reportagen, die ihn an ferne Orte auf allen Kontinenten der Erde führen, die sich in einem dramatischen Wandel befinden. Er nimmt den Leser beispielsweise mit auf eine Reise nach Moskau, bei der er Künstler besuchte und das Ende der Sowjetunion unmittelbar miterlebte, nach Afghanistan, um dessen jahrtausendealte Kultur und die erschütternde Zerstörung durch die Taliban mitzuerleben, bis hin nach Myanmar, in die Mongolei und Antarktis oder nach Ruanda. Mit seinen zahlreichen farbenfrohen und lebendigen Geschichten zeigt Solomon dem Leser wie politische und gesellschaftliche Veränderungen zu einem Wandel der Welt führen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Andrew Solomon hat in Yale und Cambridge studiert. Unter anderem schreibt er für den New Yorker, Newsweek und den Guardian. Er ist Dozent für Psychiatrie an der Cornell University und beratend für LGBT Affairs am Lehrstuhl für Psychiatrie der Yale University tätig. Sein großes Buch über Depression ›Saturns Schatten‹ war ein internationaler Bestseller und wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem National Book Award und der Nominierung für den Pulitzer Preis. Er lebt mit seinem Mann und seinem Sohn in New York und London. Für ›Weit vom Stamm‹ erhielt er den National Book Critics Circle Award 2013.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »FAR & AWAY. How Travel Can Change The World« im Verlag Scribner, an Imprint of Simon & Schuster, Inc., New York
© 2016 Andrew Solomon
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: GS/GALLERYSTOCK
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490457-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Berichte aus der ganzen Welt
Das Spektrum des Winters
Drei Tage im August
Die kühne Dekadenz des jungen Russland
Raves, Partys und Nachtclubs
Geistesleben
Rock, Pop und Rap
Die schwulen Neunziger
Den Glauben bewahren
Die jungen Geschäftsleute
Russlands Reiche unterscheiden sich
Verbrecherleben
Die Politik des Wandels?
Ein Blick auf das heutige Russland
Der Sinn für Ironie und Humor (und Kunst) der Chinesen kann ihr Land retten
Die Seele der Avantgarde
Ein wenig Geschichte
Absichtliche Absichtslosigkeit
Individualismus nach Schema F
Ein Künstlerdorf
Mao fehlt
Alte Hasen
Warum Gilbert & George?
Der Osten trifft auf den Westen
Ein gefährliches Konzept
Die Künstler Südafrikas: Gleichgestellt, aber getrennt
Bilder, Konzeptkunst und Perlen
Die »Bag Factory« und andere
Die liberalen weißen Künstler
Kunst in den Townships
Schwarze Kunst, ja; schwarze Künstler, nein
Kunst von oben
Kunstpolitik
Das Hinterland
Sehen und gesehen werden
Wladimirs Eroberungen
»Hände weg von unserem Kulturerbe!«
Auf jeder Palette eine Auswahl politischer Farben
Segeltörn nach Byzanz
Bezauberndes Sambia
Phaly Nuons drei Stufen
Die offenen Räume der Mongolei
Die Entdeckung des Gesprächs
Nackt, mit Schafsblut bedeckt, colatrinkend und mit einem wahnsinnig guten Gefühl
Ein Erwachen nach den Taliban
Man versammelt sich vor dem Fernseher
Wächter der Kunst
Poeten im Untergrund
Nur knapp davongekommen: Filmemacher
Musik bricht das Schweigen
Mein Abendessen in Kabul
Museum ohne Mauern
Der Song der Salomonen
Die Kinder der schlechten Erinnerungen
Der Feuerkreis: Brief aus Libyen
All die Köstlichkeiten Chinas
Äußere Pracht für inneren Frieden: Qianlongs Ruhesitz
Abenteuer in der Antarktis
Wenn alle die Gebärdensprache beherrschen
Rio, Stadt der Hoffnung
Im Bett mit dem Präsidenten von Ghana?
Schwul, jüdisch, psychisch krank und Förderer der Roma in Rumänien
Myanmars Augenblick
Mutterseelenallein in der Weite des Meeres
Danksagung
Bibliographie
Für Oliver, Lucy, Blaine und George,
die mir einen Grund gegeben haben,
zu Hause zu bleiben.
Denke an die lange Fahrt nach Hause.
Hätten wir zuhause bleiben, an hier denken sollen?
Wo würden wir heute sein?
…
Kontinent, Land, Stadt, Gesellschaft:
Die Auswahl ist niemals groß oder frei.
Und hier oder dort … Nein.
Hätten wir zuhause bleiben sollen, wo immer es sei?
aus: Elizabeth Bishop, Alles Meer ein gleitender Marmor
Gedichte zweisprachig (Hg. und Ü.: Klaus Martens),
S. 31 und 33, Heidelberg 2011
EINLEITUNG
Berichte aus der ganzen Welt
Als ich ungefähr sieben Jahre alt war, erzählte mir mein Vater vom Holocaust. Wir fuhren in einem gelben Buick auf dem Highway 9A durch den Bundesstaat New York, und ich hatte ihn gefragt, ob der Ort Pleasantville tatsächlich so angenehm war, wie es sein Name nahelegte. Wie wir einen oder zwei Kilometer später auf die Nazis kamen, weiß ich nicht mehr, doch ich erinnere mich noch gut, dass er dachte, ich wüsste bereits Bescheid über die »Endlösung«. Deshalb hatte er auch keine einstudierte Strategie, mir die Lager zu schildern. Er sagte, es sei den Leuten angetan worden, weil sie Juden waren. Ich wusste, dass wir Juden waren, und ich schlussfolgerte, dass uns dasselbe zugestoßen wäre, hätten wir damals dort gelebt. Auf mein Drängen hin musste es mir mein Vater mindestens viermal erklären, denn ich dachte die ganze Zeit, dass mir etwas Entscheidendes entgangen war, weil ich es einfach nicht verstehen konnte. Schließlich meinte er derart resolut, dass das Gespräch beinahe damit geendet hätte, es sei das »Böse schlechthin« gewesen. Ich aber hatte noch eine Frage: »Warum sind diese Juden nicht einfach fortgegangen, als es schlimm für sie wurde?«
»Es gab keinen Ort, wo sie hätten hingehen können«, sagte mein Vater.
In diesem Augenblick beschloss ich, dass es für mich immer einen Ort geben würde, wo ich hingehen konnte. Ich würde nicht hilflos, abhängig oder vertrauensselig sein, ich würde niemals glauben, dass es, nur weil bislang alles gut gewesen war, immer so bleiben würde. In diesem Augenblick brach meine Vorstellung, zu Hause absolut sicher zu sein, wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich würde fortgehen, ehe sich die Mauern um das Ghetto schlossen, ehe die Gleise für die Züge fertiggestellt waren, ehe man die Grenzen sperrte. Wenn uns im Zentrum Manhattans der Genozid drohte, würde ich bereit sein, meinen Pass zu nehmen und in ein Land aufzubrechen, in dem man mich mit offenen Armen willkommen hieß. Mein Vater hatte erzählt, einigen Juden sei von nichtjüdischen Freunden geholfen worden, so nahm ich mir vor, immer Freunde im Ausland zu haben, die mich hineinlassen oder herausholen konnten. In dem ersten Gespräch mit meinem Vater ging es natürlich hauptsächlich um das Leid, aber es war unter diesem Aspekt auch ein Gespräch über Liebe, und im Lauf der Zeit verstand ich immer besser, dass ein großer, auf Zuneigung beruhender Bekanntenkreis die eigene Rettung sein kann. Menschen hatten sterben müssen, weil ihr Bezugssystem zu sehr räumlich begrenzt war. Mir sollte das nicht geschehen.
Als ich einige Monate später mit meiner Mutter in einem Schuhgeschäft saß, bemerkte der Verkäufer, ich hätte Plattfüße. Ich würde später einmal unter Rückenproblemen leiden (was leider eintraf), vielleicht aber würde ich deshalb auch nicht zum Militär eingezogen werden.[1] Beherrschendes Thema in den Medien war damals der Vietnamkrieg, und ich bereitete mich allmählich darauf vor, nach Abschluss der Highschool in den Kampf ziehen zu müssen. Dabei hatte ich nicht einmal bei Raufereien im Sandkasten geglänzt, und die Vorstellung, mit einem Gewehr im Dschungel abgesetzt zu werden, versetzte mich in Angst und Schrecken. Für meine Mutter bedeutete der Vietnamkrieg die Vergeudung junger Menschenleben. Im Zweiten Weltkrieg sei es richtig gewesen zu kämpfen, und jeder gute amerikanische Junge hatte seinen Beitrag geleistet – Plattfüße oder nicht. Ich stand vor der Frage, nach welchen Kriterien meine Mutter manche Kriege als berechtigt einstufte, so dass sie sogar bereit war, meinen Tod in Kauf zu nehmen, während uns andere irgendwie nichts angingen. Kriege wurden nicht in Amerika ausgefochten, aber Amerika konnte einen in einen – gerechten oder ungerechten – Krieg an jedem x-beliebigen Ort der Welt schicken. Trotz meiner Plattfüße wollte ich diese Orte kennenlernen, um mir ein eigenes Urteil über sie zu bilden.
Die Welt machte mir Angst. Obwohl mir die Einberufung erspart blieb und unter Päsident Nixon in den USA auch der Faschismus nicht Fuß fasste, mussten wir stets auf einen Atomangriff gefasst sein. Dass die Sowjets über Manhattan eine Bombe abwerfen könnten, bereitete mir Albträume. Ohne die Sage vom »ewigen Juden« zu kennen, schmiedete ich unentwegt Fluchtpläne und stellte mir vor, dass ich mein Leben lang von Hafen zu Hafen ziehen würde. Ich fürchtete, entführt zu werden, und wenn mich meine Eltern besonders aufgeregt hatten, malte ich mir aus, ich sei bereits Opfer einer Entführung – sei netten Leuten in einem freundlicheren Land geraubt und in diesen amerikanischen Hort des Wahnsinns verschleppt worden. So bereitete ich schon früh den Boden für jene Angststörung, unter der ich als junger Erwachsener leiden sollte. Als Gegenpol zu meinen Gedankenspielen mit der Vernichtung entwickelte ich eine immer größere Liebe zu England, einem Land, das ich nie gesehen hatte. Meine Anglophilie begann etwa zu der Zeit, als mir mein Vater Pu der Bär vorlas, also im Alter von ungefähr zwei Jahren. Später waren es Alice im Wunderland, Fünf Kinder und zehn Wünsche und Die Chroniken von Narnia. In meinen Augen bezogen diese Geschichten ihren Zauber nicht nur aus Höheflügen der Phantasie ihrer Autoren, sondern ebenso stark aus dem Land selbst. Ich entwickelte eine Vorliebe für Marmelade und die viel längere geschichtliche Vergangenheit. Wenn ich wieder einmal über die Stränge geschlagen hatte und meine Eltern mich zurechtwiesen, erinnerten sie mich daran, dass ich nicht der britische Thronfolger sei. Doch irgendwie hatte ich die vage Vorstellung, ich bräuchte nur nach England zu gelangen, um bestimmte Anrechte zu erwerben (unter anderem auf einen Bediensteten, der meine Spielsachen aufräumte, oder auf das teuerste Gericht auf der Speisekarte), die für mich weniger mit dem Zufall der Geburt als mit dem Land verbunden waren. Wie alle Fluchtphantasien bezog sich auch meine nicht nur auf den Bestimmungsort, sondern außerdem auf das, was ich zurückließ. In jener Phase vor meinem Comingout hatte ich noch keine Vorstellung, was mein Anderssein für Folgen haben würde, und deshalb auch kein Vokabular, es zu analysieren. Selbst zu Hause fühlte ich mich fremd, und obwohl ich es nicht hätte in Worte fassen können, wusste ich, dass ich meine Umgebung von der intimeren Seite meines Andersseins ablenken könnte, indem ich an einen Ort reiste, wo ich tatsächlich ein Fremder war.
Unterstützt wurde meine einsetzende Anglophilie durch eine Kinderfrau. Weil ich als Kleinkind oft unter Koliken litt, hatte meine Mutter eine Hilfe eingestellt, um an einem Tag der Woche ein bisschen entlastet zu werden. Sie hatte für diese Stelle eine Anzeige aufgegeben und mit Bewerberinnen gesprochen. Eines Tages klingelte es an der Tür, obwohl niemand erwartet wurde. Überrascht sah sich meine Mutter einer Schottin in mittleren Jahren gegenüber, die ebenso breit wie hoch war und die verkündete: »Ich bin das Kindermädchen! Ich bin gekommen, um den Kleinen zu hüten.« Meine Mutter, die davon ausging, sie habe einen Termin vergessen, führte Bebe in mein Zimmer. Innerhalb von Sekunden hatte ich mich beruhigt, und ich aß besser denn je. Damit war Bebe eingestellt. Erst später fand man heraus, dass sie im falschen Stockwerk aus dem Fahrstuhl gestiegen war und anstatt zu uns in 11 E eigentlich zu einer Familie in der Wohnung 14 E hatte gehen sollen. Aber da war es schon zu spät. In den folgenden zehn Jahren kam Bebe jeden Donnerstag, kochte uns Sherry-Trifle-Pudding und erzählte uns Geschichten über ihre Kindheit auf der Isle of Mull. Als kleines Mädchen hatte sie eine Tasche mit drei Aufklebern besessen, auf denen Paris, London und New York stand. Bebe hatte ihrer Großmutter erklärt, später würde sie in all diese Städte reisen. Ihre Großmutter hatte sie zwar ausgelacht – aber Bebe fuhr tatsächlich hin und hatte sogar in allen drei irgendwann einmal ihren Wohnsitz.
Wie die Figuren in meinen geliebten Büchern war Bebe exzentrisch und von Zauber umgeben – von kindlichem Charakter und unfähig zu Ärger, Enttäuschung oder Wut. Sie brachte mir bei, wie im schottischen Dialekt das r zu rollen. Ihr schlimmster Tadel lautete: »Nun mal langsam, meine Herren!«, wenn mein Bruder und ich es zu wüst trieben. So entwickelte ich die Vorstellung, in Großbritannien würden alle und fast ständig ebenso begeistert sein von mir wie sie, und Kinder bekämen bei jeder Mahlzeit eine zweite Schale vom Nachtisch, auch wenn sie ihr Gemüse nicht aufgegessen und ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht hatten.
Außerdem bewegte mich die Geschichte eines anderen Englands, eines Landes, das mir Zuversicht gab, wenn ich an jene dachte, die ums Leben gekommen waren, weil es keinen Ort gab, wo sie hätten hingehen können. Unsere direkten Wohnungsnachbarn, Erika Urbach und ihre Mutter, Mrs Offenbacher, waren tschechische Juden, die sich ein Einreisevisum nach England besorgt hatten, als die Nazis die Grenzen schlossen. Sie mussten jedoch so lange auf ihre Transitvisa für die Reise durch Europa warten, dass ihre Papiere für England bereits wieder ungültig waren, als sie eintrafen. Trotzdem bestiegen sie in Prag den Zug. In den Niederlanden versuchte ein Staatsdiener sie mit der Begründung, man würde sie nicht nach England hineinlassen, wieder zurückzuschicken, doch Mrs Offenbacher erklärte, dass man sie dazu nicht zwingen könne, weil sie gültige Transitvisa besaß. Als ihre Fähre in Dover anlegte, stiegen sie aus, und Mrs Offenbacher beobachtete eine Stunde lang die Abfertigung der Passagiere bei der Passkontrolle, um herauszufinden, welcher der Grenzbeamten am freundlichsten war. Schließlich entschied sich Mrs Offenbacher (eine schöne Frau, die mit Erika eine ebenso schöne Tochter hatte)[2] für eine der Schlangen. »Ihr Einreisevisum für Großbritannien ist abgelaufen«, stellte der Beamte fest. »Ja«, antwortete Mrs Offenbacher, »aber wenn Sie uns zurückschicken, werden wir umgebracht.« Es entstand eine lange Pause, in der sie sich in die Augen schauten. Schließlich stempelte der Mann die beiden Pässe ab und sagte: »Willkommen in England!«
Zu meiner zwanghaften Suche nach einem Zufluchtsort im Ausland gesellte sich jedoch auch eine ungeheure Neugier auf ebenjene Welt, die ich so bedrohlich fand. England spielte zwar die Hauptrolle in meinen Phantasiereisen, aber mich interessierte auch, was die Chinesen zum Frühstück aßen, wie man sich in Afrika die Haare frisierte und warum man in Argentinien so viel Polo spielte. Ich verschlang Bücher, tauchte in die Welt der indischen Märchen und russischen Sagen und in die Tales of a Korean Grandmother ein.[3] Meine Mutter hatte mir eine Kleenex-Schachtel mitgebracht, auf der Menschen in ihren Volkstrachten abgebildet waren. Daraufhin stapften für mich die Holländer allesamt mit Holzschuhen durch die Gegend, und jeder Peruaner trug einen lustigen Bowlerhut. Ich stellte mir vor, wie ich ihnen begegnete, und bewahrte die Schachtel auch dann noch auf, als die Taschentücher schon längst aufgebraucht waren. Ich wollte wenigstens einmal in jedes Land der Welt reisen – als würden für einen Besuch Chinas oder Indiens dieselben Parameter gelten wie für den Gambias und Monacos oder den der einzelnen Inseln der Bahamas.
Zum Glück reiste meine Mutter für ihr Leben gern. Sie fuhr mit zweiundzwanzig Jahren zum ersten Mal nach Europa, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als ein Besuch des zerstörten Kontinents noch etwas derart Außergewöhnliches war, dass die Zeitung ihres Heimatorts darüber berichtete. Als ich elf war, trat meine Familie ihre erste größere Auslandsreise an – nach England, Frankreich und in die Schweiz –, und in den darauffolgenden Jahren begleiteten wir meinen Vater oft auf seinen Geschäftsreisen nach Europa. Es interessierte ihn zwar nicht sonderlich, Neues kennenzulernen, doch in meiner Mutter brachte der Tourismus die besten Seiten hervor. Ehe wir irgendwo hinfuhren, erzählte sie uns alles, was sie über unser Reiseziel wusste. Wir lasen entsprechende Bücher, befassten uns mit der jeweiligen Ortsgeschichte, informierten uns, was es dort zu essen gab und welche Sehenswürdigkeiten wir uns anschauen würden. Meine Mutter traf stets gründliche Vorbereitungen, und so erstellte sie für jeden Tag einen Stundenplan, in dem sie sogar festhielt, wann wir aufstehen und wann wir ins Hotel zurückkehren würden. Ihre Detailversessenheit mag zwar besorgniserregend klingen, aber ich empfand sie tatsächlich als beruhigend, denn so konnte uns nichts anderes überraschen als die Orte selbst. Nie waren wir in Eile. Meine Mutter vertrat die Ansicht, dass man stets so reisen sollte, als ob man eines Tages wiederkommen würde, denn sobald man glaubte, man befinde sich zum einzigen Mal an einem Ort, versuche man alles zu sehen und hätte deshalb letztlich gar nichts gesehen. »Spare dir immer etwas fürs nächste Mal auf, was dich zum Wiederkommen reizt«, meinte sie.
Erst in der Highschool begann ich, diese geographischen Abenteuer zu einer umfassenden Erzählung zu verbinden. Mr Donadio, mein Geschichtslehrer in der neunten Klasse, liebte geschwollene Phrasen; für ihn hatten verschiedene herausragende Persönlichkeiten (Ramses II., Pontius Pilatus, Katharina die Große, Napoleon, Thomas Jefferson) an einem »historischen Scheideweg« gestanden. In meiner Vorstellung wurden sie zu tapferen Männern und Frauen, die Verkehrsampeln ignorierten und scharf nach links oder rechts abbogen, wo jeder andere schnurstracks geradeaus marschiert wäre. Diese Männer und Frauen, so wurde mir klar, hatten zwar mit ihren Entscheidungen die Welt verändert, hatten diese Entscheidungen aber aufgrund bestimmter Umstände getroffen. Ein anderer Lehrer meinte, es lasse sich unmöglich entscheiden, ob diese Leitfiguren die Geschichte bewusst gestaltet oder einfach nur deren Anforderungen gehorcht hätten. In der neunten Klasse hoffte ich, solche historischen Scheidewege einmal selbst vor mir zu haben, und hegte die grandiose pubertäre Hoffnung, sofern ich erkannte, was sich auf der Kreuzung abspielte, einmal den Lauf der Geschichte beeinflussen zu können.
1980, als ich in der elften Klasse der Highschool war, sollte unser Schulchor in der UDSSR auftreten. Da die Sowjets jedoch einige Monate zuvor in Afghanistan einmarschiert waren, dirigierte man uns nach Bulgarien und Rumänien um. (Meinen ersten Soloauftritt – und angesichts meines lauten, aber grellen Baritons beinahe auch meinen Schwanengesang – hatte ich mit dem spanischen Volkslied Ríu Ríu Chíu in einem Pflegeheim vor den Toren von Plewen, in der Beliebtheitsskala rumänischer Städte etwa auf Rang sieben.) Ich hatte noch nie gehört, dass jemand in diese Länder fuhr. Vor unserer Abreise erklärten mir mehrere Lehrer und andere kluge Erwachsene, dass Bulgarien ein Marionettenstaat der Sowjets und ganz schrecklich sei, Rumänien mit Nicolae Ceauşescu hingegen einen tapferen unabhängigen Staatschef habe, der sich von Moskau keine Befehle erteilen lasse. Als wir nach Bulgarien kamen, wurden wir mit ungekünstelter Wärme empfangen. Selbst als unsere Solosopranistin Louise Elton und ich uns kurzzeitig von einer Gruppe Zigeuner mitreißen ließen, tat es der fröhlichen Atmosphäre keinen Abbruch. In Rumänien hingegen sahen wir tagtäglich Szenen der Unterdrückung, die den Beteuerungen unserer Gastgeber, in ihrem Land herrschten Freiheit und Toleranz, offensichtlich widersprachen. Als uns eine Patientin aus dem Fenster ihres Pflegeheims zuwinken wollte, wurde sie von einer Krankenschwester in militärischer Kluft barsch fortgerissen, und man ließ rasch die Rollos herunter. Verängstigt sprachen uns Rumänen in den Straßen an und baten uns, für sie Briefe außer Landes zu schmuggeln, aber wir waren viel zu eingeschüchtert, um uns auf ein Gespräch mit ihnen einzulassen. An jeder Straßenecke sah man finster blickende Soldaten. Mit der Begründung: »Hier in Rumänien gibt es kein heiteres Nachtleben« – eine Bemerkung, die beim Rest der Reise zum Running Gag wurde –, untersagte man uns, Bukarest auf eigene Faust zu erkunden.
Nach unserer Heimkehr berichtete ich, Bulgarien sei zauberhaft und Rumänien ein gruseliger Polizeistaat. Alle, die es besser wussten, wollten mir erlären, dass ich mich irrte. Später, nach dem Regimewechsel, stellte sich heraus, dass die Ceauşescus keineswegs so bewundernswert gewesen waren, wie man sie uns dargestellt hatte, und Rumänien höchstwahrscheinlich der repressivste Staat Osteuropas gewesen war. Das war eine gute Lektion in Sachen Intuition. Orte, die auf den ersten Blick reizend wirken, können tatsächlich recht finster sein, während sich Orte, die finster erscheinen, nur selten als reizend erweisen.
Fast drei Jahrzehnte später interviewte ich Saif al-Islam Gaddafi, den Sohn des libyschen Staatschefs Muammar Gaddafi. In gewisser Weise war er überzeugend: schick gekleidet in einem Maßanzug aus London, wortgewandt im Englischen, gesellschaftlich gut vernetzt und geschmeidig in seiner Großspurigkeit. Er war außerdem äußerst ichbezogen und ein geübter Lügner; seine detaillierten Schilderungen des Alltags in Libyen standen in derart krassem Widerspruch zu dem, was ich selbst gesehen und gehört hatte, dass ich mir schon fast wie in einem Theaterstück vorkam. Einige Jahre nach meinem Besuch des Landes wurde ich von einer angesehenen außenpolitischen Organisation zu einem für Saif al-Islam Gaddafi veranstalteten Brunch eingeladen. Nachdem er zwanzig Minuten geredet hatte, durfte jeder von uns eine Frage stellen. Ich staunte über die ehrerbietige Haltung der Fragenden, unter denen sich auch viele erfahrene Diplomaten befanden. Als ich an der Reihe war, sagte ich: »Alles, was Sie heute an Maßnahmen in Aussicht stellen, haben Sie auch schon vor fünf Jahren versprochen, und nichts davon ist bis jetzt umgesetzt worden. Auf welcher Grundlage können wir davon ausgehen, dass diese Versprechen nun mehr Gültigkeit haben?« Hinterher rügte man mich wegen meiner Unhöflichkeit gegenüber einem »begnadeten Staatsmann«, mit dem sich »unsere größten Hoffnungen für Nordafrika« verbanden. Heute befindet sich Saif al-Islam Gaddafi in Haft; der Internationale Strafgerichtshof wartet auf seine Auslieferung, um ihn wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und seiner schrecklichen Taten während der libyschen Revolution anzuklagen, während der er angekündigt hatte, wenn der Volksaufstand anhalte, werde »Blut in Strömen« fließen. Ein persönliches Zeugnis kann von höherem Wert sein als eine politische Analyse. Und ein unbeteiligter, von ideologischen Vorurteilen freier Zeuge sieht gelegentlich die Wahrheit ziemlich ungeschminkt. Man sollte sich nie von gutgeschneiderten Anzügen in die Irre führen lassen.
Im Sommer nach meinem Collegeabschluss besuchte ich meine Freundin Pamela Crimmins, die einen Job als persönliche Fotografin des amerikanischen Botschafters in Marokko an Land gezogen hatte. Damals gab es noch keine Mobiltelefone und in Marokko nur wenige Festnetzleitungen. Deshalb hatten wir verabredet, dass mich Pamela am Flughafen in der Hauptstadt Rabat abholen würde. Es war das erste Mal, dass ich allein an einen Ort mit völlig anderen Lebensumständen als den mir bekannten reiste. Als nach meiner Landung in der Nacht niemand da war, um mich in Empfang zu nehmen, geriet ich in Panik. Ein Mann machte mir das Angebot, mich in seinem klapprigen Auto zu Pamelas Adresse zu fahren. Dort lief ich die Treppen hinauf und rief in jedem Stockwerk »Pamela!«, bis ich sie schließlich verschlafen »Andrew?« antworten hörte. Rückblickend betrachtet war dieser Vorfall nichts Besonderes, doch ich erinnere mich noch gut an die Angst, die in mir aufstieg, als mir klarwurde, dass ich in einem fremden Land war, ohne zu wissen, wie ich allein zurechtkommen sollte. Dabei ängstigte mich nicht nur die reale Gefahr, sondern auch meine Unbedarftheit.
Am nächsten Morgen freute ich mich nach dem Aufwachen darauf, wie geplant mit Pamela das Land zu erkunden, musste jedoch erfahren, dass sie einen dringenden Auftrag hatte. Sie erzählte mir, dass Ahmed el Houmaidi, ein bei der Botschaft angestellter Fahrer, seine Tante in Marrakesch besuchen wollte, und schlug mir vor, ihn zu begleiten. Am darauffolgenden Tag bestiegen wir den Bus. Ahmeds Tante wohnte in den Außenbezirken der Stadt in einem Haus aus Schalbeton, das um einen Innenhof mit einem Granatapfelbaum angelegt war. Der Besuch eines Ausländers war für sie ein großes Ereignis, und sie räumte ihr Zimmer, um mich dort unterzubringen.
Die Männer des Haushalts gingen in dieser Woche jeden Abend auf den Djemaa el Fna, den zentralen Platz in Marrakesch, auf dem es tagsüber von Touristen wimmelte und abends das Gesellschaftsleben tobte. Weil einige von Ahmeds Cousins dort arbeiteten, setzten wir uns in der Abenddämmerung zu den Zauberern, Geschichtenerzählern und Tänzerinnen. Nach unserer Rückkehr erwartete uns im Haus ein Tajinegericht. Die stets verhüllten Frauen waren den ganzen Tag mit Saubermachen und Kochen beschäftigt. Wenn wir heimkamen, gossen sie den Männern zum Waschen Wasser über die Hände und zogen sich zurück, um später zu verspeisen, was die Männer übriggelassen hatten. Im Haus gab es weder fließendes Wasser noch Elektrizität, aber Ahmeds Tante war stolze Besitzerin eines Batterieradios. Am letzten Tag unseres Besuchs bat sie Ahmed, ihr die Zeilen ihres Lieblingssongs zu übersetzen. Da sein Englisch nicht ausreichte, zog er mich zurate. »Deine Tante wird das Lied wohl kaum verstehen«, sagte ich. »Es heißt darin nämlich, dass Mädchen einfach nur Spaß haben wollen – Girls Just Want to Have Fun.«
Da mein Bruder Evolutionsbiologie studierte, plante unsere Familie zwei Jahre später eine Reise zu den Galapagosinseln. Im Preis für die Schiffspassage war eine Rundreise durch Ecuador inbegriffen. Meine Eltern wollten darauf verzichten – ebenso wie die anderen Gäste der Kreuzfahrt. Mein Bruder und ich hatten also den Führer für uns allein. Nach der Besichtigung Quitos fuhren wir weiter Richtung Cuenca, um uns die Ruinen von Ingapirca anzusehen.[4] Unser Führer warnte uns, in der Gegend gebe es Unruhen, er sei aber bereit, uns zu begleiten, wenn wir uns dafür entschieden. Die Straße war nahezu verlassen, und abgesehen von dem einen oder anderen Lama waren wir die einzigen Besucher der Stätte. Auf dem Rückweg mussten wir jedoch plötzlich mit quietschenden Bremsen anhalten, weil die steile Straße durch einen großen Felsen blockiert war. Im nächsten Augenblick sprang ein Haufen aufgeregt schnatternder Menschen hinter einem Busch hervor und umstellte unser Auto. Einer schlitzte die Reifen auf, ein anderer schlug die Windschutzscheibe ein, ein dritter drohte uns mit einer Waffe. Unser Führer riet uns, so schnell wie möglich auszusteigen. Man sperrte uns und den Führer in einen Verschlag, während der Fahrer mit den Aufständischen verhandelte. Sie hatten sich vom Staat losgesagt, weil sie keine Steuern zahlen wollten. Über den Fahrer ließen wir ihnen mitteilen, dass wir zufälligerweise auch nicht gern Steuern zahlten. Der Mann aber erklärte ihnen offenbar, das US-Militär könnte ihre Dörfer bombardieren und ihre Ernte vergiften, und nach etwa zwei Stunden ließ man uns wieder frei. Wir machten uns auf den mühseligen Weg bergab, bis uns ein Auto mitnahm und zurück nach Cuenca brachte. Da ich mich seit meinem Besuch in Marokko sehr verändert hatte, brachte mich dieser viel gefährlichere Zwischenfall weit weniger aus der Ruhe.
In einem fremden Land zu leben ist etwas völlig anderes, als es zu bereisen. Mein Hochschulstudium führte mich nach England, und selbst in England empfand ich Sitten und Gebräuche verstörend fremd – trotz meiner Phantasien von einer spirituellen Heimkehr. Das Erlernen des Akzents und einer Handvoll neuer Begriffe bedeutete noch längst nicht, dass ich mich auch in der Kultur des Landes sicher bewegen konnte. Vielmehr musste ich mir neue Regeln von Distanz und Nähe und der Konversation, der Art, sich zu kleiden, des Benehmens, des Humors und der Respekterweisung aneignen.
Man hatte mir einen Platz in einem universitätseigenen Haus zugewiesen, das ich mir mit anderen Amerikanern und ein paar Australiern teilen sollte. Der für die Verteilung der Zimmer zuständige Tutor hatte mir erklärt, dass ich mich mit meinesgleichen »sicherlich wohler fühlen« werde. Ich hatte jedoch nicht den Atlantik überquert, um mit meinen Landsleuten zusammen zu sein. Mein Wunsch umzuziehen wurde höflich, aber entschieden abgelehnt; als ich ihn wiederholte, erhielt ich eine weniger höfliche, aber noch entschiedenere Ablehnung. Zwei Wochen nach Semesterbeginn bekam ich eine hässliche Erkältung und suchte Schwester George auf, die Krankenschwester des College, die vermutete, dass der frisch verlegte synthetische Teppichboden in meinem Wohnhaus voller Toxine war. »Kann es sein, dass Sie eine Allergie gegen Ihr Zimmer haben?«, fragte sie. Ich ergriff die Gelegenheit und bat sie, dem Tutor von dieser unwahrscheinlichen Möglichkeit zu berichten. Am nächsten Tag rief er mich in sein Büro und erklärte mit einem entnervten Seufzer: »Nun gut, Mr Solomon, Sie haben gewonnen. Ich gebe Ihnen ein Zimmer im College.«
Es dauerte eine Weile, bis mir klarwurde, dass in England eine Ausbildung eher als angenehmer Luxus galt denn als Notwendigkeit für jeden, der etwas im Leben erreichen wollte. Ich hatte noch nicht verstanden, wie prekär die Lage der Meritokratie in einer gespaltenen Gesellschaft war. Warum so viele der Lebensmittel so lange gekocht wurden, ging über meinen Horizont. Gleiches galt für das Selbstvertrauen von Angehörigen jener Familien, die seit Jahrhunderten auf demselben Land lebten und arbeiteten, für den aparten Gebrauch von Humor, mit dem dringend gebotene Aufrichtigkeit nur angedeutet wurde, für die vertrauenerweckende Beständigkeit des gesamten Landes. Ich fand es erstaunlich, dass meine englischen Bekannten viele der von mir bevorzugten Autoren nicht gelesen hatten, während ich viele ihrer Lieblingsschriftsteller überhaupt nicht kannte. Es war, als sprächen wir trotz des Englischen, das wir gemeinsam hatten, zwei verschiedene Sprachen. Mir gefiel der konstante Unterton von Glanz und Gloria und die mir neue Einstellung, dass Spaß ebenso zählte wie Erfolg. Ich liebte die Bank Holidays und die Teepausen, und mir gefiel das Hochgeistige und Feierliche der Religion in diesem Land im Gegensatz zu der moralisierenden und sich ständig neu erfindenden Religion, die ich kannte. Mich erstaunte, wie unerschütterlich Engländer beim Reisen waren; und ihre Art, tief in fremde Welten einzutauchen, trug dazu bei, dass meine Reisen so verliefen, wie es dieses Buch dokumentiert. Meine Liebe zu England hatte also eine andere Grundlage bekommen als die, die mich als Kind und Jugendlicher zum Anglophilen gemacht hatte.
Nach meinem ersten Hochschulabschluss bechloss ich, noch eine Zeitlang in England zu bleiben, und schickte Bewerbungsschreiben an Verlagshäuser und Zeitschriften. Als mich meine Eltern in jenem Frühjahr besuchten, erklärte ich ihnen ungerührt, ich würde mir eine Stelle in London suchen. Das machte meinen Vater so wütend, dass er in dem Pub in Grantchester, in dem wir zusammensaßen, mit der Faust auf den Tisch schlug, so dass alle anderen Gäste verstummten. Das werde er mir verbieten, sagte er; ich aber hielt ihm entgegen, er könne mir nichts mehr verbieten. Wir alle lehnen uns gegen unsere Eltern auf; rückblickend finde ich es erstaunlich, dass es in meinem Fall der Anlass und nicht die Frage war, wie mein weiteres Leben verlaufen würde, sondern wo.
Zum einen wollte ich bleiben, um die Bande zu meiner neuen Heimat zu stärken, zum anderen, um mir zu bestätigen, dass ich in der Lage war, fern von meinem Mutterland zu überleben. Ich war dreiundzwanzig und stand kurz vor meinem Comingout (obwohl mir das damals noch nicht richtig bewusst war), einem Schritt, der mir in New York, wo mich stets ein Strudel von Erwartungen und Annahmen mit sich gerissen hatte, nicht möglich gewesen wäre. Ich brauchte Abstand zu Amerika, um frei atmen zu können – nicht um ich selbst zu sein, sondern um zu erforschen, zu welcher Art von Mensch ich werden könnte. Wie viele junge Leute verwechselte ich meine schillernde Außenseiterrolle mit der Freiheit, zu sagen und zu denken, was mir gerade in den Sinn kam. Es genügte nicht, das neu Entdeckte anzunehmen, ich würde ein neues Ich kreieren und berühmt werden für die radikalen Bilder, denen ich dabei folgte. Aus diesem Grunde legte ich mir ausgefallene Kleidung zu, in der sich, wie ich meinte, die Eleganz einer vergangenen Epoche spiegelte, gewöhnte mir eine geschraubte Redeweise an, pflegte eine gewisse gesellschaftliche Promiskuität und nahm jede Einladung an. Mein Projekt der Selbstfindung, das mir letztlich weiterhalf wie jede Jugendsünde, aus der man lernt, war für andere oft ermüdend. Was mir als originell erschien, wirkte auf sie meist affektiert. Die Art und Weise, wie ich mein neues englisches Selbst ausdrückte, war anmaßend und zugleich verlogen, weil ich an meinem alten Wertesystem festhielt. Ich leugnete meine Privilegien und meine aus ihnen erwachsene Autonomie und ignorierte die Stürme, die in mir tobten. Meine ambigue Nationalität war das Ventil, in dem meine verwirrte Sexualität Ausdruck fand.
Wie viele Homosexuelle meiner Zeit fand ich Halt in einem selbstgewählten Wohnort und in Freundschaften. Doch im Lauf der Zeit wurde mir klar, dass ich in meinen englischen Freundschaften eine amateurhafte Arroganz an den Tag legte und nicht verstanden hatte, dass ich mich, um von meinen Freunden angenommen zu werden, ansatzweise ändern musste. Mich bezauberte die englische Art meiner englischen Freunde, und ich nahm umgekehrt an, dass sie ebenso entzückt darüber waren, wie amerikanisch ich blieb – aber im Gegensatz zu ihnen hatte ich mich entschieden, mein Land zu verlassen. Einige, die ich liebte, verletzte ich zutiefst. Vielleicht wären diese Freundschaften so oder so gescheitert; ich war jung, in psychischer Hinsicht leichtsinnig und gefangen im Solipsismus einer aufkeimenden Depression. Außerdem blieb ich ledig, während viele meiner alten Freunde heirateten, ein Erfahrungsvorsprung, der das unangenehme Gefühl erzeugte, ein Außenseiter zu sein. Heute sind viele meiner engsten Freunde in New York lebende Engländer oder Amerikaner mit Wohnitz in London. Aus der Fremde wird eine nachsichtige Heimat, etwas, was uns mit anderen verbindet.
Wenn mein Umzug nach England der Beginn meines glücklichen Exils war, so wurde meine Entsendung nach Moskau zu seiner Apotheose. Meine Fahrt mit dem Schulchor nach Moskau war wegen der russischen Invasion in Afghanistan abgesagt worden. Die geplante Familienreise in die Sowjetunion einige Jahre später wurde in letzter Minute wegen des Unfalls im Atomkraftwerk von Tschernobyl storniert.[5] Ein großer Teil meiner Lieblingslektüre, wie etwa Tschechows berühmtes Schauspiel über die drei Schwestern, war russisch.[6] Damals fragte ich mich bereits, nicht ohne eine gewisse Wehmut, ob ich überhaupt jemals nach Moskau kommen würde. 1988 arbeitete ich als Kunstkorrespondent für die britische Monatszeitung Harpers & Queen, und Sotheby’s plante seine erste Auktion zeitgenössischer sowjetischer Kunst.[7] Beim Studium der Vorschau kam ich zu dem Ergebnis, dass schlechte Kunst hochgepusht werden sollte, um sie an reiche Sammler verhökern zu können, was letztlich auf zynische Instrumentalisierung hinauslief. Daher schlug ich einen Artikel vor, der die ganze leidige Angelegenheit als eitlen Zirkus des Jetset entlarven sollte.
So fuhr ich nach Moskau. Für meinen dritten Tag hatte ich ein Interview mit einer Künstlergruppe geplant, die sich mit ihren Ateliers in einem besetzten Haus in der Furmanni-Gasse eingerichtet hatte, wurde jedoch von meiner Dolmetscherin versetzt. Um nicht unhöflich zu sein, fuhr ich allein zu den Ateliers. Sie gaben mir zu verstehen, dass ich mich eine Weile umsehen dürfe. Anfangs hatten wir kaum Kontakt, denn ich sprach nicht Russisch und sie nicht Englisch. Ein paar Stunden später kam jemand, der Französisch konnte, und mit meinen wenigen Brocken in dieser Sprache kamen wir schon ein bisschen weiter, bis schließlich jemand erschien, der des Englischen mächtig war. Aber obwohl ich es damals noch nicht wusste, waren das wahre Geschenk die Stunden ohne Gespräche. Sie gaben mir die Möglichkeit, die Künstler im Umgang miteinander zu beobachten. Während sie sich gegenseitig ihre Arbeiten zeigten, tauschten sie sich offenbar über etwas aus, das mir verschlossen blieb. Später hörte ich, dass sie ihre Werke absichtlich trivial erscheinen ließen, um nicht die unwillkommene Aufmerksamkeit des KGB auf sich zu ziehen, während die Arbeiten in Wirklichkeit verborgene Botschaften enthielten. Der Schlüssel zu ihrem Verständnis lag in der persönlichen Beziehung der Künstler untereinander. Keiner von ihnen ging davon aus, vor einem größeren Publikum ausstellen zu können. Ihre Arbeiten waren voller Insiderwitze, vor allem aber durchdrungen von einem tiefen Mystizismus: Diese Künstler glaubten, angesichts eines Regimes, das es darauf anlegte, die Wahrheit auszuhöhlen, ihre Integrität wahren zu können.
Wenn meine Dolmetscherin am Morgen gekommen wäre, hätte ich all das niemals erfahren. Der Westen war neugierig auf diese Künstler, und wie sich bald herausstellte, waren sie neugierig auf den Westen, hatten jedoch keinen Ansatzpunkt, da ihnen jegliche Kommunikation mit dem nichtsozialistischen Ausland verboten war. Ich wusste damals bereits ein wenig über die Kunstszene des Westens, weshalb ich ihnen eine gewisse Orientierungshilfe geben konnte. Zu meinem eigenen Entsetzen wusste ich jedoch so wenig über ihre Welt, dass ich kaum etwas von dem verstand, was sie bewegte. Doch während sich zwischen uns allmählich ein Zusammenhalt entwickelte, waren sie ausgesprochen nett zu mir.
Im nächsten Sommer kehrte ich zu Recherchen für einen Monat nach Moskau zurück. Ich weiß noch, wie ich voller Panik im Flughafen Heathrow saß. Ich wollte meine russischen Freunde treffen, da ich bereits beschlossen hatte, mein erstes Buch über sie zu schreiben; zugleich aber verspürte ich jene drohende Fremdheit aufkommen, die mich vier Jahre zuvor in Marokko überkommen hatte. Mein Selbstwertgefühl war noch immer sehr fragil und brauchte die ständige Bestätigung, die allein in der Vertrautheit entsteht. In Moskau aber war alles anders: Wo ich schlief, was ich aß, worüber ich mit den Menschen sprach.
Anfangs wohnte ich in einer Datscha bei einer Gruppe deutscher Künstler, zog aber schließlich etwas widerstrebend in das besetzte Haus in der Furmanni-Gasse. Ich sah mich als Beobachter, begriff aber mit der Zeit, dass mich meine Künstlerfreunde bei allem als Beteiligten betrachteten – weil sich das Leben verändert, wenn es beobachtet wird, und weil Anwesenheit eines Eindringlings niemals folgenlos ist. Damals wohnten über hundert Künstler in dem Gebäude. Zwar gab es an verschiedenen Orten Toiletten, aber nur ein voll funktionsfähiges Badezimmer auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes. Im Gegensatz zu den Künstlern duschte ich täglich. Ich lieh mir von der Malerin Larisa Resun-Swesdotschetowa einen fuchsiafarbenen Frotteebademantel. Da Larisa nur knapp einsfünfzig groß ist, sah er an meinem Körper reichlich komisch aus. Ein ein paar Jahre später erschienener russischer Dokumentarfilm über die Kunstszene in der Endphase des Sowjetregimes enthält die von oben gefilmten Aufnahmen meines täglichen Marschs über den Hof in Larisas Bademantel als Symbol für das Verstreichen der Tage.
Bei meiner Abreise nach Moskau war ich mir der Schattenseiten des Sowjetsystems bewusst gewesen, hatte jedoch weder mit den heroischen Ausmaßen des Widerstands gerechnet noch mit der Geselligkeit, die ein anhaltender ideologischer Notstand herbeiführen kann. Die Fähigkeit dieser Russen zu Nähe stand im umgekehrten Verhältnis zum Zerfall ihrer Gesellschaft. In meinen Tagträumen hatte Kunst stets die Macht gehabt, die Welt zu verändern, zugleich war mir jedoch klar, dass Kunst in Wirklichkeit nur Unterhaltung war. Diese Russen aber waren vorrangig deshalb Kunstschaffende geworden, weil sie die Welt verändern wollten. »Weißt du«, sagte mir der Künstler Nikita Alexejew, »wir streben nicht danach, große Künstler zu sein, sondern Engel.«[8] Konfrontiert mit der westlichen Marktwirtschaft, in der von ihnen erwartet wurde, kommerziellen Anforderungen zu entsprechen, schufen einige von ihnen Werke, die Sammlern und Museen gefielen, während andere durch Arbeiten mit geringem Marktpotential an ihrem ursprünglichen moralischen Anspruch festhielten und wieder andere die Kunst sogar ganz aufgaben.
Ihre beste Waffe war seit Stalins Zeiten die Ironie, und die Ironie war auch das Schutzschild, mit dem sie der neuen Weltordnung gegenübertraten. Der Künstler Kostia Swesdotschetow war zu Beginn der achtziger Jahre wie viele Sowjetbürger, die anfangs von der Einberufung befreit worden waren, zu militärischem Strafdienst verurteilt worden, ein Vorgang, der im Westen weniger Aufmerksamkeit erregte als eine Verurteilung zum Gulag, jedoch dem gleichen Zweck diente. Kostia fand sich unvermittelt in einem Kreis von Dieben und Mördern auf der Halbinsel Kamtschatka östlich von Sibirien und nördlich von Japan wieder. Sein Bataillon hatte die Aufgabe, die Fundamente eines auf schmelzendem Eis errichteten Gebäudes auszuheben. Kostia, ein zierlicher Mann, wurde wiederholt krank, und da seine Vorgesetzten schließlich erkannten, welche Talente er besaß, ließen sie ihn Propagandaplakate zeichnen. Bei seiner ersten Ausstellung im Westen viele Jahre später sprach er davon, dass man ihn einst weiter nach Osten geschickt hatte, als er je hatte fahren wollen, dass man ihn in einen Raum mit Farben und Material gesteckt und ihm gesagt hatte, er solle Kunst fabrizieren, und dass er, weil es ihn von der harten körperlichen Arbeit befreite, der Anweisung gefolgt sei, obwohl er mit Ziel und Zweck nicht einverstanden gewesen sei. Jetzt, so meinte er, befinde er sich weiter im Westen, als er es sich je erträumt hatte, und man habe ihn erneut in einen Raum mit Farben und Material gesteckt und auch hier erklärt, er solle Kunst machen. Und wieder habe er die Vermutung, dass er mit seiner Arbeit eine Ideologie unterstütze, die nicht die seine sei – aber auch jetzt würde er es machen, wenn es ihn von harter körperlicher Arbeit befreie.
Nach Erscheinen meines Buchs The Irony Tower: Soviet Artists in Time of Glasnost im Juni 1991 fragten mich Leser, ob es eine russische Übersetzung geben werde. Ich antwortete, dass die Sowjets kaum auf einen Ausländer angewiesen seien, der ihnen sagte, was in ihrem eigenen Land geschehe. 2013 wurde dann allerdings eine russische Ausgabe mit einem Vorwort von Kostia herausgebracht.[9] Inzwischen hatte sich die politische und künstlerische Landschaft grundlegend geändert, und das Leben, das wir damals geführt hatten, war eher von historischem Interesse. Ich kam mir dabei zwar alt vor, aber ich hielt mir auch vor Augen, dass mein Traum als Jugendlicher, zu Veränderungen beizutragen, womöglich wahr geworden war – dass ich mich als Chronist des Wandels in ihn eingeschrieben hatte.
Im Novemer 2015 aß ich mit einem Künstler dieser Gruppe, mit meinem Freund Andrei Roiter, zu Abend. Ich erzählte ihm von diesem Buch, und wir sprachen über gemeinsame Erinnerungen, die ich darin einfließen lassen wollte. »Weißt du noch, wie viel Hoffnung wir hatten?«, fragte er. Und ich fragte ihn, ob er die Träumereien von damals, die sich ja nicht verwirklicht hätten, bedauere. Er antwortete: »Selbst wenn sie letztlich ergebnislos blieben, hat mein Gefühl der Hoffnung in jenem Augenblick all das beeinflusst, was ich seitdem gedacht und was ich seitdem gemalt habe, und alles, was ich geworden bin.« Wir beklagten die Unrechtsherrschaft in Putins Russland, und er sagte: »Selbst diese Gewalt ist etwas anderes, weil sie auf Hoffnung folgt.« Während des Gesprächs wurde mir klar, dass Hoffnung so etwas wie eine glückliche Kindheit ist: Sie stattet den Menschen mit der Fähigkeit aus, die Traumata zu bewältigen, zu denen es zwangsläufig kommen wird. Es ist die Urerfahrung der Liebe. Mein bis zu meiner Moskaureise relativ unpolitisches Dasein wurde durch meinen dortigen Aufenthalt vom Kampf um diese unverzichtbare Redlichkeit geprägt. Ich war noch nicht in der Lage, es Lebenssinn zu nennen, doch alle meine in diesem Buch beschriebenen Reisen erfolgten auf der Basis dieses Hochgefühls. Der Optimismus jener sowjetischen Künstler gründete sich auf etwas, was sich später im Wesentlichen als Fiktion erwies – doch obwohl es sich auf eine eingebildete Wirklichkeit bezog, war das Gefühl echt. Eine enttäuschte Hoffnung ist durchdrungen von etwas Edlem, zu dem die Hoffnungslosigkeit nie Zugang hat.
Als meine Mutter unheilbar erkrankte, kehrte ich aus London und Moskau nach Hause zurück, um in den letzten Monaten ihres Lebens in ihrer Nähe zu sein. Durch meine Distanz zu New York hatte ich Unabhängigkeit gewonnen, doch der Tod meiner Mutter vernichtete meine selbstgeschaffene Identität wieder. Meine Unabhängigkeit war nur möglich, wenn es etwas gab, wovon ich unabhängig war, und dieses Etwas waren zum einen die Vereinigten Staaten und zum anderen meine familiären Wurzeln gewesen. Als ich mich mit der Erkrankung meiner Mutter auseinandersetzte, kam ich zu dem Ergebnis, dass der Abgrenzung übertriebene Bedeutung zugeschrieben wurde. Wegen meiner Mutter war ich nach Hause gekommen, aber ich blieb, weil ich endlich akzeptieren konnte, mehr oder weniger amerikanisch zu sein. Niemand hatte mich jedoch vorgewarnt, dass das Gefühl von Heimat nach einem längeren Auslandsaufenthalt für alle Zeiten brüchig ist. Man wird sich immer nach einem anderen Ort sehnen, und keine nationale Logik wird einem jemals wirklich plausibel erscheinen.
Ein Jahr nach meiner Rückkehr nach New York rief mich mein Londoner Rechtsbeistand an und teilte mir mit, da ich seit sechs Jahren im Besitz eines britischen Arbeitsvisums sei, könne ich mich um die britische Staatsbürgerschaft bewerben. Dazu müsste ich lediglich ein paar Bedingungen erfüllen. Ich hatte stets meine Steuern gezahlt und war nie wegen einer Straftat festgenommen worden. Die letzte Bedingung allerdings lautete, dass ich mich in den vergangenen sechs Jahren niemals länger als zwei Monate außerhalb Großbritanniens aufgehalten hatte, und die erfüllte ich leider nicht. Es würde also schwierig werden. Aus einer Laune heraus schrieb ich einen Brief und erklärte, ich sei wegen der Recherchen für mein Buch in Russland gewesen und in die Vereinigten Staaten gereist, um mich um meine Mutter zu kümmern, dass ich im Herzen aber treu zur Königin stehen würde. Als mein Schreiben im Herbst 1993 in dem Amt eintraf, hatte offenbar ein gelangweilter Angestellter Dienst, denn meine Einbürgerung erfolgte postwendend.
Mit der britischen Staatsbürgerschaft wurde etwas legalisiert, was mir vorher in gewissem Sinne wie ein Hintertürchen erschienen war. Nun konnte ich nicht nur zwei Länder als die meinen betrachten, sondern auch zwei Persönlichkeiten haben. Es war meine Befreiung von der Bürde, eine singuläre Identität auszubilden, von den anstrengenden Bemühungen, meine widersprüchliche Natur in ein einziges Narrativ zu zwängen. Mein Experiment mit der Fremdheit war also gelungen. Ich hatte die Möglichkeit zu wählen. Und ich musste mit dem Blick auf meinen Reisepass nicht mehr befürchten zu erleben, was mein Vater geschildert hatte: »Es gab kein Land, wo sie hätten hingehen können.« Ich hatte ein solches Land.
Die Einbürgerungspapiere bestätigten meinen Anspruch, ein Weltbürger zu sein. Obwohl ich meine Reisen in jedem Fall fortgesetzt hätte, fühlte ich mich nun doppelt berechtigt, die nahe und die weite Ferne zu erkunden. Zu Hause gehen die Tage oft übergangslos ineinander über; durch einen Aufenthalt in der Fremde wird das Leben intensiver. Tennysons Ulysses sagte: »Mein Wandern kennt kein Rasten. Trinken will ich vom Kelch des Lebens bis zum letzten Schluck.« Ich liebte das Reisen, weil es die Zeit anhielt und mich zwang, in der Gegenwart zu leben. Von Augustinus stammt der berühmte Satz: »Die Welt ist ein Buch. Wer nicht reist, sieht nur eine Seite davon.«[10] Ich wollte es von vorn bis hinten lesen. Und hoffentlich erleben, wie die Welt durch mich eine andere wurde.
Mein Freund Christian Caryl, ein angesehener politischer Journalist und Essayist, zog 1992 nach Kasachstan, um die Leitung des dortigen Wirtschaftsinstituts zu übernehmen.[11] Ein Jahr später stattete ich ihm einen Besuch ab. Als ich ihm erklärte, in die Steppe fahren zu wollen, um die Nomaden zu sehen, fragte er mich lachend, was ich ihnen sagen wolle. Bei einer Wanderung auf einen Berg in der Umgebung der Hauptstadt Alma-Ata (die mittlerweile in Almaty umbenannt ist) wurden wir von einem Schneesturm überrascht. Nachdem wir uns eine Stunde lang zusammengekauert hatten, hörten wir ein Fahrzeug näher kommen und gaben verzweifelt Zeichen, es möge anhalten. Der Fahrer, der uns mitnahm, trank regelmäßig einen Schluck aus seinem Flachmann, doch wir waren kaum in der Position, uns zu beschweren. Als er den Flachmann an mich weitergab, trank ich einen Schluck von dem, wie ich erwartete, Wodka. Es war jedoch Spirt – reiner Kornschnaps. Von dem einen Schluck wurde mir schwindelig, und vorübergehend verschwamm mir alles vor den Augen. Ich gab den Schnaps weiter an Christian, und singend und trinkend fuhren wir den Berg hinunter. Als mich unser Retter fragte, was ich in seinem Teil der Welt tat, platzte ich heraus, dass ich die Nomaden in der Steppe sehen wollte. Daraufhin bot er an, uns am nächsten Morgen in die Wildnis zu fahren. Und wir erklärten uns bereit, für diesen Tag den Spirt zu besorgen.
Die Nomaden (die durch Stalins Zwangskollektivierungen etwas sesshafter geworden waren) hätten uns nicht freundlicher empfangen können. Wir hockten in ihrer Jurte und bombardierten sie mit Fragen. Einer erklärte, sein Bild vom Iran beruhe vor allem darauf, dass das Land Straßen und Krankenhäuser in der Gegend gebaut habe, während seine Eindrücke von den Vereinigten Staaten im Wesentlichen aus Baywatch stammten, einer der am häufigsten ausgestrahlten ausländischen Sendungen in Kasachstan. Vor diesem Hintergrund sei er zu dem Urteil gelangt, der Iran sei gut und Amerika dekadent und schlecht. Da das damals seit kurzem unabhängige Kasachstan ein großes und ölreiches Land war, hielt ich diese Information für recht bedeutsam. Wieder in der Stadt schrieb ich zu diesem Thema einen Artikel und schickte ihn an einen mir bekannten Redakteur bei der Zeitschrift New Republic. Er rief mich fast unverzüglich an und sagte: »Seltsamerweise ist das jetzt schon das zweite Angebot in dieser Woche für einen Artikel über die Voreingenommenheit der Kasachen für den Iran. Irgendwas muss dort vorgehen.« Als ich daraufhin kleinlaut Christian anrief, gab er zu, ebenfalls einen Bericht über unseren Ausflug verfasst zu haben.
Als Jugendlicher hatte ich mir während der Reisen mit meinen Eltern die Haltung zu eigen gemacht, ein Tourist und Besucher solle eine Gesellschaft beobachten, sich aber nicht auf sie einlassen. Als Journalist wurde mir rasch klar, wie sehr mich diese Herangehensweise einengte. Wenn ich an einen fremden Ort kam, profitierte ich gewöhnlich von der ungeheuren Großzügigkeit der Menschen, die ich dort traf, etwas, für das es sich mit allen Mitteln zu revanchieren galt. 1992 hatten ein Freund und ich einen Autounfall in Simbabwe. Auf einer unbefestigten Straße war unser Vorderreifen geplatzt, worauf unser Wagen umkippte und in einen dichten Dschungel stürzte. Es geschah auf dem Rückweg nach Südafrika. Wir hatten gezeltet und Verpflegung für zehn Tage mitgenommen, aber auch viele Tüten »Mealie Meal« dabei, ein aus Mais hergestellter Bestandteil des alltäglichen Speiseplans in diesem Land, damit wir für den Fall, dass wir einmal bei Einheimischen übernachten mussten, etwas zum Haushalt beitragen konnten. Es hatte keinen Sinn, alles wieder mit zurückzunehmen. Nach Sonnenaufgang bogen wir bei einer Ansammlung besonders schäbiger Rundhütten von der Straße ab, und ich kletterte einen steilen Abhang hoch. Mehrere Leute rieben sich an einem ärmlichen Feuer zum Wärmen die Hände. Ich gab ihnen zehn Tüten mit Lebensmitteln und badete mich einen Moment lang in ihrem Staunen. Beim Reisen kann man Hilfe bekommen, aber auch geben.
Die Frage des Sicheinlassens und der Gegenseitigkeit beschäftigte mich immer mehr. Jede neue Bekanntschaft reißt beide Seiten aus dem Gewohnten heraus. Anstatt derartige Unterbrechungen zu vermeiden oder in Grenzen zu halten, begann ich, mich diesen Erfahrungen stärker zu öffnen. Manchmal fesselten sie mich regelrecht, oft beruhten sie auf Zufall. Obwohl ich mich unter außergewöhnlichen Umständen gut anpassen konnte, musste ich mein Anderssein zeigen und hinnehmen, dass auch mein Gegenüber es registrierte. Man kann sich nicht anpassen, indem man vorgibt, zu sein wie die anderen, sondern nur, indem man sich auf einen Dialog über die Unterschiede einlässt und die Vorstellung aufgibt, dass die eigene Lebensweise der der anderen auf irgendeine Weise überlegen sein könnte.
Da Fidel Castro jahrelang jede Religion in Kuba verboten hatte und dann die strikte Säkularität abmilderte, ehe er schließlich 1996 mit dem Papst zusammentraf, feierte man Weihnachten noch etwas zurückhaltend, als ich 1997 nach Havanna kam.[12] In den vergangenen Jahrzehnten hatte man sich in der Frage familiärer Feiern mit Silvester beholfen, nun gewöhnten sich die Menschen allmählich wieder an die Vorstellung von überschäumenderen Festen, und ich beschloss, auf diesen Zug aufzuspringen. Gemeinsam mit Freunden mietete ich eine Wohnung in einem recht verfallenen Viertel in der Altstadt Havannas, jedoch ausgestattet mit sechs Meter hohen Decken, dekorativen Säulen, filigranem Deckenstuck und einem Balkon mit Ausblick auf das alte Haus gegenüber. Wenn man ein fremdes Land schnell und gut kennenlernen möchte, gibt es nichts Besseres, als ein Fest zu veranstalten. In Kuba beginnt eine Party dann, wenn man zu tanzen anfängt. Eine atemberaubende schwarze lesbische Ballerina mit Namen Marleni führte mich in die Mitte des Raums. »Musik ist das Wichtigste in meinem Leben«, erklärte sie mir. »Ich fühle mehr dabei.« Aber wir hatten ohnehin gute Gefühle: sechs Briten, zwei Amerikaner und ungefähr dreißig Kubaner (Diplomaten, Ärzte, Künstler, Prominente aus dem Fernsehen, Stiftungsvorstände, Musiker, Stricher, Studenten), alle bereit, unsere verschiedenen Vorstellungen von einem Neuanfang zu feiern. Unterstützt von Mojitos, verloren wir bald jegliche Befangenheit, und zu Mitternacht lehnten wir uns über die Balkonbrüstung und gossen Eimer Wasser auf die Straße, um das alte Jahr fortzuspülen und das neue zu begrüßen. Die Leute in den umliegenden Häusern machten dasselbe, obwohl einige nur Sherrygläser hatten und andere Fässer mit Regenwasser. Wieder ein anderer vergoss sogar einen Mojito. Dann füllten wir einen Teller bis zum Rand mit Speisen und stellten ihn gemeinsam mit einem Drink für die Santeria-Götter nach draußen. Anschließend aßen wir noch einmal, dann tanzten wir bis zum Morgengrauen, und während wir bei Sonnenaufgang nach Hause taumelten, schienen in den Straßen alle zu tanzen. Die Kubaner waren begeistert von unserer Party, weil sie so amerikanisch gewesen war, und wir, weil wir sie so kubanisch fanden.[13]
1993 fuhr ich nach Südafrika, um über die enstehende Kunstszene des Landes zu berichten. Vor der Abfahrt hatte ich mir einen Mietwagen bestellt und einen Straßenatlas gekauft. Als man uns nach der späten Landung zur Passkontrolle fuhr, war der Flughafen schon so gut wie ausgestorben. Ich war der einzige Kunde im Büro der Leihwagenfirma und erinnerte den verschlafenen Angestellten daran, dass ich im Voraus einen Wagen mit Automatikgetriebe reserviert hatte. Selbst unter den besten Bedingungen kann ich nicht gut mit einer Schaltung umgehen; in Südafrika herrscht Linksverkehr, und damit tue ich mich noch schwerer. Darüber hinaus würde ich beim Fahren durch den Atlas blättern müssen. Außerdem war zu dieser Zeit Carjacking weit verbreitet, und man musste bei jedem Stopp auf der Hut und bereit sein, sobald es bedrohlich wurde, mit Höchstgeschwindigkeit davonzurauschen und notfalls auch bei Rot über eine Kreuzung zu fahren. Der Angestellte der Autovermietung verschwand für zwanzig Minuten. »Okay, Boss«, sagte er, als er zurückkam, »wir haben einen mit Automatik für Sie.« Ich unterschrieb die Papiere, und wir gingen nach draußen. Dort erwartete mich der größte weiße Mercedes, der mir je unter die Augen gekommen war. So viel zum Thema Anpassung.
Das Betreten der schwarzen Townships war Weißen damals noch verboten. Tat man es dennoch, ließ man sich gewöhnlich von einer Person mit schwarzer Hautfarbe begleiten, die sich auskannte, da es von diesen Gebieten keine Karten gab. Einmal fuhr ich nach Soweto, um einen Maler zu interviewen. Er erwartete mich am Eingang der Township und lotste mich dann zu seinem Atelier. Als wir fertig waren, meinte er, der Rückweg sei so einfach, dass ich allein fahren könne. Ich brach in der von ihm vorgegebenen Richtung auf und kam auch ganz gut voran, als ich hinter mir eine Sirene hörte und einen Polizisten sah, der mich an die Seite winkte. Er kam an mein Fenster und sagte: »Sie sind zu schnell gefahren.« Ich entschuldigte mich und sagte, dass ich auf meinem Weg kein Schild mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung gesehen hätte. Weiße Südafrikaner haben den Ruf, schwarze Polizisten mit Herablassung zu behandeln, ich aber war respektvoll und voller Reue. »Warten Sie hier«, sagte der Polizist. »Ich hole meinen Vorgesetzten.«
Zehn Minuten später kam ein weiterer Streifenwagen. Der Vorgesetzte stieg aus und kam an mein Fenster. »Sie sind zu schnell gefahren«, sagte er. Ich entschuldigte mich erneut. »Sie sind nicht von hier, nicht wahr?«, meinte er. »Ich hole meinen Chef.«
Nach weiteren zehn Minuten traf der dritte Streifenwagen ein. »Sie sind zu schnell gefahren«, sagte der Chef.
Ich entschuldigte mich zum dritten Mal.
»Warum diese Eile?«
»Ich wusste nichts von einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Offensichtlich ist sie nicht angezeigt. Außerdem bin ich ein weißer Ausländer und fahre mutterseelenallein in einem riesigen weißen Mercedes durch Soweto. Kein Wunder, dass einem da die Nerven flattern.«
Bei diesen Worten musste der Chef laut lachen. »Keine Sorge, Mann. Wir bringen Sie raus.«
Ich verließ die Township in einer Eskorte, mit zwei Streifenwagen vorneweg und einem hinter mir.
Das Reisen führt sowohl zu einer Erweiterung des Horizonts als auch zur Bewusstwerdung der eigenen Grenzen. Es reduziert einen auf ein Dasein ohne Kontext. Niemals hat man einen unverfälschteren Blick auf sich selbst als an einem Ort, der einem völlig fremd ist. Zum Teil liegt es daran, dass die Menschen einen anders wahrnehmen, da sie ihre Erwartungen eher von der Nationalität ableiten als von Nuancen in der Sprechweise, vom Schnitt der Kleidung oder von Hinweisen auf eine politische Haltung. Ebenso maskiert einen das Reisen aber auch. Wenn man der skizzenhaften vorgefertigten Meinung anderer begegnet, kommt es vor, dass man sich seltsam camoufliert und anonym fühlt. Ich liebe das Alleinsein, sofern es auf meine eigene Entscheidung zurückgeht. Fremde Orte und schwierige Umstände kann ich genießen, sofern ich zu Hause vermisst werde. Gesellschaftliche Einschränkungen sind mir ein Gräuel, und das Reisen hat mir geholfen, mich davon zu befreien.
Zugleich aber fühlte ich mich in dieser gesellschaftlichen Anonymität auch äußerst unwohl, wie ich in der Sowjetunion erfahren musste. Solche Ängste sind Ausdruck meiner Unfähigkeit, in Menschen anderer Kulturen zu lesen, und der Tatsache, dass auch sie mich nicht ohne weiteres deuten können. Wenn ich mir kein Bild von ihnen machen kann, dann können sie sich womöglich auch keins von mir machen. Muss man die unvertrauten Regeln eines unbekannten Ortes erlernen, wird man plötzlich wieder zum Grünschnabel. Das Reisen macht einen bescheiden; was einem zu Hause teuer ist, kann woanders unwichtig oder albern erscheinen. In einem Land mit völlig anderen Standards wird die Richtigkeit der eigenen Ansichten in Frage gestellt. Oft kann man nicht verstehen, warum dort etwas als komisch angesehen wird, und manchmal versteht man nicht, was die anderen dort als bedrückend empfinden. Man zweifelt am eigenen Sinn für Humor, an der eigenen Ernsthaftigkeit und selbst an den eigenen moralischen Werten. Vertraute Landschaften schützen uns vor der Selbsterkenntnis, weil die Grenze zwischen dem, wer man ist, und dem, wo man ist, durchlässig ist. An einem fremden Ort jedoch tritt das Ich klar hervor: Das, was man wirklich ist, ist das, was auch in der Fremde Bestand hat.
Kulturelle Divergenzen führen oft zu unfreiwilliger sprachlicher Komik. In einem Hotel an den norwegischen Fjorden stieß ich in der Speisekarte auf die Ankündigung: »Frühstück ist erhältlich von 7:30 bis 8:00 Uhr täglich; Mittagessen ist erhältlich von 12:00 bis 12:30 Uhr täglich; Abendessen ist erhältlich von 19:00 bis 19:30 täglich; Mitternachtsimbiss bis 22:00 Uhr. Eine derartige Effizienz kann man nur bewundern. Die Karte für den Roomservice in einem Hotel im französischsprachigen Westafrika hat mich hingegen begeistert. Als Vorspeise bot man »Gerollte Crêpes mit Räucherlachs und geklumptem Ei« an oder »Kleine Taschen von Auberginen-Tomaten-Mozzarella« und als Hauptgang »Gratin von Schimmel, Brotkrumen und Parmesan« oder »Gerösteter Kapitän mit Olivenölsoße« und, für Vegetarier, »Indische Hüpfer auf Linsen«. Unter den Nachspeisen war einzig und allein das »Dessert Oper auf Pudding« angeführt. In Xi’an stellte man uns einen Pianisten vor, der uns beim Mittagessen berichtete, dass er nur selten Konzerte gebe und allein dadurch über die Runden komme, dass er abends in einer Bar spiele. Obwohl er uns davon abzubringen versuchte, beschlossen wir, ihm dort zuzuhören. Mit dem chinesischen Talent für lyrische Umschreibungen nannte sich das Lokal auf dem Schild über der Tür SONNENSCHEIN-CLUB-ZUM-FREUNDE-TAUSCH-NACH-ZWANZIG-UHR. War also ein Bordell. Wann immer einer meiner Freunde einen Tausch nötig hat, gehe ich in Gedanken auf die Reise nach Nordwestchina und sehe wieder die jungen Frauen ländlicher Herkunft vor mir, von denen einige trotzig, die meisten in ihren dünnen Negligés aber eher traurig wirkten.
Selbst wenn man gut aufpasst, kann man in einer fremden Umgebung ohne Bezugspunkte leicht die Orientierung verlieren. 1985 in Prag beschlossen meine Freundin Cornelia Pearsall und ich nach dem Studium der einzig erhältlichen Touristenkarte, das jüdische Viertel zu besuchen, Nummer sechzehn auf dem Plan. Da wir Ärmlichkeit erwartet hatten, waren wir angenehm überrascht, als wir einen Komplex mit prächtigen Wohnungen vorfanden, die zudem teilweise eine atemberaubende Aussicht hatten. Da die Schilder in Tschechisch waren, mussten wir uns die Erklärungen selbst zurechtlegen. Als Cornelia über die Anzahl der vorhandenen Tasteninstrumente staunte, erklärte ich, dass die jüdische Gemeinde Prags kulturell und künstlerisch äußerst gebildet gewesen sei. Zwei Tage später erfuhren wir, dass das jüdische Viertel eigentlich unter Nummer siebzehn zu finden war und wir den Nachmittag tatsächlich in der Mozartvilla verbracht hatten.
Manchmal kann man das, was man zu sehen bekommt, auch einfach nicht verstehen. Als ich den früheren US-amerikanischen Verteidigungsminister Robert McNamara kennenlernte, war er Mitte achtzig. Der Mann hinter den Einberufungsbefehlen, die mich in meiner Kindheit so erschreckt hatten, war verantwortlich für die Zerstörung eines Landes und den sinnlosen Tod von Millionen Menschen, ohne etwas erreicht zu haben.[14]