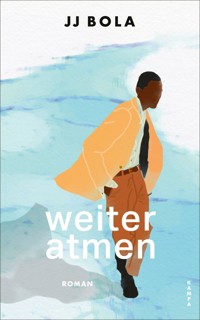
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Michael Kabongo erreicht sein Flugzeug nach San Francisco im allerletzten Moment. Er lässt sein Londoner Leben hinter sich. Seinen Job als Lehrer: Vergeblich hat er versucht, Jugendliche wie Duwayne zu retten, der ihm nach dem Unterricht als Dealer gegenüberstand. Seine Mutter: Unablässig predigt sie, Seelenheil finde man nur in der Kirche. Seinen besten Freund: Jalil sucht eine Ehefrau, nur um seinem Vater zu gefallen. Seine Kollegin Sandra: Er fühlt sich zu ihr hingezogen, aber Sandra ist mit einem anderen zusammen.Michael hat einen radikalen Entschluss gefasst: Er wird auf Reisen gehen, solange sein Geld reicht, dann wird er sein Leben beenden. Seit Jahren schon quälen ihn Depressionen, das Gefühl von Heimatlosigkeit, traumatische Erinnerungen an die Flucht aus dem Kongo und an den Tod seines Vaters. Auf seiner Reise durch die USA kommt Michael an Orte,die mit seiner Geschichte verbunden sind, begegnet Menschen, die seine Schutzmauern durchbrechen, macht Erfahrungen, die ihn an seine Grenzen bringen. Doch seine Frist läuft ab. Und mit sinkendem Kontostand wird die Frage immer drängender, ob Michael es schafft, ins Leben zurückzufinden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JJ Bola
Weiter atmen
Aus dem Englischen von Katharina Martl
Kampa
Für die, die schon losgelassen haben, und die, die sich noch festklammern.
Teil IMemento Mori
1Flughafen London Heathrow, Terminal 2, 9:00 Uhr
Ich habe gekündigt. Ich nehme mein ganzes Erspartes –$ 9021 –, und wenn es aufgebraucht ist, bringe ich mich um.
Der Flug geht in einer Stunde. Als er aufgebrochen ist, hat er noch mehr als genug Zeit gehabt, doch irgendwie ist sie ihm abhandengekommen; Zögern, Angst, Unruhe. Aus allen Richtungen strömen Körper an ihm vorbei. Er bleibt stehen und blickt auf die Anzeigetafel, sucht den richtigen Check-in-Schalter. Er sieht eine junge blonde Mutter, ihr Kind auf dem Arm. Dahinter steht ein großer Mann mit geschlossenen Augen und Ohrstöpseln, das Haar in Locs, mit Rucksack, Gitarre und in Haremshosen. Er sieht aus, als würde er zu einem Abenteuer aufbrechen, um sich selbst zu finden. Zwei Piloten und ein Quartett Flugbegleiterinnen schweben mit aufeinander abgestimmten Schritten vorbei, verströmen einen Glanz, als wäre der Weg vor ihnen erleuchtet, gefolgt von einem Liebespaar in zueinander passenden ausgewaschenen Jeans, das sich zärtlich mit den Armen umschlingt.
Er eilt auf die Schlange zu. 9:15 Uhr. Er kommt vorne an und reicht der Frau am Schalter seinen burgunderroten Pass. Dieser Pass, eine Hoffnung, ein Segen, ein Gebet, kann ein Leben retten, ein Leben ermöglichen – kann auch ein Leben kosten. Dieser Pass, gespalten zwischen Rot und Blau, zwischen Land und Meer, zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Dieser Pass, ohne ihn habe ich kein …
»Guten Morgen, Sir«, sagt sie und setzt ihr Stundenlohn-Lächeln auf. Er murmelt eine Begrüßung, trommelt mit den Fingern auf den Tresen.
»Wohin reisen Sie, Sir?«
»Nach San Francisco.«
Sie tippt mit ausdruckslosem Gesicht in die Tastatur. Sie ruft ihre Kollegin, die in der Zwischenzeit schon drei Fluggäste eingecheckt hat. Beide fixieren konzentriert den Bildschirm.
»Was ist los?«, fragt er, hörbar frustriert.
»Es tut mir leid, Sir«, sagt die Kollegin. Ihr stark geschminktes Gesicht – contourierte Nase, die Lippen weinrot – bringt ihn aus dem Konzept. »Aber wir können Ihre Buchung nicht finden.«
»Das muss ein Fehler sein! Ich habe selbst gebucht. Mein Name ist definitiv auf der Liste. Michael Kabongo. Ich darf diesen Flug nicht verpassen. Sehen Sie noch mal nach«, ruft er, hebt die Stimme, gestikuliert mit den Armen, fuchtelt mit dem Zeigefinger. Zieht Aufmerksamkeit auf sich. Ohne auf seinen Ausbruch einzugehen, blicken sie zu ihm hoch, dann einander an.
»Es tut mir leid, Sir, Sie sind am falschen Schalter. Sie müssen …«
Sein Herz hämmert, er nimmt nicht mehr wahr, was sie sagt, blickt in die Richtung, in die sie deutet. Er schnappt sich seinen Pass. 9:20 Uhr. Er rennt durch die Menge, seine Lungen werden eng, sein Atem kürzer. Trotz des frischen Herbstmorgens ist ihm zu warm. Er kocht unter seinem Mantel, der Schal schnürt ihm die Luft ab. Er beginnt zu schwitzen.
Er steht ganz am Ende einer S-förmigen Schlange. 9:22 Uhr. Er wippt auf den Fußballen auf und ab wie ein Kind, das dringend pinkeln muss. Er murmelt vor sich hin, wird misstrauisch beäugt. Vorne in der Schlange spricht jemand laut und abschweifend, unterhält sich, ist freundlich, vergeudet Zeit.
»Mach hin, alter Mann!«, ruft Michael. Die anderen tun auf diese typisch verurteilende Weise so, als hätten sie ihn gar nicht gesehen. Ich kann nicht zurück. Ich darf diesen Flug nicht verpassen.
Eine Männerstimme schwebt durch die Luft: »Sind hier noch Passagiere des Flugs AO1K23 nach San Francisco?«
Michael stürzt los, mit ihm eine Frau ein Stück hinter ihm in der Schlange, in ihrem Gesicht drückt sich dieselbe Erleichterung aus wie in seinem. Sie werden nach vorne geführt. Der braunhaarige Mann hinter dem Schalter nimmt seinen Pass und tippt in den Computer.
»Haben Sie noch Gepäckstücke aufzugeben?«
Er legt seinen Rucksack auf die Waage.
»Leichtes Gepäck, was?«, sagt der Mann lächelnd, Michael schweigt.
»Sie sind jetzt eingecheckt, Sir. Aber Sie müssen sich beeilen. Das Boarding beginnt jeden Moment. Bitte passieren Sie so schnell wie möglich die Sicherheitskontrolle.«
Wieder rennt Michael. Er kommt zur Sicherheitskontrolle, vor der sich eine Traube Menschen gebildet hat, als warteten sie auf den Einlass ins Fußballstadion. Er läuft auf und ab, sucht nach einem Weg, irgendwie nach vorne zu kommen. Er entdeckt eine Mitarbeiterin, die die Leute durchwinkt, immer zwei auf einmal.
»Bitte«, fleht er, »mein Flug geht um zehn. Ich muss sofort rein!« Sie wirft einen Blick auf seine Bordkarte und lässt ihn schnell durch. 9:35 Uhr. Das Gate schließt fünfzehn Minuten vor dem Start. Noch zehn Minuten. Seine Beine schmerzen und zittern, seine Hände verkrampfen sich. Er lässt Pass und Bordkarte fallen, hebt sie umständlich wieder auf. Er zieht hastig Jacke, Schal und Gürtel aus, legt den Rucksack ab, leert seine Taschen und wirft alles in einen der Plastikbehälter.
9:39 Uhr. Michael tritt durch den Metalldetektor, es piept. Der Sicherheitsmann kommt auf ihn zu, blickt auf seine Füße und fordert ihn auf, die Stiefel auszuziehen und zurückzugehen. Er macht kehrt und versucht, seine Schuhbänder zu lösen, die bis zum Knöchel geschnürt sind, kreuz und quer verschlungen wie Ranken um einen Baum. Er bindet sie auf und eilt durch den Metalldetektor. Der Sicherheitsmann winkt ihn weiter. Michael reißt seine Sachen an sich und rennt schon wieder, rennen, immer rennen. Gate 13. 9:43 Uhr.
9:44 Uhr. Michael rennt durch den Duty-free-Bereich, jeder seiner Schritte ist schwer genug, um einen Abdruck im Boden zu hinterlassen. 9:45 Uhr. In der Ferne sieht er Gate 13. 9:46 Uhr. Er kommt am Gate an. Niemand ist dort. Keuchend fällt er auf die Knie. Alles umsonst. Vielleicht sollte es einfach nicht sein.
Während er noch flucht, taucht hinter dem Schalter eine Frau auf wie ein Schutzengel und lässt seine Tiraden verstummen.
»Ihre Bordkarte, Sir?«
Michael reicht sie ihr und fasst sich an die Brust.
»Gerade noch rechtzeitig, Sir. Einmal durchatmen und rein mit Ihnen.«
»Danke«, sagt er immer und immer wieder.
Michael betritt das Flugzeug, wo ihn die lächelnden Gesichter der Flugbegleiter erwarten. Er lächelt zurück. Es soll sein. Er geht an den Passagieren der Businessclass und der ersten Klasse vorbei, die ihn nicht ansehen, in den Economy-Bereich und zu seinem Fensterplatz. Er sitzt neben einem Mann, über dessen Bauch sich der Sicherheitsgurt ziemlich straff spannt, und einer Frau, die sich bereits halb in den Schlaf medikamentiert hat.
Er sackt auf seinen Sitz und spürt, wie sich eine Ruhe in ihm ausbreitet, während die Sonne weit entfernt am Horizont hängt. Das ist der Anfang vom Ende.
2Grace-Heart-Academy-Mittelschule, London, 10:45 Uhr
»Ruhe alle miteinander.« Die Klasse verstummte, nur ein paar einzelne aufgeregte Stimmen hingen noch in der Luft.
»Noch fünfzehn Minuten. Wer nicht fertig wird, darf seine Mittagspause mit mir verbringen und mir helfen, meine Briefmarkensammlung zu sortieren.« Die Elftklässler stöhnten auf.
Das Herbstlicht fiel von oben ins Klassenzimmer, und ich beobachtete die Schüler, die mit gesenkten Köpfen in ihre Hefte schrieben. Alle bis auf einen: Duwayne. Das war keine Überraschung. An guten Tagen saß er im Klassenzimmer und starrte aus dem Fenster. Wenn man Glück hatte, beantwortete er eine Frage. An schlechten Tagen war die ganze Schule in Alarmbereitschaft, manchmal sogar die Polizei. Duwayne saß ganz hinten in der Ecke seitwärts auf seinem Stuhl, den Kopf an die Wand gelehnt, den Blick irgendwo nach draußen gerichtet.
»Zeit, einzupacken.« Sie rafften ihre Sachen zusammen, steckten die Bücher in ihre Taschen. Die Glocke läutete. Ein paar ganz Flinke versuchten bereits, aus der Tür zu sprinten, doch ich rief sie mit einem »Nicht die Glocke beendet die Stunde, sondern ich!« zurück. Kurz darauf fügte ich hinzu: »Ihr dürft gehen«, und die Schüler strömten ausgelassen jubelnd aus dem Klassenzimmer. Duwayne trottete als Letzter hinterher.
»Bis dann, Duwayne.« Er nickte. Ohne mich anzusehen zwar, aber immerhin nickte er. Ich zog mein Handy aus der Tasche meiner Jacke, die über der Stuhllehne hing, und schrieb eine Nachricht an Sandra.
Wo bist du, Arbeitsehefrau?
Aufsicht auf dem Fußballplatz. Hab heute noch nichts gegessen.
Ist das deine Art, mich zum Mittagessen einzuladen?
Als guter Arbeitsehemann müsstest du mir diese Frage nicht stellen.
»Ein Thunfischsandwich? Das ist alles? Ist das dein Ernst?«, sagte sie, als ich zu ihr auf den Schulhof kam.
»Thunfisch und Mais, um genau zu sein«, antwortete ich über den Lärm schreiender Kinder hinweg. »Mit Mayo.« Sie riss es mir aus der Hand.
»Nichts … mit ein paar Gewürzen?«
»Schau dich mal um. Was für Gewürze erwartest du hier bitte?«
»Ähm, du solltest mir was Selbstgekochtes mitbringen.« Sie drehte die Handflächen nach oben, wie um mich zu fragen, warum ich das heute, oder überhaupt jemals, nicht getan hatte. »Wie ein pflichtbewusster Arbeitsehemann das eben tut.«
»Dafür ist dein Freund zuständig …«
»Ach, tatsächlich?«, schnaubte sie.
»Und überhaupt verwechselst du da was.« Ich verzog den Mund zu einem dünnen Lächeln. »Ich bin nicht sicher, ob diese Arbeitsehe funktioniert. Ich sollte mich scheiden lassen und dir die Hälfte deines Vermögens abspenstig machen …«
»Gar nichts bekommst du, weil ich nämlich pleite bin, Babyyy …«
»Tag, Sir«, unterbrach eine muntere Stimme unser Gespräch. Sie kam von hinten. Ich wusste, wem sie gehörte. Wir beide wussten es. Und uns beiden graute vor ihr.
»Wetten, sie sagt uns, wir sollen nicht zusammenstehen?«, flüsterte Sandra noch schnell.
»Tag, Mrs Sundermeyer«, erwiderten wir beide. Ein Bass und ein Sopran in Harmonie. Mrs Sundermeyer war die Schulleiterin. Sie powerte im Schulgebäude herum, wie sie schon die rutschige Karriereleiter hinauf- und durch die gläserne Decke gepowert war. An Casual Fridays trug sie immer ihr T-Shirt mit der Aufschrift Who run the world? Girls!, und sie verpasste keine Gelegenheit, jedem zu erzählen, ihr Mann sei »zu Hause bei den Kindern«.
»Und? Wie sieht’s aus?«, fragte sie, obwohl sie die Antwort bereits kannte. Sie stellte ausschließlich Fragen, deren Antwort sie bereits kannte.
»Alles in Ordnung«, entgegnete Sandra und nickte einige Male, um zu verbergen, dass sie nicht recht wusste, was sie noch sagen sollte. Ich nickte mit.
»Wunderbar«, erwiderte Mrs Sundermeyer in der hohen Tonlage, in die ihre Stimme wechselte, wenn sie ihre Zufriedenheit ausdrückte. Sie beugte sich ein wenig näher zu uns und sagte: »Würde es Ihnen was ausmachen, sich auf verschiedene Seiten des Schulhofs zu stellen, damit die Kinder merken, dass Lehrer vor Ort sind? Danke.«
»Klar«, antwortete Sandra, warf mir einen Blick zu, der ausdrückte: Na, was hab ich gesagt?, und ging auf die gegenüberliegende Seite des Schulhofs. Die Glocke läutete.
»Wir müssen jetzt auf Leistung setzen. Wir wollen das Leben dieser jungen Menschen verändern. Ihnen die Kompetenzen mitgeben, die sie brauchen, um ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen …« Mrs Sundermeyer sprach bei der Lehrerkonferenz nach dem Unterricht vom Podium. Ihre Stimme verblasste, während ich den Blick durch den Raum schweifen ließ und um mich herum alle begeistert nicken und Notizen machen sah.
»Wir haben das Zeug zur besten Schule des Bezirks, wenn nicht sogar der ganzen Stadt. Wir sind auf dem Weg, eine herausragende Schule zu werden, und mit Ihrer Leidenschaft und harten Arbeit werden wir diese Vision verwirklichen.« Sie hatte etwas Geistliches an sich, wirkte wie eine Mischung aus Lehrerin, Predigerin und Politikerin. Ich saß da, nicht sonderlich überzeugt, und fragte mich, ob die anderen etwas hörten, was mir entging. Etwas, was ich nicht schon Tausende Male gehört hatte. Trotzdem hatte ich noch die Hoffnung, das Richtige zu tun. Etwas zu verändern, auch wenn es sich immer weniger danach anfühlte. Neben mir saß mit offenem obersten Hemdknopf und gelockerter Krawatte Mr Barnes und lehnte sich wie durch eine unbezwingbare Kraft angezogen nach vorne. Mr Barnes. Ich nannte ihn immer Barnes, nie bei seinem Vornamen. Zwischen einem Kollegen und einem Freund sind die Grenzlinien fließend, und niemand kann genau sagen, wann, wo und wie man sie überschreitet. Ich hielt diese Linien gerne klar und deutlich, und wenn sie auszubleichen drohten, zog ich sie nach: Mr Barnes. Wenn ich ihn so ansprach, antwortete er jedes Mal: »Das ist mein Name, und da komme ich her.« Seine Schüler bekamen denselben Spruch zu hören. Ich mochte ihn trotzdem – irgendwie. Ich bewunderte seine Direktheit, seine Fähigkeit, einfach er selbst zu sein – wie todlangweilig das auch sein mochte.
Nach der Konferenz ging ich zurück in mein Klassenzimmer und sah zu, wie die bedrohlichen grauen Wolken vorbeizogen. Ein leichter Regen fiel vom bedeckten Himmel und hinterließ Streifen auf der Fensterscheibe. London war wohl die einzige Stadt der Welt, die einem alle Jahreszeiten an einem Tag bescheren konnte. So deprimierend. Der Wind blies die Äste nach links und rechts, ließ sie hin- und herwiegen wie im Gebet zu einem unsichtbaren Gott. Ich legte passend zu meiner Stimmung klassische Musik auf und machte mich wieder ans Korrigieren. Ich spürte zwei Hände auf den Schultern und erschrak, und trotzdem löste sich eine Verspannung, die ich bisher überhaupt nicht wahrgenommen hatte.
»Ach, du bist’s.«
»Halb sieben, und du bist immer noch da. Hast du nicht bemerkt, dass ich reingekommen bin?«, erwiderte Sandra.
»Nein.«
»Du sahst ganz versunken aus. Was hörst du?« Sie nahm mir die Kopfhörer von den Ohren und setzte sie auf. Ihr Gesicht verzog sich zu einer verwirrten Miene.
»Das ist Chopin.«
»Du bist so seltsam. Kannst du nicht normale Musik hören wie normale Leute?«
»Chopins Prélude in C-Moll Opus 28 Nummer 20 ist normale Musik … Es ist ein echter Knaller.«
»Pfff … Wie lange bleibst du noch?«
»Wenn du willst, können wir los.«
Das Schulgebäude lag ganz ruhig da, als wäre es eingeschlafen und träumte jetzt, zusammengerollt, die Hände unter der Wange und mit an die Brust gezogenen Knien, sanft von kommenden Tagen. An der Pforte warteten die üblichen Pubgänger: all die Lehrer, die regelmäßig die Kneipe ansteuerten, nur um am nächsten Tag über ihren Kater zu jammern. Immerhin hatten sie auf diese Weise ein Gesprächsthema für die unangenehmen Begegnungen in der Lehrerzimmerküche, während sie auf das lang gezogene Piepen der Mikrowelle warteten.
Cameron, der Sportlehrer, der immer Shorts trug, selbst zum Vorstellungsgespräch für diesen Job, entdeckte uns als Erster, als wir in den Eingangsbereich kamen. Ich blickte Sandra an und sah den stummen Schrei in ihrem Blick. Wir gingen auf sie zu, wünschten, wir könnten uns einfach in Luft auflösen.
»Na, ihr zwei, wohin geht’s?«, fragte Cameron zweideutig. Bei ihm war alles zweideutig.
»Nach Hause«, antwortete ich. Cameron zog die Augenbrauen hoch. »Ich gehe zu mir nach Hause«, ergänzte ich, um jeden Verdacht zu zerstreuen.
»Bis dann, Leute.«
»Der ist so was von nervig«, flüsterte Sandra mir zu, als wir uns entfernten.
Als die Sonne unterging, hob ein frostiger Wind an. Laternenmasten reckten sich in die Höhe wie riesige welke Blumen und verbreiteten ein trübes Licht, in dem man kaum den Weg vor sich sah. Wir liefen gemeinsam schweigend durch den kleinen Park mit vertrocknetem Gras, roten Backsteinbögen und metallenen Bänken, in dem die Umherwandelnden sich versammelten, die Obdachlosen und jene auf der Suche nach Gesellschaft, und Dosen in den Abgrund ihrer Körper leerten. Wir liefen an dem Durchgang vorbei, wo Kapuzen tragende Phantomgestalten standen; vorbei an Hochhausblock um Hochhausblock, ein jeder ein Hort tausend geplatzter Träume; vorbei an den Bars, die sie hier gefangen hielten; vorbei an dem Pub, wo glotzende, kettenrauchende Männer versuchten, einen hereinzulocken; vorbei am Hähnchengrill neben dem Hähnchengrill gegenüber dem Hähnchengrill; vorbei an dem Hipster-Café, das irgendwas mit Avocado und Pumpkin Pie Spice auf der Karte hatte; vorbei an der Ecke mit dem bibelschwingenden Prediger auf der Suche nach Seelen, die es zu retten galt; vorbei an der Bushaltestelle, wo eine Gemeinde müder Gestalten auf den Gott wartete, der sie nach Hause brachte, und wo ein Mann stand, der jeden Tag zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr allen und niemandem »Alles Gute, alles Gute!« zurief; vorbei an der Ampel an der Kreuzung, wo die Autos selten auf Grün warteten; zum Schlund des U-Bahn-Eingangs, der uns mit einem gehauchten Wiegenlied nach Hause rief.
»Es ist Freitagabend, was machst du? Geht’s noch irgendwo hin?«, fragte Sandra. Sie blickte zu mir hoch, mit großen Augen und geweiteten Pupillen, als sähe sie ein strahlendes Licht, das sie in sich aufnehmen wollte.
»Ich geh heim«, antwortete ich in dem Wissen, dass das nicht die Einladung war, die sie sich erhofft hatte.
»Na gut. Dann schönes Wochenende«, sagte sie enttäuscht und zog sich in sich zurück.
Zwischen uns hing eine Spannung in der Luft wie der Rauch eines Waldbrands. Ich umarmte sie und ging.
3Peckriver Estate, London, 20:15 Uhr
Ich holte tief Luft und öffnete die Tür. Es war still und dunkel, bis auf das Mondlicht, das durch das Flurfenster fiel. Ich ging direkt in mein Zimmer und warf mich aufs Bett, ließ meinen Körper fallen wie einen Sack Ziegelsteine. Ich spürte, wie meine Schultern sich verspannten und steif wurden, als wären zwei riesige Klammern um sie geschlossen worden. Ich lag an die Decke starrend da und trieb dahin, irgendwo zwischen Tagträumen und Schlaf, zwischen Schlaflied und Erwachen, zwischen Jetzt und Irgendwann.
»Ich bin so müde«, stöhnte ich. Ich schloss die Augen, und in der Dunkelheit sah ich überall im Zimmer kleine schwebende Lichttröpfchen, Sternbilder aus Glühwürmchen. Den Gürtel des Orion und Kassiopeia, leuchtend. Eine Stimme erschütterte meinen Körper, hallte im ganzen Raum wider, rief meinen Namen.
»Ja, Mami«, brummte ich. Sie klopfte und kam herein.
»Tu dors?«, flüsterte sie. Ich blieb still, nickte nur und tat so, als würde ich wieder einschlafen. Für einen Moment blieb sie wie angewurzelt stehen und verließ dann rückwärts wieder das Zimmer. Ich richtete mich langsam auf und setzte mich auf den Stuhl am Schreibtisch in der Ecke, tastete mich, ohne Licht zu machen, im Mondschein voran. Ich fühlte mich schwer wie Blei, als würde ich in einem abgestandenen, stinkenden Pool versinken. In der allumfassenden Dunkelheit leuchtete hell der Bildschirm meines Handys auf.
Was machst du heute noch? Wir gehen einen trinken. Komm mit.
Hey, was machst du?
Okay, dann antworte halt nicht. Ich seh doch, dass du’s gelesen hast …
Alles klar bei dir? Lang nichts mehr von dir gehört.
Ich brauch deine Hilfe, Bro.
Die Nachrichten fluteten nur so herein. Ich spürte, wie ich mit jeder tiefer und tiefer sank, wie ich ertrank. Ich nahm das Handy und schaltete es aus. Dann griff ich nach der Batterie K Cider, die ich auf dem Heimweg gekauft hatte. Nur einen. Dann noch einen. Ich saß im Schutz der Dunkelheit und spürte, wie sie mich erstickte. Eine besitzergreifende Geliebte.
Ich kam zu spät, aber zumindest ging ich hin. An der Tür begrüßten mich ein paar unbekannte Gesichter, eifrig wie einen verirrten Fremden. Ich setzte mich in die letzte Stuhlreihe hinter den Kirchenbänken. Pastor Baptiste stand am Altar und blickte gen Himmel, als gäbe es keine Decke. Die Band spielte: ein Drummer vom Typ Phil Collins in einer geschlossenen Kabine, ein Keyboarder, der sich beim Spielen Stevie-Wonder-mäßig hin- und herwiegte, der Leadgitarrist an der E-Gitarre mit verwässerten Jimi-Hendrix-Riffs und der Akustikgitarrist, der leidenschaftlich die Saiten anschlug wie Ray LaMontagne. Sie begleiteten den Jugendchor unter der Leitung von Schwester Deloris – zumindest nannte ich sie so, weil mir ihr echter Name immer wieder entfiel. Ihre Interpretation von »Oh Happy Day« hätte auf fast unheimliche Weise als Probe für einen dritten Teil von Sister Act durchgehen können. In der vordersten Reihe entdeckte ich Mami, wie sie lobpreisend die Hände hob und im Rhythmus der Songs mitklatschte. Pastor Baptiste griff langsam nach dem Mikrophon. Er sprach weich und langsam, doch seine Stimme hatte einen selbstsicheren Bass.
»Wir lesen heute aus dem Römerbrief, Kapitel 10, Verse 9 und 10. Und wir lesen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes: ›Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet …‹«
Pastor Baptiste schlug die Bibel zu. Die Gemeinde wartete. Ich verfolgte, wie der Raum von einer Stille erfasst wurde, einer Stille, zu der ich keinen Zugang hatte.
»Brüder und Schwestern, lasst mich davon berichten, wie ich von Gott errettet wurde … Wer mich kennt, weiß, dass ich ein geplagter Mann war. Ich war vom Weg abgekommen und führte ein Leben im Dienste meines Egos, der Gier und niederer Gelüste. Mein Weg zum Glauben war nicht ohne Mühen, Brüder und Schwestern, doch das Werk Gottes ist nie ohne Mühen.«
»Amen«, rief eine einzelne Stimme, andere fielen mit ein.
»Doch es steht geschrieben: Wer im Jetzt für den Herrn arbeitet, wird im Jenseits reichlich beschenkt werden.«
»Amen«, rief die ganze Gemeinde im Chor.
Pastor Baptiste fuhr fort: »Es war ein kalter Herbstabend, vielleicht auch schon Nacht. Ich erinnere mich einzig daran, dass es längst dunkel geworden war und der Wind heulte wie ein wildes Tier. Ich saß an einen Laternenmast gelehnt in einer kalten Gasse, voller Schmerz und Verzweiflung. Sex, Suff, Drogen, Schulden, Gewalt – nichts davon war mir fremd. In diesem Moment hörte ich eine Stimme ganz klar und deutlich den Lärm durchschneiden wie ein Diamant das Glas. Ich kann euch nicht mehr sagen, was sie sagte, doch ich hörte sie und ich fühlte sie. Ich wusste, dass ich so nicht weitermachen konnte, dass ich sonst sterben würde.
Brüder und Schwestern, so oft im Leben wissen wir es eigentlich besser, handeln aber nicht danach. Und wir müssen uns erst in größter Verzweiflung wiederfinden, um gerettet zu werden. Doch wisst, dass der Herr euch nie verlassen wird. Sein Licht wacht über euch, wo ihr auch seid und wohin ihr auch geht.«
Stürmischer Applaus erfüllte den Raum, begleitet von begeisterten Freudenschreien und Jubel. Heller Sonnenschein fiel durch die Kirchenfenster und tauchte die Gemeinde in buntes Licht.
Ich wartete draußen, während die Leute langsam in den Nebenraum strömten und sich bei Tee und Keksen unterhielten, oder vielmehr tratschten. Ich tat so, als wäre ich mit meinem Handy beschäftigt, um Augenkontakt und unerwünschte Gespräche zu vermeiden, doch es gibt Grenzen, wie lange man vorgeben kann, auf sozialen Medien herumzuscrollen, ohne aufzublicken. Und wenn das Akku-Symbol rot wird und man erkennt, dass man sich früher oder später wird unterhalten müssen, setzt die Nervosität so richtig ein.
Mami wusste nicht, dass ich kommen würde. Ich wollte sie überraschen, ihr das Gefühl geben, dass ich freiwillig hier war. Sie besuchte diese Kirche jetzt seit ein paar Jahren, nachdem sie einige Jahre mal in diese, mal in jene gegangen war. Die Suche nach einer guten Kirche ist wie die Suche nach einem Lieblingsverein: Man muss daran glauben, dass es den Spielern ebenso ernst ist wie einem selbst. So hat sie es zwar nicht gesagt, aber ich denke, das trifft es in etwa genauso gut wie die Gründe, die sie mir genannt hat – der Chor, die Musik, die Predigten –, oder jeder andere Grund, den ich anführen würde – das Essen. Ich freute mich, dass sie endlich ihren Ort gefunden hatte. Einen Ort, an dem sie mühelos in die Rolle der heimlichen Seelsorgerin geschlüpft war. Sie hatte für alle ein offenes Ohr, ob am Telefon oder persönlich, was dazu führte, dass die Gemeindemitglieder sich um sie scharten.
Gerade unterhielt sie sich mit ein paar Leuten am Ausgang, die am Aufbrechen waren. Ich ging hin und tippte ihr auf die Schulter. Sie drehte sich um und schnappte nach Luft. Ihre Reaktion ließ mich stutzen. War ich so lange nicht mehr in der Kirche gewesen? Ich überlegte. Ich konnte mich nicht erinnern, wann sie mich zuletzt gebeten hatte, mitzukommen. Ich fand immer eine kreative Art, Nein zu sagen, ohne Nein zu sagen. Sie sprach dann eine Woche nicht mit mir und sah mich an, als wäre ich nicht ihr einziger Sohn; als hätte sie noch einen Ersatz für mich, einen, der sie nicht derart enttäuschte. Vielleicht war es ihre Art, mir zu zeigen, dass sie sich sorgte.
Sie stieß einen begeisterten Schrei aus, woraufhin sich die anderen Gemeindemitglieder nach uns umdrehten. »Das ist mein Sohn.« Ich erntete neugierige Blicke von den Frauen und zustimmendes Kopfnicken von einigen Männern. Mami packte meine Hand und zog mich den ganzen Weg zurück, bis zu Pastor Baptiste, um den ein paar Menschen standen und sich an seiner Anwesenheit ergötzten, ihn einsogen wie Pferde das Wasser eines Baches.
»Pastor, darf ich vorstellen: mein Sohn.«
»Hallo, ich glaube, wir haben uns schon kennengelernt«, sagte ich und erinnerte mich an das letzte Mal, als Mami mich auf die gleiche Art und Weise zu ihm geschleppt hatte, um uns vorzustellen.
»Gott sei mit dir, Bruder. Freut mich sehr.«
»Interessante Geschichte, die Sie da eben erzählt haben.«
»Ich bin nur das Sprachrohr. Die Geschichte« – er blickte gen Himmel – »erzählt Er.«
Ich sah auch nach oben, ohne recht zu wissen, was es dort für mich zu sehen gab.
Ich verabschiedete mich von Mami. Wir umarmten uns und gingen auseinander. Ich drehte mich um und sah, wie sie und Pastor Baptiste sich entfernten, wobei er seine Hand sanft um ihre legte. Ich ging mit der Gewissheit, dass ich mir zumindest etwas Zeit erkauft hatte. Dass ich mich für eine Weile nicht mehr würde fragen lassen müssen, ob ich mit in die Kirche käme, ob ich meine Gebete gesprochen hätte, ob ich nicht Angst hätte, in die Hölle zu kommen oder meine Seele zu verdammen – Dinge, die mich nicht interessierten. Auf der belebten Hauptstraße zog ich mein Handy hervor.
»Yo, ich bin’s. Ich bin fertig, soll ich vorbeikommen?«
4San Francisco International Airport, Kalifornien, 13:15 Uhr.
Das Wasser strahlt in einem klaren Blau unter einer Skyline, die in die Höhe ragt wie die ausgestreckten Finger einer Hand. Die Oberfläche bricht das Sonnenlicht und wirft kleine goldene Glanzpunkte zurück. Winzige Autos schließen auf einer kleinen silbergrauen Brücke zueinander auf, und direkt dahinter erhebt sich die leuchtend rote Brücke wie eine große Schwester, die immer im Mittelpunkt stehen muss. The Bridge – so viele sind dort ihrem Schicksal begegnet, doch meinem werde ich woanders entgegentreten. Dasselbe Schicksal, ein anderer Weg. Das Flugzeug sinkt auf die Landebahn und setzt sanft wie ein Herbstblatt auf dem Boden auf.
»Herzlich willkommen am San Francisco International Airport«, verkündet eine Stimme. Michael spürt eine stille Erleichterung, denn er weiß, warum er hier ist. Er zieht seinen langen schwarzen Wintermantel an, legt seinen Schal um und schultert seinen Rucksack. Er läuft auf den Ausgang zu, und ein Wirrwarr aus Akzenten stürzt auf ihn ein, als würden alle Fernsehserien, die er je gesehen hat, gleichzeitig laufen. Ich habe das Gefühl, durch das Leben eines anderen zu laufen, und doch ist es irgendwie mein eigenes. Er tritt nach draußen, und ein Hitzeschwall schlägt ihm entgegen. Schweiß rinnt ihm über die Stirn.
»Taxi!«, ruft Michael und winkt einen Wagen heran. Er wirft seinen Rucksack in den Kofferraum und sortiert sich.
»Wo soll’s denn hingehen, mein Freund?«, fragt der Taxifahrer mit Blick in den Rückspiegel. Sein kalifornischer Akzent ist stark, klingt fast übertrieben – als hätte er ihn sich irgendwo anders angeeignet, bevor er hergekommen ist.
»Moment, ich muss kurz die Adresse suchen«, sagt Michael, und das Gesicht des Fahrers entspannt sich.
»Wo bist du her?«, fragt er.
Michael kramt auf der Suche nach seinem Notizbuch im Rucksack.
»London.«
Ich bin nirgendwoher.
»London!«, wiederholt der Fahrer.
Michael findet das Notizbuch, reißt die Seite mit der Adresse heraus und reicht sie ihm.
»Ja.«
»Allo, Guvna!« Der Fahrer kichert in sich hinein. »Hast du schon mal mit der Queen Tee getrunken?«, fragt er, und Michael lacht auch, ein gezwungenes Lachen.
Ich habe von diesem Phänomen gehört, von dieser Faszination der Amerikaner und ihrer Frage an britische Touristen, ob sie schon mal Tee mit der Queen getrunken hätten. Ich frage mich, wo dieses Teetrinken mit der Queen hätte stattfinden sollen. Im Buckingham Palace, den ich nur einmal bei einem Familienausflug besucht hatte und den ich eher für ein Museum als für das Zuhause von jemandem hielt? In einem Café? Wahrscheinlich in Kensington, inhabergeführt – mit zwölf Sorten Käse in einer Glasvitrine. Auf keinen Fall eine Kette. Aus Rücksicht auf ihren Status würde ich es ihr so ersparen, mit »die Queen« antworten zu müssen, wenn man sie nach ihrem Namen fragen würde, um ihn auf den Kaffeebecher zu schreiben, und dann »die Queen« gerufen zu werden, wenn ihre Bestellung fertig wäre. »Was für eine Peinlichkeit«, würde sie vielleicht sagen, und ich würde antworten: »Sie sind die Queen, Ihnen muss nichts peinlich sein«, und wir würden wiehernd an unseren Frappé-Chai-Sonst-Was nippen. Oder in einem Imbiss, einer richtigen Kaffeebude, ganz ohne französischen Akzent, in die die Leute noch nicht mit Laptop und Kopfhörern kamen, um zu »schreiben«. Ein echter Imbiss, irgendwo in Finsbury Park, wo Bauarbeiter in Warnwesten sitzen, mit vor sich ausgebreiteten Tabloids, Bauhelmen zu ihren Füßen und in hellbraunen Stahlkappenstiefeln, und sie mit »Tag auch, Hoheit« begrüßen würden – und mich vermutlich ignorieren.
»Nein, ich hab noch nie mit der Queen Tee getrunken«, antwortet Michael.
Der Taxifahrer lacht.
Sie fahren durch die Stadt. Ein Gebäude nach dem anderen, ordentlich aufgereiht wie Legosteine. Es ist hell. Vielleicht scheint hier eine andere Sonne. Alles wirkt klar und scharf, wie durch einen Filter. Michael lauscht dem ununterbrochenen Gerede des Taxifahrers und antwortet nur hin und wieder mit einem zustimmenden »Ja« oder einem überraschten »Ach?«, um das Gespräch in Gang zu halten.
»Hier wären wir.« Der Fahrer fährt rechts ran und schaltet das Taxameter aus. »Das macht dann vierzig Dollar.«
Michael kramt das Monopoly-ähnliche Geld aus seiner Jeanstasche und reicht es dem Fahrer. Der wünscht ihm alles Gute und sagt: »Treib’s nicht zu wild hier … Oder doch, was soll’s!«, worüber nur er selbst laut lacht.
Ich bin da.
Er schreibt die Nachricht, während er gut sichtbar vor einem Eingang zwischen zwei Geschäften wartet.
»Hi«, ertönt eine Stimme. Als er sich umdreht, steht eine Frau vor ihm. Sie sieht genauso aus, wie sie klingt: energiegeladen, enthusiastisch und lebensbejahend, als gäbe es etwas, wofür es sich zu leben lohnt, von dem er nichts weiß.
Sie streckt ihre freie Hand aus und stellt sich vor, doch Michael gibt sich keine Mühe, sich ihren Namen zu merken. Wozu noch neue Namen merken? Wozu überhaupt noch irgendetwas in Erinnerung behalten?
In der anderen Hand hält sie den Becher einer Café-Kette (mit französischem accent aigu) und einen Schlüsselbund. Er gibt ihr die Hand.
»Hier entlang.«
Sie geht voraus, er folgt ihr, macht einen Schritt, wo sie drei braucht.
Sie betreten ein Mehrfamilienhaus. Sie hat hellblonde Strähnen in ihrem rotbraunen Haar, trägt zerrissene, ausgewaschene Jeans. Sie sprechen über das Wetter, er habe nicht erwartet, dass es so warm sein würde. Sie erzählt ihm von der Dürre in Kalifornien und meint, es wäre toll, wenn es endlich mal regnete. Er erzählt, in London regne es immer, und sie schlägt vor, sie könnten ja mal einen Tag das Wetter tauschen, woraufhin er noch eins draufsetzt und vorschlägt, gleich eine ganze Woche zu tauschen, woraufhin beide zu dem Schluss kommen, das sei nicht praktikabel, vor allem weil die Bewohner beider Städte sich schon bald darüber beschweren würden.
»So, da wären wir.« Sie kommen in die Wohnung. Sie ist großzügig, offen geschnitten, artsy – Gemälde von Gestalten mit verrenkten Gliedern – und kreativ – Sonnenblumen in alten Schraubgläsern.
»Hier sind deine Schlüssel.« Sie wirft sie hoch, vertraut auf seine Reflexe, er streckt instinktiv die Hand aus und fängt. »Mach’s dir gemütlich. Ich werde wohl ab und zu vorbeikommen müssen, um ein paar Sachen zu holen, aber ich rufe vorher an und frage, ob’s dir passt.«
Michael verlässt die Wohnung im T-Shirt. Die grelle Sonne blendet ihn, trübt seine Sicht. Er spürt ihre Wärme: kleine Stromstöße, die durch seine Haut fließen. Sein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Das ist die Summe des Lebendigseins – irgendwo sein, wo ich vorher nicht war; da sein, fest verankert im Hier und Jetzt.
Er will die Straße überqueren, schaut nach rechts, ein Auto hupt zweimal laut, rauscht scharf an ihm vorbei. Er hebt aufgebracht die Hände, wie zum Ausruf – Du hast mich fast umgebracht, du Arsch –, bevor er merkt, dass er in die falsche Richtung geschaut hat. Sogar das Überqueren einer Straße verliert seine Natürlichkeit, aber jeder Verlust birgt auch die Chance, etwas anderes zu gewinnen. Die gegenüberliegende Straßenseite scheint viel zu weit entfernt, er denkt, dass daheim nur die Autobahnen dreispurig sind. Daheim. Er hört das Wort – und sein Echo, heim, heim, heim.
Michael betritt den Laden, wo er vom Stundenlohn-Lächeln der Angestellten begrüßt wird. »Hallo, Sir, willkommen bei Target«, sagt eine von ihnen in einem hohen, enthusiastisch klingenden Singsang. Er blickt nach unten und sieht eine zierliche Frau, kaum größer als 1,50, mit rötlich dunklem Haar. Es kommt ihm vor, als hätte er ihr Gesicht schon mal gesehen, oder hätte es zumindest sehen können, in einem Musikvideo oder in einer Zeitschrift. In glamouröser Haute Couture statt in beigen Chinos und plastikrotem Arbeits-T-Shirt. Er stellt sich vor, wie sie in einem anderen Job arbeitet, das Leben einer anderen lebt.
»Hi«, antwortet Michael außer Atem. Sie lächelt noch immer, als er in die Elektroabteilung mit den kinoleinwandgroßen Fernsehbildschirmen geht, auf denen glückliche Gesichter in grellen Farben ein Produkt nach dem anderen präsentieren, und weiter in die Klamottenabteilung mit Camouflagehosen, Bootcut-Jeans und T-Shirts in verschiedenen Schnitten und Größen, von S bis zu den mehrfach-XLs.
Er ist erschöpft, seine Füße fühlen sich an, als wäre er über glühend heißen Sand gelaufen, er spürt einen stechenden Schmerz im unteren Rücken. Er will sich hinsetzen. Sieht sich um. Nur Fußboden. Er nimmt sich eine Schachtel Chocolate Chip Cookies, grünen Tee, Bananen und noch ein paar andere Sachen.
»Hi, Sir, wie geht’s Ihnen heute?«, begrüßt die Kassiererin ihn überschwänglich.
»Danke, gut«, antwortet Michael und legt seine Einkäufe aufs Band. Sie hat einen olivfarbenen Teint und hohe Wangenknochen, ihr rundes Gesicht entspannt sich. Der Scanner piept.
»Ist das alles?« Sie beugt sich vor und betrachtet seinen Mund.
»Ich versuche, nicht mein ganzes Geld auf einmal zu verschleudern.« Er lacht nervös.
»Schon okay«, sagt sie. Ihr Blick wird zu einem Starren. »Ab und zu trinke ich gern eine Tasse Tee, aber eigentlich bin ich eher der Kaffeetyp.« Sie lässt es klingen, als handelte es sich um eine wichtige Information.
»Manche Leute mögen lieber Tee, andere lieber Kaffee«, erwidert er. Sie lächelt höflich.
»Das macht dann neunzehn Dollar.« Er reicht ihr den Zwanziger aus seiner hinteren Hosentasche. Sie gibt ihm sein Wechselgeld, einen frischen Ein-Dollar-Schein, den er in seinen Geldbeutel steckt.
»Schönen Tag noch«, sagt sie. Er lächelt ihr zu. Er steckt seine Einkäufe in eine Tüte und geht Richtung Ausgang. Zwei Sicherheitsmänner, komplett in Schwarz – pechschwarze glänzende Stiefel, schwarze Socken, schwarze Cargohosen mit dicken Seitentaschen –, mustern ihn argwöhnisch. Er erinnert sich, wie er einmal nach der Arbeit mit Sandra in den Supermarkt um die Ecke gegangen ist, in seinem weiß karierten Hemd, mit rot gepunkteter Strickkrawatte, Bügelfaltenhose und Brogues, und der Sicherheitsmann ihm von Gang zu Gang folgte, was er auf eine nicht sonderlich unterhaltsame Weise irritierend fand. Er kicherte in sich hinein, und als dem Wachmann klar wurde, dass er bemerkt worden war, ging er in eine andere Richtung davon. Auch an Sandras Reaktion kann er sich noch erinnern: Du machst dir zu viele Gedanken. Er erinnert sich an Sandra. Es ist das erste Mal seit seiner Abreise, dass er überhaupt an sie denkt. Manchmal ist Vergessen leichter als Heilung. Die Erinnerung lastet schwer auf ihm, also blendet er Sandra lieber aus, zieht einen Vorhang zwischen sich und die Außenwelt.
Michael geht langsam, mit zögernden Schritten, und verlässt schließlich den Laden. Er dreht sich zu den Sicherheitsmännern um. Sie schauen noch immer, starren ihn an. Manche Dinge sind wohl überall gleich.
$ 8806
5Embarcadero, San Francisco, Kalifornien, 12:50 Uhr
San Francisco ist eine Stadt der Dinge: Gebäude und Monumente, jedes anders als das zuvor. Der Dinge: große grüne Bäume, durchsetzt von hohen Laternenmasten. Der Dinge: Hügel und Ebenen, und wieder Hügel und Ebenen. Der Dinge: Kunst, leuchtend bunte Darstellungen auf Böden, Wänden und an unmöglich zu erreichenden Orten. Der Dinge: Poesie und Musik, Essen und Trinken, Freude und Leid. Der Dinge: ein Menschenknäuel und eine Million Geschichten.
13:00 Uhr. Michael läuft inmitten von Menschen, die wirken, als wären sie auf einer Mission, derer sie sich selbst nicht allzu sicher sind. Weiße Hemden, eintönige Krawatten, graue Hosen und schwarze Loafer in Endlosschleife, einer wirkt so nichtssagend wie der andere. Ihn befällt ein heftiges Gefühl von Sonder, eine plötzliche Klarheit, dass jeder andere Mensch ein ebenso komplexes Leben führt wie er selbst. In einiger Entfernung sieht er ein hohes Gebäude, halb Rakete, halb Pyramide. Nadelspitz steht es in einer Reihe mit den anderen Gebäuden. Es sieht aus, als wäre etwas Besonderes daran – als hätte es ein Geheimnis, als wäre das Gebäude er.
Er löst sich aus der Menschenmenge, die in die Büros zurückströmt, und biegt links in die nächste Straße ein. Er blickt nach oben und sieht, wie die Straße weiter und weiter und immer weiter hinaufführt, zwischendurch immer wieder abflacht, um dann wieder weiter und weiter und weiter hinaufzuführen, und noch weiter, als hätte der Erbauer dieser Straßen beschlossen, unterwegs immer wieder zu pausieren. Er stellt sich die Aufgabe, es ganz nach oben zu schaffen. Er geht los, ein fester Schritt nach dem anderen.
Der Himmel scheint etwas unentschlossen, strahlendes Blau gemischt mit düsteren grauen Wolken. Ein Flirt zwischen Sonnenschein und Regen. Alles weist dorthin, gen Himmel, ganz nach oben. Die geparkten Autos, die Bäume, die Laternenmasten. Er läuft weiter hinauf, auf das Ende der Straße zu, vorbei an den verführerischen Düften der Restaurants, vorbei an einem Eckhaus, türkis mit spitzem Dach, vorbei an einer Reihe von Bäumen und einem großen Baum auf der anderen Seite, vorbei an einem großen Lieferwagen und Bauarbeitern, deren Münder er beobachtet, während er sich fragt, was wohl aus ihnen herauskommt und ob sie hier dasselbe sagen wie vor den Gebäuden mit Gerüsten und Leitern zu Hause. Ein Motorrad zischt vorbei. Er spürt die Luft vibrieren. In der Mitte der Straße entdeckt er einen runden Gullydeckel und stellt sich vor, wie die Teenage Mutant Ninja Turtles daraus hervorstürzen, um die Welt zu retten: In seinem Kopf hört er den Intro-Song – »Heroes in a half shell, Turtle Power!«. Er begegnet einem Paar, einem älteren Mann und einer Frau, beide tragen kakifarbene Chinos und ausgeblichene lederne Gürteltaschen und schießen Fotos mit ihren lauten, ausladenden Kameras. »Touristen«, denkt er abfällig, bevor ihm einfällt, dass er ja selbst einer ist … irgendwie. Auf dem Gehsteig neben dem makellosen weißen Schuh des älteren Mannes steht in verblassten goldenen Buchstaben Jack Kerouac, darüber chinesische Schriftzeichen. Gedichtverse schießen ihm durch den Kopf. Als er den Blick hebt, prangt dort auf einem gelbschwarzen Banner der Schriftzug City Light Books neben einem grün-blauen Landschaftsbild an der Wand. Er betritt die Buchhandlung.
Ein Buchladen ist der Garten deines Geistes, wo die Blumen nicht gepflückt, sondern gehegt werden: Wenn du etwas liebst, reiß es nicht aus der Erde und mach es dir zu eigen, sondern wässere es, gib ihm Licht, tu einen Schritt zurück und sieh es wachsen.
Michael liest den Text auf dem Schild, während er unter dem Lächeln der Mitarbeiter an der Ladentheke vorbeigeht. Er lächelt zurück und sieht sich zwischen den blühenden Blumen in den Regalen um. Er lässt den Geruch auf sich wirken. Es riecht alt, aber nicht nach etwas Alterndem, eher nach etwas, das gelebt hat, etwas Erfahrenem, etwas, das erfüllt ist von der Geschichte des Seins und tief eingeschrieben in die Erinnerung der Welt. Er geht auf eine Tür im hinteren Teil des Ladens zu und kommt an einem Wandspiegel mit breitem quadratischem Holzrahmen vorbei. Zum ersten Mal seit Langem sieht Michael sich selbst: Augen, Ohren, Nase, Mund. Er sieht sein Gesicht: zur Hälfte seine Mutter, zur anderen eine leere Erinnerung. Papa. Als er die schmale sandbraune Treppe zwischen zwei weißen Wänden hinaufsteigt, liest er auf einer der Stufen Lyrikabteilung in schwarzen Buchstaben und entspannt sich. Die Lyrikabteilung ist der Brunnen des Gartens, aus dem das klare Wasser der Wahrheit sprudelt. Es hört nicht auf zu fließen, nimmt immer die richtige Form an und spendet allem Nahrung und Leben. Michael stellt sich vor, wie es wohl war, in einer anderen Zeit zu leben. Ginsberg – I can’t stand my own mind. Wie sie mit Worten Welten einrissen und neue errichteten. Er stellt sich die Räume voller unbekannter Zuhörer vor, die ihnen Gehör, vor allem aber ihre Herzen schenkten.
An den Wänden rundum hängen Fotografien von ernsten Gesichtern, die wie alte Götter auf ihn herunterblicken. Auf kleinen weißen Zetteln stehen Sprüche wie Gebote auf Steintafeln: Setz dich und lies, Bilde dich, Lies hier 14 Stunden täglich. 14:30 Uhr.
Er betritt das Untergeschoss voller Bücher. Jeder Raum die Entdeckung einer neuen Welt, einer neuen Dimension. Hier kann man sich ausruhen. Die Terrasse des Gartens. Seine Füße fühlen sich an, als würden sie seine braunen Lederstiefel sprengen, er setzt sich auf den nächstbesten Stuhl. Umgeben von Büchern – von der Geschichte der amerikanischen Ureinwohner bis zum Zweiten Weltkrieg –, fällt sein Blick auf einen Band über Buddhismus, der ihm leuchtend rot aus dem unteren Regal entgegenstrahlt, als hätte er hier nur auf seine Ankunft gewartet. Er schlägt irgendeine Seite auf.
Atme. Alles bist du. Alles kommt zu dir. Es gibt nichts, was du nicht weißt. Nichts, was du nicht schon immer gewusst hast. Du bis nicht der Körper, du bist nicht der Geist, du bist nichts und alles, ewig und gegenwärtig, nah und fern. Entledige dich aller Bindungen, allen Besitzes, all dessen, was dich festhält, und befreie dich.
17:00 Uhr. Stunden sind vergangen. Die Zeit selbst ist zeitlos geworden, als existierte sie nicht; als wäre sie etwas Esoterisches, Magisches, ein Gemälde von Paul Lewin, auf dem ein Ahne im Traum Gaben bringt.
Michael verlässt den Laden mit zwei neuen Büchern. Links von ihm erhebt sich unter den Stromleitungen ein Gestöber aus Büchern wie ein Vogelschwarm in die Luft. Auf einem Wandgemälde über dem Restaurant dahinter spielt ein melancholisch blickender Mann Klavier, ganz versunken in seine Einsamkeit. San Francisco ist eine Stadt der Dinge.
Er geht höher und höher einen Hügel hinauf. Es wird ruhig. Hier sind nur wenige Leute unterwegs, so wenige, dass man freundliche Grüße austauscht: ein Lächeln, ein Winken, ein Hallo. Er läuft weiter bergauf, der Hügel wird steiler, so extrem steil, dass die diagonal geparkten Autos scheinbar jeden Moment der Schwerkraft nachzugeben und die ganze Straße hinunterzurollen drohen. Er beobachtet kurz die schwerfälligen Einparkversuche eines Mannes. Er geht ein paar Betonstufen hinauf, vorbei an einem von Blättern überrankten Metalltor, hinter dem eine schummrige Lampe leuchtet, als wiese sie den Weg zu einem verwunschenen Ort. Er läuft hinauf auf ein Plateau. Er rastet, wendet den Blick zurück, hinunter in die Ferne.
Die untergehende Sonne bringt den Himmel zum Leuchten. Er scheint durchwirkt von einzelnen Pinselstrichen, glänzendes Gold, flammendes Orange, Burgunderrot. Michael sieht das hohe Raketengebäude, seine Spitze, die den Himmel küsst, das Wasser in der Ferne, das das Lied des Sonnenuntergangs zurückwirft, und eine Brücke, die die Leinwand horizontal durchschneidet. Die Straßen führen nach unten, nach ganz unten, bis sie aus dem Blickfeld verschwinden. Er stellt sich vor, wie es sich wohl anfühlen würde hinunterzurollen. Er schließt die Augen, spürt den Rausch, das Adrenalin, die Freiheit; den Gegenwind, während er laut hinausschreit. Freiheit. Freiheit. Frei.
Zurück in der Wohnung sitzt Michael allein auf dem Sofa und starrt aus dem Fenster in die alles durchdringende, nur vom Mondschein durchbrochene Dunkelheit. Er isst das auf dem Heimweg gekaufte chinesische Takeaway und lauscht der Reibeisenstimme eines sich en misère suhlenden bärtigen Mannes an der Gitarre, in Dauerschleife, bis alles verloren ist, bis die Musik verklingt, die Erde sich gedreht hat und die Sonne wieder aufgeht.





























