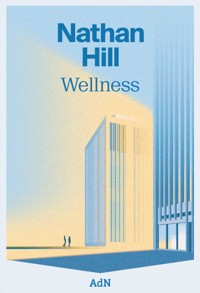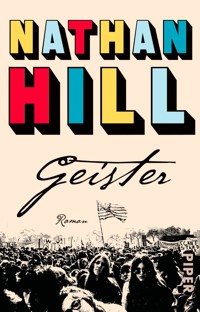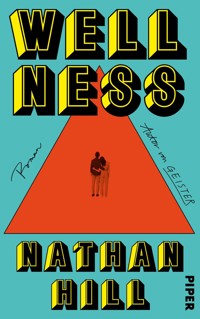
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lieben in modernen Zeiten – kühn, bewegend, klug Als Jack and Elizabeth 1993 ein Paar werden, spricht alles gegen sie. Doch der junge Fotograf mit den bäuerlichen Wurzeln und die Psychologiestudentin aus gutem Hause heiraten – und erleben in der vibrierenden Kunstszene Chicagos aufregende erste Jahre. Doch nicht alles läuft glatt. Inmitten von Achtsamkeitsseminaren, polyamourösen Bekanntschaften und schrillen Immobilienträumen droht ihre Ehe zu scheitern. Und schließlich müssen sich diese nicht mehr ganz so jungen Träumer den Dämonen ihrer Vergangenheit stellen, wenn sie nicht das Wertvollste verlieren wollen: einander. Von den Absurditäten moderner Technologie bis zur perfekten Kindererziehung legt Nathan Hill unser Leben bloß und stößt auf tiefe Wahrheiten über Liebe, Intimität und Nähe. »Ein großartiger Erzähler. Nathan Hills Prosa ist voller Esprit und Tiefe.« The Guardian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 946
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren und Stephan Kleiner
© Nathan Hill 2023
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Wellness«, Alfred A. Knopf/Penguin Random House LLC, New York 2023By arrangement with the author. All rights reserved
((immer))
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: zero-media.net, München, nach einem Entwurf von Oliver Munday
Coverabbildung: Tara Moore / Getty Images
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Kommst Du?
Er wohnt allein im dritten Stock eines alten Backsteinhauses …
Die Gebäude waren nie dazu gedacht, bewohnt zu werden. Seines war ursprünglich eine Fabrik.
Sie steht in einer der Ecken einer weiteren lauten Bar, eingeladen von einem weiteren Typen…
Was für eine eigenartige, herrliche Frage.
Getrennte Schlafzimmer
Vielleicht war es der häufige Gebrauch des Wortes »Traum«
Der Song, den die Kinder aus voller Kehle sangen, war ein populäres Tanzstück über eine Frau, …
Auch die am kompetentesten wirkenden Internetseiten waren sich uneins über etwas so Simples…
Die Idee kam ihr, als sie die Apfeltaschen aufwärmte.
Das sechsstündige Seminar, an dem Jack zu Beginn eines jeden Semesters teilnehmen musste…
Neue Beziehungsenergie
Da sind sie, Jack und Elizabeth, aneinandergeschmiegt auf Elizabeths zerwühltem kleinem Bett.
Aber irgendwann begannen sie doch, Freunde zu verlieren.
Die Lösung
Es begann an einem Dienstagmittag im Jahr 2008, und zwar damit, das …
Eine Woche später, als Elizabeth diese Supermarkt-Episode mit mehr Humor betrachten konnte und der Anekdote, …
Gedeihstörung
Eine bedrückende Tatsache, die Jack Bakers Mutter im Verlauf seiner Kindheit stets gern ansprach, …
Als ein Vogel, der über dem Chicago River gekreist hatte, plötzlich gegen eines der vielen hohen, verglasten Gebäude…
Das Besondere an der Prärie ist, dass man sie leicht für das reine Nichts halten kann.
Das Haus mit den mindestens vierzehn Giebeln
Alvin Augustine, 1835–1920In späteren Jahren sagte Alvin Augustine jedem, der es hören wollte, das große Augustine-Vermögen …
Wellness
Elizabeth Augustines Ehe mit Jack Baker begann nicht an ihrem Hochzeitstag, …
Die Wellness-Praxis lag unweit des DePaul-Campus am Lincoln Park in einer ruhigen, von Bäumen gesäumten Straße, …
Das große historische Anwesen der Augustines heißt The Gables, weil es für die Anzahl seiner Giebel berühmt ist.
Das Erste, was Elizabeth hätte aufhorchen lassen sollen, der erste Hinweis darauf, dass…
Entstehungsgeschichten
Wenn der Wind drehte, wusste Jack, dass die Brandsaison näherrückte.
Evelyn war der Grund dafür, dass Jack nach Chicago zog. Wegen ihr bewarb er sich an der Hochschule, die in dem Museum untergebracht war.
Elizabeth hatte alles geplant: ein Doubledate am Freitag mit einem neuen Paar, Eltern aus Park Shore, …
Er sitzt in dem stickigen Klassenzimmer, in der letzten Reihe, auf dem Platz direkt an dem großen Fenster, in der sengenden Sonne, …
»Dad, ich nehm grad auf«, sagte Toby verärgert, als Jack früh an jenem Samstagmorgen das Zimmer seines Sohnes betrat. Der Junge saß an seinem Computer, die…
Der Bedeutungseffekt
Zwei Patienten mit Kreuzschmerzen gehen zu einem Akupunkteur.
Es gab einige Dinge, die sie vor der Teilnahme an einer Orgie wissen mussten.
Die Placebo-Ehe
Als junger Mann hatte Jack Baker das Gefühl, sehr anders zu sein.
Elizabeth brachte Toby nach Park Shore, als sie bemerkte, dass es mit einem Mal Herbst war.
Kurz darauf werden die Bauarbeiten an The Shipworks unvermittelt eingestellt.
Die hilfsbedürftigen Nutzer
Ein Drama in sieben Algorithmen
<1>
<2>
<3>
<4>
<5>
<6>
<7>
Das Wunder
Es dämmerte beinahe, als Jack spürte, wie er wach gerüttelt wurde.
Da war das Essen. Da war so viel Essen, und da waren Freiwillige, die es servierten.
Eine Prärie wird erst durch Feuer zur Prärie. Ohne regelmäßige Brände würde die Prärie allmählich überrannt werden.
Es war Evelyn, die Jack das Sehen lehrte.
Die menschliche Seele streift draußen umher wie eine Maus
Elizabeths erste bezahlte Arbeitsstelle überhaupt war die Stelle, die …
Elizabeth stand in ihrem brandneuen Kleid im Zimmer ihrer Eltern und wartete.
Das, was schließlich zu Jack Bakers unverkennbarem künstlerischen Stil werden sollte, ergab…
Ehe Jack nach Chicago zurückkehrte, sagte ihm seine Mutter, er solle sich mal unten in Lawrence’ Schlafzimmer umschauen, …
Es war eine bestimmte Woche mitten im Herbst – die Woche, in der Chicago sich dem Winter zuzuneigen schien, …
An einem bestimmten Winterabend – klamm und trüb, der Himmel spuckt einen dünnen, balsamischen Nebel aus, ein diesiger, violetter Abend, …
#DANKBARKEIT
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für meine Eltern
Kommst Du?
Er wohnt allein im dritten Stock eines alten Backsteinhauses, ohne Ausblick auf den Himmel. Aus dem Fenster sieht er nur ihr Fenster, kaum mehr als eine Armlänge entfernt auf der anderen Seite der Gasse, wo sie im dritten Stock des alten Nachbarhauses wohnt. Keiner von beiden kennt den Namen des anderen. Sie haben nie miteinander gesprochen. Es ist Winter in Chicago.
In die enge Gasse fällt kaum Licht, ebenso wenig wie Regen oder Schnee, Graupel oder Nebel oder dieses knisternde, nasse Januarzeug, das die Einheimischen als Wintermix bezeichnen. Die Gasse ist dunkel und still und wetterlos. Sie ist scheinbar ohne jede Atmosphäre, eine in die Stadt gestickte Leerstelle mit dem einzigen Zweck, Dinge von anderen Dingen zu trennen – wie der Weltraum.
Sie ist zum ersten Mal an Heiligabend erschienen. Er ging früh zu Bett und tat sich schrecklich leid – der einzige Mensch in diesem lauten Gebäude, der nirgendwo anders hinkonnte –, als auf der anderen Seite der Gasse eine Lampe angeschaltet und das gewohnte gähnende Dunkel des Fensters durch einen schwachen warmen Lichtschein ersetzt wurde. Er stand auf, trat ans Fenster und spähte hinaus. Da war sie, richtete sich ein, zog mit raschen Bewegungen kleine, leuchtend bunte Kleider aus zwei großen, zueinanderpassenden Koffern. Ihr Fenster war dem seinen so nah, sie war ihm so nah – man hätte die Kluft zwischen ihren Wohnungen mit einem beherzten Sprung überwinden können –, dass er ein, zwei Meter zurückwich und sich im Dunkel verbarg. Doch in den vergangenen Wochen ist er öfter, als er sich eingestehen möchte, zu dieser Bühne vor seinem Fenster geschlichen. Manchmal sitzt er minutenlang im Dunkeln und sieht ihr zu.
Zu sagen, dass er sie schön findet, wäre zu einfach. Natürlich findet er sie schön – objektiv, klassisch, offensichtlich schön. Selbst ihr Gang – elastisch und beschwingt – verzaubert ihn. Sie gleitet in dicken Socken über den Boden, macht hier und da eine kleine Pirouette, sodass sich ihr Rock für einen Augenblick bauscht. An diesem tristen Ort bevorzugt sie Kleider, bunte, geblümte Sommerkleider, die gar nicht in die heruntergekommene Gegend und den kalten Winter passen. Sie schlägt die Beine unter, wenn sie in ihrem Plüschsessel sitzt; sie hat ein paar Kerzen angezündet, ihr Gesicht ist kühl und gelassen, sie hält in der einen Hand ein Buch, während die Finger der anderen über den Rand eines Weinglases streichen. Er sieht, wie sie das Glas berührt, und fragt sich, wie eine Fingerspitze so große Sehnsucht erzeugen kann.
Ihre Wohnung ist dekoriert mit Postkarten von Orten, wo sie, wie er annimmt, mal gewesen ist – Paris, Venedig, Barcelona, Rom –, und gerahmten Postern von Kunstwerken, die sie, wie er annimmt, im Original gesehen hat – David, die Pietà, das letzte Abendmahl, Guernica. Ihr Geschmack ist weit gefächert und schüchtert ihn ein. Er selbst hat noch nicht mal das Meer gesehen.
Sie ist eine unmäßige Leserin, sie liest zu allen Tages- und Nachtzeiten, schaltet um zwei Uhr morgens ihre gelbe Nachttischlampe ein und arbeitet sich durch große, unhandliche Fachbücher – Biologie, Neurologie, Psychologie, Mikroökonomie –, durch Dramen oder Gedichtsammlungen oder dicke Wälzer über Kriege und Imperien oder grau gebundene wissenschaftliche Veröffentlichungen mit unentzifferbaren Titeln. Sie hört Musik, klassische Musik nach der Art zu urteilen, wie sie den Kopf wiegt. Er versucht, Buchumschläge und Plattencover zu identifizieren, und eilt am nächsten Tag in die Bibliothek, um all die Autoren zu lesen, die ihr nachts den Schlaf rauben, und all die Symphonien zu hören, die sie unentwegt, wie es scheint, abspielt: die Haffner, die Eroica, die Aus der Neuen Welt, die Unvollendete, die Fantastique. Er stellt sich vor, dass er, wenn sie tatsächlich mal miteinander sprechen, irgendetwas über die Symphonie fantastique sagen wird, und sie wird beeindruckt sein und sich in ihn verlieben.
Wenn sie tatsächlich miteinander sprechen.
Sie ist genau der kultivierte, weltgewandte Mensch, den er in dieser beängstigend großen Stadt zu finden gehofft hat. Der offensichtliche Fehler in diesem Plan ist, wie ihm jetzt bewusst wird, dass eine so kultivierte, weltgewandte Frau wie sie keinerlei Interesse an einem so provinziellen und gewöhnlichen Burschen wie ihm haben kann.
Sie hatte nur einmal Besuch. Einen Mann. Bevor er kam, verbrachte sie erschreckend viel Zeit im Badezimmer, probierte sechs Kleider an und entschied sich schließlich für das engste, ein dunkelrotes. Sie steckte ihr Haar auf. Sie legte Make-up auf, wusch es wieder ab, legte es erneut auf. Sie duschte zweimal. Sie sah vollkommen fremd aus. Der Mann brachte ein Sixpack Bier mit, und sie verbrachten zwei, wie es schien, unerfreuliche, unheitere Stunden. Beim Abschied schüttelten sie sich die Hand. Danach kam er nicht mehr.
Als er gegangen war, zog sie sich ein schlunziges altes T-Shirt an, aß Frühstücksflocken ohne alles und saß wie in einem Anfall innerer Trägheit da. Sie weinte nicht. Sie saß nur da.
Über die sauerstofflose Gasse hinweg beobachtete er sie und fand, dass sie in diesem Augenblick schön war, obgleich das Wort »schön« mit einem Mal zu klein schien, um die Situation zu beschreiben. Schönheit hat ein öffentliches und ein privates Gesicht, dachte er, und es geschieht leicht, dass das eine das andere auslöscht. Auf eine Postkarte von Chicago schrieb er: Bei mir müsstest du dich nicht verstellen. Er warf sie weg und versuchte es erneut: Du müsstest niemals jemand sein, der versucht, jemand anderes zu sein.
Aber er hat sie nicht abgeschickt. Er schickt sie nicht ab.
Manchmal bleibt ihre Wohnung dunkel, und er verbringt den Abend für sich – seinen gewöhnlichen, hermetischen Abend – und fragt sich, wo sie wohl ist.
Dann beobachtet sie ihn.
Sie sitzt im Dunkel, er kann sie nicht sehen.
Sie beobachtet ihn, studiert ihn, bemerkt seine Stille, seine Ruhe, die bewundernswerte Tatsache, dass er stundenlang mit gekreuzten Beinen auf dem Bett sitzt und liest. Er ist immer allein dort drinnen. Seine Wohnung – eine trostlose kleine Schachtel mit kahlen weißen Wänden, einem Bücherregal aus Brettern und Ziegelsteinen und einem Futon auf dem Boden – ist kein Ort, wo man Gäste empfängt. Wie es scheint, hält die Einsamkeit ihn umschlossen wie ein Knopfloch.
Zu sagen, dass sie ihn gut aussehend findet, wäre zu einfach. Sie findet, dass er insofern gut aussieht, als ihm nicht bewusst zu sein scheint, dass er gut aussehen könnte: Ein dunkler Spitzbart verbirgt ein zartes Kindergesicht, weite Pullover verhüllen einen knabenhaften Körper. Sein Haar war vor Jahren kurz geschnitten und fällt ihm nun in fettigen, kinnlangen Strähnen ins Gesicht. Sein Kleidungsstil ist apokalyptisch: fadenscheinige schwarze Hemden, schwarze Kampfstiefel und dunkle Jeans, die dringend geflickt werden müssten. Sie sieht nichts, was darauf hindeutet, dass er eine einzige Krawatte besitzt.
Manchmal steht er vor dem Spiegel, mit nacktem Oberkörper, bleich und unzufrieden. Er ist so klein – schmächtig und anämisch und dürr wie ein Junkie. Er lebt von Zigaretten und gelegentlichen Mahlzeiten, meist ist es irgendwas aus einer Schachtel, in Plastik verpackt, für die Mikrowelle, manchmal auch etwas Getrocknetes, das mithilfe von Wasser zu etwas grenzwertig Essbarem wird. Wenn sie das sieht, hat sie dasselbe Gefühl wie beim Anblick der Tauben, die sich auf den tödlichen, stromführenden Drähten der Hochbahn niederlassen.
Er braucht Gemüse.
Kalium und Eisen. Fasern und Fruktose. Feste, knusprige Körner und Säfte in allen Farben. All die Elemente und Elixiere eines gesunden Lebens. Sie möchte eine Ananas mit Geschenkband umwickeln und ihm schicken. Mit einem Kärtchen. Jede Woche ein anderes Stück Obst. Auf dem Kärtchen würde stehen: Tu dir das nicht an.
Beinahe einen Monat lang verfolgt sie, wie Tattoos sich efeugleich auf seinem Rücken ausbreiten und in einem Aufruhr aus Mustern und Farben an seinen schlanken Armen hinunterwachsen. Sie denkt: Ich könnte damit leben. Tatsächlich hat so ein auffallendes Tattoo ja auch etwas Beruhigendes, besonders eins, das man sogar dann sehen kann, wenn der Besitzer ein zugeknöpftes Arbeitshemd trägt. Es verrät Selbstbewusstsein, findet sie, es spricht von einem Menschen, der starke Überzeugungen hat, im Gegensatz zu ihr mit ihrer täglichen inneren Krise und der Frage, die sie verfolgt, seit sie nach Chicago gekommen ist: Wer werde ich werden? Oder vielleicht genauer: Welches von meinen vielen Ichs ist das echte? Der Junge mit den aggressiven Tattoos scheint einen neuen Weg zu weisen – er könnte ein Mittel gegen ihre Angst vor der Zersplitterung sein.
Er ist ein Künstler, so viel ist klar, denn meist sieht sie ihn Farben und Lösemittel, Tinkturen und Lasuren mischen, er fischt Fotopapier aus chemischen Lösungen oder beugt sich über einen Lichttisch und vergleicht Negative mithilfe einer kleinen runden Lupe. Sie staunt, wie lange er das tun kann. Er verbringt eine ganze Stunde damit, zwei Negative zu vergleichen, starrt auf das eine, dann auf das andere, dann wieder auf das erste, immer auf der Suche nach dem perfekten Bild. Und wenn er es gefunden hat, kreist er es mit einem roten Fettstift ein und streicht alle anderen durch, und ihr gefällt diese Entschlossenheit: Wenn er sich für ein Bild, ein Tattoo, einen bohemienhaften Lebensstil entscheidet, dann tut er das aus vollem Herzen. Das ist etwas, um das sie ihn beneidet, das sie begehrt – sie, die nicht mal die einfachsten Dinge entscheiden kann: Was soll sie anziehen, was soll sie studieren, wo soll sie leben, wen soll sie lieben, was soll sie mit ihrem Leben anfangen? Der Geist dieses Jungen scheint ruhig, weil er auf ein hohes Ziel gerichtet ist; sie hingegen fühlt sich wie eine Bohne, die aus ihrer Schote springen will.
Er ist genau der trotzige, leidenschaftliche Mensch, den sie in dieser abgelegenen Stadt finden wollte. Der offensichtliche Fehler in diesem Plan ist, wie ihr jetzt bewusst wird, dass ein so trotziger, leidenschaftlicher Mann wie er keinerlei Interesse an einer so konventionellen Frau wie ihr haben kann.
Also sprechen sie nicht miteinander, und die Winternächte vergehen glazialisch langsam, das Eis überzieht die Äste der Bäume wie Seepocken. Den ganzen Winter geht das so: Wenn sein Licht aus ist, beobachtet er sie, wenn ihr Licht aus ist, beobachtet sie ihn. Und an den Abenden, an denen sie nicht zu Hause ist, sitzt er da und fühlt sich niedergeschlagen, vielleicht sogar ein bisschen verzweifelt, und er sieht zu ihrem Fenster und hat das Gefühl, als würde seine Zeit ihm durch die Finger rinnen, als wären alle Gelegenheiten verstrichen, als wäre er dabei, das Rennen gegen das Leben, das er gern führen würde, zu verlieren. Und an den Abenden, an denen er nicht zu Hause ist, sitzt sie da und fühlt sich verlassen, wieder mal rüde gestoßen von der Welt da draußen, und sie starrt auf sein Fenster wie auf ein Aquarium und hofft, dass aus dem Zwielicht irgendetwas Wunderbares erblüht.
Da sind sie also, im Schatten. Draußen fällt plump und lautlos der Schnee. Drinnen hocken sie in ihren kleinen, getrennten Wohnungen, in ihren heruntergekommenen alten Häusern. Beide haben das Licht gelöscht. Beide warten auf die Rückkehr des anderen. Sie sitzen nicht weit vom Fenster entfernt und warten. Sie starren über die Gasse in eine dunkle Wohnung, und sie wissen es nicht, aber sie starren einander an.
Die Gebäude waren nie dazu gedacht, bewohnt zu werden. Seines war ursprünglich eine Fabrik. Ihres ein Lagerhaus. Wer immer sie errichtet hat, ging nicht davon aus, dass einmal Menschen hier wohnen würden, daher gibt es keinen Ausblick. Beide Gebäude stammen aus den 1890er-Jahren, waren bis in die 1950er-Jahre profitabel, wurden in den 1960er-Jahren aufgegeben und stehen seither leer. Das heißt bis jetzt, im Januar 1993, denn sie sind besetzt und reanimiert worden – billige Wohnungen und Studios für die darbenden Künstler der Stadt –, und sein Job ist es, das zu dokumentieren.
Er soll das Gedächtnis des Gebäudes sein, den desolaten Zustand vor der Renovierung protokollieren. Bald werden die Arbeiter kommen – wobei die Bedeutung des Wortes »Arbeiter« sehr weit gefasst ist, um die Dichter und Maler und Bassgitarristen zu beschreiben, die diese Arbeiten als Gegenleistung für ihre reduzierten Mieten ausführen werden –, sie werden den Müll entsorgen, putzen, schleifen, malen und lackieren, um das alles hier einigermaßen bewohnbar zu machen. Und darum streift er durch die schmutzigsten, heruntergekommensten Winkeln der ehemaligen Fabrik, geht mit einer geborgten Kamera herum und fotografiert die Ruinen, den verklumpten Bodensatz von drei Jahrzehnten Vernachlässigung.
Er ist im vierten Stock und geht durch lange Korridore. Jeder Schritt wirbelt einen Staubnebel auf. Er fotografiert den Schmutz, das allgegenwärtige Geröll aus herabgefallenen Kacheln, Putz und Backsteinen. Er fotografiert die kunstvollen Graffiti. Er fotografiert die zerbrochenen Fensterscheiben, die zu faserigen Streifen zerfallenen Vorhänge. Er fürchtet, er könnte auf einen schlafenden Obdachlosen stoßen, und überlegt, ob er möglichst leise oder möglichst laut sein soll.
Er bleibt stehen, als ihm etwas ins Auge fällt: ein Sonnenstrahl auf einer Wand. Der Lichtstreifen bescheint die abblätternde, von Tausenden winzigen Rissen und Fissuren durchzogene Wandfarbe. Sie ist vor hundert Jahren aufgetragen worden, doch jetzt befreit sie sich. Die Textur erinnert ihn an das Craquelé auf den Porträts niederländischer Meister. Sie erinnert ihn auch – viel prosaischer – an den kleinen Teich auf dem Land seines Vaters, der in Dürresommern trockenfiel, sodass der feuchte Schlamm zum Vorschein kam, und der wurde in der Sonne hart und zerbrach zu kleinen Fraktalen aus Erde. Diese Wandfarbe sieht genauso aus wie die zerrissene Erde, und er fotografiert sie in einem schiefen Winkel, damit der Blick des Betrachters in die durchfurchte Tiefe gezogen wird. Es ist weniger ein Foto von etwas als vielmehr ein Foto über etwas: über Zeit, Veränderung, Transfiguration.
Er geht weiter. Er beschließt, laut zu sein, denn in diesen Schuhen wird er wohl kaum schleichen können. Es sind stabile, mit Stahl verstärkte Stiefel, die er billig in einem Army-Store gekauft hat, und so etwas braucht man hier, denn hin und wieder steht ein Nagel aus dem Boden, oder es liegen Scherben herum, Zeugnisse einer wilden Nacht, in der ein paar Bierflaschen draufgegangen sind. Außerdem sollte er wohl eine Maske tragen, denkt er, denn die Luft ist voll Staub – Staub und Dreck, vermutlich auch Schimmelpilzsporen, toxischen Bleimolekülen und unfreundlichen Mikroben. Es ist ein unbewegter Feinstaubdunst, der das durch einige Fenster einfallende Sonnenlicht in bleiche Balken verwandelt. In der Landschaftsfotografie nennt man das »Jesuslicht«, aber hier ist es blasphemischer. Staublicht vielleicht.
Und dann die Nadeln. Er findet eine Menge davon, kleine, methodisch angelegte Häufchen in den dunklen Ecken, mühsam gesammelt und leer bis auf das schwarze Klümpchen am Ende der Kanüle, und er fotografiert sie mit der geringsten Schärfentiefe, die die Kamera hergibt, damit das Bild beinahe nur ein verschwommenes Durcheinander zeigt, was, wie er findet, sehr treffend den Zustand des armen Menschen heraufbeschwört, der hier gesessen und sich nach einem Schuss gesehnt hat. Dem Heroin ist diese Gegend in einer seltsamen Hassliebe verbunden: Man schüttelt zwar den Kopf über die Spritzen, die man im Park findet, und über die leer stehenden Gebäude, die allgemein als »Schießbuden« bekannt sind, weil da so viele Junkies hausen, aber die meisten Künstler in seinem Haus, die sich darüber beklagen, sehen so aus, als würden sie ebenfalls Heroin nehmen. Und zwar regelmäßig. Sie haben dieses magere, strähnige, hohläugige, farblose Erscheinungsbild von Leuten, die oft high sind. Und so ist er auch zu dieser Wohnung gekommen. Der Vermieter hat ihn bei seiner ersten Ausstellung angesprochen. »Bist du Jack Baker?«
»Ja.«
»Du bist der Fotograf?«
»Ja.«
Es war die Herbstausstellung der School of the Art Institute of Chicago. Ausgestellt wurden die Arbeiten des neuen Jahrgangs, und unter diesen etwa zwei Dutzend Studenten war Jack der einzige, der hauptsächlich Landschaftsfotos machte. Die anderen waren expressionistische Maler von überragendem Talent oder schufen aus den verschiedensten Objekten aufwendige Skulpturen oder machten Videoinstallationen aus komplex gekoppelten Kameras und Bildschirmen.
Jack dagegen machte Polaroids.
Von Bäumen.
Die Bäume zu Hause, auf der Prärie, waren dem Wetter ausgesetzt: Sie neigten sich zur Seite, gebeugt vom unablässigen Wind.
Neun dieser Polaroids waren in einem Quadrat von einem Meter Seitenlänge an die weiße Wand geklebt. Jack stand bereit für den Fall, dass jemand eine Frage zu seinen Fotos hatte, aber niemand hatte eine. Dutzende gut gekleideter Sammler waren vorbeigegangen, doch dann sprach ihn ein blasser Mann mit einem löchrigen weißen Pullover und nachlässig geschnürten Arbeitsstiefeln an. Er hieß Benjamin Quince, studierte im siebten Studienjahr im Masterstudiengang Neue Medien und arbeitete an seiner Masterarbeit, was für einen Neuling wie Jack nach gewaltigen akademischen Leistungen klang. Benjamin war buchstäblich der Erste, der Jack eine Frage zu seinem Werk stellte. Sie lautete: »Tja. Bäume?«
»Wo ich herkomme, weht immer ein starker Wind«, sagte Jack. »Darum wachsen die Bäume schief.«
»Ich verstehe«, sagte Benjamin, kniff hinter großen runden Brillengläsern die Augen zusammen und rieb sich den spärlichen Kinnbart. Sein löchriger Pullover hatte ein paar Flecken, und sein dünnes, gelbbraunes Haar war ungewaschen und auf eine Länge gewachsen, die häufiges Hinters-Ohr-Streichen erforderte. Er sagte: »Und woher kommst du?«
»Kansas«, sagte Jack.
»Ah«, sagte Benjamin heftig nickend, als hätte Jack damit etwas Bedeutsames bestätigt. »Das Herz Amerikas.«
»Ja.«
»Amerikas Kornkammer.«
»Stimmt.«
»Kansas. Mais oder Weizen? Ich kann’s mir nicht merken.«
»Kennst du das Lied ›Home on the Range‹?«
»Klar.«
»So ungefähr ist es da, wo ich herkomme.«
»Gut, dass du’s geschafft hast, da wegzukommen«, sagte Benjamin, blinzelte und musterte die Polaroids. »Ich wette, kein Mensch interessiert sich für diese Bilder.«
»Vielen Dank.«
»Das sollte kein Werturteil sein. Ich will damit nur sagen, dass deine Fotos bei dem Publikum hier vermutlich nicht ankommen. Hab ich recht?«
»Die meisten bleiben zwischen einer und drei Sekunden stehen, lächeln freundlich und gehen weiter.«
»Weißt du, warum?«
»Eigentlich nicht.«
»Weil Polaroids keinen bezifferbaren Wert haben.«
»Wie bitte?«
»Sie verkaufen sich nicht. Kein Polaroid ist je bei Sotheby’s versteigert worden. Es sind Massenprodukte für den Augenblick. Die Chemikalien zersetzen sich, die Bilder verschwinden. Ein Polaroidfoto ist nicht beständig. Diese Leute hier« – Benjamin machte eine unbestimmte Geste, die alle anderen im Raum einschloss – »nennen sich Sammler, aber die bessere Bezeichnung wäre wahrscheinlich Investoren. Es sind Handlanger des Kapitalismus. Sie sind darauf aus, billig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Dein Problem ist, dass ein Polaroid niemals einen hohen Preis erzielen wird.«
»Daran habe ich noch nie gedacht.«
»Gut für dich.«
»Mir haben in erster Linie die Bäume gefallen.«
»Ich muss sagen, ich bewundere deine Authentizität. Du bist keiner von diesen sich anbiedernden Schleimscheißern. Das gefällt mir.« Benjamin trat näher, legte die Hand auf Jacks Schulter und sagte im Flüsterton: »Hör mal, mir gehört ein Gebäude in Wicker Park. Eine alte Gießerei. Hab ich für einen Dollar gekauft, die Bank wollte das Ding unbedingt loswerden. Kennst du Wicker Park?«
»Eigentlich nicht.«
»In der North Side. Etwa eine Viertelstunde mit dem Zug. Sechs Stationen mit der Blue Line, und du bist in einer vollkommen anderen Welt.«
»Inwiefern anders?«
»Vor allem echt. Es ist eine Gegend mit Substanz. Wo die echte Kunst passiert, nicht dieser Quatsch für den Stiftungsrat. Und echte Musik, nicht dieser angepasste Scheißdreck aus dem Radio. Ich renoviere mein Gebäude von Grund auf und mache daraus eine Genossenschaft für Künstler. Ich werde es The Foundry nennen. Sehr exklusiv, Mitgliedschaft nur auf Einladung. Kein Mainstream, nichts Konventionelles, keine Verbindungsstudenten, keine Yuppies.«
»Klingt nett.«
»Nimmst du Heroin?«
»Nein.«
»Aber du siehst aus, als wärst du ein Junkie. Perfekt. Willst du einziehen?«
Es ist das erste Mal in Jacks Leben, dass es für ihn von Vorteil ist, schwach und mager zu sein. Er findet, dass er an einem aufregenden Ort gelandet ist, und trotz des schlechten Zustands des Hauses, trotz der Dunkelheit und Trostlosigkeit und der brutalen Kälte des Chicagoer Winters, trotz der vielen Überfälle in dieser Gegend, trotz der angeblichen Dealer im Park und der Gangs mit ihren komplizierten Rivalitäten und gelegentlichen Kämpfen gefällt es ihm. Es ist der erste Winter, den er nicht zu Hause verbringt, und er kann gar nicht fassen, wie lebendig er sich hier fühlt, wie überaus und wirklich und zum ersten Mal frei. Die Stadt ist laut und schmutzig, teuer und gefährlich, aber sie gefällt ihm. Besonders der Lärm, das Donnern der Hochbahn, das Hupen der ungeduldigen Taxifahrer, das Kreischen der Polizeisirenen, das Stöhnen, mit dem das Eis auf dem See gegen den Beton der Uferbefestigung drückt. Und ihm gefallen die Nächte, wenn der Lärm verstummt, wenn die Stadt stillgelegt ist, erstickt von einem Schneesturm, der den dicksten, langsamsten Schnee ablädt, den er je gesehen hat. Dann sind die Wagen am Straßenrand unter der weißen Schicht begraben, der Himmel ist wie ein im Widerschein der Straßenbeleuchtung orangerot schimmernder Stoff, und jeder Schritt wird von einem befriedigenden, urtümlichen Knirschen begleitet. Ihm gefällt die Stadt am Abend, besonders wenn er das Art Institute verlässt und die Michigan Avenue und diese großartige Skyline sieht, diese Gebäude, deren Spitzen an bedeckten Tagen die Wolken berühren, die gewaltigen flachen Fassaden mit den Hunderten winzigen gelben Rechtecken, hinter denen Handel und Wandel der Stadt Überstunden machen.
Es ist ein seltsames Gefühl, die eigene Lebendigkeit zu spüren, vielleicht zum allerersten Mal, und zu begreifen, dass das Leben bis zu diesem Punkt eigentlich nicht gelebt, sondern ertragen worden ist.
In Chicago sieht er zum ersten Mal Kunst (wo er herkommt, gibt es keine Museen); er geht zum ersten Mal in ein Theater (er war nie auf einer Schule, in der ein Stück aufgeführt wurde); er isst Speisen, die er noch nie probiert hat (und denen er bis jetzt auch nie begegnet ist: Pesto, Pita, Empanada, Pirogi, Baba Ghanoush); er hört zu, wenn Kommilitonen ernsthaft darüber diskutieren, wer besser ist: John Ashbery oder Frank O’Hara? Arne Naess oder Noam Chomsky? David Bowie oder buchstäblich jeder andere? (Themen, die einem zu Hause bloß verständnislose Blicke und womöglich Schläge eingebracht hätten.) Für den Rest seines Lebens werden die Songs, die in diesem Winter veröffentlicht werden, dieses Gefühl von Freiheit und Entfaltung heraufbeschwören. Rage Against the Machine mit ihrem »Fuck you, I won’t do what you tell me!« bringen sein Ethos ziemlich genau auf den Punkt, aber auch die billigen Hits, die von den Kommerzsendern gespielt werden, sind mit Bedeutung erfüllt, Songs wie »Life Is A Highway« und »Right Now« und »Finally« und diese Aladin-Melodie, die andauernd im Radio gespielt wird und langsam zu Jacks privater Chicago-Hymne wird. Es ist tatsächlich eine vollkommen andere Welt.
(Er würde niemals zugeben, dass er manchmal heimlich einen Song aus einem Disney-Zeichentrickfilm vor sich hin summt und ihn unter der Dusche sogar singt und dass der Text für ihn sehr bedeutsam ist und er Kraft daraus schöpft. Nein, das wird er mit ins Grab nehmen.)
Er liebt den Lärm der Stadt, weil der etwas Beruhigendes hat: Er spricht von Menschen, Nachbarn, Landsleuten. Es hat auch etwas Großartiges, unempfindlich gegen den Lärm der urbanen Nacht zu werden, friedlich durchzuschlafen, ohne beim Klang der Hupen und Stimmen, der Alarmanlagen und Polizeisirenen auch nur zusammenzuzucken – das ist ein aussagekräftiger Messwert für Transzendenz. Zu Hause war das einzige Geräusch das leise Atmen des unablässigen, gleichförmigen Präriewindes. Manchmal, nach Sonnenuntergang, konnte man unter dem Wind das Bellen und Heulen der Kojoten hören, die nachts das Land durchstreiften. Und hin und wieder, es war unheimlich, verstummte das Heulen eines Rudels ganz plötzlich, bis auf eine Stimme, und die wurde eindringlicher, mehr wie ein Schrei, und dann klagender, mehr wie ein Weinen, und Jack, der noch wach lag und es hörte, obwohl er sich die Decke über den Kopf gezogen hatte, wusste genau, was das war: Ein Kojote hatte sich im Zaun verfangen.
Folgendes war passiert: Manchmal springen Kojoten an einem Stacheldrahtzaun nicht hoch genug, und dann bleiben sie mit den Hinterbeinen am obersten Draht hängen, genau da, wo die Beine in den Rumpf übergehen und, wie bei den meisten Hundeartigen, einen verhängnisvollen Winkel bilden. Die Vorderpfoten recken sich paddelnd, reichen aber nicht ganz bis zum Boden, die Hinterbeine rudern in der Luft, und da hängen sie, ganz gleich, wie kraftvoll sie treten, denn die Gelenke von Kojoten sind nicht so beweglich wie die anderer Tiere, die sich aus einer solchen Lage befreien können. Kojoten können ihre Hinterbeine, die ausschließlich für die Vorwärtsbewegung gemacht sind, nicht weit genug nach hinten strecken, und so hängen sie da, die ganze Nacht. Und weil sie an einem Stacheldraht hängen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich einige scharfe Stacheln in ihren Bauch bohren, in den weichsten und empfindlichsten Teil ihres Körpers, und je mehr sie treten und zucken und zappeln, desto tiefer bohren sich die Stacheln in ihre Eingeweide, und so sterben sie dann schließlich: Sie verbluten, und der Wind trägt ihre Schreie kilometerweit. Morgens sah Jack sie dort hängen wie Wäsche an einer Leine.
Im Vergleich dazu sind die Sirenen von Chicago geradezu ein Segen. Sogar die Überfälle sind ein, wie ihm scheint, angemessener Eintrittspreis für diese Welt.
Jack ist noch nicht ausgeraubt worden. Seit er nach Wicker Park gezogen ist, hat er eine Aufmachung perfektioniert, von der er hofft, dass sie diese Burschen abschreckt, ein semigefährliches Erscheinungsbild aus gebrauchten Klamotten von der Heilsarmee, einer Armladung Tattoos, ungekämmtem Haar, einem urban marschierenden Schritt, dem harten, entschlossenen Blick und der Zigarette, die er praktisch immer zwischen den Lippen hat. All das signalisiert, wie er hofft: Verpiss dich! Er will nicht ausgeraubt werden, und doch ist ihm klar, dass die bloße Möglichkeit, ausgeraubt zu werden, auf eine seltsame Art dazugehört und einen Teil der Attraktion ausmacht. Die Künstler, die hierherkommen, tun das nicht trotz der Gefahren, die hier drohen, sondern genau deswegen. Laut Benjamin Quince (der sich abendelang über dieses Thema verbreiten kann) ist Wicker Park Chicagos Antwort auf Montmartre: billig, schmutzig, heruntergekommen und daher lebendig.
Also wird der Schmutz gepriesen, und Jack macht Fotos, die genau das festhalten sollen: Schmutz und Schmodder. Er sucht in den Korridoren und ehemaligen Büros und Lagerräumen im vierten Stock nach Spuren eines Lebens am Rand. Die abblätternde Wandfarbe. Die liegen gelassenen Spritzen. Die zerbrochenen Fensterscheiben. Die bräunlich verfärbten Vorhänge. Die bröckelnden Wände. Den Staub, der sich in all den Jahren so verdichtet hat, dass er nicht mehr wie Staub, sondern eher wie Sand ist.
»Das ist so was von abgefahren«, sagt Benjamin später, als er die Fotos sieht.
Die beiden stehen an einem Tag im tiefsten Winter auf dem Dach des Genossenschaftshauses. Jack bläst warme Luft in seine kalten, halb geschlossenen Hände. Er hat wie immer seine dünne schwarze Seemannsjacke an und darunter sämtliche Pullover, die er besitzt. Benjamin trägt einen Parka, der so voluminös ist, dass er wie ein Ballon wirkt. Seine Wangen sind rosig wie eine Wassermelone, und der Parka sieht warm und weich aus und ist vermutlich mit Daunen gefüllt, einem Material, von dem Jack schon gehört hat, das er aber nicht genauer definieren könnte.
Benjamin sieht sich die Fotos an, und Jack betrachtet die graue Gegend, die vereinzelten Fußgänger und Wagen, die schmutzigen Schneehaufen sowie die schnurgerade auf ihren Fluchtpunkt am Seeufer ausgerichteten Straßen und Gassen. Sie stehen auf der Ostseite des Gebäudes, der Seite, die zu dem Mädchen im Fenster zeigt. Der Namenlosen. Jack sieht hinab in ihre Wohnung. Die Frau ist nicht da, aber diese neue Perspektive ist eigenartig aufregend. Er stellt fest, dass sie auf den Boden vor dem Fenster einen Teppich gelegt hat – das kann er von seinem üblichen Beobachtungspunkt im dritten Stock nicht sehen. Diese neue Information erscheint ihm sehr bedeutsam: Sie ist eine Frau, die Teppiche kauft.
Er will alles über sie wissen. Doch er hat niemanden nach ihr gefragt, denn er weiß nicht, wie er das anstellen soll, ohne zu verraten, dass er sie gelegentlich beobachtet, eine Tatsache, für die er sich allerdings nur insofern schämt, als er weiß, dass andere es verwerflich fänden.
Benjamin bewundert noch immer die Fotos und sagt: »Die müssen wir ins Internet stellen.«
»Okay«, sagt Jack, während direkt unter ihnen ein Mann in die Gasse einbiegt. Er schleppt eine große schwarze Reisetasche, und die Tatsache, dass er wankt, deutet darauf hin, dass entweder die Tasche sehr schwer oder er sehr betrunken ist.
Jack sagt: »Was ist das Internet?«
Benjamin sieht zum ersten Mal von den Fotos auf. »Im Ernst?«
»Ja. Was ist das?«
»Das Internet. Du weiß schon – der Informations-Superhighway. Das digitale hypertextuelle globale Cyberspace-Ding.«
Jack nickt und sagt: »Damit kann ich, ehrlich gesagt, auch nicht viel anfangen.«
Benjamin lacht. »Benutzt man in Kansas noch keine Computer?«
»Meine Eltern haben nie eingesehen, wozu das gut sein soll.«
»Tja, na ja, das Internet. Wie soll ich es erklären?« Benjamin denkt einen Augenblick nach und sagt: »Du kennst diese Zettel, die die Leute an Telefonmasten tackern?«
»Ja.«
»Das Internet ist wie diese Zettel, nur dass sie nicht an einem Telefonmast stecken, sondern im Telefon.«
»Verstehe ich nicht.«
»Stell dir vor, dass sich diese Zettel im Telefondraht befinden und mit Lichtgeschwindigkeit verschickt werden, und jeder Zettel ist mit allen anderen verbunden, dynamisch, kommunikativ und für jeden zugänglich.«
»Für jeden?«
»Für jeden, der einen Computer und ein Telefon hat. Ich hatte Besucher aus England, Australien, Japan.«
»Wieso interessieren Leute aus Japan sich für deine Zettel?«
»Außenseiter gibt’s überall, mein Freund. Die Unverstandenen, die Unbeliebten, die Freaks. Im Internet finden wir einander. Es ist wie eine wunderbare alternative Welt. Man braucht sich den konformistischen Regeln dieser Welt nicht mehr zu beugen. Du kannst dein wildes, schräges Ich sein. Darum gibt es im Internet mehr Ehrlichkeit, weniger Betrug. Es ist wirklicher.«
»Wirklicher als was?«
»Als die Welt. Dieses fabrizierte Konstrukt, dieses Goldfischglas, in dem wir leben. Dieser ganze kommerzialisierte, Gedanken kontrollierende Unterdrückungsapparat.«
»Mann, das muss ja ein Wahnsinnszettel sein, den du da getackert hast.«
»Absolut auf der Höhe der Zeit.«
»Und worum geht’s da? Die Foundry?«
»Irgendwie schon, aber auch um die Gegend und die Energie hier, all diese Anti-Establishment-Schwingungen. Willst du mal sehen?«
»Klar.«
»Ich zeig dir, wie das geht. Ich werde dein Internet-Sherpa sein und dich aus den Achtzigern holen.«
»Danke.«
»Du solltest für mich arbeiten. Ich brauche Bilder. Fotos von Bars, Bands, Partys. Von coolen Leuten, die coole Sachen machen. So was in der Art. Meinst du, das kriegst du hin?«
»Ich glaube schon.«
»Super!«, sagt Benjamin, und so kommt es, dass Jack einen Job in der New Economy hat, auch wenn er nicht ganz versteht, was das bedeutet.
Der Mann unter ihnen bleibt am Fahrradständer hinter dem Haus stehen. Er mustert leicht schwankend die vielen festgeketteten Fahrräder. Dann stellt er die Tasche ab, öffnet den Reißverschluss und holt einen langen Bolzenschneider hervor, mit dem er rasch und geübt den Bügel des Schlosses an einem der teureren Räder mit Zehngangschaltung durchschneidet.
»Heh!«, ruft Jack.
Der Mann fährt erschrocken herum und sieht die Gasse hinunter. Dann geht sein Blick über die Fenster des Gebäudes, und schließlich schirmt er die Augen mit der Hand ab und entdeckt sie dort oben auf dem Dach, fünf Stockwerke über ihm. Er lächelt und winkt. Es ist ein großes, ausladendes Winken, als wären sie alte Freunde.
Was können sie schon tun? Jack und Benjamin winken zurück. Und dann sehen sie zu, wie der Mann den Bolzenschneider in der Tasche verstaut und sie sich über die Schulter hängt, bevor er auf das nunmehr befreite Fahrrad steigt und davonfährt.
Benjamin lächelt, sieht Jack an und sagt: »Das war so was von scheißwirklich.«
Sie steht in einer der Ecken einer weiteren lauten Bar, eingeladen von einem weiteren Typen mit großen Meinungen, und soll wieder einmal eine Band hören, die sie, wie man ihr sagt, lieben wird. Heute Abend ist sie im Empty Bottle, der Bar an der Western Avenue mit der großen Leuchtreklame für Old Style Beer und einer Markise, auf der MUSIK/FREUNDLICH/TANZ steht.
Im Augenblick stimmt nur eine dieser Angaben.
Es gibt tatsächlich Musik, aber sie ist nicht tanzbar und alles andere als freundlich. Sie hört eine Band, deren Namen sie nicht verstanden hat, weil die Musik der Band zu laut ist. Ihr Begleiter hat ihn ihr zugerufen, Zentimeter von ihrem Ohr entfernt, zweimal, aber nichts da. Der Drummer und der Leadgitarrist scheinen besessen davon, jedes Verhalten zu unterbinden, das die totale Konzentration auf die Band beeinträchtigen könnte. Sogar die Texte – in denen es irgendwie um die bewegende spirituelle Pein und Entfremdung des Leadsängers geht – werden von mächtigen Gitarrenakkorden überdröhnt, und der Drummer beherrscht offenbar nur einen Move, zu dem eine Menge Becken gehören. Die Leute stehen da und tanzen nicht, sondern zucken im Takt. An der Bar bestellt man die Drinks mithilfe von Gesten.
Sie steht weit entfernt von der Bühne, am Fenster. Wenn die Tür geöffnet wird, strömt ein Schwall kalte Luft herein, und darum trägt sie noch immer Schal, Handschuhe und die Wollmütze, die sie über die Ohren gezogen hat, um das Pandämonium auf der Bühne um wenigstens ein paar Dezibel zu dämpfen. Die Hälfte der Gäste steht vor der Tür – lieber in der Kälte als im Lärm, die Beine eng beieinander, die Arme an den Rumpf gelegt, Mumien im Schnee. Es ist einer jener Chicagoer Winterabende, die so jenseits von eiskalt sind, dass man verzweifeln könnte, so bitterkalt, dass die Leute auf dem Bürgersteig spontan zu fluchen beginnen. »Scheiße, ist das kalt!«, rufen sie da draußen und stampfen mit den Füßen auf. Es ist die Art von Kälte, die einem in die Stiefel kriecht und die ganze Nacht dort bleibt.
Die Band, die sie hört, ist nicht die, wegen der sie gekommen ist. Die letzte Gruppe ist angeblich das große Ding, auch wenn ihr Begleiter ihr nichts dazu sagen will. Er will es ihr nicht verderben. Ihre Erfahrung, diese Musik zum allerersten Mal zu hören, soll unberührt sein, sagt er. Er organisiert ihre Erfahrung und denkt wahrscheinlich, dass sie das zu schätzen weiß. Sie steht neben ihm, nippt an ihrem Bier, und da eine Unterhaltung bei diesem Krach nicht möglich ist, wartet sie einfach ab.
Die Wände im Empty Bottle sind aus unverputzten Backsteinen und an den meisten Stellen mit so vielen Postern, Flyern und Stickern beklebt, dass man, wenn man sie genauer betrachtet, kognitiv überfordert ist. Die Decke ist mit Weißblech verkleidet, nur über der Bühne hängen Schallschluckelemente aus Schaumgummi, die aussehen wie Eierkartons, ein, zwei Meter über den Köpfen der Musiker. Die Bühne selbst ist bloß einen halben Meter hoch, mattschwarz lackiert und flankiert von großen, aufeinandergestapelten Verstärkern. An der Bar gibt’s neun Biersorten vom Fass, und alle kosten einen Dollar fünfzig.
Es ist eine der für kompromisslose Musik bekannten örtlichen Bars, in die sie sich in letzter Zeit von Männern hat einladen lassen, die sie beeindrucken wollten. Heute Abend ist es ein ernsthafter, intellektueller, düsterer Typ mit einer Art von Gewichtigkeit, die man verklemmt nennen könnte, ein Spross der Oberklasse mit blondem, exakt in der Mitte gescheiteltem Haar, John-Lennon-Brille und gemustertem Pullover über einem Hemd mit nochmals anderem Muster, und er heißt Bradley: Nenn mich Brad. Er hat heute Morgen in der Mikroökonomie-Vorlesung neben ihr gesessen, die Ärmel ihrer dicken Wintermäntel haben sich die ganzen fünfzig Minuten berührt und die Pfützen aus schmutzigem Schneematsch unter ihren Stiefeln sich schließlich zu einer einzigen vereinigt. Nach der Vorlesung – in der es um erwarteten Nutzen, Risikovermeidung und die Frage gegangen war, wie man bei unsicherer Informationslage Entscheidungen trifft – spürte sie, während sie ihre Sachen zusammenpackten, dass er sie musterte, und als sie ihn ansah, verdrehte er die Augen und sagte: »Laaaangweilig«, und sie lächelte, obwohl sie die Vorlesung ganz und gar nicht langweilig gefunden hatte. Dann, beim Verlassen des Hörsaals, fragte er sie, ob sie am Abend schon was vorhabe, denn falls nicht, könnten sie sich diese neue, umwerfende Band im Empty Bottle anhören, wo er zufällig den Barmann kenne – was bedeutete, dass sie Bier würde trinken können, obwohl sie noch nicht volljährig war –, und als sie leichtes Interesse zeigte, wurde er ausführlicher und bestand darauf, dass sie diese Band absolut hören müsse, jetzt, noch heute Abend, solange ihre Musik noch rein sei, bevor ihnen der Durchbruch gelang und die verderblichen Mächte der Popularität und des Geldes sie erfassen und zugrunde richten würden. Also gut, okay, sie verabredete sich mit Brad um neun im Empty Bottle, und als sie dann da war, bestellte er Bier und sagte: »Magst du Musik?«, und sie sagte: »Klar mag ich Musik.« Er zwang sie praktisch, es zu beweisen, und begann sie zu testen: Kennst du diese Band, kennst du jene Band? Fugazi, Pavement, The Replacements, Big Star, Tortoise, Pixies, Hüsker Dü – diesen letzten Namen sprach er so akkurat aus, dass sie jeden einzelnen Umlaut hörte –, und als sie sagte, sie kenne keine einzige davon, schüttelte er mitleidig den Kopf und erbot sich selbstverständlich, sie zu erleuchten. Wie sich zeigte, besaß Nenn-mich-Brad eine umfangreiche Sammlung seltener Vinylplatten, von der er ihr unbedingt erzählen musste und die er ihr noch lieber zeigen wollte: eine ganze Wand in seiner Wohnung, die ausschließlich den seltensten und genialsten Platten gewidmet war, heiligen Platten, die praktisch niemand außer ihm kannte oder angemessen würdigte.
Sie hörte nicht mehr zu. Brad brauchte keine Ermunterung, um seinen Monolog fortzusetzen – er verströmte geradezu sexuelle Bedürftigkeit, wie eine leise, dumpfe Panik –, und so blendete sie ihn aus, bis der expressive Gitarrist mit einem ausgefeilten Riff einsetzte, worauf Brad verstummte und das ohrenbetäubende Set begann.
Sie hat Brad nichts davon gesagt, aber der einzige Grund, warum das Gerücht von einer neuen, umwerfenden Band ihr Interesse geweckt hat, ist, dass sie bei solchen Auftritten oft ihn sieht, den jungen Mann im Fenster auf der anderen Seite der Gasse. Und tatsächlich: Als sie kam, war er schon da, in der ersten Reihe, mit seiner Kamera, und sie hatte das Gefühl, als würde sich in ihrem Bauch etwas heben – vielleicht das, was die Leute meinen, wenn sie sagen: »Mein Herz hat einen Hüpfer gemacht.« Aber das klingt so angenehm und erfreulich, viel erfreulicher jedenfalls als das, was sie spürt, und das ist weniger ein Hüpfen, sondern eher ein Verflüssigen.
Immer wenn sie ihn irgendwo draußen sieht, wird sie schüchtern, obwohl sie sich eigentlich nicht für einen schüchternen Menschen hält. Sie sieht ihn spätnachts im Empty Bottle, im Rainbo Klub, in der Lounge Ax, im Phillys’ Inn, bei der Arbeit mit seiner Kamera, und dann sieht sie ihm zu, bis ihre Aufmerksamkeit, ihr Interesse unerträglich werden: Warum bemerkst du mich nicht? Es ist, als wäre ein Scheinwerfer auf ihr Gesicht gerichtet, der umso heller scheint, je länger sie ihn anstarrt, aber dieser Typ sieht sie einfach nicht. Er ist immer ganz vorn, immer mit der Kamera beschäftigt, geht in die Knie, wenn er die Sänger und Leadgitarristen fotografiert, damit sie monumental wirken.
Sie hat seine Arbeiten online gesehen, an einer dieser elektronischen Pinnwände, und so hat sie auch herausgefunden, wie er heißt: Fotos von Jack Baker. Er steht immer vorn, an der Bühne – und manchmal auch auf der Bühne, von wo er das Publikum aus der Perspektive des Drummers fotografiert –, wenn die besten Bands spielen, die Lokalberühmtheiten, mit denen er dann meist die Bar verlässt, woraus sie folgert, dass er für sie unerreichbar ist.
Hier, in Chicago, ist sie ein Niemand.
Sie wird nicht zu den After-Show-Partys eingeladen, die, wie sie weiß, anderswo stattfinden. Und sie weiß, dass sie stattfinden, weil sie sie auf der Pinnwand gesehen hat, Fotos von Jack Baker: von ihm aufgenommene Ausschweifungen, irgendwo hier in der Gegend. Gibt es eine schlimmere Qual, als zu wissen, dass andere gerade einen Riesenspaß haben, und selbst nicht eingeladen zu sein? Sie heißt Elizabeth Augustine – von den Litchfield-Augustines –, aber der gute Name ihrer Familie zählt nur in gewissen Kreisen etwas, und diese Kreise verkehren hier nicht. Sie ist bloß irgendeine Studentin, ein Erstsemester an der DePaul, eine Uneingeweihte in der hinteren Ecke, die den Finger nicht gerade am Puls der örtlichen Musikszene hat, und um zu erfahren, wo Jack Baker und die anderen tonangebenden Leute der Gegend zu finden sind, ist sie auf die Hilfe von Kennern angewiesen, von Typen wie Brad, der sich, als es gerade ein bisschen leiser ist, weil der Leadgitarrist sein Instrument stimmt, zu ihr beugt und ihr diese umwerfende Band erklärt: Ihr Sound unterscheide sich klar von Rock oder Alternative oder Grunge. Sie könnte die Unterschiede gar nicht benennen, für sie klingt das alles wie Lärm, doch Brad besteht darauf, dass der Seattle-Sound, der jetzt andauernd im Radio gespielt wird und die Hitparaden dominiert, ganz anders ist als der Chicago-Sound, der, wie er sagt, weniger kommerziell ist, näher dran an den Jazz-Wurzeln, weniger Mainstream, mehr Indie. Es ist ein Bruch mit dem Eastcoast-Hardcore, der seine Seele schon längst verkauft hat, und ein Bruch mit dem Westcoast-Grunge, der dabei ist, sie zu verkaufen. Es ist ein ganz eigener Sound, hervorgebracht von diesem vergessenen Landstrich, über den alle immer nur hinwegfliegen, er ist unbeschmutzt von finanziellen Interessen. Sie hat noch nie über das Terroir eines Rocksongs nachgedacht, wohl aber über die hinderlichen Aspekte von Geld, und tatsächlich war die Flucht vor der Gier und dem Reichtum ihrer Familie – und dem unmenschlichen Verhalten, dem nie endenden Streben, dem ewigen Konkurrenzkampf, den Gier und Reichtum erfordern – einer der Hauptgründe, warum sie alles und jeden hinter sich gelassen hat und nach Chicago gekommen ist.
Es soll, hat sie sich geschworen, ihr letzter Ortswechsel sein. Noch bevor sie hier angekommen ist, hat sie sich geschworen, dass sie bleiben wird, dass sie sich, nach einer Kindheit voller Umzüge, endlich eine dauerhafte Existenz aufbauen wird. Ihr eigenes Leben, ein anständiges Leben voll Mitgefühl. Sie hat ihre Kindheit in den reichen Vororten der großen Ostküstenmetropolen verbracht, ist auf unzählige Privatschulen gegangen und von einem Ort zum anderen gezogen, während ihr Vater sich mal diese, mal jene Firma vorgenommen, geprüft, gekauft, ausgenommen, filetiert, liquidiert, kassiert, realisiert, profitiert und dabei nichts als Insolvenzen und wütende Gläubiger hinterlassen hat – das ist so etwas wie eine Familientradition.
Und so war sie begeistert, als sie in Chicago auf diese Szene getroffen ist, in der man den krassen Merkantilismus ablehnt und es von jedem, der nach Reichtum strebt, heißt, er habe »sich verkauft«, er sei »ein Schaf«.
Sie will sich nicht verkaufen.
Sie will kein Schaf sein.
Aber sie möchte sehr gern zu diesen Partys eingeladen werden.
Die Band beginnt mit ihrer nächsten überlauten Darbietung, und Jack fotografiert den Sänger, erst von der Seite, im Profil, dann von hinten und schließlich von vorn, wobei er in die Knie geht und die Kamera nach oben richtet, und der Sänger beugt sich wie choreografiert vor und presst das Mikrofon an die Lippen, was auf dem Foto bestimmt heroisch aussehen wird, und auf einmal flüstert er etwas ins Mikrofon, aber man kann es nicht verstehen, denn der eitle Gitarrist steigt wieder ein und zerreißt den Moment mit voller Lautstärke. Sie spürt eine geradezu geschwisterliche Rivalität zwischen dem Sänger und dem Gitarristen, beide wollen die Bewunderung des Publikums. Die Mühe, den Namen der Band herauszufinden, kann sie sich sparen – sie wird sich auflösen, wahrscheinlich noch vor dem Frühjahr. Jack ist inzwischen aufgestanden und zieht den Pullover aus, den dicken schwarzen Pullover, der ihm eineinhalb Nummern zu groß und im Grunde seine tägliche Winteruniform ist. Er ist hinten ausgefranst, weil er immer darauf sitzt. Darunter trägt er einen dünneren schwarzen Pullover.
Was ist an diesem Typen, das sie so unwiderstehlich findet? Sicher nicht bloß die Tatsache, dass er auf der anderen Seite der Gasse wohnt. Bei den meisten Männern würde sie nur den unwiderstehlichen Drang verspüren, die Vorhänge zuzuziehen, doch bei diesem befällt sie ein unerklärliches Gefühl des Erkennens, als besäße er vielleicht eine bedeutende Eigenschaft, die sie sucht, aber nicht ganz benennen kann. Elizabeth ist mit dem festen Vorsatz nach Chicago gekommen, sich kopfüber in die lebhafte Boheme dieser Stadt zu stürzen, mit Dichtern zu trinken und mit Malern zu schlafen. (Oder auch umgekehrt, wie es sich ergibt.) Und es hätten nicht mal gute Dichter oder gute Maler sein müssen – das einzige Kriterium, das ein Mann zu erfüllen hat, damit sie mit ihm nach Hause geht, ist, dass er ein guter, interessanter, selbstloser Mensch ist.
Eine Bedingung, die die Typen in Chicago bislang nicht erfüllt haben.
Doch der im Fenster scheint anders zu sein. Er verströmt eine Freundlichkeit, Sanftheit und Zurückhaltung, die im krassen Widerspruch zu dem Weltbeherrschungsethos steht, vor dem sie nach Chicago geflohen ist. Jack Baker ist rücksichtsvoll – jedenfalls glaubt sie das. Sie glaubt, dass er ein rücksichtsvoller Mensch, ein rücksichtsvoller Liebhaber ist. Sie glaubt es, weil sie von ihrem Platz am Fenster Zeugin so vieler privater Augenblicke, so vieler kleiner Momente von Aufmerksamkeit geworden ist: die Bücher, die Gedichte, die philosophischen Texte, die er bis spät in die Nacht liest, die Geduld und Sorgfalt, mit der er all die Negative betrachtet, bis er das richtige gefunden hat, die Art, wie er sich schüchtern hinter seinen langen Strähnen versteckt. Selbst seine Berufswahl – Fotograf – erscheint ihr auf sympathische Weise bescheiden. Er wird immer ein Außenstehender sein, einer, der zusieht. Ein Fotograf steht per Definition nicht im Mittelpunkt. Sie war mit Männern aus, die immer im Mittelpunkt stehen mussten, wie diese Burschen auf der Bühne, wie Brad, und sie hat festgestellt, dass das irgendwann erdrückend wird.
Die Band beendet ihr Set mit einem explosionsartigen Donnern, das sich von dem vorangegangenen Lärm nur durch die Inbrunst unterscheidet, mit der der Drummer die Becken bearbeitet. Wenn man die ganze Zeit mit voller Lautstärke spielt, ist ein Crescendo unmöglich, und so werden die Musiker nun einfach schneller und verdichten den Rhythmus so sehr, dass aus den großen Boxen nur noch ein Klangbrei quillt. Mit einem finalen orgasmischen Aufbäumen der Gitarristenhüfte kommen sie zu einem misstönenden Ende, und der Sänger sagt die ersten verständlichen Worte an diesem Abend: »Danke, Chicago!«, als würde er auf dem ausverkauften Soldier Field stehen und nicht in einer Kneipe, in die sich ein paar Dutzend Leute vor der Kälte verkrochen haben.
Die Musiker packen ihre Instrumente ein, und Brad wendet sich zu ihr und sagt: »Na, was sagst du jetzt?« Dann verschränkt er die Arme und wartet. Ganz gleich, wie ihre Antwort lautet – Elizabeth weiß, dass sein Urteil deutlich sein wird.
»Auf einer Skala von eins bis zehn«, sagt sie, »wie sehr, würdest du sagen, haben dich deine Eltern geliebt?«
»Was?«
»Auf einer Skala von eins bis zehn.«
»Mann«, sagt er und lacht verlegen. »Haha!«
»Ich meine es ernst.«
»Du«, sagt er mit einem breiten, dummen Grinsen, zeigt auf sie und schüttelt den Kopf. »Du traust dich ja was. Du willst es wissen, was?«
Dann geht er zur Bar, um neues Bier zu holen.
Am anderen Ende des Raums mischt Jack sich unter die Leute. Er geht zu verschiedenen Grüppchen, die an der Theke stehen, sagt etwas und macht ein Foto. Auch diese Bilder hat sie online gesehen: Porträts von Leuten in Bars. Sie erinnern sie an die Gesellschaftszeitschriften zu Hause, die für gewöhnlich mindestens sechs Hochglanzseiten voller Schnappschüsse von Leuten enthielten, die in letzter Zeit an wichtigen gesellschaftlichen Ereignissen oder Benefizveranstaltungen teilgenommen hatten. Der Unterschied zwischen diesen und jenen Fotos ist, dass die Leute in Chicago eine ironische Distanz ausstrahlen. Sie lächeln nicht; die meisten sehen nicht mal in die Kamera. Ihre Haltung signalisiert: Sie wissen, dass sie fotografiert werden, sind aber nicht bereit zu kooperieren. Jack bedankt sich und geht weiter.
Er kommt jetzt in ihre Richtung, zum vorderen Teil der Bar, und sucht nach neuen Gesichtern: Mit taxierendem Blick fasst er mal diese, mal jene Person ins Auge, und Elizabeth fragt sich, ob dies der Moment ist, in dem er sie endlich bemerken und ein Foto von ihr machen wird. Sie kommt zu dem Schluss, dass es ihr egal ist, wie offensichtlich sie sich um ihn bemüht: Sie wird ihn jetzt ansehen, direkt ansehen, sie wird seine Aufmerksamkeit fordern. Aus irgendeinem Grund kommt ihr das sehr riskant und beängstigend vor, und als sein Blick in ihre Richtung geht, will sie sich beinahe instinktiv verbergen. Sie hat ihn noch nie so mutig angesehen, und darum bemerkt sie, dass er sie rasch in Erwägung zieht und ebenso rasch verwirft. Ohne irgendein Erkennen oder Interesse geht er weiter.
In diesem Augenblick fühlt sie sich, als würde sie als einziges Mädchen der Schule nicht zum Abschlussball eingeladen.
Sie sieht ihn hinausgehen. Als er die Tür öffnet, strömt arktische Luft herein, vor der sich alle Umstehenden tiefer in ihre Jacken und Mäntel verkriechen, und da wird ihr bewusst, dass sie die Mütze tief in die Stirn gezogen und den Mund mit dem Schal bedeckt hat. Sie ist praktisch maskiert.
Sie legt Schal und Mütze ab, fährt sich mit den Fingern durchs Haar und sieht zum Fenster hinaus. Sie bringt ihr Gesicht ganz dicht an das Glas, sodass sie die Kälte der Luft da draußen spüren kann. Jack steht am Bordstein, er macht ein Foto, geht einen Schritt beiseite, macht noch eins aus einem anderen Winkel, geht noch einen Schritt und macht noch ein Foto. Die Leute tun, als würden sie ihn nicht bemerken, und doch richten sie ihren Körper nach der Kamera aus. Jetzt zielt er auf Elizabeth, aber zwischen ihnen sind all diese Leute, die beieinanderstehen und dicke weiße Wolken in die kalte Nachtluft atmen, und so hat er sie nicht bemerkt – oder vielleicht ignoriert er sie auch, sie ist sich nicht sicher.
In diesem Moment ertönen vom anderen Ende der Bar ein paar einfache, ruhige Gitarrenakkorde. Elizabeth blickt zur Bühne, um zu sehen, welche Band jetzt dran ist, doch zu ihrer Überraschung steht da nur eine Frau. Sie ist klein, kaum eins sechzig, sie ist blond, dünn und jung, sie trägt Jeans, ein Trägerhemd und eine cremefarbene Strickjacke und hat glattes, schulterlanges Haar. Mit anderen Worten: Sie sieht nicht aus wie ein Rockstar. Ihr Auftritt ist das Gegenteil von der Exzentrik der Band, die eben gespielt hat. Weil sie so unprätentiös wirkt, hält Elizabeth es für möglich, dass sie bloß ein Gast ist und betrunken zur Gitarre gegriffen hat und dass der Barmann sie gleich vor die Tür setzen wird. Aber nein, er tritt nicht in Aktion, und bei den ersten Klängen kommt Jack Baker wieder rein und fängt sofort an, die Frau zu fotografieren, und damit ist klar, dass sie sich nicht warmspielt, sondern ihr Set begonnen hat, dass sie keine Band und nur diese Gitarre hat, die nicht an die gewaltigen Boxen hinter ihr angeschlossen ist, sondern bloß an einen kleinen Verstärker zu ihren Füßen, sodass sie über dem Gequatsche der Leute nur schwer zu verstehen ist. Elizabeth beugt sich vor und hört der seltsam monotonen Stimme zu, diesem Lied, das anscheinend von einem Mann handelt, der so gierig ist, dass er nichts mehr wirklich würdigen kann:
I bet you’ve long since passed understanding
What it takes to be satisfied
Das ist eigentlich nicht gesungen, aber auch nicht gesprochen – es ist irgendwie seltsam dazwischen. Und nicht ganz sauber im Ton, aber auch nicht direkt falsch. Sie spielt die Gitarre so zurückhaltend und singt so nüchtern, ohne die Verzierungen, das Melodrama und die Mätzchen der typischen Rocksänger. Als Brad zurückkehrt, flüstert Elizabeth: »Wer ist das?«
Er sieht zur Bühne und wirkt überrascht, als hätte er noch gar nicht bemerkt, dass dort jemand auftritt. »Niemand«, sagt er. »Füllmasse.«
»Füllmasse?«, sagt sie.
»Die Hauptband verspätet sich. Sie füllt die Pause.«
Er wedelt mit der Hand und setzt seinen Vortrag fort. Diesmal ist es ein Monolog über die fünf besten Konzerte, die er je erlebt hat. Ringsum unterhalten die Leute sich laut und ungeniert. Elizabeth versucht, sich auf die Musik zu konzentrieren. An der Theke stehen die vier Typen der vorigen Band und lachen betont laut, als sollten alle merken, wie sehr sie den Auftritt der Sängerin ignorieren. Und so geht der kleine Song dahin: Die Frau spielt schlichte Gitarrenakkorde, und ihre bescheidene Lautstärke kämpft gegen das Gequatsche der gleichgültigen Menge an.
»Nummer fünf? Die Stones im Silverdome«, sagt Brad. »Das Konzert wäre höher auf meiner Liste, aber 1989, als es stattfand, hatten die Stones ihren kreativen Höhepunkt schon überschritten. Außerdem ist die Atmosphäre im Silverdome so leblos wie in einer Klapsmühle.«
»Mh-hm.«
»Nummer vier war Soul Asylum im vergangenen Juli im Metro, und das hätte leicht Nummer drei oder sogar Nummer zwei werden können, wenn nicht all diese Yuppies da gewesen wären, die die ganze Zeit ›Runaway Train‹ geschrien haben, als wäre es der einzige Song, den sie kennen.«
Während Brad seinen Countdown fortsetzt, denkt Elizabeth, dass er für einen, der behauptet, Musik zu lieben, offenbar sehr vieles daran zu hassen scheint. Die Sängerin singt noch immer von dem unersättlichen Mann, der kein Glück mehr empfinden kann, und Elizabeth hört zu und kichert, worauf Brad seine umständlichen Ausführungen unterbricht, sie irritiert ansieht – er lässt sich nicht gern bekichern – und fragt: »Was ist so komisch?«
»Dieser Song«, sagt sie. »Er ist über dich.«
»Tatsächlich?« Er ist jetzt echt interessiert und hört endlich zu, während die Frau in ihrem Sprechgesang fortfährt:
You’re like a vine that keeps climbing higher
But all the money in the world is not enough
Brad ist völlig verwirrt, aber das ist Elizabeth egal. Es ist, als wäre dieser Song nur für sie geschrieben worden, ein Song über die Gier, der zu entkommen sie sich zur Lebensaufgabe gemacht hat.
Dann geht die Tür auf, und mit der kalten Luft kommen drei Typen herein, die so exzentrisch gekleidet sind, dass sie nur die Hauptband sein können. Den Sänger erkennt sie sofort an der dicken Plastiksonnenbrille und dem hellblauen, mit Rüschen besetzten Smokinghemd aus den Siebzigerjahren – auffallend uncool und daher natürlich echt cool –, dessen obere vier Knöpfe mit Bedacht geöffnet sind. Die drei treten so großspurig auf, dass die Menge sich unwillkürlich teilt.
»Das sind sie!«, sagt Brad. »Das sind sie!«
Auf der Bühne bringt die Sängerin ihren Song zu Ende, zuckt die Schultern, als wollte sie sich entschuldigen, und sagt: »Das war’s dann wohl.« Ein paar Leute klatschen. Elizabeth sieht, dass die Frau ihre Gitarre einpackt und mit Jack – der sie die ganze Zeit fotografiert hat – zum Hinterausgang geht. Jack, die Sängerin und ihre kleine Entourage gehen irgendwohin, wo sie eine wunderbare Party erwartet.
Ihr Blick folgt Jack, während Brad nicht aufhört, ihr zu erklären, was für ein Glück sie hat, heute Abend hier zu sein und diese neue Band zum ersten Mal zu erleben, mit ihm, und sie nickt, starrt aber weiter auf den Fotografen mit dem Kindergesicht, und genau in dem Moment, als Jack an der Hauptband vorbeigeht, wandert sein Blick zu den Musikern und an ihnen vorbei zu einem Tisch ganz hinten, an dem ein paar nichtssagende Gestalten sitzen, und dann, auf einmal, sieht er Elizabeth in die Augen. Sie sieht, dass er sie sieht, jetzt ohne Schal und Mütze, und beide spüren den Schauer des Erkennens. Er lächelt und winkt, und sie lächelt und winkt zurück. Brad sieht sie entgeistert an, und die Erleichterung, die sie spürt, lässt sie beinahe in die Knie gehen.
Und was tut Jack? Er geht an der Band vorbei, direkt zu Elizabeth, er ignoriert die genialen Musiker und den jetzt ernsthaft irritierten Brad, er streckt die Hand aus und sagt die ersten Worte, die er jemals zu ihr spricht:
»Kommst du?«
Kommst du?
Was für eine eigenartige, herrliche Frage.
Kommst du?