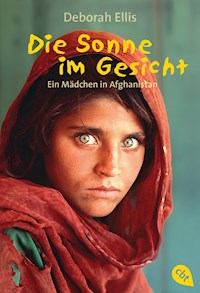8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eine gefährliche Liebe ...
Die 15-jährige Farrin hat eine Menge Geheimnisse. Denn obwohl sie auf eine Schule für Hochbegabte geht und aus einer angesehenen und wohlhabenden Familie stammt, ist es nach der islamischen Revolution besser, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Zumal ihre Mutter eine Schah-Anhängerin war und ist. Aber dann begegnet sie Sadira und alles ändert sich mit der Freundschaft zu dem klugen, witzigen und beherzten Mädchen. Als aus ihrer Freundschaft allerdings mehr wird, wissen beide, dass sie einen gefährlichen Weg einschlagen: Homosexualität steht im Iran unter Todesstrafe. Doch ihre Beziehung wird publik und beide werden inhaftiert. Getrennt von Sadira kann Farrin nur hoffen, dass ihre Familie einen Weg findet, sie vor der Hinrichtung zu retten – sie beide.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Ähnliche
Aus dem Englischen von Edith Beleites
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Kinder- und Jugendbuchverlagin der Verlagsgruppe Random House
1. Auflage 2015© 2014 Deborah Ellis originally published by Pajama Press, Toronto, Canada.Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Moon at Nine« bei Pajama Press Inc.© 2015 für die deutschsprachige Ausgabe: cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenAlle deutschsprachigen Rechte vorbehaltenÜbersetzung: Edith BeleitesCovergestaltung: Kathrin SchülerCovermotiv: © Shutterstock (Vlad Teodor, Meggi)kg ∙ Herstellung: CFSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-15498-1V002
www.cbj-verlag.de
Für alle, die vernichtet wurden, weil sie geliebt haben,
und alle, die noch lieben
und der Unterdrückung tanzend und lachend entgegentreten.
Dieser Roman basiert auf einer wahren Geschichte.
Ich deute die Zeichen der Zeit und bewahre mein Geheimnis.
HAFIS
EINS
1988
GEISTERJÄGER IN DER WÜSTE
Alte Geister durchstreifen ein altes Land.
Sie hausen in Tälern und lauern auf Bergen. Sie verstecken sich im Wüstensand und schlafen neben Skorpionen.
Sie beobachten das alltägliche Treiben der Menschen – wie sie auf Märkten einkaufen, dem Ruf zum Gebet folgen, ihre Kinder erziehen. Die Menschen sind zu beschäftigt, um die Geister zu bemerken.
Ungehindert treiben die Geister ihr Unwesen – ein Zugunglück hier, ein krankes Kind dort – und die Menschen geben sich selbst die Schuld, schlagen sich an die Brust und beklagen ihre Unzulänglichkeit und Schwäche vor Gott.
Die Geister lachen sie aus.
So vergehen Jahrhunderte, Jahrtausende.
Bis ein Mensch endlich aufwacht, die Augen öffnet und den Kampf gegen sie aufnimmt.
»Du schreibst über Geister?«
Die Stimme der Schulleiterin, Frau Kobra, war streng und humorlos.
Farrin schaute von ihrem Heft auf, das auf dem Schreibtisch der Kobra lag, sah sie an und fragte sich, wie viel Ärger sie jetzt bekommen würde.
»Eigentlich sollte sie ihre Chemieaufgaben machen«, sagte die dritte Person, die im Schulbüro anwesend war. Pargol, die Aufseherin von Farrins Jahrgang, war eine der einflussreichsten Schülerinnen und eine entsetzliche Zecke.
»Damit war ich schon fertig«, sagte Farrin. »Mit dieser Geschichte habe ich erst angefangen, als ich meine Aufgaben erledigt hatte.«
»Dann weißt du also alles, was man über Chemie wissen sollte«, sagte die Kobra. »Was für ein Glück, eine so brillante Schülerin unter unserem Dach zu haben! Sicher kannst du mir die Formel für Tetrachlorkohlenstoff nennen.«
Farrin kannte die Formel und nannte sie, ohne erst nachdenken zu müssen. Aber die Kobra stellte ihr gleich die nächste Aufgabe und dann noch eine und noch eine. Als Farrin unsicher wurde, antwortete Pargol an ihrer Stelle. Am liebsten hätte Farrin ihr das überlegene Grinsen aus dem Gesicht geschlagen.
»Nimm Haltung an!«
Die Aufforderung irritierte Farrin und sie reagierte nicht sofort.
»Stell dich gerade hin!«
Farrin stand schon so gerade wie menschenmöglich, aber sie hob das Kinn noch ein wenig höher und machte eine leichte Bewegung, damit es so aussah, als täte sie, was von ihr verlangt wurde. Ihr Blick fiel jetzt nicht mehr auf die Schulleiterin, sondern auf das Staatsoberhaupt Ajatollah Chomeini. Ein großes Porträt des iranischen Führers hing über dem Schreibtisch an der Wand, genau wie in jedem anderen Schulraum.
Aber die Kobra war noch lange nicht fertig.
»Glaubst du, wir hätten Revolution gemacht und den Schah aus dem Land gejagt, damit du hier wie ein Fragezeichen herumlümmelst?«
»Nein, Frau Direktorin.«
»Viele Iraner sind letzte Nacht bei den Bombenangriffen ums Leben gekommen, und heute Nacht sterben wahrscheinlich noch einmal genauso viele, aber du stehst da wie ein Fragezeichen. Das ist unerhört!«
»Es tut mir leid, Frau Direktorin.«
»Du glaubst wohl, du wüsstest mehr als deine Lehrerinnen«, sagte die Kobra. »Deine Chemielehrerin hat einen Masterabschluss, aber du weißt es ja besser als sie. Wahrscheinlich fühlst du dich auch deiner Aufseherin überlegen. Pargols Familie hat im Krieg gegen den Irak drei Söhne geopfert. Sie ist die beste Schülerin deines Jahrgangs, während du gerade mal Platz fünfzehn belegst. Aber du weißt ja alles besser.«
An der Schule kursierte das Gerücht, in ihrer Freizeit führe die Schulleiterin Verhöre im Evin Gefängnis durch, nur zu ihrem Vergnügen.
»Nein, Frau Direktorin.«
Die Kobra nahm Farrins Heft von ihrem Schreibtisch und hielt es hoch.
»Du schreibst über Geister«, wiederholte sie. »Geister in der Wüste.« Sie blätterte in dem Heft, las hier und da einen Satz oder betrachtete eine Zeichnung. Farrin hielt den Atem an, denn sie hatte auch die Schulleiterin gezeichnet.
»Handelt es sich um iranische Geister?«
»Ja, Frau Direktorin.«
»Damit verfestigst du Vorurteile und Klischees«, sagte die Kobra. »Der Iran besteht nur zu dreißig Prozent aus Wüste. Der Rest sind Berge und Marschland, Seen und fruchtbare Ebenen, nicht zu vergessen die großen Städte.«
»Ja, Frau Direktorin. Das alles soll auch noch in meiner Geschichte vorkommen«, sagte Farrin. »Nach dem Vorbild unseres Nationalepos’ Schahname, wo der Held den Drachen besiegt.«
Natürlich war das eine Lüge. Das wahre Vorbild für Farrins Geschichte waren die unscharfen Videos einer amerikanischen Fernsehserie, The Night Stalker, die der »Mann mit der Aktentasche«, wie Farrin ihn nannte, in ihr Haus eingeschleust hatte. Aber das durfte sie nicht verraten.
»Du willst schreiben wie Ferdowsi?«, fragte die Kobra. Die Bewunderung für den alten persischen Dichter war ihr anzumerken. »Sehr löblich.«
»Vielen Dank, Frau Direktorin.« Farrin sah zu Pargol hinüber, die von dieser positiven Wendung sichtlich irritiert war.
»Für wen stehen die Geister, die es zu bekämpfen gilt?«, fragte die Kobra.
Farrin sah das schadenfrohe Grinsen in Pargols Gesicht zurückkehren und hatte auf diese Frage keine Antwort, was bedeutete: Diese Frage war gefährlich. Im Iran musste man auf alles eine Antwort parat haben, und es war ratsam, wenn diese Antwort der Wahrheit entsprach. Zumindest sollte sie plausibel klingen und sie durfte nicht im Widerspruch zur offiziellen Politik stehen.
Wer also waren die Geister? Für Farrin waren es einfach nur Geister, wie man sie sich eben vorstellte, ganz gewöhnliche Kreaturen aus der Unterwelt, die es schon immer gab – Djinns und Ghule, Gestaltwandler und Blutsauger. Die Idee zu diesen Geschichten war ihr gekommen, als sie eine Folge von Night Stalker gesehen hatte, in der Geister aus dem Mittleren Osten vorkamen, und diese Geschichte hatte vorne und hinten nicht gestimmt. Aber das wäre keine akzeptable Antwort gewesen.
»Für wen die Geister stehen?«, wiederholte Farrin die Frage, um Zeit zu gewinnen.
»Genau. Ist die Frage so schwer zu verstehen?«, fragte die Kobra. »Du bist doch ein kluges Mädchen und solltest ihr gewachsen sein, schließlich bist du fünfzehn und keine fünf mehr. Aus dem Alter, in dem man an Feen und Elfen glaubt, bist du doch sicherlich längst heraus. Ich weiß, dass ihr euch im Literaturunterricht mit Allegorien beschäftigt habt. Deswegen wiederhole ich meine Frage und erwarte eine zügige Antwort. Andernfalls drängt sich der Verdacht auf, dass du etwas zu verbergen hast. Also: Für wen stehen die Geister?«
Farrin hatte von ihren Eltern eingeschärft bekommen, niemals etwas Anstößiges zu tun oder zu sagen. »Wir stehen sowieso unter Beobachtung«, pflegte ihre Mutter zu sagen. »Weil wir den Schah wieder an die Macht bringen wollen. Das ist wichtiger als alles andere. Also benimm dich! Ein Fehler genügt, um die ganze Familie auffliegen zu lassen.«
Plötzlich hatte Farrin eine Idee und grinste. »Die Geister stehen für die antirevolutionären Kräfte, Frau Direktorin.«
Die Kobra stand auf, kam um den Schreibtisch herum und baute sich direkt vor Farrin auf.
»Entschuldige dich bei deiner Klassenaufseherin, dass sie gezwungen war, Meldung zu machen.«
Farrin drehte sich zu Pargol um und sagte so ernsthaft wie möglich: »Es tut mir leid.«
»Und?«, fragte die Kobra.
»Und danke, dass du mir hilfst, eine bessere Schülerin zu werden.« Farrin wusste, was die Kobra von ihr erwartete. Um die Zecke würde sie sich später kümmern.
»Ich nehme an, du möchtest das hier wiederhaben.« Die Schulleiterin nahm das Heft vom Schreibtisch. »Ich brauche dich ja wohl nicht daran zu erinnern, dass wir eine Begabtenschule sind. Wir haben dich hier aufgenommen, aber wir können dir genauso gut einen Verweis erteilen. Geistergeschichten während des Unterrichts zu schreiben, ist eine Beleidigung deiner Chemielehrerin. Wenn du dich nicht aufs Lernen konzentrierst, nimmt ein anderes Mädchen deinen Platz mit Freuden ein.«
Die Kobra hielt Farrin das Heft hin, ließ es aber nicht los.
»Du bist ein kluges Mädchen, Farrin«, wiederholte sie beinahe beschwörend. »Und du hast einen starken Willen. Das sind gute Eigenschaften. Alle iranischen Frauen sollten sie besitzen. Sie geben einem Selbstvertrauen. Aber pass auf, dass dein Selbstvertrauen nicht in Selbstüberschätzung umschlägt!«
Sie gab Farrin das Heft und bedeutete ihr mit einer Kopfbewegung zu gehen.
Farrin nahm das Heft und eilte zur Tür, so schnell sie konnte. Sie wusste, dass es kein würdevoller Abgang war, aber das war ihr in diesem Moment egal. Sie wollte nur weg.
ZWEI
Auf dem Weg zum Umkleideraum plante Farrin ihre Rache.
Sie war es leid, dass die Klassenaufseherin ihre Nase in alles und jedes steckte. Ohne Pargol und ihre Spitzel könnte die Schule so viel Spaß machen. Im Fach Revolutionskunde konnte Farrin die erwünschten Antworten auswendig herunterschnurren, und die meisten anderen Fächer wurden von Lehrerinnen unterrichtet, die ihren Beruf liebten und ihre Schülerinnen mit pädagogischem Engagement zu guten Leistungen befähigten. Farrin hatte zwar keine Freundinnen an der Schule, aber die meisten Mädchen fand sie ganz in Ordnung. Hätte sie sich mit nur einer oder zwei von ihnen anfreunden können, wäre sie rundum zufrieden gewesen, obwohl ihre Mutter behauptete, dass sie zur falschen Gesellschaftsschicht gehörten.
»Wenn du Freundinnen haben möchtest, besorge ich dir welche«, war ein Standardspruch ihrer Mutter. »Hauptsache, du lässt dich nicht mit irgendwelchen Gestalten aus der Unterschicht ein. Als ich in deinem Alter war, besaß deine Schule noch einen Elitestatus, aber heute …«
Dann folgte eine Tirade über die guten alten Zeiten. Farrins Mutter hatte diese Schule besucht, als wohlhabende Familien ihre Töchter dort hinschickten – weniger um etwas zu lernen, sondern um den letzten gesellschaftlichen Schliff zu bekommen. Seit der Revolution jedoch besuchten begabte Mädchen aus allen Gesellschaftsschichten Teherans diese Schule. Das einzige Aufnahmekriterium war ein Leistungstest und der Unterricht war kostenlos.
»Es ist einfach nicht mehr dasselbe«, jammerte Farrins Mutter und weigerte sich, am Schuljahresende den Festakt zu besuchen, bei dem die besten Schülerinnen ausgezeichnet wurden, und das sogar dann, wenn Farrin zu den Preisträgerinnen gehörte. »Was hat es schon zu bedeuten, aus einem Mob von Slumbewohnern hervorzustechen?«, lautete ein anderer Standardspruch ihrer Mutter. »Lerne, was gefordert wird, damit du nicht unangenehm auffällst, aber versuche bloß nicht, durch besondere Leistungen zu glänzen! Schließlich wollen wir keine Aufmerksamkeit erregen, dafür steht zu viel auf dem Spiel.«
Es war ein regelrechter Balanceakt. Einerseits musste Farrin gut genug sein, um den Anforderungen der Schule zu genügen, denn ein Schulwechsel hätte einen akademischen Abstieg bedeutet. Andererseits durfte sie nicht so gut sein, dass sie auffiel. Deswegen stand unter ihren Tests und Klassenarbeiten oft: Das kannst du besser.
Doch in einem Leben, das ohnehin eine einzige Lüge war, spielte das schon keine Rolle mehr.
Sie war gerade mal fünf gewesen, als der Schah von Leuten entmachtet wurde, die ihre Mutter als einen »Mob von Slumbewohnern« bezeichnete. Danach war alles anders geworden. Frauen mussten Kopfbedeckungen tragen, aus denen kein einziges Haar herauslugen durfte, wenn sie nicht mitten auf der Straße von Revolutionsgarden angehalten und schikaniert werden wollten. Es gab sogar Gardistinnen, die extra auf Patrouille durch die Stadt geschickt wurden, um nach Frauen Ausschau zu halten, die gegen die neuen Kleidungsvorschriften verstießen.
»Was für ein Blödsinn!«, sagte Farrins Mutter verächtlich, wenn sie wieder mal wegen ihrer Kleidung zur Rede gestellt worden war. »Das ganze Land geht vor die Hunde, und das Einzige, worüber die Ajatollahs sich Sorgen machen, sind Haare!« Bemerkungen wie diese musste sie im Flüsterton machen, weil überall Spitzel sein konnten, genau wie an Farrins Schule. Deswegen wuchs Farrin mit zwei Gesichtern auf – einem öffentlichen und einem privaten.
Die Geistergeschichte, die sie gerade angefangen hatte, war der Versuch, all das zu vergessen. Sie hatte nichts mit Politik, dem Schah, der Revolution oder Religion zu tun. Es sollte nur eine Abenteuergeschichte sein, in der ein junges Mädchen böse Geister bekämpfte.
Sie stürmte durch die Flure, in denen endlose Spruchbänder mit revolutionären Parolen an den Wänden hingen, und achtete nicht auf jüngere Schülerinnen in weißen Tschadors, die ihr erschrocken Platz machten. Das Heft umklammerte sie so fest, dass die Spiralbindung ein Muster in ihre Handfläche drückte.
Es hätte so eine schöne Geschichte werden können, vielleicht gut genug für eine Buchveröffentlichung, und das Buch wäre vielleicht so erfolgreich gewesen, dass man es verfilmt hätte, und dann wäre der Film vielleicht um die Welt gegangen und hätte überall bekannt gemacht, dass es im Iran starke, kluge, fantasievolle Mädchen gab. Womöglich wäre dann sogar ein Filmproduzent auf sie zugekommen, um zu fragen, ob sie nicht noch einen Film machen wolle, in England oder Amerika …
Doch aus der Traum! Nur wegen Pargol, dieser Zecke. Dafür würde sie büßen!
Farrin betrat den Umkleideraum. An den Kleiderhaken hing ein schwarzer Tschador neben dem anderen.
Als Schuluniform diente eine schwarze Tunika, zu der die älteren Mädchen ein graues, die jüngeren ein weißes Kopftuch trugen. Außerhalb der Schule trugen die meisten Schülerinnen lange dunkelgraue Stoffmäntel, aber Mädchen aus sehr konservativen Familien, zu denen auch die Klassenaufseherinnen gehörten, trugen voluminöse schwarze Tschadors.
Farrin trug selbstverständlich einen Stoffmantel, denn für ihre Mutter war der Tschador ein Symbol der Revolution und somit ein Schah-feindliches Statement.
Unter dem Kleiderhaken, an dem ihr grauer Mantel hing, ließ sie sich auf die Bank fallen. Jede Schülerin hatte ihren eigenen Kleiderhaken, und das Stück Bank darunter gehörte ihr, genau wie eine Kiste mit Schuhen und Sportkleidung, die unter der Bank stand. Frustriert und wütend warf sie ihr Heft auf den Fußboden.
Die ganze Arbeit! Ihr großer Traum! Sie kam sich so dumm vor wie das von der Kobra zitierte kleine Mädchen, das noch an Feen und Elfen glaubte.
Sie starrte auf das Heft, das auf einem Dreckhäufchen gelandet war. Die Schülerinnen, die diese Woche für die Reinigung des Umkleideraums zuständig waren, nahmen ihre Aufgabe offenbar nicht ernst. Überall lag Müll herum.
Müll, dachte Farrin. Meine Geistergeschichte ist auch bloß Müll.
Ihr Blick fiel auf ein Stück Kreide, das aus dem Dreckhaufen ragte wie ein Pilz aus dem Waldboden. Auch das war jetzt nur noch Müll. Dabei achteten die Lehrerinnen sorgfältig darauf, dass nichts verschwendet wurde, weil es nie genug Arbeitsmaterial gab. Dass ein Stück Kreide im Dreck landete, war sehr ungewöhnlich.
Farrin schaute sich um. Die anderen Schülerinnen nahmen um diese Zeit an einer der Pflichtveranstaltungen teil, die nach dem regulären Unterricht der Persönlichkeitsbildung dienen sollten. Deswegen war sie ganz allein im Umkleideraum. Schnell bückte sie sich und hob die Kreide auf. Die dicht an dicht hängenden schwarzen Tschadors erinnerten an eine Schultafel.
Sie stand auf, suchte Pargols Tschador und griff mit zitternden Händen danach, denn sie wusste, dass sie im Begriff war, etwas streng Verbotenes zu tun. Sie breitete den Tschador aus und malte einen Fleck auf den Rücken. Krass hob sich die weiße Kreide von dem schwarzen Stoff ab.
Dann überlegte sie. Was sollte sie schreiben? Sie wollte ja nicht, dass Pargol gleich verhaftet würde. Es genügte, wenn sie von Revolutionsgardistinnen auf der Straße angehalten und zurechtgewiesen würde.
Aber ihr fiel nichts ein. Aus Angst, jemand könnte in den Umkleideraum kommen und sie erwischen, malte sie schnell einen großen Kreis, machte zwei Punkte als Augen und einen Halbkreis als grinsenden Mund. Dann steckte sie die Kreide in die Tasche und setzte sich wieder unter ihren Kleiderhaken. Sie blickte sich um und öffnete ihre Kiste unter der Bank, als eine Gruppe plappernder junger Schülerinnen hereinkam.
Sie richtete sich wieder auf und lehnte sich an die Wand. Junge Schülerinnen sahen immer so unbekümmert und glücklich aus. Hatten sie wirklich keine Probleme? Schleppte keine außer ihr die Geheimnisse ihrer Eltern mit sich herum? War sie vor ein paar Jahren selbst noch so naiv gewesen? Sie beneidete die Mädchen um ihren ungezwungenen Umgang – das Plappern und Scherzen, das Gekicher und Gerangel. Wie ein Nest junger Mäuse.
Keine Sorgen, dachte Farrin. Sie schleppen bestimmt keine Sorgen mit sich herum.
Wieder ging die Tür auf und eine Nachzüglerin kam herein. Solange die Tür offen war, mischte sich ein anderes Geräusch unter die Kakophonie der Mädchenstimmen. Farrin horchte auf. So etwas hatte sie an dieser Schule noch nie gehört, und es kam so überraschend, dass sie es nicht gleich identifizieren konnte.
Doch dann wusste sie, was es war: Musik.
Musik an sich war im Iran nicht verboten, Revolutionslieder wurden sogar gefördert. Aber jede andere Art von Musik war nicht erlaubt, seit Farrin denken konnte.
Als die Tür wieder zuging, war nichts mehr zu hören. Aber als die ersten Schülerinnen mit Umziehen fertig waren, ihre Rucksäcke nahmen und den Umkleideraum verließen, um nach Hause zu gehen, ertönte die Musik erneut. Im allgemeinen Getöse ging sie jedoch unter, sodass Farrin sich anstrengen musste, um überhaupt etwas davon mitzubekommen.
»Seid alle mal still!«, rief sie.
Erschrocken verstummten die anderen, bis ein Mädchen, klein wie eine Maus, sagte: »Ach, das war bloß Farrin. Die hat doch nichts zu sagen.« Dann sprach die Maus Farrin direkt an. »Du bist keine Aufseherin. Wir müssen nicht tun, was du willst.«
»Ihr habt doch keine Ahnung von gar nichts«, schoss Farrin zurück. »Haltet einfach mal die Klappe! Ich will wissen, was das für ein Geräusch ist.«
Einen kurzen Moment lang blieb es still und Farrin konnte die Musik wieder hören.
»Das nennt man Musik«, sagte die Maus spöttisch, und Farrin verließ den Umkleideraum unter allgemeinem Gelächter.
Sie folgte dem Klang ein kleines Stück den Flur hinunter und dann um eine Ecke, wo die Tür eines Materialraums einen Spaltbreit offen stand. Von dort kam die Musik.
Sie wollte die Tür weiter öffnen, um zu sehen, wer da etwas Verbotenes tat, doch dann zögerte sie, denn sie wollte die Musik nicht unterbrechen, sondern ihr weiter lauschen.
Es war eine traditionelle Melodie, die auf einem Santur gespielt wurde, einem iranischen Saiteninstrument. Farrin kannte sie von einer Schallplatte, die ihre Eltern manchmal heimlich auflegten – eins von vielen Verboten, die sie missachteten.
Was sie jetzt hörte, war so perfekt, dass sie sich fragte, ob es eine Aufnahme war. Sie wollte es genau wissen, zog die Tür ein Stück weiter auf und blinzelte in den Raum.
Eine Schülerin spielte das Instrument, und nach der Farbe ihres Kopftuchs zu urteilen, musste sie in Farrins Jahrgang sein, aber Farrin konnte nicht erkennen, wer es war. Das Licht der nackten Glühbirne an der Decke fiel hinter die Schülerin, sodass ihr Gesicht im Schatten lag. Falls sie bemerkte, dass sie beobachtet wurde, ließ sie sich nichts anmerken, sondern spielte flüssig weiter.
Wie gebannt sah Farrin zu ihr und lauschte der zauberhaften Musik. Alles um sie herum hörte auf zu existieren, sogar Pargol wurde unwichtig, während die Töne wie pures Mondlicht schimmerten, in dem sie selbstvergessen badete.
Sie schloss die Augen und gab sich ganz diesen wunderbaren Santurklängen hin, bis sie verstummten und Farrin plötzlich wieder bewusst wurde, dass sie im Schulflur stand.
»Suchst du was?«
Farrin öffnete die Augen. Die Musikerin sah auf, und Farrin war wie vom Blitz getroffen, als sich ein Paar ungeheuer grüner Augen auf sie richtete. Einen Moment lang vergaß sie sogar zu atmen.
»Ja, ich brauche … Nein, ich meine … Du kannst doch keine Musik machen!«
»Ich weiß. Ich bin noch nicht gut«, sagte die Musikerin.
»Nein, nein! Du spielst großartig, aber du kannst doch nicht … Ich meine, es ist verboten. Bestimmt kriegst du Ärger.«
»Wäre es wirklich verboten, besäße die Schule keinen Santur«, sagte das Mädchen. »Ich halte das Musikverbot eher für eine Richtlinie als ein richtiges Gesetz. Jedenfalls habe ich beschlossen, es so zu verstehen.« Sie spielte noch ein kurzes Stück, dann legte sie die Holzschlägel weg, mit denen die Saiten angeschlagen wurden, bedeckte den Santur mit einem Tuch und legte ihn in ein Regal. »Ich bin hier nur zufällig reingeraten, weil ich dachte, es sei ein Klassenzimmer. Aber als ich dann den Santur sah, konnte ich nicht widerstehen.«
»Ich werde es keinem verraten«, versprach Farrin.
»Danke.« Das Mädchen strahlte sie an. »Aber ich will dir kein Geheimnis aufhalsen. Spielst du auch?«
»Den Santur?« Es war eine dieser Fragen, auf die es keine guten Antworten gab. Wenn sie verriet, dass sie Klavier spielte – wenn auch nicht annähernd so gut wie dieses Mädchen Santur –, würde sie ein eigenes Vergehen zugeben. Und sie konnte ja nicht wissen, ob die Santurspielerin eine Petze war. Deswegen verzichtete sie auf eine Antwort und sagte nur: »Du dachtest, der Materialraum sei ein Klassenzimmer? Es ist doch nur ein Kabuff.«
»Heute ist mein erster Tag hier«, sagte das Mädchen. »Ich heiße übrigens Sadira.«
Sadira. Farrin wiederholte den Namen still für sich. Wie schön das klang!
Sadira sah sie amüsiert an und schien auf etwas zu warten, aber Farrin wusste nicht, was.
Plötzlich ertönte lautes Geschrei aus dem Flur.
»Was ist da los?«, fragte Sadira, öffnete die Tür ein Stück weiter und stellte sich neben Farrin. Sie roch nach Jasmin.
»Das ist Pargol, eine Aufseherin. Sie schreit die jüngeren Schülerinnen an«, erklärte Farrin. Wahrscheinlich hatte Pargol die Kreidezeichnung auf ihrem Tschador entdeckt.
»Warum denn?«, fragte Sadira. »So etwas tut man doch nicht!« Sie ließ Farrin an der Tür stehen und ging auf das Geschrei zu. Farrin folgte ihr, um sie vor Ärger zu bewahren.
»Pargol schreit andauernd herum. Das musst du nicht so ernst nehmen.«
Sadira sagte nichts. Mit großen Schritten ging sie auf den Umkleideraum zu, dicht gefolgt von Farrin.
Pargol hielt ihren bekritzelten Tschador hoch und schrie die jungen Schülerinnen so heftig an, dass einige schon weinten.
»Ich schicke euch alle zur Schulleiterin, wenn ihr nicht sagt, wer das getan hat«, schrie Pargol. »Meint ihr etwa, ihr könnt euch über mich lustig machen? Wer war das?«
»Ach, ist das dein Tschador?«, fragte Sadira und ging gelassen auf Pargol zu. »Dann habe ich mich wohl geirrt. Ich dachte, ich hätte meinen eigenen Tschador angemalt.«
»Wer bist du?«, knurrte Pargol.
»Verzeihung«, sagte Sadira und nahm Pargol den Tschador aus der Hand. »Ich mache das schnell sauber. Es dauert nicht lange.«
Sie trug den Tschador zum Waschbecken und wischte die Kreide mit einem feuchten Tuch ab.
»Und damit, meinst du, sei die Sache erledigt?«, fragte Pargol aggressiv. »Du kannst doch nicht einfach machen, was du willst! Schließlich bin ich die Aufseherin.«
»Ich heiße Sadira«, sagte Sadira und gab Pargol den sauberen Tschador zurück.
Pargol sah sie düster an. »Du kommst mit zur Schulleiterin!«
»Frau Kobra?«, fragte Sadira gelassen. »Mit der habe ich heute Morgen schon gesprochen. Eine nette Frau.«
»Wenn sie hört, was du getan hast, ist sie bestimmt nicht mehr so nett.«
»Was habe ich denn getan?«
»Du hast meinen Tschador beschmiert.«
»Ach ja?« Sadira warf Farrin einen vielsagenden Blick zu.
»Ich habe keine Schmiererei gesehen«, sagte Farrin schnell.
»Halt den Mund!«, fuhr Pargol sie an.
»Wir haben auch nichts gesehen«, sagten einige jüngere Schülerinnen.
Pargol begriff, dass sie auf verlorenem Posten stand, aber so schnell wollte sie sich nicht geschlagen geben. »Bist du etwa mit der da befreundet?«, fragte sie Sadira und machte eine Kopfbewegung in Farrins Richtung.
Sadira lächelte sie an und sagte: »Man kann gar nicht genug Freunde haben, findest du nicht?«
»Gut, du hast dich entschieden«, sagte Pargol. »Aber lass dir gesagt sein: Hier bestimme ich. Willkommen in meiner Welt!«
»Danke. Hier gefällt es mir ausgesprochen gut.«
»Das wird sich ändern«, sagte Pargol. Dann befahl sie den jüngeren Schülerinnen, ihr aus dem Weg zu gehen, und stürmte aus dem Umkleideraum.
Farrin zog ihren Stoffmantel an und Sadira ihren Tschador. Zusammen verließen sie das Gebäude.
»Für diese Freundschaft sehe ich schwarz«, sagte Sadira. »Als ich heute Morgen zu Frau Kobra sagte, dass ich hier gute Freundinnen zu finden hoffe, hat sie mir geraten, es als Erstes mit Pargol zu versuchen.«
»Pargol steht bei ihr ganz hoch im Kurs«, sagte Farrin. »Die Kobra hält sie für eine Führungspersönlichkeit, die sich schon bald einen Namen in der Welt machen wird.«
»Was für ein beängstigender Gedanke«, sagte Sadira. »Ich hoffe doch sehr, dass in Zukunft andere die Führung übernehmen. Manchmal kommt es einem allerdings so vor, als hätten überall böse Geister das Sagen.«
Vor Schreck blieb Farrin stehen. »Was sagst du da?«
Sadira lachte, nahm Farrins Arm und zog sie an den Rand des Gehwegs, als ein Pulk junger Schülerinnen aus der Schule gestürmt kam.
»Ich habe das nicht wörtlich gemeint«, sagte Sadira. »Obwohl Präsident Reagan auf manchen Fotos wie der Teufel aussieht, der er angeblich sein soll. Ich wollte nur sagen, dass so vieles besser sein könnte, vor allem bei uns. Aber wenn Pargol Jüngere anschreit, nur um sich überlegen zu fühlen, repräsentiert sie für mich das Böse.«
Sadira setzte sich auf eine der Bänke, die hier und da auf dem Schulhof standen. Da Farrin kaum Umgang mit anderen hatte, wusste sie nicht, ob sie darauf warten sollte, dass Sadira ihr einen Platz anbot. Doch dann fand sie es blöd, vor ihr herumzustehen, und setzte sich neben sie. Sadira schien nichts dagegen zu haben.
Aha, dachte Farrin. So macht man das also.
»Darf ich dich was fragen?«, fragte Sadira. »Ich komme mir dabei ein bisschen blöd vor, denn ich liege bestimmt falsch. Aber ich weiß, dass ich die ganze Zeit daran denken muss, wenn ich mir keine Klarheit verschaffe.«
Sie weiß über mich Bescheid, dachte Farrin, und plötzlich wurde ihr ganz kalt. Sie weiß, dass meine Mutter eine Anhängerin des Schahs ist und ich eine Außenseiterin bin.
»Schieß los«, sagte sie aber tapfer und machte sich auf das Schlimmste gefasst.
»Trägt die Kobra immer eine Waffe?«
Farrin musste laut lachen. »Sie hat dir ihre Pistole gezeigt? Eigentlich macht sie das nur, wenn sie jemanden einschüchtern will. Du müsstest die jüngeren Schülerinnen mal heulen sehen, wenn sie in ihr Büro zitiert werden! Aber bis jetzt hat sie noch niemanden erschossen. Jedenfalls keine Schülerin.«
»Sie hat mir die Waffe nicht direkt gezeigt, aber ich hatte den Eindruck, dass sie ein Halfter unter dem Tschador trug. Ich war mir allerdings nicht sicher.«
»Sie ist sehr streng«, sagte Farrin. »Und sie beschränkt sich nicht darauf, Leute anzuschreien, wie Pargol. Sie hat an der Frauenuniversität in Qom studiert und war dabei, als Studenten gleich nach der Revolution die amerikanische Botschaft besetzten. Du solltest ihr lieber aus dem Weg gehen.«