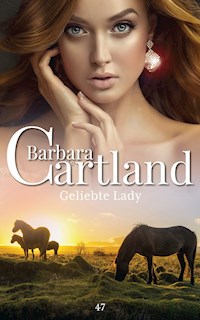Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Barbara Cartland Ebooks Ltd
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die zeitlose Romansammlung von Barbara Cartland
- Sprache: Deutsch
Der gutaussehender Diplomat Ian McCraggan war nach Schottland zurück gekommen um sein Erbe anzutreten, das alte Schloss zu übernehmen und als Clansoberhaupt zu walten. Aber als er an der geliebten Ruine ankommt, muss er feststellen dass er der größten diplomatischen Herausforderung seiner Karriere gegenübersteht. Er muss der Schönheit, die ohne Einladung in seinem Herrensitz wohnt, ein Ultimatum stellen. Wer ist die bezaubernde Moida, die es wagt sein Erbrecht in Frage zu stellen? Als Ian die erstaunliche Wahrheit über sie herausfindet und die merkwürdige Sehnsucht sein Herz in Besitz nimmt ist es zu spät. Er war mit einer charmanten blonden Sirene verlobt ... doch wird sie ihn gehen lassen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
Als er mit dem Wagen um die Ecke bog, erblickte er die Küstenlinie, die sich bis zum grauen Horizont erstreckte.
Der lange Sandstrand hob sich golden gegen das dunkle Blau und Smaragdgrün des schillernden Meeres ab und stand im Gegensatz zur Heide, die sich unter dem wolkenbedeckten Himmel in purpurnem Glanz ausbreitete.
Es war so schön, daß Ian den Atem anhielt.
Er hatte vergessen, wie schön die schottischen Highlands im August sein konnten, wenn das Moorhuhn dicht über die Heide dahinflog.
Fünfzehn Jahre war er nicht mehr hier gewesen, und jetzt empfand er die prickelnde Erregung der Heimkehr. Unbewußt erhöhte er die Geschwindigkeit, um schneller am Ziel zu sein. Fünfzehn Jahre waren eine lange Zeit! Als er die Heimat verlassen hatte, war er fünfzehn gewesen.
Er erinnerte sich, wie er auf dieser Straße in Begleitung seiner Mutter nach Skaig gefahren war. Er glaubte noch ihre hohe schrille Stimme neben sich zu hören; die Mutter hatte ihm auf der Heimfahrt dauernd damit in den Ohren gelegen, daß sie beleidigt worden sei.
Er hatte sich vor seinem Großonkel gefürchtet - Duncan war wirklich ein ungewöhnlich furchteinflößender alter Mann gewesen -, doch er hatte sich durch seine Schroffheit nicht brüskiert gefühlt und konnte die Empörung seiner Mutter nicht teilen. Er bedauerte, daß er Großonkel Duncan nie mehr gesehen hatte. Der alte Mann mit seinem schlohweißen Haar, seiner vogelartigen Nase und seinem kantigen Gesicht, das ihm ein patriarchalisches Aussehen verlieh, hatte ihn immer sehr beeindruckt.
Ian war es schwer gefallen, mit ihm zu reden, und noch schwerer, die knappen, inquisitorischen Fragen des Großonkels zu beantworten; doch gleichzeitig hatte er ihn bewundert.
Großonkel Duncan war der Prototyp des schottischen Gutsherrn, des Oberhaupts eines Clans, der im halbverfallenen Schloß seiner Vorfahren lebte.
Und jetzt gehörte das Schloß ihm.
Zum ersten Mal seit dem Tod seines Großonkels fühlte Ian Verantwortung. Als ihm die Nachricht übermittelt worden war, war er in Malaya. Der Brief war erst drei Wochen später gekommen, doch er konnte nichts daran ändern.
Damals hatte er noch nicht erkannt, von welcher Tragweite der Tod seines Großonkels für ihn persönlich sein würde.
In den letzten Jahren war er so beschäftigt gewesen, daß er seinen Großonkel Duncan, der sich in seiner Hochlandfestung wie ein verlorener Adler in seinem Horst verschanzt hatte, fast vergessen hatte.
Monate später erinnerte ihn ein Brief seiner Mutter an seine Pflichten. Sie schrieb ihm: »Vor ein paar Tagen traf ich bei Harrods Deine Kusine Isabel. Mehr denn je wirkte sie wie ein aufgescheuchtes Huhn, doch sie schwärmte von Dir und sagte, es sei wunderbar, daß Du jetzt Oberhaupt des Clans seist. Das erinnerte mich daran, daß hier ein Brief von Schloß Skaig für Dich liegt. Ich denke, irgendwann mußt Du nach Skaig fahren, um nachzusehen, was Dein Großonkel Dir außer den Ruinen hinterlassen hat.«
Ian hatte damals über den Brief gelächelt. Zwischen den Zeilen konnte er lesen, daß seine Mutter Großonkel Duncan immer noch grollte. Nicht einmal nach dem Tod vergab ihm Beatrice McCraggan. Sie war eine Frau, die keine Beleidigung vergaß. Ihr Leben lang war sie verwöhnt worden. Als Tochter eines Eisenbahnmillionärs hatten ihr die Feen vom Augenblick ihrer Geburt an den roten Teppich ausgerollt und sie mit einem Silberlöffel gefüttert.
Sie war hübsch, intelligent und besaß so viel Geld, daß Ian es schon lange aufgegeben hatte, den Überblick über ihr Vermögen und ihre Grundstücke behalten zu wollen.
Sie wurde auf Schritt und Tritt von einer Eskorte von Sekretärinnen, Rechtsanwälten und sonstigen Faktoten, die sich um sie und ihre Geschäfte kümmerten, begleitet.
Sie war es gewohnt zu befehlen, hielt ihre Privatarmee in Schuß, so daß ihr Sohn sich ungeniert seiner eigenen Karriere widmen konnte.
Wenn Beatrice Ians geheimste Gedanken gekannt hätte, wäre sie damit einverstanden gewesen, denn sie zeugten von gesundem Menschenverstand, den sie in der Theorie empfehlenswert fand, in der Praxis jedoch äußerst unpraktisch.
Seine Vorstellungen hätten sie bestimmt nicht überrascht, denn sie hatte es schon lange aufgegeben, über Ians Ideen oder Taten erstaunt zu sein. Sie hatte darum gekämpft, ihr einziges Kind modern zu erziehen, doch diesen Kampf hatte sie verloren.
Ians Vater, ein ruhiger, ausgeglichener Mann, der in seine hübsche Frau vernarrt war, hatte mit Ausnahme dieses einen Punktes in allem nachgegeben. Er hatte auf einer konventionellen englischen Erziehung für seinen Sohn bestanden, wollte nicht, daß er amerikanisiert werde.
Beatrice hatte gekämpft, doch genauso gut hätte sie gegen eine Sphinx kämpfen können. Aber sie war klug und weiblich genug, um zu erkennen, wann sie sich ins Unvermeidliche fügen mußte.
Mit acht Jahren wurde Ian auf eine College-Vorschule geschickt. Kurz vor seinem vierzehnten Lebensjahr trat er in Eton ein. Seine Mutter reiste ab und zu nach Amerika, doch Ian blieb in England.
Seine Ferien verbrachte er zusammen mit seinem Vater. Sie gingen zum Reiten, Schießen und Fischen. Ian registrierte mehr oder weniger unbewußt, daß der ganze Komfort, den er genoß, und der Sport, den er betrieb, durch amerikanische Dollars finanziert wurden.
Erst als er älter wurde, erkannte er, wie sehr seine Mutter darunter litt, daß er seine Zukunft unabhängig von ihr plante und dann war es schon zu spät für ihre Einflußnahme.
Er wußte, was er wollte, und die Tatsache, daß er viel Geld hinter sich hatte, spielte bei seinen Plänen nur eine untergeordnete Rolle.
Die letzten Kriegsjahre hatten ihm Gelegenheit gegeben, seine Intelligenz und seine Tapferkeit unter Beweis zu stellen. Nach dem Krieg galt er als ein junger Mann mit glänzender Zukunft.
Er reiste rund um die Welt, von Konferenz zu Konferenz, von einem Katastrophengebiet zum anderen. Männer, die weitaus älter und erfahrener waren als er, suchten seinen Rat.
Offiziell arbeitete er fürs Verteidigungsministerium, doch in Mayfair munkelte man, daß er für den Geheimdienst arbeite. Wenn es im Außenministerium eine besonders heikle diplomatische Aufgabe zu erledigen galt, wandte man sich an ihn.
Es war keineswegs erstaunlich, daß sich Ian McCraggan kurz nach seinem dreißigsten Geburtstag plötzlich sehr erschöpft fühlte. Er war in Sonderflugzeugen, Zügen und Schiffen von einem Erdteil zum anderen geeilt.
An einem einzigen Nachmittag hatte er sechs Sprachen gesprochen und abends eine Sitzung mit Dolmetschern absolviert, die ihn jedes Mal in Rage brachten, da sie seine Reden so langsam und schwerfällig vermittelten.
Wenn er nicht in einem Bericht einen fundamentalen und äußerst dummen Fehler gemacht hätte, wäre er nicht auf die Idee gekommen, Urlaub zu beantragen.
Sein Chef machte ihn lachend auf den Fehler aufmerksam, doch Ian konnte seine Heiterkeit nicht teilen.
»Um Himmels willen, Sir! Habe ich das wirklich geschrieben?« fragte er.
»Nehmen Sie es nicht so ernst«, hatte ihm sein Vorgesetzter geantwortet, »es ist doch nichts passiert.«
»Das hätte einen internationalen Konflikt heraufbeschwören können«, sagte Ian.
Sein Chef betrachtete ihn nachdenklich.
»Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal Urlaub gemacht?« fragte er. »Nein, sagen Sie nichts, ich kenne die Antwort. Es wird höchste Zeit, daß Sie Urlaub machen. Ich weiß, da wäre noch der Auftrag in Japan, doch das kann warten. Nehmen Sie einen Monat, oder noch besser zwei, und denken Sie daran, daß Sie noch jung sind. Betrinken Sie sich, heiraten Sie, tun Sie alles, was Ihnen Spaß macht, doch sehen Sie nicht so ernsthaft drein.«
Ian überlegte, daß sein Vorgesetzter wohl etwas getrunken haben mußte; doch als er in seiner Wohnung war und sich in seinem Sessel räkelte, merkte er, daß er tatsächlich sehr müde war.
Seit Wochen, Monaten - oder waren es Jahre? - hatte er keinen freien Augenblick gefunden, um über sich nachzudenken oder sich zu amüsieren.
Er überlegte, wann er das letzte Mal ein Mädchen zum Essen ausgeführt hatte. Als er versuchte, sich zu erinnern, fing er an zu lachen. Er griff nach dem Hörer, um seine Mutter anzurufen. Vor langer Zeit hatten sie beschlossen, in getrennten Wohnungen zu leben, doch in unmittelbarer Nähe voneinander. Beatrice hatte zwei höchst luxuriöse Wohnungen am Grosvenor Square gemietet, im gleichen Gebäude, aber in verschiedenen Stockwerken. Sie konnten sich so oft wie möglich sehen, ohne sich auf die Nerven zu fallen.
In dem Augenblick, als sich Ian mit seiner Mutter unterhielt, klickte es.
Er erzählte ihr, er habe Urlaub genommen, und sie war begeistert.
»Wie schön, Liebling! Du hättest keine bessere Zeit wählen können. Seit dem Krieg ist das die beste Saison.«
»Was für eine Saison?« fragte Ian.
»Sei nicht töricht. Du weißt genau, was ich meine.«
»Du meinst doch nicht etwa die Debütantinnen, Eton, Harrow und Henley?« fragte er voller Entsetzen.
Seine Mutter lachte.
»Komm zum Essen, und ich erzähle dir, was ich meine.«
Ian war zum Essen zu seiner Mutter gegangen und hatte Lynette kennengelernt. Die Abendessen bei seiner Mutter waren immer sehr exquisit, doch das Einzige, woran er sich nach diesem Abend erinnern konnte, war Lynette mit ihren großen blauen Augen und ihrem weichen goldblonden Haar, das ihr reizendes Gesicht einrahmte.
»Ich dachte schon, Sie seien eine Legende«, erzählte sie ihm mit vibrierender Stimme.
»Weshalb?« fragte er.
»Es wurde immer über Sie geredet, doch nie sah man Sie persönlich. Ihre Mutter veranstaltete die entzückendsten Partys, an denen tout le monde teilnahm, nur Sie nicht.«
»Aber jetzt bin ich hier«, widersprach er.
»Ja, das sehe ich.«
Ihre Augen blickten ihn vielversprechend an.
»Lassen Sie uns zum Tanzen gehen«, schlug er Lynette vor, und war über sich selbst erstaunt, da er geglaubt hatte, er sei todmüde.
»Was wird Ihre Mutter sagen?« fragte Lynette.
Das war eine rein rhetorische Frage. Sie wußten beide, daß sie tun und lassen konnten, was sie wollten, und doch war die Vorstellung, daß sie etwas Heimliches taten, erregend.
Für einen Mann, dessen Leben in den letzten fünf Jahren ein langes endloses Abenteuer gewesen war, schien es ein Abenteuer zu sein, in der Dunkelheit des Grosvenor Square ein Taxi zu rufen, das sie zu einem Nightclub fahren würde.
An einem Tisch, der in sanftes rotes Licht getaucht war, streichelte Ian Lynettes Hand.
»Erzählen Sie mir von sich«, bat er sie, spürte aber, daß sich Worte erübrigten.
Lynettes Augen lockten, ihre vollen roten Lippen waren eine stumme Einladung. Er wollte sie ohne weitere Einleitung küssen, ihren weichen Körper im Arm halten.
»Ich habe mir immer gewünscht, Sie kennenzulernen«, sagte Lynette leise.
»Und jetzt ist es so weit ...« Er wartete auf ihre Antwort.
»Ich freue mich, und Sie?«
Er ließ sich mit seiner Antwort Zeit, und sie senkte den Blick.
»Es tut mir leid, daß ich sagen muß, wie froh ich bin.«
»Es tut Ihnen leid?« Sie war überrascht.
»Für den Fall, daß ich zu viel sage und Sie erschrecke oder, noch schlimmer, Sie verärgere.«
Lynette atmete tief durch. »Ich glaube nicht, daß ich ... ärgerlich wäre.«
Die Kapelle spielte eine sanfte Melodie, und er atmete den Duft ihrer Haare ein, zog ihren geschmeidigen Körper an sich.
Es war ein zauberhafter Abend.
Ian fuhr die nördliche Küstenstraße der Grafschaft Sutherland entlang und wünschte sich, Lynette wäre bei ihm. Er verspürte den Wunsch, ihr diesen Teil des Landes zu zeigen, mit all dem Stolz, den ein Mann empfindet, der der Frau, die er liebt, seine Heimat zeigt. Hier waren seine Wurzeln, sein Ursprung. Seltsam, dachte er bei sich, daß er so viele Jahre kaum einen Gedanken auf Schloß Skaig oder seinen Großonkel verwandt und trotzdem das Gefühl hatte heimzukehren.
Wenn Lynette bei ihm gewesen wäre, überlegte er, hätte er ihr die Namen der Berge, deren Spitzen in der Ferne zu erkennen waren und die sich hoch über die Heide erhoben, genannt.
Er fuhr über die graue Steinbrücke, die sich über die Brora spannte; ein paar Meilen weiter würde er das silberne Wasser des Skaig erblicken, der ins Meer mündet.
Auf der Höhe eines breiten Tals erhob sich Schloß Skaig. Es war auf der Seite des Sees erbaut, die ihm die strategische Position verschaffte, den Feind im Visier zu haben.
Hier hatte der McCraggan-Clan, der einst stark und mächtig gewesen war, jahrhundertelang seinen Besitz verteidigt und den Neid und Haß der weniger begüterten Nachbarn erweckt. Im 16. Jahrhundert wurden sie durch schändlichen Verrat besiegt. Heute gab es nur noch eine Handvoll McCraggans. Doch ihre Geschichte war mit der Geschichte Schottlands verknüpft, und Ian dachte voller Wärme an die Stellung, die ihn als Oberhaupt des Clans erwartete. Ja, Lynette hätte bei ihm sein sollen.
Er wäre gerne mit ihr zusammen zum Schloß hochgefahren, um ihr voller Stolz zu erklären: »Das gehört mir, ist durch Tradition und Recht mein Eigentum.« Wie stolz sein Vater auf ihn gewesen wäre, überlegte er. Ian hatte die Privilegien, die ihm das Geld seiner Mutter verschaffte, nie unterschätzt, und doch war er im Innersten so sehr Schotte, daß er stolz war, daß dieses Erbe allein seinem Vater gehört hatte.
Oft hatte er hinter der angeborenen Reserviertheit seines Vaters dessen Gefühl des Unbehagens, ja der Verlegenheit gespürt, weil er vom Geld seiner Frau leben mußte. Er besaß ein bescheidenes eigenes Einkommen, doch wie Beatrice einmal in einer Anwandlung von Zorn gesagt hatte, reichte es nicht einmal aus, seine Zigaretten zu kaufen.
Euan McCraggan hatte sich nie beklagt. Er hatte Beatrice Stevenson aus Liebe geheiratet und es nicht bedauert, doch Ian hatte das demütigende Gefühl der Abhängigkeit, das sein Vater empfand, gekannt und freute sich, daß ihm Skaig und der dazugehörige Besitz als Erbe seines Vaters zugefallen waren.
Seine Mutter hatte entdeckt, daß zu der Schlossherrn Würde noch ein Baronstitel gehörte. Nach Großonkel Duncans Tod hatte sie in den Familienpapieren, die Ians Vater ungeordnet, aber gebündelt in einem Aktenkoffer hinterlassen hatte, gewühlt und daraus erfahren, daß die Seitenlinien seit zwei Jahrhunderten nicht registriert worden waren, daß aber der Barons Titel wieder in Kraft treten konnte, wenn ein berechtigter Anspruch darauf erhoben wurde.
»Lynette würde ein Titel gefallen«, sagte sie zu ihrem Sohn, und Ian konnte sich nicht verkneifen zu sagen: »Und dir auch.«
»Wenn ich nur zu Lebzeiten deines armen Vaters davon erfahren hätte«, seufzte Beatrice. »Doch es hätte nichts genutzt, da dieser Titel deinem Großonkel als Familienoberhaupt zugestanden hätte. Wenn er geheiratet und Kinder gehabt hätte, wärst du als Erbe ausgeschieden.«
»Ich habe es noch nicht angetreten«, sagte Ian. »Und vielleicht gibt es noch alle möglichen Hindernisse, von denen wir nichts wissen.«
»An deinem Erbe ist nicht zu rütteln, denn es ist im Familienstammbaum und in den Familienurkunden eingetragen«, sagte Beatrice energisch. »Ich habe entdeckt, daß wir uns in dieser Sache an das Wappenheroldsamt in Edinburgh wenden müssen. Wir werden es auf unserer Hinreise aufsuchen.«
Wenn sich Beatrice etwas in den Kopf gesetzt hatte, war sie nicht davon abzubringen. Da Ian in Gedanken mit Lynette beschäftigt war, ließ er seine Mutter gewähren.
Gemeinsam waren sie nach Edinburgh gefahren. Dann war Ian allein weitergefahren, um das Schloß für Lynette herzurichten.
»Ich möchte, daß dir Skaig gefällt, Liebling«, hatte er zu ihr gesagt, bevor er weitergefahren war.
»Wenn du es liebst, werde ich es bestimmt auch mögen«, antwortete sie, doch diese Worte kamen ihr zu leicht von den Lippen.
Er wollte es nicht zugeben, auch nicht sich selbst gegenüber, daß er Angst hatte, Lynette könne Schottland nicht gefallen und sie zöge es vor, in London zu leben.
»Ich werde dich dazu bringen, daß du es liebst«, sagte er wild entschlossen.
Lynette blickte ihn überrascht an, doch seine sehnsüchtigen Lippen erstickten jede Erwiderung von ihr.
Sein Kuß war hart und fordernd, die Küsse eines Mannes, der entschlossen war, der Herr zu sein.
»Ian, nicht!« Lynette versuchte, ihn zurückzustoßen, doch er lachte über ihre Anstrengungen.
»Du wirst tun, was ich will«, neckte er sie, und sie gab widerstrebend nach.
Ian hatte die Stelle erreicht, wo er von der Küste abbiegen und das Skaig-Tal hinauffahren mußte. Erst da kam ihm der Gedanke, daß er wohl Schwierigkeiten haben dürfte, ins Schloß zu gelangen.
»Ich kann mir nicht vorstellen, was auf Skaig passiert ist«, hatte ihm seine Mutter erklärt. »Mein letzter Brief an den Verwalter Mr. Scott wurde mit dem Vermerk ,Unbekannt verzogen' zurückgeschickt.«
»Wer ist Mr. Scott? Sollte ich ihn kennen?« erkundigte sich Ian.
»Er hat uns den Tod deines Großonkels mitgeteilt«, erwiderte Beatrice. »Eigentlich schrieb er an dich, doch da du im Osten warst und man im Augenblick deine genaue Adresse nicht kannte, brachte deine Sekretärin ihn mir. Natürlich schickte ich einen Kranz und schrieb Mr. Scott, er solle uns mitteilen, wie die Dinge auf dem Schloß stünden. Ich schrieb ihm, du würdest noch einige Zeit im Ausland sein, und fragte, ob irgendwelche Angestellten bezahlt werden müßten und was er selber noch an Geld bekomme.«
»Bestimmt haben sich doch Großonkel Duncans Anwälte um derlei Dinge gekümmert?« fragte Ian.
»Nein, der Anwalt deines Großonkels war Mr. Scotts Vater, ein fähiger Mann. Nach seinem Tod kümmerte sich sein Sohn um die Verwaltung des Besitzes. Ein anderer Anwalt wurde nicht engagiert.«
»Dann hat also dieser Scott alles in der Hand?«
»Ich fürchte, ja. Das beunruhigt mich auch. Er schrieb mir und bat mich um Geld für die Haushälterin. Ich schickte ihm tausend Pfund und bekam eine Bestätigung, aber keine weitere Information. Nach zwei Monaten schrieb ich erneut, und mein Brief kam mit dem Vermerk ,Unbekannt verzogen' zurück.«
»Wer hat sich in letzter Zeit um das Schloß gekümmert?« wollte Ian wissen.
»Ich weiß es wirklich nicht«, erwiderte seine Mutter. »Ich wartete deine Rückkehr ab, damit du dich selbst darum kümmerst. Schließlich hatte ich andere Dinge zu tun. Du kannst nicht von mir erwarten, daß ich selber dorthin fahre, oder?«
»Natürlich nicht«, erwiderte Ian. Wenn er in England gewesen wäre, hätte er selbstverständlich an der Bestattung seines Großonkels teilgenommen. Nun galt es die Frage zu klären, was in der Zeit zwischen dem Tod des Großonkels im Januar und dem Monat August geschehen war.
Die Straße war kurvenreich und holprig, so daß er seine Geschwindigkeit drosseln mußte.
Er stellte fest, daß der Fluß Hochwasser hatte, was für diese Jahreszeit ungewöhnlich war, und überlegte, ob die Aussichten, einen Lachs zu fangen, gut wären. Er dachte an den Eigensinn seines Großonkels, seinen Fischgrund niemand anderem zu überlassen, auch dann nicht, als er selbst zu alt zum Angeln war.
Duncan McCraggan konnte störrisch wie ein Esel sein. Er hatte geschworen, daß kein verdammter Engländer im Skaig fischen solle, und auch den Schotten, die es sich hätten leisten können, Pacht dafür zu zahlen, war das Fischen hier versagt.
So fischte der Herr über Skaig mit seinen Freunden an seinem eigenen Fluß. In den letzten Monaten hatten die Fischdiebe eine gute Zeit gehabt, überlegte Ian und dachte an die Zeitungsberichte über Fischdiebe in den Highlands und die Fragen, die dem Parlament vorgelegt worden waren.
Heute sah man weit und breit niemanden fischen. Die Straße stieg immer höher an, bis Ian einen ersten Blick auf das Schloß werfen konnte.
Verlassen und verwittert stand es am Rande des Sees. Dahinter erstreckte sich die Heide, und ein kleiner Tannenwald schützte das Schloß vor den Nordwinden.
Von der Straße aus konnte man nur die Ruinen sehen. Ein Teil des Schlosses war Ende des 18. Jahrhunderts wiederaufgebaut worden, doch dieser Teil lag auf der anderen Seite.
Die wenigen verstreut liegenden Häuser, die das Dorf Skaig bildeten, lagen am Fuße eines langen steilen Hangs, der den Zufahrtsweg zum Schloß darstellte. Drei Geschäfte, ein Pfarrhaus, eine Schule, ein paar häßliche graue Häuser und eine pompöse Villa, in der der Arzt lebte, stellten das Dorf dar.
Ian bemerkte auch einige neue Bungalows, die inzwischen gebaut worden waren. Ansonsten war alles unverändert.
Er zögerte einen Augenblick und überlegte, ob er halten solle, um sich zu erkundigen, wer auf dem Schloß wohnte und was mit Mr. Scott geschehen war, beschloß aber dann, es zu unterlassen. Er würde zum Schloß weiterfahren.
Er verspürte das plötzliche Verlangen, es wiederzusehen. Als Schuljunge war es ihm sehr romantisch und prachtvoll erschienen, und er hatte Angst, daß es seinen Zauber verloren haben könnte. Das Wasser des Sees war sehr blau. Im Gegensatz dazu sah das Schloß düster und unheilvoll aus.
Die Eisentore vor dem Zufahrtsweg waren rostig und bedurften dringend der Farbe. Eines der Tore war aus den Angeln gehoben, und der Sockel eines der Torpfosten lag zerschmettert am Boden. Ian fuhr durch die Tore und entdeckte dann etwas, was ihn auf die Bremse treten ließ - ein Schild.
An einem Brett, das mit Draht an den Eisentoren befestigt war, entdeckte er ein Stück weißes Papier, auf dem in roten handgeschriebenen Großbuchstaben zu lesen war: »Schloß Skaig täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt 1 Pfund.«
Ian starrte darauf und las es so sorgfältig, als ob es sich um eine Anweisung des Außenministeriums handelte. Stirnrunzelnd setzte er dann seinen Weg zum Schloß fort.
Als er oben angelangt war und zur Auffahrt vor dem gotischen Tor der Ruinen einbog, entdeckte er drei parkende Autos. Er stellte seinen Wagen auf der anderen Seite ab, stieg aus und hielt Ausschau nach den Fahrzeughaltern.
Die privaten Wohnräume des Schlosses lagen auf der Westseite; doch die drei Wagen waren bei den Ruinen geparkt. Er war davon überzeugt, daß es Besucher waren, die ein Pfund gezahlt hatten, um sein Erbe zu besichtigen.
Er zündete sich eine Zigarette an, als ob er damit Zeit zum Nachdenken gewinnen wollte, und ging auf das Gebäude zu. Im Toreingang entdeckte er einen Tisch und daneben eine zarte Gestalt. Beim Näherkommen stellte er fest, daß der Tisch unter den Torbogen gestellt worden war, um vor dem Wind, der vom See her wehte, geschützt zu sein.
Ian bemerkte, daß es ein Verkaufsstand war. Auf einem weißen Tischtuch lagen fein säuberlich sortiert Salatköpfe, zwei Gurken und ein paar grüne Äpfel, daneben ein Dutzend weiße Heidekrautsträuße. Auf einem weißen Teller lag ein Lachs. Er war in Stücke zerteilt worden, und auf einem Papier konnte man lesen: »Frischer Lachs 2 Pfund das Kilo.«
Während er noch auf den Tisch starrte, hörte er Stimmen, und drei oder vier Frauen erschienen im Toreingang.
»Weißes Heidekraut«, rief eine aus. »Das muß ich unbedingt mitnehmen, damit es Glück bringt.«
»Glaubt ihr, es hilft mir beim Toto?« fragte eine der Damen.
»Alice, sei nicht albern. Ich bringe Mutter etwas Lachs. Sie mag ihn zum Tee.«
»Zwei Pfund«, rief die dritte Frau aus. »Das ist ganz schön gesalzen. Doch ich kaufe ein Stück für Tante Dora. Ich frage mich, ob es billiger kommt, wenn wir zwei Kilo nehmen?« Sie wandte sich an die schmale Gestalt neben dem Stand. Ian erkannte jetzt, daß es ein Junge war - ein kleiner rothaariger Junge mit Sommersprossen, der einen verblichenen Kilt und einen grünen Pullover trug.
»Drei Pfund, wenn Sie zwei Kilo nehmen«, sagte er langsam. »Einen solchen Lachs bekommen Sie in keinem Geschäft. Er wurde heute morgen frisch aus dem Fluß gefischt.«
»Aus diesem Fluß?« erkundigte sich eine der Damen.
»Genau. Er wog drei Kilo.«
»Er sieht gut aus«, gab die Frau zu. »Komm, Gladys, gib deinem Herzen einen Stoß, und ich mach’s dir nach. Junge, du kannst alles einpacken.«
Der kleine Junge holte Zeitungspapier hinter dem Stuhl hervor und wickelte die Lachsstücke geschickt ein. Er zählte das Geld, das ihm die beiden Frauen gaben, sorgfältig nach.
»Stimmt«, sagte er todernst. »Wollen Sie weißes Heidekraut?«
»Ein tüchtiger kleiner Geschäftsmann«, lachte eine der Frauen. »Ja, gib mir etwas.«
Der Junge reichte ihr einen Strauß, nahm ein halbes Pfund entgegen und legte das Geld in eine alte Zigarettendose. Als die Frauen zu ihrem Auto gingen, blickte er zu Ian auf, der ihn beobachtete.
»Wollen Sie ins Schloß?« fragte er.
»Ich muß dafür wohl ein Pfund zahlen?«
»Genau«, erwiderte der Junge. »Sie können das Geld mir geben.«
»Kann mich hier jemand herumführen?«
»Im Schloß ist eine Führerin«, sagte der Junge. »Sie führt gerade zwei Gruppen herum, doch sie wird Sie auch führen.«
»Danke«, sagte Ian. Er zahlte ein Pfund und ging ins Schloß. Es hatte vier Mauern, doch kein Dach.
Es war leicht zu erkennen, wo sich die Stockwerke befunden hatten. In einer Ecke waren die Überreste einer Wendeltreppe, eines Kamins und viele Fenster und Türen, die darauf hindeuteten, daß dies einst ein riesiges Gebäude gewesen war. Am anderen Ende des Unkraut übersäten Bodens entdeckte Ian eine Gruppe Menschen - zwei Männer, die Tweedmäntel trugen und Pfeife rauchten, vier Frauen und Kinder, die alle etwas Süßes im Mund hatten.
Ein Kind ließ einen buntfarbigen Lutscher fallen und brüllte. Seine Mutter hob ihn auf, säuberte ihn mit ihrer behandschuhten Hand und schob ihn dem Kind in den Mund.
Sie lauschten alle dem Mädchen, das sie umringt hatten - das war wohl die Führerin, von der der kleine Junge gesprochen hatte -, und er schlenderte auf die Gruppe zu. Das Mädchen war klein und dunkelhaarig, und ihre Stimme war für eine Frau ungewöhnlich tief und dunkel. Er glaubte, ein perlendes Lachen darin zu entdecken. Trotz seines zunehmenden Ärgers blieb er stehen und lauschte.
»1437 beobachtete Malcolm, das Oberhaupt der McCraggans, von hier aus die Ankunft der Wikinger«, sagte sie. »Sie waren in ihren mit Schnitzereien verzierten und bunt bemalten Holzschiffen über die Nordsee gekommen, um zu plündern, die jüngeren Frauen zu entführen und das, was sie nicht mitnehmen konnten, zu verwüsten. Malcolm McCraggan war entschlossen, ihnen Widerstand zu leisten. Er rief alle Mitglieder seines Clans, die er versammeln konnte, ins Schloß. Sie führten das Vieh herein, verbarrikadierten die Tore und trotzten den Wikingern. Die McCraggans schossen von den Zinnen auf sie, und nach einmonatiger Belagerung, in der die Wikinger das Schloß dreimal in Brand setzten, siegte Malcolm McCraggan, und die Wikinger kehrten in ihr Land zurück, nahmen Vieh und junge Frauen mit, die anderen Clans gehörten, aber nichts, was dem McCraggan-Clan gehörte.«
»Stell dir das heute vor«, sagte einer der Zuhörer.
»Er hätte eine Atombombe gebraucht«, bemerkte einer der Männer in dem Versuch, komisch zu sein.
Alle brachen in Lachen aus.
»Ich glaube, jetzt habe ich Ihnen alles gezeigt«, sagte das dunkelhaarige Mädchen. »Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie erzählen Ihren Freunden davon.«
»Das werden wir«, sagte eine der Besucherinnen und wandte sich um, um zu ihrem Auto zu gehen.
Das Mädchen sah der Gruppe, die sich entfernte, nach. Als sie entdeckte, daß Ian sie beobachtete, trat sie auf ihn zu. Er stellte fest, daß sie hübsch war. Ihr Teint war sehr hell, und sie hatte dunkle, goldgefleckte Augen, hohe Backenknochen und eine stolze Körperhaltung, die auf eine lange Reihe schottischer Ahnen schließen ließ. Ja, sie war hübsch, dachte er bei sich und überlegte, wer zum Teufel sie wohl sein mochte. Sie trug einen Schottenrock, eine weiße Bluse und eine grüne Strickjacke.
Sie war nicht modisch gekleidet, und doch fand er, daß sie gut zu den grauen Wänden paßte, dem Gras, das zwischen den Steinen sproß, und den weißen Wolken, die über den blauen Himmel jagten.
Sie war ein Teil von Schottland, ja ein Teil von Skaig selbst, und doch hatte sie nicht das Recht, hier zu sein.
Einen Augenblick hatte er sich durch ihren Anblick einlullen lassen, doch jetzt fühlte er erneut Ärger in sich aufsteigen. Er wartete, bis sie vor ihm stand.
»Wollen Sie das Schloß sehen?« fragte sie.
»Nein«, stieß er so barsch hervor, daß sie unmerklich die rechte Augenbraue hob. Sie schwieg, blickte ihn fragend an.
»Ich heiße Ian McCraggan«, sagte er und gewahrte die Bestürzung in ihrem Blick und die Röte, die ihr in die Wangen stieg.
»Ian McCraggan«, wiederholte sie.
»Von Schloß Skaig«, fügte er hinzu.
Einen Augenblick dachte er, sie wolle zu einer Erklärung ansetzen. Sie hatte den Mund geöffnet, als ob sie sprechen wollte, doch plötzlich schien sie es sich anders überlegt zu haben. Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr.
»Es ist sechs Uhr«, sagte sie. »Ich werde die Tore schließen, und dann müssen wir uns unterhalten. «
»Das ist eine gute Idee«, sagte er grimmig.
Sie wandte sich von ihm ab und rief: »Cathy! Cathy!«
Ein kleines Mädchen kam herbei gerannt. Es war ungefähr sechs Jahre alt und sein Haar tizianrot und glänzend.
Das dunkelhaarige Mädchen sagte zu der Kleinen: »Sag Hamish, er soll das Schild aufhängen, daß die Besuchszeit zu Ende ist.«
»Ist es schon Zeit?« fragte Cathy.
»Ja, es ist fast sechs Uhr.«
»Ich sage es Hamish«, sagte Cathy. Sie rannte zu dem Stand.
Das Mädchen blickte zu Ian auf.
»Würden Sie mir bitte folgen?« forderte sie ihn auf.
Er wußte, wohin sie ihn führen würde.
»Gehen wir ins Schloß?« fragte er.
»Dort können wir reden«, sagte sie.
»Dann haben Sie also die Schlüssel«, sagte er.
»Ja, ich habe die Schlüssel.«
Sie ging ihm voraus. Sie war zartgliedrig, hatte schlanke Hände und schmale Knöchel. Sie war eine Dame, das war ihm klar, doch wer war sie, und woher kam sie?
Fragen über Fragen wirbelten in seinem Kopf herum, als er ihr durch die Ruinen folgte, hinaus zum Seeweg.
Das Schloß hatte sich harmonisch in die Ruinen eingefügt; eine Wand des alten Gebäudes war benutzt worden, und das neue Schloß war auf seine Art romantisch.
Es hatte Türmchen und winzige bogenförmige Fenster; auf der einen Seite war ein großer Glockenturm und in der Mitte breite graue Steinstufen, die zu einer großen eisenbeschlagenen Eingangstür führten.
Es war imposant und genauso,, wie ein schottisches Schloß sein sollte.
Vor dem Haus waren ein paar Blumenbeete, die von Unkraut überwuchert waren. Efeu zog sich über die oberen Fenster, und Kletterpflanzen zierten das Untergeschoß.
Sie schritten schweigend dahin. Der Wind spielte mit dem dunklen Haar des Mädchens, preßte es an ihre Wangen, die jetzt so blaß waren, wie sie vorher gerötet gewesen waren. Über ihren Köpfen kreisten die Möwen, und auf der anderen Seite des Sees sah Ian Wildgänse, die ihren Abendflug machten. Plötzlich verspürte er den Impuls, laut hinauszuschreien, daß dies sein Schloß war, sein Heim, ein Ort, zu dem er immer wieder zurückkehren würde, was auch geschehen mochte.
Das Mädchen schritt ihm voraus, die Stufen hinauf. Sie öffnete die Tür, die unverschlossen war, und ging ihm in der großen viereckigen Halle voraus.
An den Wänden hingen Hirschköpfe; ein ausgestopfter Dachs hielt einen Aschenbecher in den Klauen; auf dem Boden waren Vorleger aus Wildkatzenfell ausgebreitet.
Hier war es sauber, stellte Ian fest. Offensichtlich hatte sich das Mädchen mit den Kindern darum gekümmert. Scott hatte dies wohl arrangiert, überlegte er. Statt ärgerlich sollte er dankbar sein.
Vielleicht hatten sie kein Geld erhalten und verlangten deshalb von den Touristen, die das Schloß sehen wollten, Eintritt. Als sich das Mädchen ihm zuwandte, umspielte ein Lächeln seine Mundwinkel.
Sie wollte sprechen, doch Ian unterbrach sie.
»Bevor wir uns unterhalten, bitte ich Sie, mir Ihren Namen zu nennen. Meinen kennen Sie ja.«
»Das ist nicht wichtig«, sagte sie. »Ich heiße Moida MacDonald.«
»Natürlich, Sie tragen ja den MacDonald-Schottenrock«, sagte Ian. »Ich hatte mir schon Gedanken gemacht.«
»Ich befürchte, da gibt es noch einiges, was Ihnen Gedanken machen wird, Mr. McCraggan«, sagte Moida ruhig.
»Wirklich?« erwiderte Ian. »Nun, vielleicht hätte ich als erstes die wichtigste Frage stellen sollen. Was tun Sie hier?«
Sie zögerte einen Augenblick, dann erwiderte sie ruhig: »Wir sind Hausbesetzer.«
2
Sogar die Hirschköpfe an den Wänden schienen ihre Mäuler vor Überraschung aufzusperren.
Einen Augenblick lang konnte Ian das Mädchen vor sich nur anstarren und entdeckte zu seiner Überraschung einen feindseligen Zug in ihrem Gesicht.
Er war es nicht gewohnt, daß junge Frauen ihn mit einem haßerfüllten Funkeln in den Augen ansahen. Doch das Mädchen, das stolz seinen Blick erwiderte, war ihm zweifellos feindlich gesinnt, obwohl er sich nicht vorstellen konnte, aus welchem Grund.
»Hausbesetzer«, wiederholte er schließlich. »Was verstehen Sie darunter?«
»Ich glaube, das ist die übliche Bezeichnung«, erwiderte Moida gemessen, »für Leute, die kein eigenes Heim haben und deshalb ein leeres Haus besetzen.«
»Doch das Schloß ist bewohnt. Zumindest war es das und wird es wieder sein«, erwiderte Ian. »Gibt es hier kein Personal oder einen Verwalter?«
»Es gibt da die alte Mrs. Mackay«, erwiderte sie, »und ihren Mann. Sie leben seit sechzig Jahren hier. Auch wenn sie keinen Lohn erhalten, bleiben sie aus Treue gegenüber Mr. McCraggan.«
»Keinen Lohn erhalten?« rief Ian aus und dachte an das Geld, das seine Mutter dem Verwalter geschickt hatte. »Dem muß ich später auf den Grund gehen. Um auf Ihre Worte zurückzukommen, Sie sagten, Sie seien hier eingezogen, weil Sie kein eigenes Haus hätten. Das ist doch wohl ein etwas ungehöriges Verhalten.«
»Ich dachte mir, daß Sie es so sehen«, erwiderte Moida, und in ihrer Stimme klang Bitterkeit.
»Vielleicht wäre es einfacher, Sie würden es mir erklären«, schlug Ian vor. »Sollen wir uns setzen?«
Der fast versöhnliche Ton seiner Stimme überrumpelte Moida, auch wenn sie ihn nicht als diplomatischen Schachzug erkannte. Einen Augenblick schien sie zu zögern und wirkte weniger feindselig.
Dann antwortete sie schnell: »Ich möchte lieber stehen.«
»Wie Sie wollen«, erwiderte Ian. »Nun fangen Sie an!«
Moida zögerte jetzt deutlich. Nach einer Weile sagte sie: »Mein Schwager und meine Schwester wurden einen Monat nach dem Tod Ihres Großonkels bei einem Autounfall getötet. Sie hatten hier im Dorf ein kleines Haus, wo sie mit ihren beiden Kindern lebten. Ich kümmerte mich um Hamish und Cathy, und eine Woche danach verkaufte Ihr Verwalter das Haus über unsere Köpfe hinweg und erklärte uns, wir müßten ausziehen.«
»Ich nehme an, Sie sprechen von Mr. Scott?« fragte Ian.
»Ja, Mr. Scott«, erwiderte Moida. »Er sagte, er handle auf Ihre Anweisung.«
»Tatsächlich? Und weshalb haben Sie sich gefügt?«
»Wir hatten keine andere Wahl. Die Leute, die das Haus gekauft hatten, standen vor der Tür. Sie hatten dafür bezahlt und erwarteten, es leer vorzufinden.«
Moidas weiche volle Lippen zogen sich zu seinem Strich zusammen, und Ian stellte sich die Szene vor.
»So kamen Sie also hierher«, sagte er.
»Das war nur gerecht«, erwiderte Moida schroff.
Sie wirkte nicht mehr verlegen. Ihre goldgefleckten Augen funkelten.
Sie war, überlegte Ian mit einem leichten Lächeln, die Personifizierung eines Kämpfers, der gegen Ungerechtigkeit angeht.
»Und das Personal ließ Sie herein?« fragte er.
»Es gab kein Personal, das dies hätte verhindern können«, erwiderte Moida. »Die Schwestern, die Mr. McCraggan zuletzt versorgt hatten, waren nach Inverness zurückgekehrt; die Hausmädchen stammten aus dem Dorf; der Koch und der Butler gingen, als sie keinen Lohn erhielten.«
»So haben Sie, Ihr Neffe und Ihre Nichte sich ohne Widerstand von irgendeiner Seite hier niedergelassen?« sagte Ian.
»Genau. Sie hatten uns vor die Tür gesetzt, und wir fanden, daß es Ihre Aufgabe sei, eine andere Bleibe für uns zu finden.«
»Und wenn ich sage, daß mich das nichts angeht?«
Moida zuckte die Schultern.
»Ich ahnte, daß Sie so denken würden. Wir bleiben hier, bis Sie uns mit Gewalt hinauswerfen.«
Etwas an ihrer Haltung ging Ian unter die Haut und bewirkte, daß er sich plötzlich gereizt fühlte.
»Wissen Sie«, sagte er, »es ist mir klar, daß seit dem Tod meines Großonkels ein ganz schönes Durcheinander hier herrscht und Sie bestimmt Grund zum Groll haben. Das muß geklärt werden, doch inzwischen muß ich Sie bitten, sich eine andere Bleibe zu suchen. Meine Mutter und ihre Gäste werden demnächst hier eintreffen. Es ist unmöglich, daß Sie dann noch hier im Schloß sind.«
»Das glauben Sie«, erwiderte Moida. »Ich habe Ihnen gesagt, daß wir nicht wissen, wohin wir uns wenden sollen. Sie haben den Kindern die Heimat genommen, und es ist Ihre Pflicht, ihnen eine Unterkunft zu besorgen.«
»Gibt es denn im Dorf keine leeren Häuser?« fragte Ian.
»Natürlich nicht«, gab ihm Moida zur Antwort. »In Schottland sind Häuser genauso knapp wie anderswo.«
»Was sollte ich Ihrer Meinung nach tun?« fragte Ian.
»Besorgen Sie uns ein Dach über dem Kopf«, erwiderte Moida. »Bis dahin bleiben wir hier.«
»Das ist unmöglich, und Sie wissen es«, antwortete Ian. »Und im Übrigen, welches Recht haben Sie, aus meinem Besitz Kapital zu schlagen? Ich vermute, es war Ihre Idee, für die Besichtigung des Schlosses ein Pfund je Besucher zu verlangen?«
»Wir müssen ja leben«, erwiderte Moida knapp.
»Und wovon haben Sie gelebt, bevor Sie hierher kamen?« wollte Ian wissen.
Als sie ihm antwortete, spielte ein triumphierendes Lächeln um ihre Mundwinkel, als ob sie die Frage geahnt und gewußt hätte, daß die Antwort ihn aus der Fassung bringen würde.
»Mein Schwager erhielt viele Jahre eine Rente, die kurz vor seinem Tod plötzlich ausblieb. Er verkaufte Erzeugnisse aus dem eigenen Garten. Er und meine Schwester zogen Gemüse, das sich hier gut verkaufte, da, was Sie wohl nicht wissen, Gemüse hier schwer zu bekommen ist. Sie besaßen auch ein Gewächshaus, das sie eigenhändig gebaut hatten. Als wir aus dem Haus getrieben wurden, erhielten wir keine Entschädigung dafür.«
»Ich gebe zu, daß das ganze Problem äußerst schwierig ist«, sagte Ian, »aber bevor ich Mr. Scott nicht gefunden habe, kann ich keine Entscheidung treffen. Ich muß erst wissen, was ihn bewogen hat, das Haus zu verkaufen.«
Moida lachte.
»Wenn Sie ihn finden wollen, müssen Sie einen weiten Weg zurücklegen«, sagte sie. »Er ist jetzt in Australien.«
»In Australien?« wiederholte Ian erstaunt. »Aber weshalb?«
»Darüber gibt es im Dorf verschiedene Theorien«, erwiderte Moida, »doch der Hauptgrund scheint der zu sein, daß er genügend Geld besaß, um dorthin zu reisen. Und zufällig ging die Tochter des Schulleiters mit ihm. Ihr Mann ist bei der Armee in Malaya, und bis jetzt hat niemand den Mut gefunden, ihm zu schreiben.«
»Wollen Sie damit sagen, Scott sei mit dem Geld durchgebrannt?« fragte Ian.
»Das wird gemunkelt«, antwortete Moida. »Natürlich ist es möglich, daß er das Geld, das er für unser Haus und zahlreiche andere Geschäfte erhalten hat, zurückgelassen hat. Sie können ja in sein Büro gehen und nachsehen. Seit er weggegangen ist, war niemand dort.«
»O Gott, welch ein Durcheinander!« stöhnte Ian.
Alles fügte sich zusammen. Er erinnerte sich, wie seine Mutter gesagt hatte: »Ich habe ihm tausend Pfund geschickt und ihn gebeten, sich um alles zu kümmern.«
Es sah ihr so ähnlich, überlegte er, impulsiv und großzügig, wie sie war, ohne zu überlegen, ob es klug war, einem Mann, den sie nicht kannte, einen Scheck in solcher Höhe zu schicken. Sie war immer so gewesen, und er erinnerte sich, wie es ihn als Kind verwirrt hatte, daß sie immer alles dutzendweise angeschleppt hatte, während sich andere überlegten, ob sie sich auch nur einen Teil davon leisten konnten.
»Der allmächtige Dollar.«
Er hatte sich geniert, wenn ihn die Jungen in der Schule wegen seiner Mutter aufgezogen hatten. Seine Freßpakete waren immer viermal so groß wie die der anderen gewesen, und er hatte Beatrice nie gestanden, daß er die Geschenke, die sie ihm schickte, versteckte - die Goldfüller, die Armbanduhr aus Platin, die mit Brillanten geschmückten Manschettenknöpfe. Er hatte sie in seinen Schrank eingesperrt und sich billigere gekauft, so daß er wie die anderen Jungen war.
Bestimmt war diese Großzügigkeit von Beatrice daran schuld, daß Scott zum Betrüger geworden war, doch weder das noch zahlreiche andere Vorkommnisse würden sie überzeugen, daß Geld sowohl ein Fluch als auch ein Segen sein konnte.
Doch wessen Schuld es auch immer sein mochte, es war absolut unmöglich, daß seine Mutter und Lynette Moida und die beiden Kinder, die Besitz vom Schloß ergriffen hatten, vorfinden durften. Es mußte etwas geschehen, das war ihm klar, aber was?
»Wer kümmert sich um den Besitz?« fragte er.
»Niemand.«
»Aber da muß doch jemand sein«, beharrte er. »Sind die Arbeiter noch hier?«
»Sie leben in ihren Häusern«, erwiderte sie, »aber ich weiß nicht, ob sie sich, da sie seit einem halben Jahr keinen Lohn erhalten haben, noch als bei Ihnen angestellt betrachten.«
»Da Sie sich ja über den ganzen Besitz und die Leute darauf so gut auskennen«, sagte Ian mit einem Anflug von Sarkasmus in der Stimme, »könnten Sie mir jemanden vorschlagen, an den ich mich wenden und mit dem ich darüber reden könnte?«