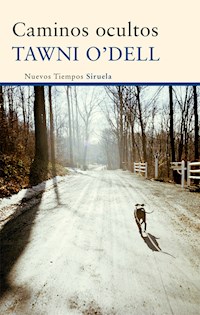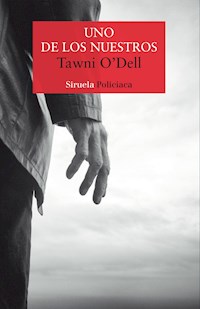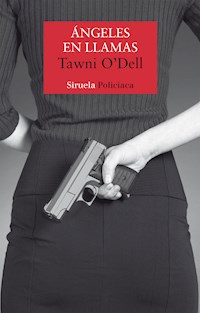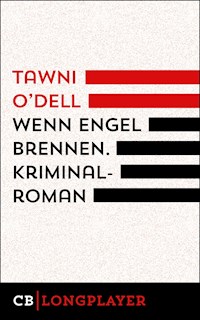
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Galaktisch gut gelingt es Tawni O’Dell, das Desparate eines zerstörten Landstrichs einzufangen. Ein mitreißendes, geniales Porträt menschlichen Gemüts sowie der hauchdünnen Grenze, die verletzt wird, wenn jemand einem anderen das Leben nimmt.« Publisher’s Weekly Als Polizeichefin von Buchanan, dem Ort ihrer Kindheit, hat Dove Carnahan schon viel gesehen. Es ist keine kuschelige Gegend: Vom exzessiven Kohleabbau verwüstete Landstriche liegen brach, Geisterstädte rotten vor sich hin. Menschen rackern sich ab oder haben sich schon aufgegeben, Träume blühen und welken. Oder sie verbrennen, wie das tote Mädchen, das in einer glühenden Erdspalte steckt. Der alternde State Trooper Nolan übernimmt die Ermittlung, doch Chief Carnahan bleibt mit dran. Auf der Suche nach dem Hintergrund der Toten bekommt sie es mit einer berüchtigten Familie zu tun. Kriminell oder arbeitslos, verschworen und zerstritten – die Trulys sind Redneck-Unterschicht der schlimmsten Spielart. Und dieses Milieu ruft in der Polizeichefin längst überwunden geglaubte Alpträume wach. Denn hier ist vieles nicht, wie es scheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2019
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Titel der englischen Originalausgabe:
Angels Burning
© 2016 by Tawni O'Dell
All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten
Printausgabe: © Argument Verlag 2019
Übersetzerin: Daisy Dunkel
Lektorat: Else Laudan
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: Juli 2019
ISBN 978-3-95988-142-5
Über das Buch
Als Polizeichefin von Buchanan, dem Ort ihrer Kindheit, hat Dove Carnahan schon viel gesehen. Es ist keine kuschelige Gegend: Vom exzessiven Kohleabbau verwüstete Landstriche liegen brach, Geisterstädte rotten vor sich hin. Menschen rackern sich ab oder haben sich schon aufgegeben, Träume blühen und welken. Oder sie verbrennen, wie das tote Mädchen, das in einer glühenden Erdspalte steckt.
Der alternde State Trooper Nolan übernimmt die Ermittlung, doch Chief Carnahan bleibt mit dran. Auf der Suche nach dem Hintergrund der Toten bekommt sie es mit einer berüchtigten Familie zu tun. Kriminell oder arbeitslos, verschworen und zerstritten – die Trulys sind Redneck-Unterschicht der schlimmsten Spielart. Und dieses Milieu ruft in der Polizeichefin längst überwunden geglaubte Alpträume wach. Denn hier ist vieles nicht, wie es scheint.
»Galaktisch gut gelingt es Tawni O’Dell, das Desparate eines zerstörten Landstrichs einzufangen. Ein mitreißendes, geniales Porträt menschlichen Gemüts sowie der hauchdünnen Grenze, die verletzt wird, wenn jemand einem anderen das Leben nimmt.« Publisher’s Weekly
Über die Autorin
Tawni O’Dell stammt aus der Bergbauregion des westlichen Pennsylvania, schrieb schon als Kind Geschichten und ging als Erste ihrer Familie auf die Universität, um Journalismus zu studieren. Ihr Durchbruch als Schriftstellerin kam mit der kometenhaft erfolgreichen Oprah’s-Entdeckung ihres Romans Back Roads, der von Michael Ohoven (Oscar für Capote) verfilmt wird. Wenn Engel brennen ist ihr sechstes Buch und der erste explizite Kriminalroman. Tawni O’Dell erscheint weltweit in mehr als 40 Ländern. Sie schreibt am Folgeroman.
Tawni O'Dell
Wenn Engel brennen
Roman
Für meine geliebte kleine Schwester
Vorwort von Else Laudan
Wer auf faszinierende Charaktere steht, wird bei Tawni O’Dell grandios bedient. Ihre Szenarien sind opulente Sittengemälde einer von den Folgen der Gier unterhöhlten Jetztzeit. Die Romanschriftstellerin ist mit Salinger, Zola und John Steinbeck verglichen worden wegen ihrer Gabe, Personen, Ort, Milieu und gesellschaftliche Verhältnisse zu einem Blue-Collar-Setting zu verdichten, in dem es – aufregend, packend, mit tief fühlbarem Realismus und wohldosiert trockenem Humor – um Leben und Tod geht.
Von daher erscheint es absolut folgerichtig, dass sie mit ihrem sechsten Buch Wenn Engel brennen nun einen waschechten Kriminalroman verfasst hat. Tawni O’Dell: »Schon immer liebe ich Whodunnits. Ich wollte die Kleinstadtfiguren, für die ich berühmt bin, und ihren Alltag mit den dramatischen Twists und der Spannung des Genres verknüpfen. Und ich hatte Sehnsucht nach einer Figur, die mir nahe ist und dieselben Hürden, Entdeckungen, Enttäuschungen, Freuden und Frustrationen erlebt wie ich.«
So kommen wir zu Chief Carnahan, der ersten Polizeichefin des County, einer Frau, die sich nicht mit Klischees zufriedengibt und eine Nase für die Bedeutung des scheinbar Unbedeutenden besitzt. Die genau weiß, wie sehr der Schein trügen kann, weil sie selbst nicht ist, was sie scheint. Eine Ermittlerin, auf die das Genre gewartet hat.
Bitte, bitte mehr davon!
Eins
Als ich Rudy Mayfield das letzte Mal so nah war, hatte er sich im Truck seines Dads zu mir rübergelehnt, um meine erst kürzlich gereiften Brüste zu begrabschen.
Ich schließe die Augen, und für einen Moment rieche ich wieder schwitzende Teenagergeilheit, kaum gedämpft von antibakterieller Seife, anstelle des süßlich-rauchigen Gestanks von verkohltem Fleisch, der sich mit dem ewigen beißenden Schwefeldunst dieser giftigen Geisterstadt mischt.
»Wer tut so was nur?«, fragt Rudy zum zehnten Mal in den letzten Minuten. Es ist zu seinem Mantra geworden, ein betäubender Singsang, der ihm helfen soll, das Unfassbare zu verdauen, dem er heute Morgen auf seinem täglichen Weg die verlassene Straße entlang begegnet ist. Buck, sein zotteliger Hütehundmischling, hebt den Kopf von seinem Platz zu Rudys Füßen und blickt ihn mitfühlend an.
»Bist du dir ganz sicher, dass du niemanden gesehen hast?«, frage ich erneut.
Wir schauen beide auf die abgesackten Zufahrtswege, die zu den zerfallenen Fundamenten eines Dutzends verschwundener Häuser führen, und die knorrigen, blattlosen Bäume, die wie Riesenhände von Untoten aus der leicht schwelenden Erde ragen. Die knallorange Rostschicht auf dem Schutzblech eines umgestürzten Kinderfahrrads ist der einzige Farbklecks in der menschenleeren Umgebung.
»Von denen, die in Run geblieben sind, ist mein Großvater als Einziger noch am Leben. Nur ich komme noch hierher, um nach ihm zu sehen. Und das weißt du.«
»Wie’s aussieht, war doch jemand hier«, stelle ich fest. »Das Mädchen ist nicht allein hierhergekommen und hat sich auch nicht selbst in Brand gesetzt.«
Rudys Gesicht wird so grau wie der Asphalt unter seinen Füßen. Er schluckt und blickt starr auf seinen mächtigen Bierbauch, über den sich ein altes Unterhemd mit verschiedenfarbigen Flecken spannt, die aussehen wie auf einen großen weißen Globus gemalte Länder.
»Wir hatten ein paarmal richtig Spaß in der Schule«, versuche ich leichthin zu sagen, was unter den gegebenen Umständen nicht ganz einfach ist.
Die Ablenkung funktioniert, und er lächelt mich schief an wie früher im Gesundheitsunterricht, wenn unser Lehrer etwas Überflüssiges oder Sinnloses von sich gab, was meistens der Fall war. Er hat noch immer die hübschen grünen Augen, halb verschattet vom Schirm seiner Baseballmütze; sie sind mit den Jahren nicht stumpf geworden. »Oh ja«, sagt er. »Ich hab nie verstanden, warum aus uns kein Paar geworden ist. Ich mochte dich.«
»Vielleicht hättest du mir das mal sagen sollen.«
»Ich dachte, es im Truck meines Dads zu machen, hätte dir das gezeigt.«
»Das hat mir nur gezeigt, dass du gern im Truck deines Dads rummachst.«
Ich weiß noch, wie überrascht er war, dass ich ihm nicht irgendwann Einhalt gebot. Wahrscheinlich dachte er, es sei mein erstes Mal, was es auch hätte sein sollen; ich war knapp fünfzehn und zu jung für Intimitäten, aber das ausgeprägte Sexleben meiner Mutter hatte schon früh meine Neugier geweckt. Auf meine Schwester Neely hatte es die gegenteilige Wirkung. Sie fand, nach den vielen Malen, die wir es mit anhören mussten, und den wenigen Malen, die wir heimlich zusahen, wüsste sie alles Wissenswerte über den Akt an sich. Sie schien nie das Bedürfnis zu haben, es selbst auszuprobieren, ich hingegen glaubte irrtümlicherweise, dass meine Mom es tat, weil es ihr Spaß machte, und ich wollte wissen, was so toll daran war, dass sie sich lieber mit nackten grunzenden Männern herumwälzte, als mit ihren Kindern zu spielen oder sie satt zu kriegen.
Ich höre einen Wagen kommen. Buck hebt den Kopf.
Die Straße durch Campbell’s Run ist gesperrt, seit ich denken kann, und so voller Schlaglöcher und von Unkraut überwuchert, dass man sie aus der Ferne nicht erkennt. Wir haben das Tor für den Leichenbeschauer offen gelassen, doch ein Streifenwagen der State Police und zwei nicht gekennzeichnete Wagen sind als Erste da.
»Ich muss wieder an die Arbeit«, sage ich zu Rudy und beuge mich hinunter, um Buck hinter den Ohren zu kraulen. »Aber geh nicht weg. Wir haben vielleicht noch ein paar Fragen.«
Corporal Nolan Greely kommt auf mich zu. Er wirkt wie der große, stämmige, humorlose Trooper, bei dem einem Autofahrer mulmig wird, wenn er ihn in seinem Außenspiegel sieht. Tatsächlich ist er Detective bei der Kriminalpolizei und trägt keine Uniform mehr, aber die braucht er auch gar nicht. Vom stahlgrauen Bürstenhaarschnitt bis zum gemessenen, zielstrebigen Gang ist er durch und durch Cop, da gibt es kein Vertun.
Er bleibt vor mir stehen und mustert mich mit regloser Miene durch eine verspiegelte Sonnenbrille. »Hallo, Chief«, begrüßt er mich. »Auf dem Weg zum Tee mit der Queen?«
Ich trage einen irisblauen Rock mit Blazer und neue taupefarbene Lackleder-Pumps, die ich gerade mit einem Dreißig-Prozent-Gutschein bei Kohl’s gekauft habe. Meine Bluse hat ein leuchtendes Blumenmuster zu Ehren des strahlenden Sommertags. »Ich sollte eigentlich bei einem Frühstück der Handelskammer im Veteranenverein sein.«
Sein Ausdruck verändert sich nicht. Ich weiß nicht, ob er mich bewundert, bedauert oder beneidet. »Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass du mich gleich angerufen hast«, sagt er. »Es gab Zeiten, in denen man dir diesen Fall hätte mit Gewalt entreißen müssen.«
»Ich habe beschlossen, meine Zeit und Energie nicht zu verschwenden, indem ich gegen das Unvermeidliche ankämpfe«, erwidere ich.
»Meinst du damit mich?«, fragt er. »Oder die gesamte State Police?«
Ich deute ein Lächeln an. »Dich, Nolan«, scherze ich. »Wärst du ein Superheld, wäre das dein Name: der Unvermeidliche. Und deine Superkraft wäre, immer dann aufzutauchen, wenn du unerwünscht bist und nicht gebraucht wirst.«
»Ich werde immer gebraucht«, sagt er, ohne zu lächeln.
»Diesmal habe ich nichts dagegen, dich um Hilfe zu bitten«, erkläre ich. »Ich habe zwar einen Haufen Mitarbeiter, aber von denen ist keiner auf das hier vorbereitet.«
»So schlimm?«
»Das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ich glaube, sie ist noch ein Teenager.« Ich streife meine Schuhe ab. »Mit den Absätzen kann ich hier nicht laufen«, erkläre ich, »und ich habe kein praktisches Schuhwerk dabei.« Wieder kann ich nicht sagen, ob Nolan mich bewundert, bedauert oder beneidet.
Wir gehen auf die Stelle zu. Nolan gibt den beiden Kriminaltechnikern, die mit ihm angekommen sind, ein Zeichen. In ihrer Arbeitsuniform aus Cargohosen und Poloshirt mit dem aufgestickten Abzeichen der State Police über dem Herzen gehen sie mit ihren Kameras und ihrer Ausrüstung zur Beweismittelaufnahme zur Leiche. Ich gebe Colby Singer und Brock Blonski, den beiden Officers, die mit mir am Tatort sind, ebenfalls ein Zeichen. Nach der ersten Besichtigung der Leiche habe ich gewartet, bis sie mit Kotzen fertig waren, und sie dann losgeschickt, um nach Blutspuren, Fußabdrücken und sonstigen Hinweisen Ausschau zu halten.
Blonski und Singer sind Frischlinge, in der Polizeiarbeit und im Leben allgemein. Sie sind Anfang zwanzig und wohnen noch zu Hause, obwohl Blonski vor kurzem so verwegen war, in eine Wohnung über der Garage seiner Mom zu ziehen. Ich habe sie vor ungefähr einem Jahr eingestellt. Die einzige Leiche, die Singer vor diesem Mädchen gesehen hat, war seine Großmutter, die in ihrem besten Sonntagskleid friedlich in ihrem mit weißem Satin ausgeschlagenen Sarg lag. Und Blonski war vor ein paar Monaten als Erster bei einem tödlichen Unfall vor Ort. Kein schöner Anblick, aber nichts im Vergleich zu dem hier.
»Warst du schon mal hier?«, frage ich Nolan.
»Einmal als Mutprobe, als ich noch ein Kind war.«
Wir bleiben vor einem Gewirr aus Stacheldraht stehen.
»Du kannst da mit deinen bloßen Füßen nicht drübersteigen«, sagt er zu mir.
»Ich hab’s vorhin schon gemacht.«
Wortlos packt er mich um die Taille und schwingt mich durch die Luft über den Draht.
»Das war demütigend«, bemerke ich, sobald ich wieder Boden unter den Füßen habe.
»Ich hätte das Gleiche mit einem Mann gemacht«, versichert mir Nolan, »nur begegne ich selten einem, der ohne Schuhe seinen Dienst versieht.«
Ich ignoriere die Spitze. Ich bin schon mein gesamtes Erwerbsleben in einem männerdominierten Beruf. Ich habe sämtliche Spielarten von Ablehnung, Sabotage und Schikanen erlebt, die das Y-Chromosom aufzubieten hat. Meistens ist es nicht persönlich gemeint; es wird einfach als normal angesehen. Meine Entrüstung hebe ich mir für die echten Frauenhasser auf.
Das Minenfeuer, das den Ort Campbell’s Run zerstörte, begann vor über fünfzig Jahren mehrere Meilen tief in der Erde und machte sich erst zehn Jahre später bemerkbar, als sich in einem Hinterhof ein Krater auftat und eine Dampfwolke entließ, die den typischen Faule-Eier-Gestank von Schwefel verbreitete. Wie sich herausstellte, war die Öffnung hundert Meter tief und die Temperatur im Innern fast dreimal so hoch. Kurz darauf wurden der Kaninchenstall eines kleinen Mädchens und anschließend eine Vogeltränke verschlungen. Eines Morgens ragte von einer teuren Harley nur noch der Lenker aus einer drei Meter langen Erdspalte in der Auffahrt ihres Besitzers.
Sämtliche Bewohner der Ortschaft wurden umgesiedelt, bis auf ein paar Verweigerer wie Rudys Großvater, der sich sträubte zu gehen und es irgendwie schaffte, am Leben zu bleiben, während die leeren Häuser seiner Nachbarn um ihn herum abgerissen, Straßen gesperrt und Warnschilder aufgestellt wurden.
Das einzige andere Gebäude, das man stehen ließ, war die weiße Schindelkirche. Die Regierung brachte es nicht fertig, sie abzureißen. Von meinem Standort aus liegt sie hinter einer Straßenkurve verborgen, und ich sehe lediglich das verwitterte graue Kreuz auf der Turmspitze, kann mir den Rest aber deutlich vorstellen: eine vergessene Zufluchtsstätte, das einst leuchtende Rot der Eingangstüren bis auf ein paar störrische Streifen fast vollständig verblasst.
Ich war vor zwölf Jahren hier, als Rudys Großvater anrief, um den Diebstahl der Bleiglasfenster der Kirche zu melden. Bei dem Fall kniete ich mich rein, auch wenn alle anderen es für Zeitverschwendung hielten. Und ich hatte mehr Erfolg als gedacht. Ich fand heraus, dass die Diebe professionelle Antiquitätenjäger waren, die von New York aus operierten, aber ich hatte keine Chance, jemanden festzunageln oder die geraubten Stücke aufzuspüren. Hier waren diese Fenster sprühende Wunder aus Farben und Glaube inmitten der Ödnis. Jetzt befinden sie sich in irgendwelchen Sommersitzen stinkreicher Leute, ohne gebührend gewürdigt zu werden. Jedes Mal, wenn ich daran denke, fühle ich mich persönlich angegriffen.
Mir der Gefahren unter meinen Füßen voll bewusst, steige ich behutsam über den verkohlten Grund, während Nolan mit schwerem Schritt hinter mir herstapft und riskiert, dass der Boden nachgibt.
Dort, wo die Feuer am heißesten schwelen, haben sich über ein Dutzend Spalten gebildet. Tote Bäume haben sich aus dem gelockerten Boden gelöst und sind umgekippt. Ihre aufragenden Wurzeln erinnern mich an die verschlungenen Beine vertrockneter Spinnen, wie Neely und ich sie auf unserem Dachboden fanden.
In eins dieser schwelenden Löcher im Boden hat jemand das tote Mädchen gesteckt.
Nolan und ich blicken auf sie hinab.
Der obere Teil ihres Körpers ist stark verbrannt. Ihre Augen sind offen und blicken überrascht aus einem Gesicht, das aussieht, als wäre es mit Barbecue-Sauce bestrichen und überbacken worden, bis es Risse bekommen hat und aufgeplatzt ist. Ihr Haar ist größtenteils verbrannt, und die Verletzung an ihrem Schädel ist deutlich zu erkennen. Ich bezweifle sehr, dass sie diese Schläge überlebt hat. Hoffentlich wurden sie ihr zugefügt, bevor man sie verbrannt hat.
»Wir haben die Umgebung und die Straße abgesucht. Nirgends ist Blut von den Kopfverletzungen. Sie muss anderswo getötet und dann hierhergebracht worden sein«, erkläre ich ihm, weil ich das Schweigen durchbrechen muss. »Es war trocken in letzter Zeit, also gibt es leider weder Fußabdrücke noch Reifenspuren.«
Nolan kniet sich hin, um sich die Tote näher anzuschauen.
»Wahrscheinlich hat derjenige, der sie hier abgeladen hat, gedacht, sie würde vollständig verbrennen«, rede ich weiter, »und als das nicht funktionierte, hat er eine Art Brandbeschleuniger benutzt. Dann gibt es noch das da.«
Ich zeige auf eine Decke mit Blutflecken und schwarzen Brandlöchern, die wir in einem Streifen Unkraut gefunden haben.
»Chantillyspitze in Korallen- und Orangetönen mit einem türkisfarbenen Medaillonmuster. Ich bin mir ziemlich sicher, das stammt aus der Jessica Simpson Sherbet-Lace-Kollektion. Die gibt es bei Bed, Bath and Beyond.«
Nolan blickt auf, seine Spiegelbrille gibt nichts preis.
»Ich habe kürzlich neue Bettwäsche gekauft«, erläutere ich. »Allerdings nicht die«, rechtfertige ich mich weiter. »Wie es aussieht, hat sie nicht allzu lange gebrannt. Vielleicht hat jemand versucht, das Feuer mit der Decke zu ersticken.«
»Vielleicht hat der Mörder Gewissensbisse bekommen, oder jemand war bei ihm und konnte den Anblick nicht ertragen«, wirft Nolan ein. »Wie hat Mayfield sie gefunden?«
»Es war sein Hund.«
Er kommentiert das nicht. Meine Officer und ich stehen daneben, während er aus dem Dunkel hinter seiner Brille lange auf das Mädchen starrt.
Noch unheimlicher als die Umgebung ist das völlige Fehlen von Geräuschen. Es ist ein vollkommener Junitag, und kein einziger Vogel zwitschert, keine Fliege summt, es gibt kein Hundegebell und kein Kindergeschrei. Niemand mäht den Rasen oder hört Radio oder bedient ein Elektrowerkzeug.
»Wie wollt ihr sie da rausholen?«, frage ich Nolan.
Sie ist kaum einen Meter tief drin, aber man kann nicht wissen, wie brüchig der Boden an dieser Stelle ist und wie tief die Erdspalte. Auch das Ausmaß ihrer Verbrennungen ist unklar und damit der Zustand ihres Körpers. Wenn wir versuchen, sie herauszuziehen, fällt er womöglich auseinander.
Schließlich steht Nolan wieder auf. »Einer von uns muss da runter, um dabei zu helfen, sie hochzuhieven«, sagt er. »Wir können ihm ein Seil umbinden. Ich habe zwei Trooper dabei, aber das sind Riesenkerle.«
Er taxiert Blonski, der den gedrungenen, halslosen Körperbau eines Gewichthebers hat, dann Singer, der lang und schlaksig ist, und dann mich.
»Wiegst du mehr als er?«, fragt er mich.
»Nein«, antworte ich knapp.
»Sicher? Er ist dünn wie eine Bohnenstange.«
»Er ist eins neunundachtzig groß und ein Mann. Ich wiege am wenigsten. Ich mache es.«
»Sie tragen einen Rock, Chief«, wagt Singer einzuwenden. »Und Sie haben keine Schuhe.«
»Ja«, schaltet sich Blonski ein. »Sollten wir nicht auf jemandem mit passender Kleidung und Ausrüstung warten, der weiß, was zu tun ist?«
»Der weiß, was zu tun ist?«, wiederhole ich in einem Ton, der keine weitere Diskussion zulässt.
Ich schlüpfe aus meiner Jacke und ziehe mir ein Seil unter den Achseln durch, während die Männer das andere Ende festhalten. Ich mache mir keine Sorgen um meine Sicherheit, wohl aber um meine Bluse. Es passt mir gar nicht, ungerüstet und nicht einsatzbereit erwischt zu werden, obwohl ich fairerweise sagen muss, dass ich für solche Aufgaben gar nicht mehr zuständig bin. Ich habe jetzt ein Büro, einen bequemen Stuhl und eine Keurig-Kaffeemaschine: Ich bin eine Koordinatorin, eine Dienstplanerin und Antragstellerin, eine PR-Expertin und ein händeschüttelndes Aushängeschild. Ich bin die erste Polizeichefin des County. An dieses Wissen klammere ich mich in dem Bemühen, eine gewisse Würde zu wahren, als ich in das schlammige Loch hinabsteige, um eine Leiche zu bergen.
Ich versuche, nicht an das Mädchen zu denken oder sie anzusehen, erst wenn es nicht mehr anders geht. Das Loch ist warm und dampfig, und ich versuche auch, nicht an die Erde um mich herum zu denken, die vielleicht nachgibt und das züngelnde Höllenfeuer eine Meile unter meinen baumelnden Füßen zum Vorschein bringt.
Ich quetsche mich an eine Seite und strecke die Arme aus, um die Leiche um den Bauch herum zu packen. Sieht so aus, als wäre das Feuer nur bis zu ihren Hüften gekommen. Der Anblick ihrer jungen nackten Beine, die aus den abgeschnittenen Shorts herausschauen, schnürt mir die Kehle zu. Wundersamerweise hängt noch immer einer ihrer Flip-Flops am Fuß. Ihre Zehennägel sind knallrosa lackiert, und ein Fußkettchen aus funkelnden Herzen schimmert in der schwarzen Erde. Ich ziehe sie sanft an mich, wobei ich das Geräusch, den Geruch und das Gefühl von versengtem Fleisch und verbrannten Knochen ignoriere und mir das Mädchen vorzustellen versuche, das sie war, bevor ihr Herz zu schlagen aufhörte und ihre Seele sich verflüchtigte. Ist sie gern zur Schule gegangen? Hatte sie viele Freunde? Was wollte sie später mal werden? Hat sie es je in einem Pick-up-Truck gemacht?
Niemand von uns spricht, nachdem wir sie auf den Boden gelegt haben. In einem schützenden Kreis stehen wir um sie herum und teilen stumm unsere Trauer, jeder für sich und doch gemeinsam. In solchen Situationen sind sogar beim hartgesottensten Polizisten Tränen erlaubt. Sie alle denken an Schwestern und Töchter. Ich bin die Einzige, die sich selbst sieht.
Ich schaue als Erste auf und richte den Blick weg von dem toten Mädchen und dem toten Ort auf das üppige Grün der Hügellandschaft am Horizont, und ich spüre den vertrauten Schmerz, der mich jedes Mal überfällt, wenn ich mit zerstörter Schönheit konfrontiert bin.
Nacheinander wenden sich die Männer ebenfalls ab, noch erfüllt von ihren quälenden Gedanken, bevor sie zur gewohnten Gefühlstaubheit zurückkehren, die es ihnen ermöglicht, ihre Arbeit zu machen, sie jedoch leider nicht vor ihren Träumen schützt.
Heute Nacht werden uns im Schlaf diese Beine verfolgen, die selbst im Tod noch so aussehen, als wollten sie gleich aufstehen und davonlaufen.
Zwei
Singer und Blonski sind lange vor mir wieder in dem Behördenbau aus hellbraunem Backstein, der unser Revier beherbergt. Ich musste noch am Tatort bleiben, mit dem Gerichtsmediziner sprechen und mit Nolan eine Strategie entwickeln. Campbell’s Run ist ein Niemandsland, was die polizeiliche Zuständigkeit betrifft, weil es für den Staat Pennsylvania nicht mehr existiert. Die Straße, die hindurchführt, existiert ebenfalls nicht mehr. Buchanan ist die nächste Gemeinde mit einer eigenen Polizeidienststelle, und dort bin ich seit zehn Jahren Chief.
Nolan verfügt über sämtliche Ressourcen der State Police, ihr forensisches Labor eingeschlossen. Ich habe sechs Officer (zwei davon im Urlaub), vier Fahrzeuge und einen Verkaufsautomaten, der ständig kaputtgeht. Es ist also seine Ermittlung, aber wir werden ihn unterstützen. Die Regelung wäre die gleiche, wenn das Mädchen auf meiner Türschwelle gelegen hätte. Das Verbrechen ist zu abscheulich, als dass wir mit unserer Unerfahrenheit in Mordfällen einen Fehlschlag riskieren dürften, zumal mit einem Budget, das kaum für das Betanken der Fahrzeuge und für die Druckertinte reicht.
Erst als ich mit dem Wagen auf meinen Stellplatz rolle – immer noch barfuß, weil ich meine neuen Schuhe nicht wieder anziehen mochte –, merke ich, dass ich vergessen habe, nach Hause zu fahren, zu duschen und mich umzuziehen. Kurz erwäge ich zu wenden, aber wir haben in unserer Umkleide eine Duschkabine, und in meinem Büro liegt eine Jogginghose. Ich habe heute Morgen noch viel zu tun. Ich kann in der Mittagspause heimfahren und was Richtiges anziehen.
Singer und Blonski diskutieren mit Karla, unserer Dispatcherin, und Everhart und Dewey, meinen zwei anderen verfügbaren Officers. Die haben heute eigentlich frei, aber ich brauche jetzt alle Mann an Deck. Dewey hat vier Kinder, es sind Schulferien, und er wirkte ganz froh über den Ruf. Everharts Frau ist mit ihrem ersten Kind schwanger, der Geburtstermin ist überfällig und sie treibt ihn in den Wahnsinn; er wirkte noch erfreuter. Als ich das Gebäude betrete, verstummen alle.
»Mir ist bewusst, dass ich ein bisschen schmutzig bin«, sage ich und gehe rasch vorbei, ohne irgendwelche Kommentare abzuwarten. Singer und Blonski gebe ich ein Zeichen. »Sie beide. Auf ein Wort, bitte.«
Sie folgen mir in mein Büro. Dieses Drei-mal-sechs-Meter-Kabuff, militärhosengrün gestrichen mit einem Fenster zum Parkplatz und ohne Klimaanlage, ist das Nestähnlichste, was ich habe, und die wachsame Zuneigung, die mich befällt, wenn meine Officers hereinkommen, ist mein mütterlichstes Gefühl.
»Was wiegen Sie?«, frage ich Singer, als ich das Fenster öffne und mich in dem Wunsch nach einer leichten Brise an das Sims lehne.
»Achtzig«, sagt er.
»Unmöglich«, stößt Blonski hervor und lässt sich auf einen Stuhl plumpsen, als würde er bei einer Hinterhofrauferei auf der Brust eines Kumpels landen. »Und du willst eins neunundachtzig sein? Du bist abnormal. Du brauchst mehr Muskelmasse.«
»Ich kann essen, was ich will. Ich bekomme keine Muskeln«, antwortet Singer und lässt sich auf den anderen Stuhl sinken.
»Ihre Kommentare in Anwesenheit von Corporal Greely haben mir nicht gefallen«, teile ich ihnen mit.
»Wir haben versucht, Sie zu beschützen«, antwortet Singer.
»Du bist so ein Idiot«, sagt Blonski kopfschüttelnd.
»Hätten Sie auch das Bedürfnis gehabt, mich zu beschützen, wenn ich ein Mann wäre?«
»Wenn Sie ein Mann wären, würden Sie keinen Rock tragen und …«
»Wissen Sie, warum ich so angezogen bin?«, falle ich Singer ins Wort.
»Ihre Bluse gefällt mir«, sagt er.
»Weil ich auf dem Weg zu fadem Rührei und labberigem Bacon war, um mit Gemeinderäten und besorgten Bürgern über die Schlaglöcher auf dem Jenner Pike und das neue Bußgeld für Hundegebell zu sprechen. Wenn Sie mich mal wieder beschützen wollen, dann beschützen Sie mich davor.«
»Ja, Ma’am.«
Blonski grinst. Die Schelte galt eigentlich beiden, aber Singer hat es ausgebadet, was bedeutet, dass der Punkt an Blonski geht.
Als ich auf einer Bewerbung den Namen Brock Blonski sah, stellte ich mir einen Linebacker aus Fred Feuersteins Lieblingsmannschaft vor, und als ich ihm das erste Mal begegnete, entsprach er genau diesem Bild, nur dass er keine Cartoonfigur im Lendenschurz war: kantiges Kinn, breitschultrig, ehrgeizig, mit einem schwerfälligen Primatengang, der trog. Er war einsilbig, grunzte und verspeiste zum Mittagessen ganze Brathähnchen. Ich fand, an seinem Namen fehlten bloß zwei Buchstaben – Brocken –, um seine ganze Persönlichkeit zu erfassen, bis ich zufällig hörte, wie er der Mutter eines Jungen, der sein Dirt Bike geschrottet und eine Kopfwunde hatte, die neuesten nanotechnologischen Entwicklungen in der Hirnforschung erklärte. Er tut nur so blöd.
»Ich wollte Ihnen danken, dass Sie das übernommen haben«, sagt Singer zu mir. »Ich hatte Angst, dass der Detective mich darum bitten würde.«
»Ich hätt’s gern gemacht«, sagt Blonski.
Ich betrachte sie, wie sie da nebeneinandersitzen: der eine mit dichten, sorgfältig gescheitelten dunklen Haaren und langen Gliedmaßen, die er wie einen Regenschirm zusammengeklappt hat, ein nervöses Energiebündel; der andere ein menschlicher Bulldozer, den Schädel rasiert, mit halb geschlossenen Augen in seinen Stuhl gelümmelt, als würde er gleich einnicken. Zwei scheinbar völlig verschiedene junge Männer, körperlich wie geistig, aber für jemanden in meinem Alter zählt bloß, dass sie beide dreiundzwanzig sind und damit genau gleich.
»Gab es kürzlich eine Vermisstenanzeige für ein junges Mädchen?«
»Nicht in unserem County«, antwortet Blonski.
»Schade, dass Sommer ist und die Schulen geschlossen sind. Eine Abwesenheitsliste von der Highschool wäre ein guter Anfang für eine Suchaktion.«
»Übernimmt so was alles nicht die State Police?«, fragt Singer.
»Entschuldigung, Officer, wollten Sie sich heute freinehmen?«
Er läuft rot an. »Nein, es ist nur …«
»Wir werden unsere eigene Ermittlung durchführen. Wir kennen die Gegend und die Menschen, die hier leben, besser als sie. Corporal Greely begrüßt unsere Hilfe.«
»Begrüßt?«, fragt Blonski skeptisch.
»Er fühlt sich verpflichtet, unsere Hilfe anzunehmen«, korrigiere ich mich. »Ich gehe duschen. Wenn ich fertig bin, machen wir ein Brainstorming.«
Singer steht auf und geht zur Tür.
Blonski zögert. »Sie ist vielleicht gar nicht von hier«, sagt er.
»Nur jemand von hier würde auf die Idee kommen, eine Leiche draußen in Run zu entsorgen«, hält Singer dagegen.
»Vielleicht ist der Mörder von hier, aber das Mädchen von woanders.«
Singer ist anderer Meinung. »Wie sollte er dann auf sie kommen? Bist du hier schon mal jemandem begegnet, der nicht von hier ist?«
Blonski steht auf und geht hinaus. Ich halte Singer auf, als er zur Tür strebt, und gebe ihm einen meiner neuen Pumps.
»Kriegen Sie die Schramme weg?«, frage ich flüsternd.
»Klar doch, Chief«, sagt er.
Ich benutze die Umkleide nie. Ich bin überrascht, wie ordentlich und sauber es hier ist. Schlagartig wird mir bewusst, dass ich weder Handtuch noch Seife noch einen Kamm habe. Ein verblasstes blaues Strandhandtuch mit einem zähnebleckenden Hai darauf liegt zusammengefaltet am Ende der Bank. Ich hebe es auf und inspiziere es. Es ist trocken und riecht nicht. Darin eingewickelt ist eine Art Duschgel.
Als ich am Spiegel vorbeikomme, bleibe ich stehen und betrachte verdattert mein Spiegelbild. Ich kann nicht glauben, dass ich in diesem Zustand gerade ein Gespräch mit zwei von meinen Männern geführt habe und es ihnen gelungen ist, keine Miene zu verziehen. Ich sehe aus wie eine Schornsteinfegerin.
Unwillkürlich denke ich an meine Mutter und wie sie wohl auf mein Aussehen reagiert hätte. Sie hatte einen solchen Reinlichkeitsfimmel, dass sie ihr erstes Kind nach ihrer Lieblingsseife nannte. Sie duschte mindestens zweimal am Tag und nahm sich jeden Abend eine volle Stunde für ihr akribisch durchgeführtes Schaumbad mit brennenden Kerzen, leiser Radiomusik, prickelndem Mateus Rosé in einem goldenen Plastikkelch vom Renaissance-Markt sowie einem Altar aus glänzenden Glasflaschen, Tuben und Tiegeln mit Metalldeckeln und silbern schimmernden Lippenstifthülsen.
Ihre Sehnsucht nach Makellosigkeit erstreckte sich jedoch nur auf ihren Körper. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter je einen Staubsauger benutzt oder Geschirr gespült hätte. Unsere Großmama kam manchmal vorbei und machte sauber, bis ich alt genug dafür war, doch ihre Besuche genügten nicht, um den Dreck, das Durcheinander und die Schmutzwäsche in den Griff zu bekommen, die sich überall häuften.
Ich wünschte mir immer, Großmama würde mal sauer werden und von Mom mehr mütterlichen und haushälterischen Einsatz verlangen, aber sie fand die Weigerung ihrer Tochter, sich mit derart banaler Hausarbeit abzugeben, völlig gerechtfertigt, weil sie so schön war.
»Eure Mutter sollte sich um so was nicht zu kümmern brauchen. Es wäre ein Verbrechen, wenn ein so hübsches Mädchen sich die Finger schmutzig machen muss«, erklärte sie und nahm den klebrigen Linoleumboden unserer Küche in Angriff, ein Kopftuch um ihr Haar geknotet, angetan mit einem verwaschenen Hauskleid und klobigen Schuhen mit Gummisohlen. Niemand käme bei Großmamas Anblick auf die Idee, dass sie Nachwuchs hervorgebracht hatte, der zu hübsch zum Putzen war.
Die stets pragmatische Neely meldete sich schließlich irgendwann zu Wort und fragte: »Wenn es so was Besonderes ist, hübsch zu sein, warum benutzt Mom es dann nicht dazu, Geld zu verdienen? Sie könnte ein Filmstar sein, oder Miss America.«
Großmama sah aus, als wollte sie Neely zurechtweisen, dann wurde ihre Miene sanft, als wollte sie etwas Nettes sagen. Am Ende sagte sie gar nichts.
Uns war nicht klar, dass Mom mit ihrem Aussehen tatsächlich Geld beschaffte. Diverse Verehrer schenkten ihr Kleider, zahlten unsere Miete, gaben ihr Taschengeld. Wenn es ganz eng wurde, arbeitete sie eine Weile als Kellnerin oder Sekretärin in der Stadt, aber jeder Job führte schnell dazu, dass sie einen neuen Sugardaddy fand.
Ich trete unter die Dusche und drehe das Wasser auf, stelle es so heiß, wie ich es gerade noch aushalten kann. Ich sehe, wie es sich schwarz färbt, wo es auf meine dreckverkrustete Haut trifft und an meinem Körper hinabströmt, bevor es im Bodenablauf verschwindet. Egal wie ich schrubbe und pule, den Dreck unter meinen Fingernägeln bekomme ich nicht weg.
Ich frage mich, ob das tote Mädchen hübsch war. Wahrscheinlich. Die meisten Mädchen im Teenageralter sind allein schon wegen ihrer Jugendlichkeit hübsch, obwohl sich fast alle für hässlich halten.
Ich stelle das Wasser noch heißer, bis ich es kaum noch ertrage, wohl wissend, dass es nicht annähernd so heiß ist wie die Flammen, die das Gesicht des Mädchens angefressen haben.
Es ist mir gelungen, die schlimmen Einzelheiten in Schach zu halten, doch jetzt, nackt und bloß auf einem Betonboden, schwindet meine Abwehr. Das Bild ergießt sich mit dem dampfenden Wasser über mich: Flecken verbrannter Haut, bernsteinbraun wie Pfeifentabak, die sich auf ihrem Gesicht und den nackten Armen spannt; ihr Schädel, auf der einen Seite eingedrückt, mit strähnigen Büscheln versengter Haare; ihre Hände, die ins Leere greifen, die Finger wie Streifen von Dörrfleisch. Mir fällt plötzlich auf, dass ihre Hände schlimmer verbrannt sind als alle anderen Körperteile. Ich merke mir das als möglicherweise bedeutsam.
Ich weiß, dies ist der Moment, endlich um sie zu weinen, um das Leben, das sie nicht leben wird, über ihre grauenhaften letzten Minuten, um ihre Familie und den Schmerz, über den sie nie hinwegkommen werden, aber die Tränen bleiben aus, bis ich aufhöre, an die Ermordete zu denken, und mich auf das Ungeheuer konzentriere, das zu so etwas imstande ist. Damit bin ich auf vertrautem Terrain, und die Wut und Redlichkeit, die ich dort finde, wärmt und tröstet mich. Es sind keine Tränen der Trauer, sondern der Erleichterung.
Wieder in meinem Büro, noch immer barfuß und die widerspenstigen Haare hochgesteckt, setze ich mich in grauen YMCA-Jogginghosen und einem rosa Sweatshirt von einem Brustkrebs-Sponsoringlauf an meinen Schreibtisch und greife mit einem Seufzer nach meiner Lesebrille.
Seit letztem Jahr brauche ich eine. Zuerst gefiel es mir irgendwie. Ich redete mir ein, ich könnte auf sexy Bibliothekarin machen. Diese Selbsttäuschung hielt nicht lange an.
Ich bin vor ein paar Wochen fünfzig geworden. Die Zahl an sich stört mich nicht. Es stieß mir nicht einmal auf, als Singer gedankenlos mit aufrichtiger Bewunderung feststellte: »Wow, fünfzig! Das ist ein halbes Jahrhundert.«
Ich bin bei guter Gesundheit. Abgesehen von dem bisschen Grau im Haar, das ich färbe, ein paar Falten im Gesicht und dem beginnenden Erschlaffen bestimmter Körperteile sehe ich noch gut aus. Ich komme klar mit meinem Alter, aber alle anderen nicht. Insbesondere Männer.
Es geht mir gegen den Strich, wie mich Nolan heute Morgen in Campbell’s Run über den Stacheldraht gehievt hat, als wäre ich ein Sack Streusalz. Als ich jünger war, hätte er das nie getan, denn da hätte derselbe Akt die sinnliche Konnotation eines Schundromanhelden gehabt, der sein Liebchen über einen plätschernden Bach schwingt.
Er hätte mich auch nie so nüchtern prüfend nach meinem Gewicht gefragt wie ein Bauer, der auf der Viehmesse an einer eingepferchten Sau vorbeikommt.
Vielleicht ist das die Quittung dafür, dass ich mein Leben lang so viel Energie darauf verwendet habe, Männer dazu zu bringen, mein Gesicht und meinen Körper zu ignorieren und mich als gleichberechtigt anzuerkennen. Ich wollte nicht, dass sie mich wie ein Mädchen behandeln; jetzt wär mir das recht, aber sie sehen nur noch einen geschlechtslosen Klops.
Singer klopft an meine Tür, obwohl sie offen ist. Er hält inne und schnuppert.
»Ich rieche Axe-Duschgel«, sagt er.
»Unerheblich.«
»Da draußen ist ein Typ, der Sie unbedingt sprechen will.«
»Hat das mit unserem Mädchen zu tun?«
»Nein. Er will seinen Namen nicht nennen, aber er sagt, er hat Ihre Mutter getötet.«
Er lässt die Schwere dieser Ansage wirken. Bestimmt erwartet er eine Reaktion von mir, aber von mir kommt nichts.
»Alles in Ordnung, Chief? Glauben Sie, der Witzbold meint das ernst? Sollen wir mal nach Ihrer Mutter sehen?«
»Meine Mutter wurde ermordet, als ich fünfzehn war.«
Er blickt zu Boden. »Tut mir leid. Das wusste ich nicht.«
»Schon in Ordnung. Schicken Sie ihn rein.«
Ich bin vollkommen ruhig. Ich muss mich nicht dazu zwingen. Ich fühle wirklich nichts, und ganz kurz frage ich mich, ob mit mir etwas nicht stimmt.
Ich bin davon ausgegangen, ihn nie mehr wiederzusehen, aber ich habe die Möglichkeit nie ganz ausgeschlossen. Er ist jetzt ein alter Mann, aber immer noch eitel. Sein volles Haar ist nicht gelichtet, nur komplett ergraut. Er hat es mit einem fettigen Gel aus der Stirn gestrichen. Er trägt ein verwaschenes, aber sauberes kurzärmeliges Karohemd mit falschen Perlenknöpfen und eine emaillierte Gürtelschnalle mit der amerikanischen Flagge darauf, so groß wie seine Faust. Seine nackten Arme sind mit tiefschwarzen Tattoos bedeckt. Als er in den Knast ging, hatte er noch keine, also müssen sie das Werk eines Gefängniskünstlers sein, der anscheinend wahllos auf ihn eingestochen hat. Ich kann kein einziges Bild oder Wort erkennen.
»Hallo, Dove.«
Er lächelt mich an. Seine Zähne sind nicht so gut erhalten wie sein Haar. Sie sind fleckig, und es fehlen ein paar.
»Du bist ja richtig erwachsen. Und mehr als das. Du bist ja übers Erwachsensein längst hinaus.«
»Alles klar. Ich hab verstanden«, sage ich.
»Obwohl du so jung auch nicht mehr warst, als ich eingefahren bin. Du hattest damals schon ’n ordentlichen Vorbau. Und ’n hübschen Hintern.«
»Noch immer der alte Charmeur, was?« Ich falte meine Hände auf dem Schreibtisch. »Was willst du, Lucky? Oder hat man dir im Gefängnis einen treffenderen Spitznamen verpasst? Lautet er jetzt Erbärmlicher Versager?«
»Kein Grund, persönlich zu werden«, erwidert er und nimmt unaufgefordert Platz. »Nein, immer noch Lucky. Im Vergleich zu vielen Typen dort, wo ich gerade herkomme, bin ich ein Glückspilz. Und man hat mir wegen guter Führung ein paar Jahre erlassen. Mehr Glück gibt es nicht, oder?«
»Man hat mich informiert, dass du freikommst.«
Er taxiert mich auf diese besitzergreifende Weise, wie er Mom und mich und Neely immer angesehen hat, aber auch Bierkästen, den Trans Am unseres Nachbarn und unseren Fernseher, bevor er ihn einschaltete und sich setzte, um sich ein Baseballspiel anzuschauen. Er hatte zwei Gesichtsausdrücke: einen mürrisch gelangweilten für das, was ihm egal war oder was er nicht verstand, und ein gieriges geiles Gaffen für alles andere. »Wie geht’s deiner kleinen Schwester? Hab gehört, sie ist lesbisch.«
»Sie ist nicht lesbisch.«
»Da hab ich was anderes gehört. Sie soll ’ne echte Männerhasserin sein.«
»Viele heterosexuelle Frauen hassen Männer. Dank Männern wie dir.«
»Tuscheh!«, ruft er aus und wirft mir erneut ein strohgelbes Lächeln zu. »Hab gehört, sie ist jetzt Hundetrainerin. So ’ne Art Hundeflüsterin, oder in ihrem Fall wohl eher Hundeanbrüllerin.« Er lacht und amüsiert sich köstlich über den originellen Einfall seines stumpfen Geistes.
»Für jemanden, der die letzten fünfunddreißig Jahre hinter Gittern war, hast du ja eine Menge gehört«, sage ich.
Ich bin noch genauso erstaunt wie damals, dass meine Mutter sich mit ihm eingelassen hat, aber als Kind gehörte das zum üblichen Gegrübel. Soweit ich das beurteilen konnte, war die einzige Anforderung meiner Mutter an einen Mann, dass er sie sich leisten konnte. Jung, alt, ansehnlich, unscheinbar, durchtrainiert, dicklich, Prolet, Bürohengst, verheiratet, ledig, gebildet oder ignorant: Wir sahen alles kommen und gehen.
Nur sehr wenige sagten Neely und mir zu, und wenn, dann erwiesen sie sich auf lange Sicht als Ekel. Lucky war von Anfang an ein Ekel gewesen, obwohl wir uns einig waren, dass er gut aussah. Er arbeitete in einer Fabrik, die Teile für Bergbaugeräte herstellte, und fuhr eine schwarze Harley mit einem knallblauen Streifen. Er trank zu viel, aber das tat unsere Mutter auch, und er behandelte meine Geschwister und mich je nach Stimmungslage wie Dienstboten oder unartige Haustiere, aber das tat unsere Mutter auch.
»Vielleicht besuche ich sie mal.«
»Halt dich von Neely fern.«
»Da hab ich wohl ’n wunden Punkt getroffen«, ruft er grinsend aus. »Komm schon. Du bist doch nicht mehr sauer wegen dem Klaps, den ich ihr mal gegeben habe, als sie so pampig zu ihrer Mutter war? Hättet ihr einen Vater gehabt, er hätte das Gleiche getan.«
»Was willst du?«, frage ich erneut.
»Ich denke, das weißt du.«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Was ist mit eurem kleinen Bruder? Wie hieß er gleich? Rex? Bello? Rocky?«
»Champ.«
»Ja, richtig, Champ.«
»Er hat nach der Highschool den Staat verlassen.«
»Vor seinen Schwestern geflüchtet, was?«
Er war vor etwas auf der Flucht. Aber nicht vor seinen Schwestern. Zumindest haben Neely und ich das immer gehofft.
Auf gar keinen Fall wird hier über Champ geplaudert. Ich sehe Lucky über den Brillenrand hinweg scharf an. »Ich habe heute viel zu tun. Du musst jetzt gehen.«
»Du willst also nicht nett sein? Auch nach all den Jahren nicht?«
»Leb wohl, Lucky.«
»Kein Lebwohl. Wir sehen uns jetzt öfter. Das gilt auch für deine Schwester.«
Er steht auf und starrt auf mich herunter. Ich weiß, er versucht mich aus der Ruhe zu bringen, aber er hat keine Ahnung, mit wem er es zu tun hat.
Plötzlich erinnere ich mich lebhaft an meine Mutter am Tag ihres Todes, bevor ich zur Schule ging. Sie stand in ihrem kurzen smaragdgrünen Bademantel an Gils großem Erkerfenster, trank eine Tasse Kaffee und spielte mit ihrer Farrah-Fawcett-Mähne. Sie beäugte den Müll der Nachbarn, während die Müllmänner die Tonnen in die Presse hinten am LKW kippten. Sie fand, man könnte anhand von dem, was Menschen wegwarfen, viel über sie erfahren.
Nachdem sie Gil geheiratet hatte und endlich das Ansehen genoss, das mit einem gemeinsamem Nachnamen und einem großen Haus in einem besseren Stadtviertel einherging, fing sie an, die Nachbarn zu bespitzeln, ein Zeitvertreib, dem sie sich niemals hingegeben hätte, als wir arm waren. Damals hatte sie sich damit begnügt, selbst Zielscheibe neugieriger Blicke zu sein. Großmama nannte ihre neue Angewohnheit Schnüffelei, bis Gil ihr das Wort »Voyeurismus« beibrachte. Das gefiel ihr besser, sie fand, es klang stilvoll.
Wer über die Vergangenheit meiner Mutter Bescheid wusste, ging so weit, zu sagen, dass Cissy Carnahans Tod am Tag der Müllabfuhr perfektes Timing war.
Lucky wendet sich zum Gehen, und ich entspanne mich ein wenig, aber er bleibt im Türrahmen stehen.
»Ich will nur wissen, warum ihr, du und Neely, gelogen und mich ins Gefängnis gebracht habt für etwas, das ich nicht getan habe.«
Ich zucke nicht mit der Wimper. Ich starre ihn nur wortlos an, bis er schließlich aufgibt und geht.
Ich werde ihm nie verraten, dass ich mich oft das Gleiche gefragt habe.
Drei
Den Mord an meiner Mutter behalte ich meist für mich; wenn ich ihn zur Sprache bringen muss, trage ich ihn je nach Stimmungslage wie eine Krone oder wie einen Strick um den Hals. Nach dem Gespräch mit Lucky habe ich ihn mir wie eine schusssichere Weste umgelegt.
Ihr gewaltsamer Tod ereignete sich vor fünfunddreißig Jahren, und obwohl es das abscheulichste Verbrechen war, das diese Stadt vor dem heutigen Tag heimgesucht hat, geriet er weitgehend in Vergessenheit außer bei ihren Kindern, ihrer Mutter und natürlich dem Mann, der ungerechterweise dafür büßen musste.
Ich möchte gern annehmen, dass der Mann, mit dem sie seinerzeit verheiratet war, sich in seinem selbstauferlegten Exil ebenfalls erinnert, während er sich weich gebettet auf dem Familienkapital durch Europa treiben lässt. Damals wollte ich Gil nur möglichst weit weg wissen von meinen Geschwistern und mir, heute hingegen könnte ich angemessen mit ihm verfahren. Ich hätte gar nichts dagegen, wenn er heimkäme.
Für die Auseinandersetzung mit Lucky aber bin ich noch nicht bereit. Ich mag im Gespräch mit ihm hart und kaltschnäuzig gewirkt haben, aber innerlich rang mein schlechtes Gewissen die Hände. Ihn aufs Korn zu nehmen kam mir damals alternativlos vor; heute bin ich mir nicht mehr so sicher. Einer der schlimmsten Aspekte des Älterwerdens ist die zunehmende Rückschau. Je mehr sie sich dehnt, desto dünner und transparenter wird sie, und wir sehen die Dinge klarer.
Gegen Mittag fahre ich nach Hause, um mich umzuziehen. Ich bin immer noch unbeschuht, und das Gefühl des Gaspedals unter meinem nackten Fuß beschwört die Erinnerung herauf, wie Lucky mir Fahrstunden gab. Es war Sommer. Samstagvormittags kam er auf seinem Motorrad angebraust und genoss die missbilligenden Blicke von Gils Nachbarn, die hinter ihren eleganten Vorhängen lauerten, so wie Mom ihren Müll überwachte. Dann schnappte ich mir Gils Autoschlüssel und lief hinaus zu Lucky, wobei ich meist vergaß, Schuhe anzuziehen.
Luckys Beziehung mit Mom hatte fünf Jahre zuvor geendet. Nach ihrer Trennung kam und ging eine ganze Parade von Männern, ehe sie schließlich mit Gilbert Rankin den Sprung wagte. Ich hatte schon geglaubt, Mom sei nicht nur zu schön für Hausarbeit, sondern auch zum Heiraten. Ich stellte mir Großmamas Argumentation vor: »Es wäre doch ein Verbrechen, wenn ein so hübsches Mädchen für den Rest ihres Lebens nur noch einem Mann den Kopf verdrehen kann.«
Mom hatte die dreißig überschritten, ohne das geringste Interesse an fester Bindung zu zeigen, aber Gils Geld und Verfügbarkeit konnte sie wohl doch nicht widerstehen.
Gil entstammte einer von Buchanans reichsten Familien. Solche gibt es in allen Kleinstädten, und niemand weiß, wo genau ihr Geld herkommt, aber in Pennsylvania lässt es sich fast immer auf etwas Dunkles oder Unsichtbares zurückführen, das aus der Erde gebuddelt, gesprengt oder gepumpt worden ist. Sein Vater hatte ihm ein Kaufhaus und zwei Restaurants überlassen, um ihn zu beschäftigen. Auch schien er ein aktives Liebesleben zu führen, doch trotz ständiger Gerüchte über potenzielle Ehefrauen hatte er nie geheiratet und keine Kinder.
Als ich eines Tages von der Schule heimkam, lümmelte Lucky auf Gils Sofa mit dem avocadogrünen und sonnenblumengelben Paisleymuster, seine Stahlkappen-Bikerstiefel auf dem Plexiglas-Sofatisch, der wie ein riesiger Eiswürfel aus Limonade aussah. Er hatte eine Bierdose in der einen Hand und die andere auf Mom, die über etwas lachte, das er gesagt hatte. Sie versuchten nicht, irgendetwas zu verbergen, als ich hereinkam. Mir kam kurz der Gedanke, dass sie vielleicht etwas Ungehöriges taten, aber ich hatte schon vor langer Zeit gelernt, die Handlungen meiner Mutter nicht zu bewerten, weil es sinnlos und unbefriedigend war. Mom war so taub für Moralkritik wie Gils fortwährend kläffender Terrier für den Befehl, die Klappe zu halten.
Einmal kam Lucky zufällig gerade vorbei, als ich Mom bekniete, mit mir zu fahren. Ich stand kurz davor, den Führerschein machen zu dürfen, aber ich hatte niemanden, der mir das Fahren beibrachte.
Lucky bot sich an. Ich weiß nicht, ob er das tat, um bei Mom Eindruck zu schinden, oder ob er es auf meinen hübschen Hintern und da bereits ansehnlichen Vorbau abgesehen hatte, aber der Hauptgrund war wohl, dass er vor und nach meinen Übungen auf dem leeren Highschool-Parkplatz Gelegenheit bekam, Gils großen, glänzenden cranberryfarbenen Buick Riviera zu fahren, und er fuhr ihn viel zu schnell.
Fahren lernen war einer der seltenen Momente, in denen mir ein Dad fehlte. Soweit ich das beurteilen konnte, brauchte niemand einen Dad. Nicht dass Cissy eine dieser tollen alleinerziehenden Mütter gewesen wäre, die antreten und bewundernswert die Rolle beider Elternteile ausfüllen; sie übernahm ja kaum ihren eigenen Part. Aber meine Geschwister und ich hatten es ohne einen Dad geschafft, und was wir nicht kannten, fehlte uns auch nicht.
Allerdings schrieb die Gesellschaft vor, dass bestimmte Ereignisse im Leben einer Tochter einen Vater erforderten. Ein Dad brachte ihr Radfahren bei, nahm sie auf den ersten Campingausflug mit, führte sie zum Altar und gab ihr Fahrstunden.
Ich hatte meinen Vater nie kennengelernt, aber immerhin kannte ich seinen Namen: Donny McMahon. Von dem Moment an, als meine Mom ihm mitteilte, dass sie schwanger war, leugnete er, mein Vater zu sein. Das war damals, als es noch keine Blut- und DNA-Tests gab. Sie waren nicht verheiratet, und meine Mutter hatte bereits einen gewissen Ruf. Es war unmöglich, ihn oder seine Familie dazu zu bringen, mich anzuerkennen, obwohl mir Großmama erzählte, dass er mich besuchen kam, wenn sie auf mich aufpasste und wir allein waren. Der Stolz meiner Mutter erlaubte mir keine Beziehung zu einem Mann, der sie verschmähte und, viel wichtiger, sich weigerte, zu zahlen. Großmama beharrte darauf, dass mein Vater mich liebte, solange niemand hinsah.
Er starb zwei Jahre nach meiner Geburt, an einem Märztag mit Graupelschauern, in dem ersten Pontiac Sunbird, den unser Städtchen zu sehen bekam. Für einen offenen Sarg war er bei dem Unfall zu schlimm zugerichtet worden. Ich habe zwei Fotos von ihm, bevor sein Gesicht für seine Angehörigen nicht mehr zu erkennen war: eins in Passbildgröße als Zwölftklässler auf der Highschool, auf dem meine Ähnlichkeit mit ihm nur zu offensichtlich ist, und ein verblasstes Polaroid, auf dem er grinsend neben dem Wagen posiert, in dem er einen Monat nach dem Kauf zu Tode kam.
Neelys Vater war nur auf der Durchreise. Das ist das Einzige, was wir über ihn wissen. Wir dachten uns alle möglichen Geschichten aus, wer er war und wie er und Mom sich kennengelernt hatten. Am liebsten machten wir aus ihm einen maskierten Helden nach dem Vorbild von Zorro oder dem Lone Ranger oder Batman. Er war eines Nachts in Moms Schlafzimmer eingedrungen, hatte sie geschwängert und seinen Weg fortgesetzt, bevor sie seine Identität feststellen konnte.
Champs Vater hingegen war jemand, den Mom gut kannte. Er war ein anständiger Kerl mit Frau und Kindern, das zumindest erzählte uns Mom eines Abends, als sie betrunken und ohne Verabredung zu Hause festsaß und sich leidtat. Sie fügte hinzu, dass sie Champ seinen Namen niemals sagen konnte, weil sie ihm versprochen hatte, dass sein unehelicher Sohn nie versuchen würde, ihn zu behelligen.
Im Gegensatz zu Leugner Donny und Durchreise-Mann ließ Champs prinzipientreuer Vater Mom jeden Monat einen Stapel Zehndollarnoten zukommen. Es war Schweigegeld und somit zuverlässiger als Alimente, weil es ihm nie eingefallen wäre, eine Zahlung zu versäumen. Wir nannten ihn den Umschlag.
Mir tat es immer leid, dass Neely und Champ eine zusätzliche Bürde trugen, die mir erspart geblieben war. Als Kinder mussten sie sich ständig fragen, wer ihre Väter waren, und damit rechnen, ihnen auf der Straße zu begegnen, ohne es zu wissen. Das galt auch für Neely. Wenn ihr Dad einmal hier durchgekommen war, konnte das auch ein zweites Mal geschehen.
Ich hatte diese Sorgen nicht. Ich hatte einen Namen und zwei Fotos, und ich wusste jederzeit genau, wo meiner war: auf dem Friedhof hinter der Methodistenkirche.
Als ich mich umgezogen und mir ein Sandwich gemacht habe, fahre ich noch bei Neely vorbei, bevor ich mich wieder zur Arbeit aufmache. Ich weiß nicht, wieso ich es so eilig damit habe. Selbst wenn Lucky fest vorhat, sie ausfindig zu machen, kann er nicht mal in ihre Nähe kommen, wenn sie es nicht will. Ich glaube nicht, dass er versuchen würde, handgreiflich zu werden, und wenn, dann hieße es Gute Nacht, Lucky, oder jedenfalls Gute Nacht, Luckys Eier. Ich bin auch nicht besorgt, dass er ihr womöglich emotional schaden könnte. Neely hat ihre Gefühle bezüglich Lucky schon vor langer Zeit ad acta gelegt. Ich beneide sie um diese Fähigkeit.
Ich muss es ihr sofort erzählen, weil ich sonst den Rest des Tages damit hadere, dass ich etwas so Wichtiges weiß und Neely nicht.
Die Fahrt zu ihr bessert meine Laune und hilft mir, vorübergehend nicht an das tote Mädchen zu denken, das in der Gerichtsmedizin des Countys auf kaltem, rostfreiem Stahl liegt und darauf wartet, einen Namen zu bekommen. Neelys Anwesen liegt tief im Wald abseits einer Schotterpiste, die durch das Naturschutzgebiet am Laurel Dam führt, einem von eisigen Bergquellen gespeisten See mit einem Sandstrand, wo es um diese Jahreszeit von picknickenden Familien, blasierten Teenagern auf Stranddecken und kreischenden Kindern mit blauen Lippen wimmelt.
Niemand wäre je in der Lage, Neelys Zuhause zu finden, gäbe es nicht den Totempfahl aus Warnschildern unten an der anderthalb Kilometer langen Zufahrt, die durch noch mehr dichten Wald zu ihrem Haus und Büro führt. Sie hat nirgends einen Hinweis auf ihre Tätigkeit angebracht. Von unten nach oben gelesen steht da: ZUTRITT VERBOTEN! KEINE WERBUNG! JAGEN VERBOTEN! Obendrüber prangt das Geschenk der dankbaren Besitzerin eines Bichon Frisé, die mit ihrem bissigen, pissenden notorischen Kläffer extra aus Pittsburgh zu Neely kam und mit einem entspannten, ruhigen Komplizen wieder abreiste, den sie bedenkenlos in ihrer Designer-Umhängetasche verstauen kann; es ist ein handgefertigtes Schild, auf dem steht: HÜTET EUCH VOR DEN HUNDEN, ABER FÜRCHTET EUCH VOR MIR.
Neelys zwei Pick-ups stehen am gewohnten Platz, nebst einem Wagen, den ich nicht kenne. Sie muss Besuch von einem Kunden haben.
Ich steige aus, schließe die Tür und warte darauf, dass der Wald zum Leben erwacht.
Mit Sicherheit hören sie jedes Fahrzeug, sobald es in die Zufahrt einbiegt, aber sie warten ab, bis es Neelys Blockhaus erreicht hat, parkt und die Insassen aussteigen, dann erst zeigen sie sich. Neely hat sie nie darauf trainiert. Sie haben das aus eigenem Antrieb eingeführt.
Egal wie oft ich ihr Begrüßungsritual schon miterlebt habe, mein Herz rast und mein Mund wird ganz trocken, teils aus einer instinktiven Angst, die auf unsere Neandertaler-Vorfahren zurückgeht, und teils wegen des Kitzels zu sehen, wie diese Tiere über ihr Revier wachen.
Eben noch bin ich allein. Im nächsten Moment umringen mich fünf Schäferhunde. Wie aus dem Nichts und völlig geräuschlos sind sie aufgetaucht und stehen in gleichmäßigen Abständen am Waldrand.
Wenn ein Neuankömmling einen von ihnen bemerkt, lächelt er oder sie vielleicht oder ruft ihm etwas zu. Schließlich kommt man nicht zu Neely, wenn man kein Hundeliebhaber ist. Dann entdeckt man noch einen, dann noch einen. Schon huscht der Blick nervös hin und her. Man dreht sich um, schaut hinter sich, und was sieht man? Genau. Da ist noch einer.
Die Hunde bellen nicht. Sie stürmen auch nicht los. Sie stehen vollkommen reglos da und passen auf. Da sind Kris und Kross, identische schwarz-rotbraune Wurfgeschwister mit makellosem Stammbaum, die aus Deutschland stammen; der altehrwürdige Owen, ein pensionierter Polizeihund aus der Bronx; Maybe, ein rabenschwarzer Schäferhundmischling, den Neely gerettet hat; und ihr geliebter Smoke, ein riesiger zehn Jahre alter schneeweißer Kerl, der, davon bin ich überzeugt, nicht nur die menschliche Sprache versteht, sondern auch Gedanken lesen kann.
Neben Neely und Tug, dem Jungen, der für sie arbeitet, bin ich der ihnen vertrauteste Mensch. Sie erkennen mich auf Anhieb, aber sie lassen sich Zeit damit, meine Anwesenheit für rechtmäßig zu befinden. Maybe tanzt immer als Erster aus der Reihe und schlendert mit fröhlich wedelndem Schwanz auf mich zu. Kris und Kross nehmen das als Stichwort und stürmen los. Sie sind erst drei Jahre alt, die Jüngsten der Gruppe, und wollen spielen. Deshalb verwahre ich zwei Tennisbälle im Handschuhfach. Als sie näher kommen, halte ich in jeder Hand einen hoch. Sofort bleiben sie stehen, den Blick auf die Beute geheftet. Ich werfe beide Bälle gleichzeitig in verschiedene Richtungen, und sie jagen hinterher.
Owen kommt als Nächster und streift einmal um meinen Wagen, bevor ich ihn streicheln darf. Smoke verschwindet wieder zwischen den Bäumen.
Kris und Kross sind schon wieder da. Ich werfe die Bälle erneut.
Neelys Bürotür geht auf, und sie kommt mit einem Mann und einem Pitbull heraus.
Es ist ein heißer Tag, aber sie trägt wie gewohnt Jeans, Arbeitsstiefel und ein kariertes Flanellhemd über einem T-Shirt. Ihr langes blondes Haar mit den Silbersträhnen ist zu einem Pferdeschwanz gebunden und steckt unter einem Käppi mit dem Logo der Polizeihundestaffel.
Über die Jahre habe ich die Theorie entwickelt, dass atemberaubend schöne Frauen nur zwei extreme Möglichkeiten haben, mit dieser Bürde umzugehen: Sie können sich begeistert darauf einlassen, wobei leicht alles andere auf der Strecke bleibt, oder sie können sich dem verweigern und versuchen, sich gut zu tarnen.
Neely hat sich für Letzteres entschieden. Meiner Meinung nach hat es nicht funktioniert. Sie kann sich noch so sehr in Männerkleidung verstecken und einen Bogen um Schminke, Schmuck und Fön machen: Solange sie keine Maske aufsetzt, wie wir es ihrem Dad früher gern für die schicksalhafte Nacht ihrer Empfängnis unterstellt haben, ist ihr wunderschönes Gesicht nicht zu übersehen.
Und seltsam: Obwohl sie der hinreißende weibliche Nachwuchs einer hinreißenden Frau ist, haben sie und Mom keinerlei Ähnlichkeit bis auf die weit auseinanderstehenden blassblauen Topasaugen. In einem Anfall schwesterlicher Egostärkung habe ich mal zu Neely gesagt, sie sähen aus wie der Ring mit dem Dezember-Geburtsstein in der Schmuckvitrine bei Woolworth, den sie so gern haben wollte. Sie gab zurück, dass meine Augen wie geschmolzener brauner Zucker aussähen. Das ist eins der hübschesten Komplimente, die ich je bekommen habe.
Neelys Hunde gehen alle auf den Pitbull zu, der drohend bellt und an der Leine zerrt. Streng ruft Neely: »Aus!« Sie wiederholt den Befehl nicht. Ihre Stimme klingt weder wütend noch bettelnd. Alle ihre Hunde folgen aufs Wort. Sie stehen stramm und hecheln. Smoke tritt lautlos zwischen den Bäumen hervor.
Der Pitbull rastet aus.
Neely legt den Kopf schräg und blickt den Mann erwartungsvoll an.
Prompt fängt er an, wild an der Leine zu reißen, dazu brüllt er: »Aus! Aus! Aus! Aus!«
»Lassen Sie ihn bei Fuß gehen«, sagt Neely. »Im Kreis. Wie ich es Ihnen gezeigt habe.«
»Bei Fuß!«, schreit der Mann. »Bei Fuß!«
»Ansagen, nicht schreien.«