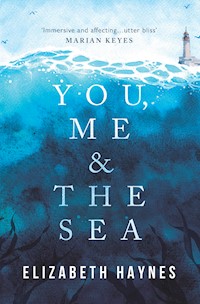8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Ihre Vergangenheit ist tödlich, denn sie weiß zu viel …
Genevieve will ihren Traum von einem Hausboot erfüllen und hat sich deshalb auf einen lukrativen Nebenjob als Tänzerin eingelassen. Doch hinter den Kulissen des exklusiven Londoner Clubs spielen sich Dinge ab, von denen niemand erfahren darf – und Genevieve weiß zu viel. Überstürzt flieht sie aus der Stadt und fühlt sich in ihrem neuen Zuhause, einem Boot in einem ruhigen Themse-Hafen, vorerst sicher. Bis eines Nachts die Leiche ihrer Londoner Freundin Caddy im Wasser treibt. Für Genevieve besteht kein Zweifel: Ihre Vergangenheit hat sie eingeholt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Ähnliche
Zum Buch
Seit dem frühen Tod ihres Vaters, mit dessen Holzwerkstatt sie die liebsten Erinnerungen verbindet, träumt Genevieve davon, ein Hausboot zu kaufen und selbst zu renovieren. Um ihr Ziel zu erreichen, hat sie sogar einen zweiten Job angenommen: Tagsüber arbeitet sie im Vertrieb einer großen Firma, nachts als Tänzerin in einem Londoner Edelclub. Doch aufgrund ihrer Neugierde gerät sie bald in den Fokus des skrupellosen Clubbesitzers Fitz, der einiges zu verbergen hat. Während Genevieve sich der Gefahr zuerst nicht bewusst ist, hat ihr Kollege Dylan Angst um sie und hilft ihr schließlich, die Stadt zu verlassen. Für Genevieve wendet sich alles zum Guten, als sie ihr Hausboot auf einem Nebenfluss der Themse in Kent bezieht. Doch dann entdeckt sie eines Nachts die Leiche ihrer Freundin Caddy neben dem Boot. Genevieve muss herausfinden, warum Caddy sterben musste, und sich selbst in Sicherheit bringen. Nur Dylan kann ihr dabei helfen, doch der scheint jetzt, wo sie ihn am meisten braucht, wie vom Erdboden verschluckt …
»Diesen zweiten Roman der Autorin von Wohin du auch fliehst kann man kaum aus der Hand legen.« The Bookbag
Zur Autorin
Elizabeth Haynes wuchs in Seaford, Sussex, auf und studierte an der Leicester University Englisch, Deutsch und Kunstgeschichte. Sie arbeitet als Fallanalytikerin bei der Polizei und lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Kent. Ihr Debüt, Wohin du auch fliehst,ist ein internationaler Bestseller und wurde auf Amazon UK zum besten Buch 2011 gewählt. Wenn es Nacht wirdist ihr zweiter Roman.
ELIZABETHHAYNES
Wenn es Nacht wird
Thriller
Aus dem Englischen
von Christiane Winkler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel Revenge of the Tide bei Myriad Editions, Brighton
Deutsche Erstausgabe 02/2013
Copyright © Elizabeth Haynes 2012
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013
by Diana Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion | Christiane Burkhardt
Umschlaggestaltung | t.mutzenbach design, München
Umschlagmotiv |© shutterstock
Satz | Leingärtner, Nabburg
ePub-ISBN 978-3-641-08808-8V002
www.diana-verlag.de
Für David
1
Ich öffnete die Augen, und da war es wieder, dieses unbestimmte, unbehagliche Gefühl. Das Schaukeln des Bootes kündigte die Ebbe an, und der Südwind blies flussaufwärts und erwischte die Revenge of the Tide von der Seite.
Ich blieb lange im Bett liegen und lauschte auf die Wellen, die neben meinem Kopf an den Schiffsrumpf schlugen, den Stahl durchdrangen und nur von der Holztäfelung gedämpft wurden. Es war warm unter meiner Decke und schön, dort auszuharren. Direkt über mir befand sich die rechteckige Dachluke. Sie gab den Blick auf Schwärze frei, die sich langsam in Dunkelblau und Grau verwandelte. Ich sah Wolken über mich hinwegjagen, die mir das seltsame Gefühl gaben, ich jagte mit dem Boot dahin – so als bewegte sich das Boot und nicht die Wolken. Dann verspürte ich wieder dieses Unbehagen.
Ich war weder see- noch »flusskrank«. Nach knapp fünf Monaten, die ich mittlerweile aus London weg war, hatte ich mich daran gewöhnt. Fünf Monate auf einem Hausboot. Trotzdem war ich immer noch ein wenig überrascht, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte und den Weg zum Parkplatz nahm. Aber nach ein paar wackeligen Schritten hatte ich mein Gleichgewicht schnell wiedergefunden.
Der Tag war irgendwie grau – nicht gerade ideal für eine Party, doch daran war ich selbst schuld, weil ich sie für September geplant hatte. »Schulanfangswetter«: Der Wind pfiff über das Deck, als ich aufstand und den Kopf aus dem Steuerhaus steckte.
Nein, es war nicht die Ebbe und auch nicht der Gedanke an die Leute, die später auf mein Boot kommen würden. Da war noch was anderes. Ich fühlte mich, als hätte mich jemand gegen den Strich gestreichelt.
Folgendes hatte ich heute noch vor: das letzte Stück Holzverkleidung im zweiten Raum befestigen, der irgendwann als Gästezimmer dienen sollte. Das Schreinerwerkzeug wegräumen und es vorne im Bug verstauen. Das Boot fegen, ein wenig aufräumen. Dann schauen, ob ich eine Mitfahrgelegenheit zum Supermarkt bekommen konnte, um dort Essen und Bier für die Party einzukaufen.
Ich hatte nur noch eine einzige Wand vor mir, doch die hatte eine seltsame Form, weshalb ich sie mir für den Schluss aufgehoben hatte. Der Raum war voller Sägemehlstaub und Holzreste, Abschlussleisten und Schmirgelpapier. Ich hatte in der Nacht zuvor Maß genommen, betrachtete stirnrunzelnd meinen Zettel und beschloss, zur Sicherheit noch einmal alles zu kontrollieren. Als ich die Kombüse verkleidet hatte, hatte ich viel Holz verschwendet, weil ich meine eigenen Messungen nicht mehr verstanden hatte.
Ich schaltete das Radio ein, obwohl ich es wegen der Tischkreissäge kaum hören konnte, und machte mich an die Arbeit.
Um neun legte ich eine Pause ein, ging in die Kombüse und kochte mir einen Kaffee. Ich füllte den Kessel und stellte ihn auf den Gasherd. Das Boot versank im Chaos. Doch das fiel mir nur ab und zu auf. Ich sah mich um, warf einen Blick auf die Schachteln des Take-away-Essens, die ich schnell in eine Plastiktüte geworfen hatte und die nun darauf warteten, entsorgt zu werden. Schmutzige Teller stapelten sich im Spülbecken, Pfannen und andere Utensilien verpackt in Kartons auf Stühlen in der Essnische, die noch darauf warteten, eingeräumt zu werden – jetzt, wo ich endlich Schränke in die Kombüse eingebaut hatte. Dann stand da ein schwarzer Plastiksack mit Stoffen, die eines Tages zu Vorhängen und Kissenbezügen verarbeitet werden sollten. Das war alles nebensächlich, solange ich hier allein wohnte, doch in ein paar Stunden würde das Boot nur so wimmeln von Menschen, und ich hatte versprochen, die meisten Renovierungsarbeiten bis dahin so gut wie erledigt zu haben.
So gut wie erledigt? Nun ja, ein dehnbarer Begriff. Ich hatte das Schlafzimmer fertig, und auch das Wohnzimmer sah gar nicht mal so schlecht aus. Die Kombüse war auch fertig, musste aber noch aufgeräumt und geputzt werden. Das Badezimmer war – nun, funktionsfähig, aber das war auch das Netteste, was man darüber sagen konnte. Und was den Rest anging – den geräumigen Platz unter dem Bug, der eines Tages zu einem größeren Bad umfunktioniert werden sollte, mit einer Badewanne anstelle des Duschschlauchs, den großen Wintergarten mit einem Glasschiebedach (ein ehrgeiziger Plan, doch ich hatte so etwas in einer Zeitschrift gesehen und so toll gefunden, dass ich es unbedingt realisieren wollte) und vielleicht noch ein Extrazimmer oder ein Büro, ein Raum, der unglaublich gemütlich, ja magisch sein würde –, er diente momentan noch als Lagerraum.
Der Kessel begann leise zu pfeifen, und ich spülte eine Tasse unter dem Wasserhahn aus, gab ein paar Löffel, genau genommen zwei Löffel, Instantkaffee hinein: Ich brauchte das Koffein.
Auf Höhe des Pontons sah ich ein Paar Schuhe durch das Bullauge, und kurz darauf hörte ich, wie jemand vom Deck rief: »Genevieve?«
»Ich bin hier unten. Das Wasser kocht schon – willst du was trinken?«
Kurz darauf kam Joanna die Treppe herunter und in die Kabine. Sie trug einen Minirock, dicke Socken und schwere Stiefel mit offenen Schnürsenkeln am Ende ihrer dünnen Beine. Obenrum hatte sie zum Ausgleich einen dunkelblauen Pulli von Liam an, der voller Sägespäne, kleiner Zweige und Katzenhaare war. Ihr Haar hing in wirren, verschiedenfarbigen Locken herunter.
»Nein, danke – wir gehen sowieso gleich wieder. Ich bin nur vorbeigekommen, um zu fragen, wann wir kommen sollen. Was hältst du davon, wenn wir außer dem Käsekuchen noch eine Lasagne mitbringen? Liam meinte, dass er von der Grillparty noch ein paar Bier übrig hat und die auch mitnimmt.«
Sie hatte einen Bluterguss auf der Wange. Joanna schminkte sich nicht – sie machte sich nichts daraus –, und so prangte ein ins Violette spielender pfenniggroßer Bluterguss unter ihrem linken Auge.
»Was ist mit deinem Gesicht passiert?«
»Ach, hör bloß auf! Ich habe mit meiner Schwester gestritten.«
»Sag bloß!«
»Komm an Deck – ich brauche eine Zigarette.«
Der Wind pfiff immer noch, also setzten wir uns auf die Bank vor dem Steuerhaus. Die Sonne versuchte, sich durch die dahinjagenden Wolken zu kämpfen, doch es gelang ihr nicht. Auf der anderen Seite des Hafens sah ich Liam, der Kartons und Tüten in den zerbeulten Ford Transit lud.
Joanna zog ein Päckchen Tabak aus der Tasche ihres Minirocks. »Ich finde, sie sollte ihre verdammte Nase nicht in meine Angelegenheiten stecken«, sagte sie.
»Deine Schwester?«
»Sie hält sich für was Besseres, nur weil sie mit zweiundzwanzig schon eine Hypothek hat.«
»So toll sind Hypotheken auch wieder nicht.«
»Genau!«, sagte Joanna mit Nachdruck. »Das habe ich ihr auch gesagt. Ich habe alles, was sie auch hat, aber keine Schulden, und ich muss keinen Rasen mähen.«
»Und darüber habt ihr euch gestritten?«
Joanna schwieg einen Augenblick, ihr Blick schweifte zum Parkplatz, wo Liam die Hände in die Hüften gestemmt hatte, demonstrativ auf die Uhr sah und in den Wagen stieg. Über die Hafengeräusche hinweg – den Bohrer aus der Werkstatt, das Radio unten in der Kabine und das ferne Dröhnen des Verkehrs auf der Autobahnbrücke – war das Knattern eines angelassenen Dieselmotors zu hören.
»Verdammt, ich muss los!«, sagte sie. Sie verstaute das Päckchen Tabak in ihrer Tasche und zündete sich die schmale Zigarette an, die sie soeben selbst gedreht hatte. »Gegen sieben oder acht? Wann?«
Ich zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. So gegen sieben? Lasagne klingt gut, aber mach dir keine Umstände.«
»Ich mach mir keine Umstände. Liam hat sie zubereitet.«
Joanna winkte mir noch einmal zu, sprang eilig von der Brücke auf den Ponton und rannte trotz ihrer schweren Stiefel über die grasbewachsene Uferböschung zum Parkplatz hinauf. Der Ford Transit machte kleine Sätze nach vorn, so als könnte er es kaum erwarten wegzufahren.
Um vier Uhr war die Kabine endlich fertig. Ein leerer Raum, aber zumindest ein holzgetäfelter. Die Wände waren verkleidet, die Schlafkoje an der hinteren Wand unter dem Bullauge eingebaut. Dort, wo die Matratze hinsollte, befanden sich zwei Falltüren mit runden Öffnungen im Holz,, die zu einem Lagerraum führten. Der Rest war mit hellem Holz verkleidet, Fußleisten verdeckten Verbindungsstücke und Winkel. Wenn es erst mal einen richtigen Anstrich hat, wird es auch nicht mehr so nach Sauna aussehen, dachte ich. Schon nächstes Wochenende würde es einen ganz anderen Eindruck machen.
Die Beseitigung des Mülls meiner letzten Schreineranstrengungen dauerte länger als gedacht. Für das Werkzeug hatte ich Kisten. Ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, sie wegzuräumen, seit ich vor Monaten mit dem Schlafzimmer begonnen hatte.
Ich zerrte sie unter dem Bug hervor und durch eine Luke in den höhlenartigen Raum darunter. Drei Stufen. Ich achtete darauf, mir den Kopf nicht an der niedrigen Decke zu stoßen, und verstaute die Kisten am Rand.
Erst auf meinem letzten Gang, als ich den schwarzen Plastiksack mit den Stoffen aus der Essnische holte und ihn in den vorderen Bereich warf, ertappte ich mich dabei, wie ich nachsah, ob der Karton in der hintersten Ecke noch da war. Ich konnte ihn im Dämmerlicht ausmachen, das von oben aus der Kabine kam; mit schwarzem Filzstift war darauf vermerkt: KÜCHENSACHEN.
Plötzlich verspürte ich den Drang nachzusehen, ob noch alles drin war. Natürlich, sagte ich mir. Natürlich war noch alles drin. Seit du den Karton dort hingestellt hast, war niemand mehr hier unten.
Gebückt lief ich über die drei Holzpaletten, die als Fußboden dienten, stützte mich am Bootsrumpf ab und hockte mich neben den Karton. KÜCHENSACHEN. Zwei Drittel davon war Krempel, den ich aus der Londoner Wohnung mitgebracht hatte – Pfannenwender, Holzkochlöffel, eine Teekanne von Denby mit einem Sprung im Deckel, ein Quirl, ein kaputter Mixer, eine Eiskelle und verschiedene ineinandergesteckte Keksdosen. Darunter befand sich eine Pappschicht, die bei flüchtiger Betrachtung aussah wie der Kartonboden und von weiteren Nachforschungen abhalten sollte.
Ich klappte den Deckel wieder zu und schob die andere Lasche darunter.
Dann zog ich mein Handy aus der hinteren Jeanstasche. Ich rief das Adressbuch auf, in dem nur einzige Nummer gespeichert war: GARLAND. Mehr stand da nicht. Dabei war das noch nicht mal sein Name. Es wäre ein Leichtes gewesen, auf die kleine grüne Taste zu drücken und ihn anzurufen. Doch was hätte ich ihm sagen sollen? Vielleicht konnte ich ihn einfach fragen, ob er heute Abend kommen wollte. »Dylan, komm zu meiner Party! Es werden nur ein paar enge Freunde da sein. Ich würde dich gerne sehen.«
Was würde er sagen? Er würde sauer und gleichzeitig bestürzt sein, dass ich das Telefon benutzt hatte, obwohl er mir das ausdrücklich untersagt hatte. Es diene ausschließlich dazu, dass er mich anrufen könne und auch nur dann, wenn er zur Abholung bereit sei – und keine Minute vorher. Würde mich jemand anders darauf anrufen, dürfe ich nicht drangehen.
Ich schloss kurz die Augen und dachte sehnsüchtig an ihn. Dann schaltete ich das Handy wieder aus, damit es nicht aus Versehen irgendeine Nummer wählen konnte und schon gar nicht seine, steckte es in meine Tasche und ging zurück in die Kabine.
2
Malcolm und Josie waren die Ersten und kamen um sechs. Sie hatten zum Plaudern vorbeigeschaut und blieben gleich da. Ich war an Deck und schüttete gerade die Eiswürfel, die ich im Supermarkt besorgt hatte, in eine große Plastikkiste, als Malcolm auf seinem Kanalboot das Klirren der Bierflaschen hörte. Sekunden später stand er mit drei Flaschen französischem Rotwein unterm Arm auf dem Ponton und unterhielt sich in aller Seelenruhe mit mir.
»Wir haben noch viel mehr, falls es knapp werden sollte, Genevieve«, sagte Josie, als sie an Bord kamen. »Wir waren letztes Wochenende in Frankreich und haben uns schon für Weihnachten eingedeckt.«
»Ich dachte, ihr trinkt keinen Wein«, sagte ich und reichte Malcolm den Flaschenöffner, mit dem er sein erstes Bier köpfte.
»Tun wir eigentlich auch nicht«, erwiderte Malcolm. »Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, warum wir so viel gekauft haben.«
Ich machte, so gut es ging, sauber. Es hätte besser sein können, aber die gröbste Unordnung hatte ich beseitigt, und so schlimm sah die Kombüse nun auch wieder nicht aus. Maureen hatte mich zum Supermarkt mitgenommen, anschließend war ich mit dem Taxi und zwei Kisten Bier, mehreren Säcken Eiswürfel, riesigen Tüten Chips und einem dicken Stück Käse, den ich in diesem Moment für eine gute Idee gehalten hatte, nach Hause gefahren. In Sachen Partysnacks-Zubereitung war ich keine große Leuchte – doch zumindest gab es reichlich Alkohol.
Josie hatte Knoblauchbrot in Alufolie mitgebracht. »Ich dachte, das backen wir in deinem Ofen auf«, sagte sie.
»Ich wollte ihn eigentlich nicht anmachen. Bei den vielen Leuten wird es hier brütend heiß.«
Malcolm, der selbst ernannte Experte in diesem Raum, der mir in den vergangenen Monaten mehr als genug Ratschläge über das Leben auf einem Hausboot erteilt hatte, schnaubte. »Du frierst nachts, wenn du den Ofen nicht anmachst.«
Kurz starrten wir alle auf den Holzofen, der auf großen Ziegeln in einer Ecke der Hauptkabine stand. Noch war es nicht kalt, doch Malcolm lag nicht ganz falsch – es war nicht gerade schön, um vier Uhr morgens zitternd vor Kälte im Bett zu liegen.
»Ich mache ihn an, wenn du willst«, sagte Malcolm schließlich. »Ihr Damen geht besser an Deck und bewundert den Sonnenuntergang.«
Auf dem Weg durch die Küche nahm ich den Flaschenöffner mit und dachte, dass die beiden Bierflaschen noch nicht so kalt waren wie gewünscht, aber immerhin fast, während Josie irgendeine Bemerkung über den Mann machte, den wir zurückließen, damit er Feuer machen konnte. »Das liebt er! Wir werden uns irgendwann eine Zentralheizung einbauen, aber er schiebt es immer wieder vor sich her. Er stapelt sogar im Sommer Holzscheite, nur für den Fall, dass es ein wenig kühl wird. Demnächst wird er noch einen Baum auf dem Sportgelände fällen.«
Ich sah zur Scarisbrick Jean hinüber, dem schmalen Boot von Malcolm und Josie, das sie sich mit ihrer Katze Oswald teilten. Kurz nachdem ich eingezogen war, hörte ich sie immer wieder über Aunty Jean reden und glaubte, es sei noch eine dritte Person an Bord, bis ich begriff, dass Aunty Jean der Kosename für ihr Boot war. Ein netter Name. Vielleicht sollte ich mir auch einen Kosenamen für mein Boot überlegen.
Als ich das Boot zum ersten Mal gesehen hatte, wusste ich auf Anhieb, dass es das richtige war. Der Preis entsprach zwar nicht ganz meinem Geldbeutel, doch nachdem ich eine Finanzspritze bekommen hatte, konnte ich mir Boote ansehen, die zunächst nicht infrage gekommen waren. Das Boot musste renoviert werden, doch der Rumpf war in Ordnung und die Kabine einigermaßen erträglich. Ich konnte es mir gerade noch leisten und rechnete damit, ein Jahr für die Renovierung zu brauchen, vorausgesetzt, ich ging sparsam mit meinem Geld um und machte alle Arbeiten selbst.
»Revenge of the Tide. Was für ein seltsamer Name für ein Boot«, hatte ich an dem Tag gesagt, an dem ich beschlossen hatte, einen Großteil meiner Ersparnisse darin zu investieren. Cameron, der Werftbesitzer und Bootsmakler, hatte neben mir auf dem Ponton gestanden. Er war kein gewiefter Geschäftsmann; er hatte es eilig gehabt, wollte den unzähligen anderen Tätigkeiten nachgehen, die auf ihn warteten. Er war von einem Fuß auf den anderen getreten und hatte sich gerade noch beherrschen können zu sagen: Wollen Sie es jetzt oder nicht? Für ihn war es schon ein tolles Geschäft, dass ich mich bereits in das Boot verliebt hatte.
Die Revenge of the Tide war ein knapp dreiundzwanzig Meter langer Frachtkahn vom Typ Hagenaar, benannt nach den Grachten von Den Haag, weil er niedrig genug war, um unter den Brücken hindurchzupassen. Er war 1903 in den Niederlanden gebaut worden und ein wahres Monstrum von Boot, ein echtes Arbeitstier. Die Segelmasten waren entfernt und nach dem Zweiten Weltkrieg durch einen Dieselmotor ersetzt worden. Das Boot war im Hafen von Rotterdam zum Warentransport eingesetzt worden, bis es in den 1970er-Jahren verkauft und über den Ärmelkanal gebracht worden war. Seitdem hatten die Besitzer ständig gewechselt, die es mit unterschiedlichem Aufwand und Erfolg als Lastkahn, Ausflugs- oder Hausboot genutzt hatten. »Der Besitzer hat das Boot kurz vor seiner zweiten Scheidung gekauft«, hatte Cam gesagt. »Er hat seine Alte reingelegt, indem er alle seine Ersparnisse in das Boot gesteckt hat. Vermutlich wollte er sie nur Revenge nennen, doch das wäre ein bisschen zu offensichtlich gewesen, also hat er sie Revenge of the Tide genannt.«
»Vielleicht sollte ich den Namen ändern«, hatte ich gemurmelt, als Cam mich zum Unterschreiben des Kaufvertrags in sein Büro führte.
»Das geht nicht. Es bringt Unglück, wenn man ein Schiff umtauft.«
»Unglück? Was gibt es Schlimmeres, als einem Boot den Namen einer gescheiterten Ehe zu geben?«
Cam hatte das Gesicht verzogen.
»Wie dem auch sei, der letzte Besitzer hat den Namen doch auch geändert, oder?«
»Ja. Und jetzt lässt er sich gerade zum dritten Mal scheiden und muss das Boot verkaufen, um die Scheidung zu finanzieren. Was schließen Sie daraus?«
Also ließ ich den Namen, wie er war, denn ich wollte in meinem Leben nicht noch mehr Unglück heraufbeschwören. Außerdem hatte die Revenge Charakter, eine Seele: An Bord eines solch majestätischen, wunderschönen Bootes zu wohnen, gab mir ein wenig Sicherheit und sorgte dafür, dass ich mich nicht ganz so einsam fühlte. Es behütete mich und schützte mich vor fremden Blicken. Schiffe sind eigentlich weiblich, doch für mich war die Revenge männlich: ein großer, ruhiger Gentleman, der auf mich aufpassen würde.
»Und, wann kommen deine Freunde aus London?«, fragte Josie.
»Ach, irgendwann. Vermutlich spät.«
Josie war wie ein warmes Kissen: bunt und flauschig. Auf der schmalen Bank hatten wir kaum Platz. Ihr langsam grau werdendes Haar versuchte sich mit Hilfe des Windes aus dem Pferdeschwanz, zu dem sie es gebunden hatte, zu befreien. Immerhin schien jetzt die Sonne, der frühe Abendhimmel über uns war blau, einzelne weiße Wolken schwebten dahin.
»Wa,s glaubst du, werden sie von uns halten?«
»Ich mache mir mehr Gedanken darüber, was ihr von ihnen halten werdet.«
Ein paar Tage nachdem ich auf das Boot gezogen war, hatte ich meinen Kopf aus dem Steuerhaus gesteckt und war von Malcolm begrüßt worden. Er hatte in Boxershorts auf dem Dach der Scarisbrick Jean gesessen und eine Selbstgedrehte geraucht. Es war gerade erst hell geworden, und die Frühlingsluft war so kalt, dass Malcolms Atem in kleinen Wolken aus seinem Mund kam. Die Haare standen ihm an einer Seite vom Kopf ab
»Alles klar?«, hatte er mir zugerufen.
»Guten Morgen«, hatte ich gesagt und war gleich wieder runtergegangen, bis die Neugier dann doch wieder von mir Besitz ergriffen hatte. »Und, bei Ihnen da drüben auch alles klar?«
»Ja«, hatte er gesagt und lange und tief an seiner Zigarette gezogen »Und bei Ihnen?« So als wäre es völlig normal, um fünf Uhr morgens in Unterwäsche auf einem Bootsdach zu sitzen. Damals hatte ich seinen Namen noch nicht gewusst. Ich hatte ihn natürlich immer kommen und gehen sehen, und wir hatten uns ein paar Mal zugenickt und gegrüßt, doch irgendwie fühlte es sich seltsam an, die Morgendämmerung mit einem Mann zu teilen, der bis auf diesen grauen Fetzen praktisch nackt war.
»Ist Ihnen nicht kalt?«
»Oh«, hatte er geantwortet, und langsam schien auch ihm zu dämmern, dass er halb nackt war. »Ja, verdammt kalt. Aber ich kann nicht reingehen, weil Josie gerade gekackt hat und das ganze Boot danach stinkt.«
In den ersten Tagen als Bootsbesitzerin hatte sich das Leben im Jachthafen angefühlt, als wäre ich in einem fremden Land. Der Lebensrhythmus war deutlich langsamer. Ging jemand einkaufen, rief er einem zu, ob man was brauchte. Manchmal kam auch jemand unerwartet vorbei, setzte sich an Deck, redete drei Stunden über irgendwas und ging dann wieder, manchmal sogar ganz plötzlich, als wären ihm die Gesprächsthemen ausgegangen oder etwas Dringendes dazwischengekommen. Manchmal brachten die Leute auch etwas zu essen oder zu trinken mit. Sie halfen einem bei Reparaturen, auch wenn das zu Reparierende nicht unbedingt repariert werden musste. Sie gaben einem Ratschläge, welche Chemikalien man benutzen sollte, damit die Toilette richtig funktionierte. Und sie lachten viel.
Manche Boote gehörten Leuten, die nur am Wochenende und bei Regenwetter noch seltener zum Hafen kamen. Ein ziemlich heruntergekommenes englisches Kanalboot gehörte einem Mann, der noch zerzauster aussah als Malcolm. Ich hatte ihn erst zwei Mal gesehen. Beim ersten Mal hatte ich ihm im Vorbeigehen ein fröhliches Hallo zugerufen, doch anstelle einer Antwort hatte er mich nur angestiert. Beim zweiten Mal war er mit einer schweren Einkaufstüte voller Flaschen über den Parkplatz gegangen.
Und dann war da noch Carol-Anne. Sie wohnte in einem Kabinenkreuzer, der eigentlich nicht im Jachthafen vor Anker hätte liegen dürfen, doch sie kam trotzdem damit durch, weil sie schon immer dort gewohnt hatte. Sie war geschieden und hatte drei Kinder, die in Chatham bei ihrem Vater lebten. Sie grüßte meistens und versuchte einen dann in stundenlange Gespräche über die Widrigkeiten des Lebens zu verwickeln. Alle anderen Bootsbewohner bemühten sich, ihr nach wenigen Wochen aus dem Weg zu gehen, genau wie ich.
Aber der Rest war wunderbar.
Joanna war einmal mit einem vollen Teller zum Abendessen vorbeigekommen. »Hast du schon gegessen? Gut, wir haben zu viel gekocht.«
Wir hatten uns zusammen in die Essnische gesetzt, Joanna hatte ein Bier aus meinem Kühlschrank getrunken, und zwar direkt aus der Flasche, während ich mich über den Shepherd’s Pie mit Erbsen hermachte.
»Ich bin es nicht gewohnt, dass mir Leute Essen vorbeibringen«, hatte ich anschließend gesagt.
Joanna hatte nur mit den Schultern gezuckt. »Das ist keine große Sache. Ich bin froh, dass ich es nicht wegwerfen muss.«
»Die Leute hier sind sehr freundlich«, hatte ich gesagt und gleichzeitig gemerkt, wie maßlos untertrieben das war. Man hatte das Gefühl, eine einzige große Familie zu sein.
»Ja, bei Bootsbesitzern ist das so. Man gewöhnt sich nach einer Weile daran. Das ist in London natürlich anders, was?«
Allerdings!, hatte ich gedacht.
Meine Freunde aus London und die vom Jachthafen zusammenzubringen, war kein einfaches Unterfangen, das leicht in einer Katastrophe hätte enden können: Sie hatten nichts gemeinsam, von der Tatsache einmal abgesehen, dass Simon samstags ab und zu den Guardian las. Lucy würde mit ihrem panzerartigen Luxusgeländewagen hier aufkreuzen, der irrsinnig viel Benzin verbrauchte und nie über den Highway M25 herausgekommen war; Gavin würde unglaublich teure Designerschuhe tragen, die der Matsch um das Hafenbecken völlig ruinierte.
Und dann war da noch Caddy. Ob sie überhaupt auftauchen würde?
Irgendwann einmal würde die Revenge of the Tide ein tolles Partyboot abgeben und genügend Leuten Platz bieten, die sich kennenlernen und ineinander verlieben wollten – aber nicht jetzt. Falls tatsächlich alle kamen, mussten ein paar an Deck sitzen, andere würden vermutlich nie einen Fuß unter Deck setzen – es gab einfach nicht genügend Platz. Sie würden darüber lachen, dann zur Hauptstraße zurückkehren und in den Pub gehen. Die anderen Bootsbewohner würden ein paar Kommentare über die Städter abgeben, viel lachen, noch mehr Bier trinken und schon früh auf ihre Boote zurückkehren.
Sie würden bald hier sein. Josie schloss die Augen und atmete tief durch, während langsam die Sonne unterging. Ein zufriedenes Lächeln huschte über ihr Gesicht, als befände sie sich nicht auf einem holländischen Frachtkahn auf dem Medway, sondern würde sich auf einer Jacht im Mittelmeer sonnen.
»Wir werden sie schon mögen«, sagte sie schließlich. »Sie gefallen uns bestimmt, außer sie sind total versnobt.«
Mir war es mittlerweile völlig egal, was meine Freunde aus der Stadt dachten. Doch Anfang des Jahres war mir das noch sehr wichtig gewesen. Da hatte es noch eine Rolle gespielt, was ich dachte, was ich trug, was ich sagte, welche Musik ich hörte, in welchen Pubs ich nach der Arbeit etwas trinken ging und was ich an den Wochenenden machte. London ist ein großes soziales Netzwerk, man kann in Bars und Clubs, im Fitnesscenter, bei der Arbeit, bei Veranstaltungen, in Parks und im Theater, bei Salsa-Tanzabenden und in den Pubs Leute treffen. Man verbringt genügend Zeit mit ihnen, um herauszufinden, ob man auf der gleichen Wellenlänge ist, und weiß irgendwann, ob man sie als Freunde bezeichnen kann. Die Leute kommen und gehen, und irgendwie scheint das nie richtig von Bedeutung zu sein.
Es gab immer noch andere, mit denen man ausgehen konnte, irgendwelche Einladungen zu irgendwelchen Partys oder Treffen. Ich kannte entsprechend viele Leute, und in London hätte man sie wohl als Freunde oder Kumpel bezeichnet. Aber waren sie das wirklich? Waren das Leute, die man im Notfall anrufen konnte? Würden sie einem beistehen, wenn man krank oder in Gefahr war? Würden sie einen beschützen, wenn man beschützt werden musste?
Dylan bestimmt. Dylan hatte das auch schon getan.
»Das sind keine richtigen Snobs. Aber vermutlich werden sie schon ein wenig verblüfft sein. Ich glaube, sie erwarten ein schwimmendes Luxusapartment.«
»Unsinn – du hast tolle Arbeit geleistet!«
»Aber es liegt noch viel vor mir. Und nichts auf diesem Boot ist neu. Leider haben diese Leute keinen Sinn für recycelte Sachen.«
»Wirklich? Aber dein Boot sieht doch toll aus. Und du hast es ganz alleine hergerichtet. Nur wenige von uns haben das getan.«
»Zumindest setzt bald die Flut ein.«
Noch ruhte der Rumpf bequem auf einer Schlammbank. Sobald die Flut einsetzte, würde das Boot mit dem Wasser steigen und abhängig vom Wetter bestimmt sechs Stunden auf dem Wasser schaukeln, bis die Ebbe wieder einsetzte. Das Boot sah besser aus, wenn es schaukelte, außerdem roch der Schlamm nicht unbedingt angenehm.
Josie sah zum Ponton rüber. »Wer ist denn das?«
Der funkelnde Wagen mit Allradantrieb, der auf den Parkplatz des Jachthafens gefahren war, kündigte die Gäste aus London an. Und wie sich herausstellte, saßen darin auch die meisten. Lucy sprang als Erste heraus. Sie hatte sich dazu durchgerungen, Jeans und Stiefel anzuziehen, obwohl selbst die hohe Absätze hatten. Sofort versank sie damit in der weichen Erde, und von Deck aus hörten wir, wie sie »Fuck!« kreischte.
Hinten stiegen Gavin und Chrissie aus, dann noch jemand vom Beifahrersitz, den ich zuerst nicht erkannte, ihn dann aber in all seiner Pracht zu sehen bekam, sobald er um die mächtige Motorhaube herumgegangen war.
»Das glaube ich nicht!«, murmelte ich.
»Oh, der sieht aber gut aus«, sagte Josie.
»Das ist Ben.«
»Wie, der Gutaussehende?«
»Ja. Der im Jackett ist Gavin. Ich habe mal mit ihm zusammengearbeitet. Die Blondine ist Lucy, die andere heißt Chrissie und ist Model.«
Ich erhob mich und winkte. Ben erkannte mich als Erster und winkte zurück, dann liefen alle über den Parkplatz zum Jachthafen hinunter, wobei sie irgendwelche Sachen mitschleppten. Gavin verschwand fast hinter einem riesigen Blumenstrauß. »Dafür brauchst du eine große Vase«, flüsterte Josie.
»Hm. Irgendwo müsste ich noch eine Milchflasche haben.«
Wir lachten uns verschwörerisch zu, und ich fragte mich kurz, warum ich überhaupt beschlossen hatte, so eine Party zu veranstalten. Das war wie das Aufeinandertreffen zweier Welten, zweier unterschiedlicher Planeten, die ich bewohnte – der eine war vorher mein Zuhause gewesen, der andere jetzt. Ich stand mit je einem Fuß darin und fühlte mich, ehrlich gesagt, in keiner so richtig wohl.
»Hallo!«, Lucy war am Ende des Pontons angekommen und schaute skeptisch zu uns hinüber. »Kann man darauf laufen?«
»Klar«, sagte Ben und ging an ihr vorbei. »Dürfen wir an Bord?«
Er stand am Fuß des schmalen Stegs. Selbst von hier aus konnte ich sehen, wie blau seine Augen blitzten.
»Natürlich«, sagte ich. »Kommt rauf!«
Er kam an Bord und griff nach meiner Hand, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, obwohl er das gar nicht nötig gehabt hätte. So hatte er einen Grund, mich zu umarmen und an sich zu ziehen.
»Ich wusste gar nicht, dass du auch kommen würdest«, sagte ich.
»Das wusste ich selbst nicht mal. Ich war bei Lucy, und sie hat gesagt, ich dürfe mich anschließen. Das macht dir doch nichts aus?«
»Natürlich nicht.«
»Äh, hallo, würde mir mal jemand behilflich sein?«
Ben streckte seine Hand nach Lucy aus, und sie stöckelte gefolgt von Chrissie und Gavin zum Steg.
»Leute, darf ich vorstellen? Josie.«
Josie stand ein wenig unbeholfen auf. »Hi. Ich wohne auf dem Boot da hinten.« Sie zeigte auf die Scarisbrick Jean, die einsam und ein wenig zur Seite geneigt im Schlick lag. Oswald faulenzte auf dem Dach, genoss die Abendluft, hatte ein Bein elegant in die Luft gestreckt und leckte dabei sein Hinterteil.
»Oh, cool«, sagte Lucy. »Das ist ein … äh … ein hübsches Boot.«
Es folgte eine Pause, und genau in dem Moment, als diese peinlich zu werden drohte, stand Malcolm in der Tür des Steuerhauses, wischte sich mit einem verrußten Handrücken über die schweißnasse Stirn und sagte: »Ich habe das Knoblauchbrot auf den Ofen gelegt. Alles klar?«
3
Je weiter der Abend voranschritt, desto besser wurde er, und das war eine große Erleichterung. Als ich die erste Führung hinter mir hatte, waren Carla und Simone gerade mit Zug und Taxi angekommen. Nach der zweiten waren Boot, Deck und Ponton voller Leute. Die Gäste vom Jachthafen waren den Städtern zahlenmäßig überlegen und brachten die Party in Schwung.
Joanna und Liam kamen mit Lasagne und zwei ganzen Käsekuchen vorbei, Maureen und Pat brachten noch mehr Bier, Roger und Sally ein Fässchen selbst gebrautes Bier und eine Tasche selbst gebackenes Brot. Diane und Steve kamen ohne ihre Kinder, dafür mit einem Babyfon, das ziemlich gut funktionierte, denn ihr Boot lag nur ein paar Meter entfernt. Joanna hatte als Geschenk zusätzlich eine Lichterkette mitgebracht, die natürlich um das Deck gewunden wurde und dem Boot in der Dämmerung ein festliches Aussehen verlieh.
Von Caddy fehlte dagegen nach wie vor jede Spur. Ich überlegte, ob ich die Einladung freundlich genug ausgesprochen hatte. Lange war sie in London die einzige Person gewesen, die einer engen Freundin am nächsten kam. Ich vermisste sie und wollte sie wiedersehen. Wenn ich schon Dylan nicht einladen konnte, dann wenigstens Caddy. Doch sie hatte es offenbar nicht geschafft.
Seit meinem Abgang hatte ich nur ein paar Mal mit ihr gesprochen. Sie hatte mir immer noch nicht ganz verziehen, dass ich so Hals über Kopf auf und davon war. Wenn ich sie anrief, schien sie ein paar Minuten zu brauchen, um aufzutauen, bevor wir entspannt genug waren, um zu lachen.
»Was für eine Party?«, hatte sie gefragt.
»Ach, du weißt schon, einfach nur eine Party. Vielleicht, um das Boot vorzuführen.«
»Kommen auch ein paar nette Männer?«
Ich hatte mir kurz Malcolm vorgestellt. »Na ja …«
»Oh, na schön. Ich denke schon. Simse mir die Adresse.«
»Wie läuft’s im Club?«, fragte ich wie immer.
»Alles in Ordnung. Zurzeit ist es ziemlich ruhig. Letzte Woche haben ein paar neue Mädchen angefangen – die meisten sind beschissen. Es gibt keine echte Konkurrenz mehr.«
Darauf war eine Pause gefolgt. Sie wusste genau, was ich eigentlich wissen wollte und ließ mich immer zappeln. Manchmal zwang sie mich dazu, sie direkt danach zu fragen; manchmal erbarmte sie sich meiner.
»Dylan war nicht oft im Club. Fitz hat irgendeinen Job für ihn, nehme ich an.«
»Wie geht es ihm?«
»Er ist wie immer schlechter Laune.«
Und dann lachte sie.
Wo steckte sie bloß?
Ich saß eingepfercht zwischen Malcolm und Joanna in der Essnische und war aus irgendeinem Grund in ein langwieriges Gespräch mit Lucy über das Toilettensystem verstrickt, darüber, wie es funktionierte.
»Und was ist mit der Dusche?«, rief Lucy über das Stimmengewirr hinweg. Joanna backte Brot in der Kombüse auf und knallte auf der vergeblichen Suche nach einem Backblech mit den Schranktüren.
»Was soll damit sein?«, sagte Malcolm provozierend. Er hatte einen Haartick – er benutzte niemals Shampoo, was für ihn offenbar kein Problem darstellte, wurde aber pampig, wenn er das Gefühl hatte, dass ihn jemand für schmuddelig oder ungepflegt hielt.
»Na ja«, sagte Lucy, »um es mal ganz deutlich zu sagen: Das ist nur ein Schlauch.«
»Ich weiß, dass das ein Schlauch ist«, sagte ich. »Es wird aber nicht immer nur ein Schlauch bleiben.«
Mein Gott, ich bin betrunken, dachte ich. Ich bin jetzt schon betrunken.
Ich sah auf meine Uhr. Caddy müsste längst da sein. Warum kam sie nicht?
Währenddessen sagte Malcolm: »Die meisten Leute haben Bäder an Bord, aber für den Notfall gibt es eine Dusche unweit des Büros. Die ist wirklich sauber.«
»Oh, so wie auf dem Campingplatz?«, sagte Lucy, obwohl sie, abgesehen von einem zweieinhalbtägigen Ausflug nach Glastonbury, nie auch nur den Fuß in die Nähe eines Campingplatzes gesetzt hatte. Und selbst in Glastonbury war sie ins Hotel gegangen.
»Ja, so ähnlich. Nur sauberer«, sagte Malcolm.
»Hör mal, ich werde schon noch ein Bad bauen. Eines mit einer richtigen Badewanne«, sagte ich, damit sie nicht glaubte, das Bad würde für immer eine Baustelle bleiben.
Malcolm hustete.
»Bis Weihnachten ist es fertig, das schwör ich euch!. Und draußen in meinem Wintergarten werde ich eine Dusche anbringen.«
»Du wirst was?«
»Ich habe vor, hinter dem Schlafraum ein Schiebedach anzubringen. Ich habe an die drei Quadratmeter Deckfläche, die ich in eine Freiluftdusche umwidmen kann. Außerdem wird es direkt am Bug noch einen weiteren Raum geben – für ein Büro, ein Extrazimmer oder sonst irgendwas.«
»Das klingt nach harter Arbeit«, sagte Joanna und lächelte mitfühlend.
»Das passt schon«, erwiderte ich. »Es hetzt mich ja niemand.«
»Und wie sieht es mit dem Geld aus? Fünf Monate ohne Einkommen würden mich umbringen«, sagte Lucy.
Weil du dein ganzes Geld in Klamotten steckst, dachte ich insgeheim. »So schlimm wird das auch wieder nicht. Ich habe noch Ersparnisse.«
»Ich dachte, die hättest du alle ins Boot gesteckt?«
»Nicht alle.«
Eine Pause entstand. Ich wartete nur darauf, dass sie es wagte, noch was zu sagen. Malcolm sah von mir zu Lucy und wieder zu mir.
»Was für einen Job hattest du denn in London?«, fragte er.
»Vertrieb«, sagte ich, noch bevor Lucy etwas sagen konnte. »Hast du schon mal was von SAP gehört? Dabei handelt es sich um große Softwarelösungen; man verkauft sie an multinationale Konzerne und versucht dann, ihnen immer mehr Zubehör zu verkaufen. Du weißt schon, so was wie Buchhaltungs-, Personalführungsmodule und so weiter.«
Malcolms Augen wurden glasig.
»Im Grunde geht es um Vertrieb«, fuhr ich fort. »Es ist egal, was man vertreibt – es funktioniert immer gleich. Nur dass wir unter besonders großem Druck gestanden haben, weil wir unsere Kunden auf der Führungsebene gewinnen und sie dazu überreden mussten, Tausende von Pfund auszugeben.«
»Und neunzig Prozent unserer Kunden sind Männer«, mischte Lucy sich ein. »Sogar das gesamte Vertriebsteam besteht nur aus Typen, die uns einreden wollen, es gäbe keine ungleiche Behandlung der Geschlechter mehr. Aber genau die gibt es beim Vertrieb von SAP, das kannst du mir glauben.«
Malcolm hörte schon nicht mehr zu, dafür war Joanna noch beim Thema. »Wart ihr denn die einzigen Frauen im Vertriebsteam? Aus wie vielen Leuten bestand das Team?«
»Aus zwanzig Personen«, sagte Lucy. »Und wir waren die ersten Frauen, die überhaupt jemals eingestellt worden sind. Wir waren wie die ersten Mädchen, die ins Baumhaus gelassen werden.«
»Ich wette, das war bestimmt nicht leicht«, sagte Joanna.
»Das ist es immer noch nicht«, erwiderte Lucy. »Nur dass ich jetzt das einzige Mädchen im Baumhaus bin, nachdem Genevieve uns verlassen hat.«
Joanna und Malcolm sahen mich beide erstaunt an.
»Ich hatte die Nase voll«, sagte ich. »Ich wollte nur das Geld für das Boot zusammenkriegen und anschließend kündigen.«
»Das muss ein guter Job gewesen sein, wenn du so viel verdient hast, dass du dir ein Boot davon kaufen konntest.«
Lucy fiel mir ins Wort, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte. »Na ja, eigentlich hatte Genevieve ja zwei Jobs, nicht wahr, Gen?«
»Aber das meiste habe ich im Vertrieb verdient«, flunkerte ich.
»Genevieve hat in einem Club gearbeitet«, sagte Lucy. Sie sah mich direkt an, mit einem undurchdringlichen Gesichtsausdruck.
Mein Gesicht wurde heiß. Auf der anderen Seite der Kajüte sah ich, wie Ben sich mit Diane unterhielt; beide lachten. Er war so groß, dass er fast schon gebückt dastehen musste, obwohl der Raum fast zwei Meter hoch war. Er sah fantastisch und gleichzeitig unerreichbar aus.
Oben an der Treppe tauchte Liam auf. »Joanna? Wo ist denn das Ding für den Käsekuchen?«
»Was für ein Ding? Du meinst wohl einen Tortenheber?«
»Genau, Tortenheber, was auch immer. Hast du einen?«
Sie verließ die Essnische, wühlte in der Kombüse in der Schublade herum und warf alles durcheinander.
»Dort am Haken hängt ein großer Bratenwender«, sagte ich.
Joanna nahm den Wender, fuchtelte wie mit einer Waffe damit herum, ging die Treppe hinauf und half beim Käsekuchen.
»Du hast in einem Club gearbeitet? In einer Art Bar?«, fragte Malcolm plötzlich hellwach.
Ich sah Lucy an, doch die bemerkte nichts oder tat so als ob.
»Genevieve war Tänzerin«, sagte Lucy triumphierend. »Hat sie dir das nicht erzählt? Sie war sogar ziemlich gut. Zumindest habe ich das gehört. Ich war nämlich nie in dem Club, in dem sie gearbeitet hat – das sind eher Männerlokale, wenn du verstehst, was ich meine.«
Malcolm riss die Augen auf. Zicke!, dachte ich. Ich wünschte, ich hätte sie nicht eingeladen. Caddy kam offensichtlich nicht, sonst wäre sie längst hier gewesen. Bis zu diesem Moment war mir gar nicht klar gewesen, wie sehr ich mir wünschte, sie wiederzusehen. Außerdem wäre sie bei Diskussionen über die Moral oder die feministischen Aspekte des Tanzens eine gute Verbündete gegen Lucy gewesen – mit Caddy hätte sich niemand angelegt.
»Hattet ihr jemals so eine Art Vorahnung … Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll«, sagte ich eher zu mir als zu den beiden. »So, als könnte jeden Moment etwas Schreckliches passieren? Ich habe das heute schon den ganzen Tag.«
»Mir passiert das auch manchmal«, sagte Lucy. »Meistens nach zwei Uhr morgens, wenn ich immer noch trinke und weiß, dass ich am nächsten Tag um sieben raus und zur Arbeit gehen muss.«
Das hob ein wenig die Stimmung, trotzdem hatte ich keine Lust mehr, hier sitzen zu bleiben und mich länger mit Lucy zu unterhalten. Wenn sie noch weitere Einzelheiten über meine Vergangenheit preisgeben wollte, konnte sie das gerne ohne mich tun. Ich entschuldigte mich, Malcolm rückte beiseite und ließ mich vorbei. Ich schob mich an den Leuten in der Kombüse vorbei und ging hinauf an Deck.
Ich sah zum Parkplatz hinüber und hoffte, Caddy aus einem Taxi steigen zu sehen. Doch alles war ruhig. Josie saß mit dem Rücken ans Steuerhaus gelehnt, neben ihr Roger und Sally und ausgerechnet Gavin, der sein Jackett und die handgefertigten italienischen Schuhe ausgezogen hatte, barfuß im Schneidersitz bei ihnen saß und ihnen von der Zeit erzählte, als er noch reiste und in Thailand versehentlich seinen Pass verkauft hatte. Zwischen ihnen stand auf einem Eimer das Fässchen mit selbst gebrautem Bier, von dem sie sich eifrig bedienten.
»Hier«, sagte Ben hinter mir und reichte mir ein weiteres Bier.
»Oh, danke.«
Der Abend war irgendwie surreal. Wir gingen um das Steuerhaus herum und sahen zur Brücke hinüber, deren Lichter sich im Wasser spiegelten. Der Wind hatte nachgelassen. Vom anderen Ufer war das dumpfe Hämmern der Musik aus dem Nachtclub zu hören.
»Ich habe mich seit Monaten nicht mehr betrunken«, sagte ich.
»Ich weiß nicht, seit wann ich mich nicht mehr betrunken habe. Seit Tagen? Wohl eher seit Stunden«, sagte Ben.
Wir saßen auf dem Kajütendach.
»Du hast mir gefehlt«, sagte er.
Ich musste lachen. »Du Schwindler!«, antwortete ich. »Dir fehlt nie irgendwas.«
Er sah mich ein wenig beleidigt an, aber ich wusste, dass das nur gespielt war. Trotz der Leute und trotz allem, was in der Vergangenheit zwischen uns vorgefallen war, hatte er es darauf angelegt, die Nacht hier zu verbringen.
»Du hast das mit dem Boot toll hingekriegt«, sagte er.
»Danke.«
»Das Schlafzimmer gefällt mir.«
Siehst du?, dachte ich.
»Ich mag die Dachluke. Es muss herrlich sein, nachts darunter zu liegen und in den Sternenhimmel zu schauen.«
Ich lächelte. »Eigentlich ist er ja eher beleuchtet. Lichtverschmutzung ist nicht nur in London ein Thema.«
»Ich wollte nur romantisch sein.«
»Ich weiß, und das warst du auch, Ben. Aber vergiss nicht, dass ich dich kenne. So was zieht bei mir nicht mehr.«
»Genevieve! Was soll denn das?«
»Und das fragst du auch noch? Ich habe dich mit diesem Mädchen gesehen, als du eigentlich mit mir ausgehen wolltest. Hast du das vergessen?«
Die Worte kamen mir jetzt leicht über die Lippen. Doch damals hatte es mir das Herz gebrochen.
Ben schüttelte den Kopf. »Herrgott, du vergisst wirklich nichts. Aber das habe ich nicht gemeint. Ich meinte, was in London passiert ist. Du bist so plötzlich verschwunden. Niemand wusste, wo du steckst. Lucy hat schon gedacht, du bist entführt worden.«
»Nichts ist passiert. Übertreib nicht.«
»Genny, du hast einfach gekündigt und bist gegangen. Du bist mehr oder weniger geflohen.«
»Wer hat dir das denn erzählt?«
»Na, wer wohl? Lucy natürlich. Sie meinte, das sei das Aufregendste, das jemals bei euch im Büro passiert sei. Du seist einfach während eines Meetings bei deinem Boss hereingeplatzt und hättest ihm dein Kündigungsschreiben auf den Tisch geknallt. Dann hättest du deinen Mantel genommen und seist gegangen. Sie hat gesagt, sie hätte deinen Schreibtisch leer räumen müssen. Als sie vorbeikommen und dir deinen Karton bringen wollte, seist du schon mitten im Umzug gewesen.«
Eine Weile schwieg ich. Dieses Gefühl von Unruhe machte sich wieder breit. Die Flut hatte eingesetzt, in ein paar Stunden würde sie ihren höchsten Stand erreicht haben. Das Boot bewegte sich bereits, allerdings nur leicht, und die Revenge wiegte mich tröstend. Doch trotz der vielen Leute an Bord hatte ich das Gefühl, als stimmte etwas nicht.
Aus der Dachluke neben uns kam freundliches Geplauder aus der Kombüse, das aber unterschwellig immer hitziger wurde. Joanna und Malcolm auf der einen und Lucy und Simone auf der anderen Seite.
»Ich habe nur gesagt …«
»Ich weiß genau, was du gesagt hast, und ich weiß auch, wie du es gemeint hast.« Das klang nach Joanna.
»Ihr seid doch alle gleich, ihr habt ja keine Ahnung …«, das klang nach Malcolm, der von zu viel billigem Bier bereits lallte. »Ihr denkt alle, dass wir minderwertig sind, nur weil wir auf einem Boot wohnen, während ihr euch für ein Haus entschieden habt …«
»Ich habe nichts dergleichen gesagt!«
»Ach, und warum hast du dann ständig vom Bad gefaselt? Ich sag dir mal was: Wenn dieses Boot fertig ist, wird es wie ein Palast aussehen, und ihr werdet vor Neid erblassen.«
Lucy lachte. »Irgendwie glaube ich das nicht.«
Ich saß oben an Deck und griff mir an den Kopf. »Oh, Gott. Ich wusste, dass es ein Fehler war.«
Ben nutzte die Gelegenheit und legte einen Arm um meine Schultern. »Genny, die sind bloß betrunken. Morgen ist alles wieder vergessen.«
»Ben! Wo zum Teufel steckst du?« Lucy stapfte in ihren hochhackigen Stiefeln die lackierte Kiefernholztreppe zum Steuerhaus hinauf. »Gavin? Komm, wir gehen in den Pub.«
»Willst du, dass ich bleibe?«, fragte Ben leise. Ihn hatte sie noch nicht entdeckt.
»Nein«, sagte ich. »Geh mit, das ist schon in Ordnung.«
»Ich könnte später zurückkommen.«
Seine Stimme klang so hoffnungsvoll, dass ich kurz zu ihm aufsah. Ich bräuchte einfach nur Ja zu sagen, dachte ich. Dann könnte ich heute Nacht das Bett mit ihm teilen und ihn morgen früh in den Zug nach London setzen. Würde eine Nacht mit Ben wehtun? Fünf Monate nach Dylan, fünf lange Monate voller Hoffnung, dass er wieder Kontakt zu mir aufnehmen würde. Ich fehlte ihm offensichtlich nicht so sehr wie er mir.
»Wo zum Teufel steckt Ben?«, sagte Lucy.
»Was ist los, Prinzessin?«, fragte Gavin und stand auf.
»Ich will woanders hingehen!«
»Trink das hier!«, sagte Roger besänftigend. »Dann geht es dir gleich besser, versprochen.«
»Was ist das?«, fragte Lucy misstrauisch.
»Zaubertrank«, sagte Gavin und kicherte.
»Was?«
»Nein, im Ernst, Luce. Versuch es mal. Ich habe noch nie so was getrunken, ehrlich: Man hat das Gefühl, die Erde, den Mond und die Sterne zu trinken …«
»Gavin, was bist du nur für ein Idiot! Du hast wieder einen Joint geraucht, stimmt’s? Hast du nicht behauptet, das Zeug wäre alle?«
»Rog hat mich mal ziehen lassen. Aber ich kann dir sagen, Prinzessin Lucy Loo, der Zug am Joint war nicht annähernd so gut wie das Zeug hier. Nimm.«
»Bäh! Das schmeckt ja widerlich!«
Gelächter von Steuerhaus und Deck.
Ben küsste mich. Er hatte mein Gesicht in beide Hände genommen und küsste mich, bevor ich mich dagegen wehren, Nein sagen oder weggehen konnte. Darin war er gut. Ich spürte, wie meine Hemmungen, meine Entschlossenheit und mein Widerstand langsam nachließen. Ich brauchte ihm bloß zu sagen, dass er später wiederkommen sollte. Niemand würde etwas davon merken. Die Chancen standen nicht schlecht, dass die anderen Bootsbewohner in der kommenden Stunde oder so einfach auf ihre Boote verschwinden würden. Waren Lucy und die anderen Londoner erst mal im Pub, um anschließend nach Rochester, Maidstone oder aus Verzweiflung vielleicht sogar nach London zurückzufahren, würde die Werft still und verlassen daliegen, und niemandem würde auffallen, wenn er zurückkäme; niemand müsste je etwas davon erfahren …
»Ben! Da bist du ja!«
Der Kuss endete abrupt. Lucy starrte mich streng an, als wäre ich schuld daran, dass sie so furchtbar von diesem Flussbewohner beleidigt worden war, von dem Mann mit den wirren Haaren und dem Mädchen mit dem blauen Auge. Doch dass sie mich jetzt mit Ben im Halbdunkel sah, seine Lippen auf den meinen und seine Hand unter meinem Top, brachte das Fass endgültig zum Überlaufen.
»Bleibst du hier oder kommst du mit?«, fragte Lucy kühl.
Bevor er etwas sagen konnte, war ich schon aufgestanden. »Du solltest lieber gehen«, sagte ich leise.
»Warum?«
Lucy war gegangen, um die anderen zusammenzutrommeln, einschließlich Simone und Carla. Vermutlich erwartete sie, dass sie im Kofferraum Platz nehmen würden.
Ich zuckte unmerklich die Achseln.
»Hast du einen anderen?«
»Ich führe ein anderes Leben.«
Er versuchte es erneut mit einem gewinnenden Lächeln. »Es muss ja nicht gleich wieder was Ernstes sein, Genny. Nur noch eine Nacht. Komm schon, du willst mich doch auch, oder?«
Ich musste wider Willen lachen.
»Klingt verlockend, Ben, aber ich bin lieber allein als mit dir auf dem Boot, und sei es nur für eine Nacht. Trotzdem, danke.«
Schließlich gab er auf. »Wie du willst«, sagte er, kehrte mir den Rücken zu und machte sich auf die Suche nach Lucy.
Sie gingen, versprachen anzurufen oder SMS zu schicken, es gab Umarmungen, lobende Bemerkungen über den herrlichen Abend und wie schade es sei, dass er schon wieder zu Ende sei. Und während ich alle der Reihe nach an mich drückte, amüsierten sich die Bootsbewohner weiterhin mit Bier, angeregten Gesprächen und den letzten Bissen von Liams Lasagne.
Während ich ihnen nachwinkte und der Bewegungsmelder das Parkplatzlicht angehen ließ, stolperte Lucy über irgendetwas und fiel aufs Gesicht – zum Glück aufs Gras. Malcolm stieß ein johlendes Gelächter aus.
Kurz darauf gingen auch Diane und Steve. Über das Babyfon hatten sie unmissverständlich gehört, dass die Kinder aus dem Bett gekrabbelt waren und irgendein Computerspiel spielten – entweder das, oder ihr Boot war von Terroristen gestürmt worden, die auf alles schossen, was sich bewegte.
Unten in der Hauptkajüte wurde inzwischen über unverfänglichere Themen geredet.
Joanna reichte mir ein Bier.
»Komm, setz dich zu uns!«, sagte sie.
»Tut mir leid, dass sie so ungalant waren«, erwiderte ich.
»Sie waren nicht ungalant.«
»Im Großen und Ganzen waren sie in Ordnung«, meldete sich Malcolm zu Wort, der Lucy offenbar bereits verziehen hatte.
»Danke«, sagte ich. »Ihr seid rührend.«
»Ich finde, du hättest diesen Ben vögeln sollen«, sagte Josie und kicherte.
»Was?«
»Denkst du, wir haben dich nicht gehört? Er hat förmlich darum gefleht.«
»Ja, schon ein wenig, oder?«
Sie gab mir einen heftigen Stups. »Ich hätte ihn nicht von der Bettkante gestoßen«, sagte sie.
»He, du Luder!«, sagte Malcolm. »Wenn du so weitermachst, wirst du auf dem Dach pennen müssen.«
Ich lachte. »So toll ist er nun auch wieder nicht. Ben, meine ich.«
»Oh, hattest du den schon mal?«, fragte Josie.
»Ja, den hatte ich schon mal.«
»Und, ist er nicht gut? Verdammt. Wer hätte das gedacht? Für mich sah er aus wie der Richtige.«
Ich dachte kurz darüber nach. Eine solche Unterhaltung hatte ich nicht unbedingt eingeplant.
»Ich will gar nicht behaupten, dass er nicht gut ist«, sagte ich. »Er ist bloß niemand, den ich immer um mich haben möchte.«
»Hast du einen anderen?«, fragte Joanna.
»Nicht wirklich. Im Moment bin ich einfach lieber allein. Bei alldem, was auf dem Boot noch so zu tun ist …«
»Ah, das Boot«, sagte Roger. »Sie ist bereits mit dem Boot verheiratet. Das ist uns allen so gegangen. Du hast mir das neue Zimmer noch gar nicht gezeigt.«
»Sieh es dir an«, sagte ich. »Wirf einen Blick hinein.«
Malcolm übernahm die Führung und zeigte Roger das neu vertäfelte Zimmer, während ich noch eine Flasche Bier leerte. Zu viele, dachte ich. Das Feuer im Holzofen glühte vor sich hin, und es war warm im Raum, seit die Tür zum Steuerhaus geschlossen war. Wir saßen alle mit angezogenen Beinen da und spürten, wie das Boot leicht auf dem Wasser schaukelte und uns einlullte.
Mir fiel auf, dass ich nicht mehr an Caddy gedacht hatte, seit Ben mit mir geflirtet hatte. Wo war sie nur? Vielleicht hatte sie doch noch arbeiten müssen.
»Wir sollten das öfter tun«, sagte Josie schläfrig.
»Das sagen wir immer«, erwiderte Sally. Sie hatte sich wie ein kleines Kind auf dem großen Sofa zusammengerollt und ihre Füße unter eine Decke geschoben, die ich bei einer Wohlfahrtsorganisation gekauft hatte.
»Ich mag dein Boot«, sagte Joanna. »Wusstest du das? Du hast von uns allen das beste Boot.«
Diese Unterhaltung führten wir regelmäßig – wer das beste Boot besaß und warum. Wir schienen nie zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen.
»Mir gefällt die Souvenir am besten«, sagte ich.
Sally lachte. »Das sagst du nur, weil du lieb und nett bist.«
»Mir gefällt die Souvenir auch«, sagte Joanna. »Ich glaube, die Souvenir ist momentan das beste Boot, aber wenn Genevieve erst den Wintergarten mit dem Glasschiebedach hingekriegt hat, wird die Revenge das beste Boot sein.«
»Da hast du recht«, sagte Sally. »Einen Wintergarten können wir nicht toppen. Wir haben nur drei Blumentöpfe und einen Schrebergarten in Rochester.«
»Gen, was willst du an Deck eigentlich anpflanzen? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht?«
Ich überlegte, ob Josie mich so umständlich fragen wollte, ob ich für sie und Malcolm Cannabis anbauen würde, doch noch bevor ich darauf antworten konnte, kamen Malcolm und Roger wieder zurück.
»Wusstest du, dass Liam in deinem Bett schläft, Genevieve?«
»Verdammt«, sagte Joanna. »Ich habe mich schon gewundert, wo er die ganze Zeit steckt, und gedacht, er hätte sich wieder aufs Boot verpisst.«
Sie stand auf und ging ins Zimmer, um ihren Freund aus seinem Bierschlummer zu wecken.
»Wir sollten jetzt gehen«, sagte Malcolm. »Morgen wird ein anstrengender Tag.«
»Ach ja?«, fragte ich. »Was habt ihr denn vor?«
»Wir müssen Klamotten besorgen«, sagte Josie. »Meine Nichte heiratet bald, und Malcolm hat mir versprochen, dass er mit mir shoppen geht.«
»Und bevor du fragst«, sagte Malcolm, obwohl niemand von uns etwas gesagt hatte, »Ich werde mir vor der Hochzeit die Haare schneiden lassen, okay?«
4
Kurz darauf verließen alle über den Ponton mein Boot und wankten auf ihre Boote und in die Wärme ihrer Holzöfen zurück.
Nachdem ich das Steuerhaus verriegelt hatte, blieb ich noch im Aufenthaltsraum sitzen, starrte benebelt in die Ofenglut und leerte meine letzte Flasche Bier. Ich versuchte, nicht an Ben zu denken, und fragte mich, wo die Londoner wohl gerade waren. Seine Telefonnummer hatte ich nicht, das war schon einmal gut. Vermutlich wäre ich sonst schwach geworden und hätte ihm eine SMS geschickt. Aber wie verzweifelt hätte das erst gewirkt?
In der Kombüse sah es furchtbar aus – überall standen Flaschen, Gläser und schmutzige Teller herum. Der Fußboden war mit Krümeln vom Knoblauchbrot übersät. Joanna und Liams leere Lasagneformen standen in der Spüle, an ihren Rändern klebten verbrannte Krusten. Ich überlegte, wie lange ich sie wohl schrubben musste, damit ich sie ihnen in einigermaßen sauberem Zustand wieder zurückgeben konnte.
Etwas drückte gegen mein Bein …
Ich griff in meine Jeanstasche, und da war es, Dylans Handy. Ich klickte mich wieder einmal durch das Menü bis zu den Kontakten. GARLAND. Warum ausgerechnet dieser Name? Es ist doch nur ein Name, hatte er gesagt. Er sollte zufällig wirken. Ein Name, der niemandem verdächtig vorkam, falls das Handy in falsche Hände geriet.
»Und was ist, wenn ich Kontakt zu dir aufnehmen will?«, hatte ich gefragt.
»Warum solltest du Kontakt zu mir aufnehmen wollen?«
Er ahnte nicht, wie es um meine Gefühle stand. Damals war ich mir ihrer selbst noch nicht sicher gewesen. Ich wusste nur, dass ich mir kaum vorstellen konnte, ihn nicht zu sehen.
»Und was ist, wenn irgendwas schiefläuft?«, hatte ich gefragt.
»Es wird schon nichts schieflaufen.« Er war ungeduldig geworden. »Alles wird gut gehen, das verspreche ich dir. Nichts wird schiefgehen. Wenn ich so weit bin und alles erledigt habe, rufe ich dich an, und wir treffen uns irgendwo. In Ordnung?«
Das war vor über fünf Monaten gewesen. Die ganze Zeit über hatte ich das Telefon stets bei mir getragen, es immer wieder aufgeladen und niemals verwendet. Nicht ein Mal.
Unbeholfen warf ich das Handy auf das Holzregal hinter dem Sofa. Es hatte keinen Sinn, hier zu sitzen und an Dylan zu denken. Egal, wo er gerade war – bestimmt dachte er nicht mehr an mich.
Ich hatte die Toilette erst heute Morgen sauber gemacht, doch jetzt war sie wieder voll, und alles staute sich. Bootsbesitzer hätten sie niemals so hinterlassen. Ich war unglücklich und fühlte mich einsam. Ich hätte Ben nicht zurückweisen sollen. Es wäre schön gewesen, ihn einfach nur hier zu haben. Er war zwar nicht Dylan, aber immerhin.
Ich machte das Licht aus und kroch ins Bett.
Ich träumte vom Handy, von Dylans Handy. Es klingelte, GARLAND erschien auf dem Display, als wollte es signalisieren, dass das der Anruf war. Doch immer, wenn ich auf die grüne Taste drückte, um das Gespräch anzunehmen, passierte nichts.
Ich wurde immer wieder wach, öffnete die Augen und sah zum dunklen Viereck über mir empor. Auch Ben kam in meinem Traum vor. Er lag neben mir.
»Das mit den Sternen war gelogen«, sagte er.
Ich sah zur Dachluke voller Sterne hinauf, die so hell leuchteten, dass sie wie ein einziges blendendes Licht auf uns herabschienen.
Dann öffnete ich tatsächlich die Augen, und es war immer noch dunkel. Der Himmel war voller Sterne – ich konnte sie sehen, aber sie leuchteten nur schwach.
Ich vertrage keinen Alkohol, dachte ich.
Inzwischen war ich hellwach, weil ich auf die Toilette musste. Da fiel mir wieder ein, dass mein Klo verstopft war, aber ich wollte nicht mitten in der Nacht zu den Duschen laufen, also krabbelte ich in den Lagerraum unter dem Bug und suchte nach dem Eimer, in dem ich den Klebstoff gemischt hatte. Ich setzte mich drauf, ließ ihn dann im Bad stehen und ging zurück ins Bett.
Ich lag eine Weile da und lauschte auf das Wasser, das gegen den Rumpf schlug. Bald würde es hell werden und die Ebbe einsetzen, dann würde das Boot wieder regungslos auf dem Schlamm liegen.
Doch neben dem Schwappen der Wellen war noch ein anderes Geräusch zu hören, ein sanftes Stoßen, so als wäre das Boot mit dem Bug gegen den Ponton geprallt oder ein Puffer wäre durch eine plötzliche Woge hochgeschoben worden und dann zurück an den Rumpf geknallt. Zunächst ignorierte ich das Geräusch. Doch es kehrte in gleichmäßigen Abständen immer wieder – wurde Teil der typischen Bootsgeräusche, des klatschenden Wassers.
Das sanfte Stoßen wurde zu einem hartnäckigen Hämmern, irgendwas schrammte am Rumpf entlang. Ich war wieder wach, lauschte auf das Geräusch und versuchte, es zu identifizieren. Es klang, als hätte sich etwas direkt neben meinem Schlafzimmer zwischen Ponton und Boot geklemmt. Doch die Flut ging zurück, was bedeutete, dass es nicht weggeschwemmt würde. Es würde dort weiterhämmern, bis der Rumpf ganz auf dem Schlamm saß. Und das würde noch Stunden dauern.
Seufzend setzte ich mich im Bett auf und lauschte. Das Klopfgeräusch ging mit den ans Boot schlagenden Wellen einher. Irgendwas berührte mein Boot, etwas, das groß genug war, um so ein Geräusch zu verursachen. Was konnte das sein? Ein Plastikbehälter?
Fröstelnd schlüpfte ich in der Dunkelheit in meine Jeans und zog einen Pulli aus der Schmutzwäsche. Im Boot war es jetzt kalt, der Ofen schon lang erloschen. Direkt hinter der Falltür zum Lagerraum lag meine starke, durch Gummi geschützte Taschenlampe. Ich hatte mal eine Maglite-Lampe besessen, doch die war mir in der ersten Woche auf dem Boot ins Wasser gefallen, und ich hatte sie nicht mehr gefunden. Eine der ersten Weisheiten, mit denen Malcolm aufgewartet hatte, lautete: »Befestige an allem, was dir wichtig ist, einen Schwimmer.«
Frierend öffnete ich die Tür zum Steuerhaus. Hier oben war es bitterkalt, der Himmel leuchtete fahl. Ich zog meine Schlappen an, die neben dem Steuerrad standen; sie waren feucht und kalt, aber das war immer noch besser, als barfuß über die nassen Planken zu laufen.
Weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. Die Boote im Hafen lagen ruhig im Dunkeln da. Die Boote diesseits des Pontons hoben und senkten sich mit der einsetzenden Ebbe, und die in Ufernähe saßen bereits auf der Schlammbank des Flusses.
Zu meinem Erstaunen hörte ich auf dem Parkplatz plötzlich ein Geräusch – war das eine Autotür? Dann wurde ein Wagen angelassen, und Reifen knirschten auf dem Kies. Seine dunklen Umrisse waren kurz zu sehen, als er den Parkplatz verließ. Weder die Bremslichter noch die Scheinwerfer waren an. Warum fuhr das Auto ohne Licht? Und warum war trotz der Bewegungsmelder die Parkplatzbeleuchtung nicht angegangen? Mir fiel ein, dass sich mal irgendwer bei Cam beschwert hatte, weil das Parkplatzlicht in seine Kajüte fiel, sobald sich Füchse bei den Mülltonnen herumtrieben. Die Lösung hatte darin bestanden, die Mülltonnen zu verschieben. Wenn also jemand auf den Parkplatz kam, hätten die Lichter doch angehen müssen?
Alles war still, nur das Plätschern des Wassers war zu hören. Selbst von der Autobahnbrücke war kein Lärm zu vernehmen. Da war es wieder, das leise Stoßen, begleitet von einem sanften Plätschern, wenn eine Welle darüberschlug. Es musste sich um etwas Großes handeln.
Ich kroch auf der Hafenseite das Seitendeck entlang und hielt mich dabei an der Kajüte fest. Ich war immer noch ein wenig betrunken, und vom sanften Schaukeln des Bootes wurde mir übel.