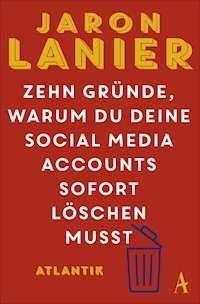9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Jaron Laniers Essays erstmals als Buch - ein einzigartiger Einblick in den Ideenkosmos des großen Internetvisionärs Mit Kreativität und visionärem Blick, der nie kulturpessimistisch ist, sondern sich aus dem Wissen um Chancen und Fluch der neuen Technologien speist, denkt er diese in die Zukunft weiter. Lanier, der als Vater des Begriffs »Virtuelle Realität« gilt, hat 1983 sein erstes Computerspiel entwickelt. 1985 machte er sich mit Freunden selbstständig, um Technologien für die neue, virtuelle Welt zu entwickeln. Ab der Jahrtausendwende hat sich Lanier dann zunehmend kritisch mit den Heilversprechen der digitalen Welt auseinander gesetzt. Seine Forschungen und Entdeckungen hat er von Beginn an mit Essays begleitet, in denen er seine Errungenschaft in ihren Implikationen für die Gesellschaft überprüft und einen Blick in die Zukunft richtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Ähnliche
Jaron Lanier
Wenn Träume erwachsen werden
Ein Blick auf das digitale Zeitalter
Aus dem amerikanischen Englisch von Friedrich Pflüger, Heike Schlatterer, Sigrid Schmid, Violeta Topalova
Essays und Interviews 1984–2014
Hoffmann und Campe
Vorwort
Mit meinem Buch will ich nachzeichnen, wie sich die Meinung eines Menschen ändern kann. Ein Meinungswechsel ist ein wunderbares Phänomen, das viel zu selten dokumentiert wird. In diesem Buch sind Essays und Interviews gesammelt, die zeigen, wie es zu einem Meinungsumschwung kommt, und zwar bei mir. Vielleicht nützt das auch anderen.
Mein Sinneswandel war ziemlich drastisch und verstörend, denn gerade als ich anfing umzudenken, wandte sich plötzlich die ganze Welt einer Denkweise zu, die ich einst mit formuliert und populär gemacht hatte.
Vielleicht ist das gar nicht so überraschend. Ich habe im Leben schon oft festgestellt, dass sich das Erwünschte nach einer langen Auseinandersetzung genau in dem Moment einstellt, in dem man seine alten Wünsche hinter sich gelassen hat. Vielleicht soll es ja so sein.
Wie bin ich hier gelandet?
In jüngster Zeit werde ich manchmal als »radikaler« Autor zum Thema Internet und technologieverwandter Fragen bezeichnet, obwohl ich mich selbst als gemäßigt und pragmatisch betrachte.
Wenn die alten Ideen funktioniert hätten, würde ich sie immer noch unterstützen. Aber stattdessen musste ich feststellen, dass das Leben heute viel anstrengender und zugleich absurder ist als früher. Ich mache mir Sorgen, dass mit der zunehmenden Digitalisierung immer mehr Menschen in eine düstere wirtschaftliche Zukunft blicken. Und deshalb gehe ich nun einfach wieder zurück ans Zeichenbrett und belebe Optionen neu, die wir Digitalfans damals in unserer anfänglichen Begeisterung nicht in Betracht gezogen haben.
Ist es »radikal«, wenn man die Wahrheit erkennt, wenn man sieht, was funktioniert und was nicht? Heute findet man beispielsweise die weitverbreitete Ansicht, dass viele Leute gut von der »Sharing Economy« leben, aber wenn man genauer hinschaut, wird man feststellen, dass nur ein winziger Bruchteil tatsächlich dauerhaft Geld verdient. Warum soll man die Wahrheit nicht aussprechen? Das ist zwar nie einfach, sollte aber auch nicht als radikal gelten, auch wenn es vielleicht bequemer ist, zu lügen.
Ich habe nicht den Wunsch, zu schockieren. Allerdings bin ich in einer ungewöhnlichen Position und sage Dinge, die all diejenigen aufschrecken, die in einem Klima aufgewachsen sind, in dem die Digitalisierung als der Trend schlechthin gilt.
Nach meinen Vorträgen kommen manchmal technikbegeisterte junge Leute auf mich zu und sagen: »Sie äußern immer Ihre Meinung, ohne sich darum zu kümmern, was die Leute sagen werden. Wie schaffen Sie das?« Solche Fragen sind ein bisschen traurig und besorgniserregend. Ich bin keinen gewalttätigen Drohungen ausgesetzt wie manch andere Autoren. Aber der soziale Druck kann dennoch gewaltig sein.
Der digitale Diskurs bewegt sich fast immer in einem bestimmten Rahmen, der mir jedoch langweilig und hoffnungslos erscheint. Der Grund dafür ist nicht in Unterdrückung zu suchen, sondern in einer neuen Form der allgemeinen Konformität.
Ich schreibe natürlich auch, um meine Leserinnen und Leser von etwas zu überzeugen, aber ich mache mir wenig Gedanken darüber, ob sie mir tatsächlich zustimmen. Viel wichtiger ist mir, dass sie selbstständig denken.
Mein Buch dient hoffentlich noch anderen Zwecken. Es war die Idee meines deutschen Verlags, ein Buch mit meinen Essays zu veröffentlichen, nachdem mir der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen worden war. Dieser Preis ist in der deutschsprachigen Welt eine ziemlich große Sache. Viele Leute waren schockiert, dass ein Preis, den man mit früheren Preisträgern wie Albert Schweitzer oder Martin Buber in Verbindung bringt, jemandem wie mir verliehen wurde, einem Vertreter der Technologie-Kultur.
Das Buch soll also auch einen Eindruck vermitteln, wer dieser Autor ist, der Träger eines Preises, der normalerweise Personen verliehen wird, die sich auf ganz anderen Wegen für die Würde des Menschen einsetzen.
In jüngster Zeit bin ich in gewissen Kreisen eher als »Kritiker« oder sogar Nestbeschmutzer bekannt geworden, doch über viele Jahre hinweg war ich ein begeisterter Erfinder, Impulsgeber und Förderer der Technologie. Bevor die Überwachungswirtschaft Fuß fasste und ich anfing, sie zu kritisieren, wurde ich recht häufig als »Prophet« der Technologie beschrieben. Ein peinlicher Begriff, den ich selbst nie verwenden würde.
Gemeint war damit vermutlich, dass ich begeistert von etwas schwärmte, was damals noch völlig neu war – die virtuelle Realität. Wenn ich darüber sprach, hatte das einen mythischen und spirituellen Unterton. Heute bin ich älter und sehe die Sache nüchterner, doch meinen anfänglichen Enthusiasmus spüre ich nach wie vor. Ich liebe die Technologie noch immer. Ich habe immer noch große Freude daran, vor allem an der virtuellen Realität.
Daher finden sich im Buch Essays und Interviews aus den frühen Jahren, aber auch aus allerjüngster Zeit, denn in letzter Zeit ist das Interesse an der virtuellen Realität noch einmal enorm gestiegen. Ich hoffe, dass Leser, die sich für virtuelle Realität interessieren, Vergnügen an den Schnappschüssen aus ihrer Entstehungszeit haben.
Mit meiner Essaysammlung möchte ich aber auch vermitteln, wie die Informatik einen positiven, kreativen Zugang zur Welt und zum Leben bieten kann. Dafür wurden einige meiner ungewöhnlicheren Essays in die Sammlung aufgenommen, satirische Texte wie der Vorschlag, Zeitungsarchive in die DNA von Küchenschaben einzupflanzen oder Sterne zu verlegen und künstliche Sternbilder zu erschaffen, um den Kontakt zu Außerirdischen zu erleichtern.
Ich kann mir nichts Absurderes vorstellen als den Kampf um eine bessere Welt, wenn man dabei den Spaß vergisst. Deshalb übe ich nicht nur Kritik und äußere meine Befürchtungen, sondern schreibe auch über das, was mir Freude macht.
Aber zuerst kommt meine Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels.
Jaron Lanier, im Dezember 2014
Der »Hightech-Frieden« braucht eine neue Art von Humanismus
Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels
Dieser geschichtsträchtige Preis darf nicht mir allein gelten. Ich kann ihn nur im Namen der Weltgemeinschaft der digitalen Aktivisten und Idealisten annehmen, auch wenn viele von uns nicht einer Meinung sind.
Ich nehme diesen Preis auch zu Ehren des Lebens von Frank Schirrmacher entgegen, der in unserer Zeit eine Quelle des Lichts gewesen ist. Er wird uns schrecklich fehlen.
Gern würde ich hier eine Rede halten, die zum großen Teil positiv und inspirierend ist, aber als Realist bin ich gezwungen, manchmal etwas dunkler zu werden. Wenn man dem Realismus genug Vertrauen schenkt, kann man sich durch die Ausläufer der Dunkelheit hindurchbrennen. Denn oft stellt sich heraus, dass auf der anderen Seite das Licht wartet.
Wir leben in einer verwirrenden Zeit. In der entwickelten Welt haben wir so lange Überfluss genossen, dass wir ihn kaum noch zu schätzen wissen. Wir lieben besonders unsere Gadgets, denen wir immer noch Neues abgewinnen können, aber vieles deutet darauf hin, dass wir, wenn wir die Augen weiter öffnen würden, über den Rand eines Abgrunds blickten.
Es tut mir weh, die bekannte Liste der aktuellen Gefahren anzustimmen: zuallererst der Klimawandel; die Spiralen von Bevölkerungswachstum und Abwanderung, die unseren Gesellschaften völlig zuwiderlaufen; unsere Unfähigkeit, für das Versiegen der billigen fossilen Brennstoffe vorzusorgen; die scheinbar unausweichlichen Wellen von Sparmaßnahmen; die unaufhaltbaren Trends von Reichtumskonzentration; der Aufstieg gewalttätiger Extremisten in vielerlei Formen an vielerlei Orten … und natürlich sind all diese Prozesse miteinander verwoben.
Angesichts dessen ist es für viele von uns (und für mich am meisten) natürlich eine Überraschung, dass der diesjährige Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgerechnet an eine Figur wie mich verliehen wird, die mit dem Aufstieg der digitalen Technologien assoziiert wird. Sind digitale Spielzeuge nicht mehr als der flüchtige Schaum auf den großen, dunklen Wellen?
Digitale Errungenschaften haben auf jeden Fall geräuschvolle Veränderungen in unsere Kultur und Politik gebracht.
Fangen wir mit den guten Nachrichten an. Wir haben einen ersten Blick darauf erhascht, was eine digital effiziente Gesellschaft sein könnte, und trotz der Absurdität der Überwachungswirtschaft, für die wir uns scheinbar bisher entschieden haben, dürfen wir nicht vergessen, dass es auch viel Positives gibt.
Wie sich zeigt, kann Abfall systematisch reduziert werden, genau in dem Moment, da wir den Klimawandel noch wirksamer bekämpfen müssen. Wir haben festgestellt, dass sich Sonnenenergie viel effektiver nutzen lässt, als viele für möglich gehalten hätten, indem sie an ein intelligentes Netz gekoppelt wird, um zuverlässig zur Verfügung zu stehen. Das ist genau die Art von positiven Optionen, die meine Kollegen und ich uns von einer digitalen Vernetzung erhofft hatten.
Doch die praktischen Hoffnungen für digitale Netzwerke werden von einem symbolischen, fast metaphysischen Projekt begleitet. Die digitale Technik wird in unserer Zeit als maßgeblicher Kanal des Optimismus überfrachtet. Und das, nachdem vor ihr so viele Götter versagt haben. Was für ein sonderbares Schicksal für ein Phänomen, das als sterile Ecke der Mathematik begonnen hatte.
Trotzdem ist digitaler Kulturoptimismus nicht verrückt. Wir haben neue Muster der Kreativität gesehen und vielleicht sogar ein paar neue Fühler der Empathie gefunden, die sich über frühere Barrieren wie Entfernung und kulturelle Fremdheit hinausstrecken. Diese freudigen Ereignisse wurden inzwischen erschöpfend gefeiert, aber sie bleiben eine Tatsache. Um ein triviales persönliches Beispiel zu geben: Wie herrlich, dass ich heute mit Oud-Spielern1 auf der ganzen Welt in Verbindung stehe, mit denen ich über das Internet für Konzerte proben kann. Es macht einen Riesenspaß.
Ich habe ein paar der guten Dinge erwähnt, doch wenn wir unser digitales Spielzeug verwenden, unterwerfen wir uns bekanntermaßen der billigen und beiläufigen Massenspionage und Massenmanipulation. Damit haben wir eine neue Klasse ultra-elitärer, extrem reicher und unberührbarer Technologen erschaffen, und allzu oft geben wir uns mit dem Rausch eines digital effizienten Hyper-Narzissmus zufrieden.
Ich habe immer noch größere Freude an Technologie, als ich ausdrücken kann. Die virtuelle Realität kann Spaß machen und wunderschön sein. Trotzdem stehe ich hier als Kritiker. Denn Widersprüche und Mehrdeutigkeiten zu vermeiden heißt, die Realität zu vermeiden.
Können wir zurücktreten und Bilanz ziehen? Gibt es derzeit mehr digitales Licht oder mehr Dunkelheit?
Dies ist eine Frage, über die Online-Kommentatoren täglich viele tausend Mal nachdenken. Eine Meinung über die Internetkultur abzugeben ist wie ein Tropfen aus einer Pipette auf einen Bürgersteig bei Sturzregen. Jeder, der im Netz das Wort ergreift, weiß, wie es heutzutage ist. Entweder du schließt dich mit denen zusammen, die deine Meinung teilen, oder deine Meinung wird sofort von gewaltigen Klingen in den großen grauen Brei püriert.
In der Online-Welt führen These und Antithese, eine Hand und die andere, nicht mehr zu einer höheren Synthese. Hegel wurde enthauptet. Stattdessen gibt es nur statistische Datenwellen, die unaufhörlich zu erstaunlichen Vermögen zusammengerührt werden von denen, die sie benutzen, um ihren wirtschaftlichen Vorteil auszurechnen.
Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels hat mit Büchern zu tun, also müssen wir uns in der Ära der digitalen Übernahme fragen: »Was ist ein Buch?«
Im Internet gibt es ebenso viele Kommentare über das Internet wie Pornografie und Katzenfotos, aber in Wirklichkeit können nur Medien außerhalb des Internets – insbesondere Bücher – Perspektiven und Synthesen aufzeigen. Das ist einer der Gründe, warum das Internet nicht zur einzigen Plattform der Kommunikation werden darf. Wir haben am meisten davon, wenn es nicht gleichzeitig Subjekt und Objekt ist.
Aus diesem Grund schreibt ein Geschöpf der digitalen Kultur wie ich Bücher, wenn es Zeit ist, einen Blick auf das große Ganze zu werfen. Denn es besteht die Chance, dass ein Leser ein ganzes Buch liest. Zumindest gibt es einen ausgedehnten Moment, den ich mit dem Leser teile.
Wäre ein Buch nicht mehr als ein Erzeugnis aus Papier, könnten wir es nur auf die Art feiern, wie wir Klarinetten oder Bier feiern. Wir lieben diese Dinge, aber es sind eben nur bestimmte Erfindungen, aus denen sich Produkte entwickelt haben, mit ihren jeweiligen Fachmessen und Subkulturen.
Doch ein Buch greift viel tiefer. Es ist die Feststellung eines bestimmten Verhältnisses zwischen einem Individuum und der menschlichen Kontinuität. Jedes Buch hat einen Autor, eine Person, die ein Risiko auf sich genommen hat und eine Verpflichtung eingegangen ist, indem sie sagt: »Ich habe einen wesentlichen Teil meines kurzen Lebens damit verbracht, eine bestimmte Geschichte und einen bestimmten Standpunkt wiederzugeben, und ich bitte euch, dasselbe zu tun, indem ihr mein Buch lest: Darf ich so viel Engagement von euch verlangen?« Ein Buch ist ein Bahnhof, nicht die Gleise.
Bücher sind ein Spiel mit hohem Einsatz, vielleicht nicht in Bezug auf Geld (im Vergleich mit anderen Branchen), doch in Bezug auf Aufwand, Engagement, Aufmerksamkeit, der Bereitstellung unseres kurzen Menschenlebens und unseres Potenzials, positiven Einfluss auf die Zukunft zu nehmen. Autor zu sein zwingt uns zu einer vermenschlichenden Form der Verwundbarkeit. Das Buch ist ein Bauwerk menschlicher Würde.
Das Wesen des Buchs ist Beweis dafür, dass individuelle Erfahrung existenziell für die Bedeutungsebene ist, denn jedes Buch ist anders. Bücher aus Papier sind naturgemäß nicht zu einem kollektiven universalen Buch verquirlt. Seltsamerweise ist für uns der Gedanke normal geworden, es gäbe nur einen Wikipedia-Eintrag für ein humanistisches Thema, für das es absolut nicht die eine optimierte Darstellung geben kann. Die meisten Themen sind keine mathematischen Sätze.
Im Zeitalter des Buchdrucks gab es viele verschiedene Enzyklopädien, von denen jede einen Blickwinkel vertreten hat – und im digitalen Zeitalter gibt es nur eine. Wieso muss das so sein? Es ist keine technische Zwangsläufigkeit, trotz »Netzwerkeffekten«. Es ist eine Entscheidung, die auf dem unbestrittenen, aber falschen Dogma beruht, Ideen selbst sollten mit Netzwerkeffekten gekoppelt werden. (Manche sagen, Wikipedia werde zum Gedächtnis einer globalen künstlichen Intelligenz.)
Bücher verändern sich. Einige der Metamorphosen sind kreativ und faszinierend. Ich bin entzückt von der Vorstellung, eines Tages könnte es Bücher geben, die sich mit virtuellen Welten synchronisieren, und von anderen seltsamen Ideen.
Aber zu viele der Metamorphosen sind unheimlich. Plötzlich müssen wir uns gefallen lassen, überwacht zu werden, um ein E-Book zu lesen! Auf was für einen eigentümlichen Handel haben wir uns da eingelassen! In der Vergangenheit kämpften wir, um Bücher vor den Flammen zu retten, doch heute gehen Bücher mit der Pflicht einher, Zeugnis über unser Leseverhalten abzulegen, und zwar einem undurchsichtigen Netzwerk von Hightech-Büros, von denen wir analysiert und manipuliert werden. Was ist besser für ein Buch: ein Spionagegerät zu sein oder Asche?
Bücher haben uns immer geholfen, die Probleme zu lösen, die wir uns aufgehalst haben. Jetzt müssen wir uns selbst retten, indem wir die Probleme erkennen, die wir den Büchern aufhalsen.
Abgesehen von Büchern geht es bei einem »Friedenspreis« offensichtlich um Frieden, aber was meinen wir mit Frieden?
Ganz sicher muss Frieden bedeuten, dass keine Gewalt und kein Terror benutzt werden, um Macht oder Einfluss zu gewinnen. Aber dem Frieden müssen außerdem schöpferische Eigenschaften innewohnen.
Die meisten von uns wollen keine statische oder stumpfsinnige Existenz akzeptieren, selbst wenn sie frei von jeder Gewalt wäre. Wir wollen nicht die friedliche Ordnung akzeptieren, die uns autoritäre oder aufgezwungene Lösungen vermeintlich bieten, seien sie digital oder altmodisch. Genauso wenig dürfen wir erwarten, dass zukünftige Generationen für immer unsere Version einer nachhaltigen Gesellschaft akzeptieren, ganz gleich wie klug wir sind und wie gut unsere Intentionen.
Frieden ist also ein Puzzle. Wie können wir frei sein, ohne die Freiheit zu missbrauchen? Wie kann Frieden gleichzeitig abwechslungsreich und stabil sein?
Die Kompromisse zwischen Freiheit und Stabilität, die wir erlebt haben, neigen dazu, auf Bestechung zu beruhen – durch stetig wachsenden Konsum. Aber das scheint auch keine langfristige Lösung zu sein.
Vielleicht ließe sich die Gesellschaft durch digitale Boni stabilisieren, das ist zumindest eine Idee, die man im Silicon Valley häufiger hört. Bringt die Leute dazu, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, indem ihr sie mit virtuellen Vergütungen in Videospielen umgarnt. Am Anfang mag es funktionieren, aber dieser Ansatz hat etwas Verlogenes, Gönnerhaftes an sich.
Ich glaube, wir wissen heute einfach noch nicht genug, um Lösungen für das langfristige Puzzle Frieden zu finden. Das mag negativ klingen, aber eigentlich ist es eine ganz klar optimistische Aussage, denn ich glaube, dass wir immer mehr über den Frieden lernen.
Die dunkelste meiner digitalen Ängste betrifft das, was ich den »Rudelschalter« nenne. Es ist die These von einem hartnäckigen Zug des menschlichen Charakters, der sich dem Frieden widersetzt.
Nach dieser Theorie sind die Menschen Wölfe. Wir gehören zu einer Spezies, die als Individuum oder als Rudel funktionieren kann. In uns ist ein Schalter. Und wir neigen dazu, uns immer wieder plötzlich in Rudel zu verwandeln, ohne dass wir es selbst bemerken.
Wenn es eines gibt, was mich am Internet ängstigt, dann dies: Es ist ein Medium, das »Flashmobs« auslösen kann und regelmäßig schlagartig »virale« Trends schafft. Zwar haben diese Effekte bisher noch keinen größeren Schaden angerichtet, aber was haben wir im Gegenzug, um sie zu verhindern? Wenn Generationen heranwachsen, die sich großenteils über globale korporative Cyber-Strukturen wie geschützte soziale Netzwerke organisieren und austauschen, woher wissen wir, wer die Kontrolle über diese Strukturen erbt?
Die traditionelle Definition von »Frieden« bezieht sich auf den Frieden zwischen Rudeln oder Clans, und so ist das »Clangefühl« vielleicht die gefährlichste unserer Sünden. Es zersetzt uns tief im Wesen.
Trotzdem wird Schwarmidentität fast überall als Tugend angesehen. Das Buch der Sprüche im Alten Testament enthält eine Liste von Sünden, darunter Lügen, Mord, Hochmut, aber auch »Hader zwischen Brüdern säen«. Ähnliche Gebote gibt es in allen Kulturen, allen politischen Systemen, allen Religionen, die ich studiert habe. Ich will damit nicht sagen, dass alle Kulturen und Glaubensbekenntnisse gleich sind, sondern dass es eine Gefahr gibt, die uns gemein ist, weil sie in unserer Natur liegt, und die wir abzuwehren lernen müssen. Die Loyalität gegenüber dem Rudel wird immer wieder mit Tugend verwechselt, obwohl – besonders wenn! – Menschen sich selbst als Rebellen sehen. Es tritt immer Rudel gegen Rudel an.
Dies gilt für die Anhänger bestimmter Pop-Richtungen oder Stile digitaler Politik wie für traditionelle Volkszugehörigkeiten, Nationalitäten und Religionen. In der digitalen Kultur zum Beispiel wird schnell diffamiert, wer sich nicht streng genug zum Dogma der »offenen« Netzgemeinde bekennt.
Immer wieder brechen krude »Sünden« wie Habgier oder Rudel-Mentalität hässlich, aber verstohlen durch unsere sorgsam kultivierten Muster des perfekten Denkens – ausgerechnet dann, wenn wir uns einbilden, wir wären nahe an der technischen Perfektion.
Die großartige Idee der Menschenrechte wird in unserer algorithmischen Ära durch Kumpanei zunichtegemacht. Nach Generationen von Denkern und Aktivisten, die für die Menschenrechte kämpften, was ist passiert? Konzerne sind Personen geworden – das hat zumindest das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten entschieden! Ein Menschenrecht ist ein uneingeschränkter Vorteil, also verschwören sich gewiefte Spieler, um für sich und ihre Rudel-Kumpane das Vielfache dieses Vorteils zu errechnen. Was können wir in Amerika noch mit der Idee der Menschenrechte anfangen? Sie wurde ad absurdum geführt.
Ein anderes Beispiel: Ausgerechnet wenn digitale Unternehmen glauben, sie täten das Bestmögliche, um die Welt zu optimieren, stellen sie plötzlich fest, dass sie ein gewaltiges Imperium der Spionage und Verhaltensmanipulation leiten. Man denke an Facebook, das erste große öffentliche Unternehmen dieser Art, das von einem einzigen sterblichen Individuum kontrolliert wird. Facebook steuert heute zum großen Teil die Muster sozialer Verbindungen in der ganzen Welt. Doch wer wird seine Macht erben? Steckt in diesem Dilemma nicht eine neue Art von Gefahr?
In Deutschland hat dieses Thema natürlich ein besonderes Echo. Gern würde ich etwas Tiefgründiges dazu sagen, aber offen gestanden verstehe ich einfach nicht, was passiert ist. Meine Mutter kam aus Wien, und viele ihrer Verwandten fielen dem Bösen und der hochglänzenden Mega-Gewalt des Nazi-Regimes zum Opfer. Als junges Mädchen hat sie schreckliches Leid erlebt und wäre fast selbst gestorben. Wenn mir diese Ereignisse nicht so nahe wären, wenn ich ihre Wirkung gedämpfter zu spüren bekommen hätte, fiele es mir jetzt vielleicht leichter, so zu tun, als würde ich verstehen, was passiert ist, wie es so viele Gelehrte behaupten.
Auch wenn ich viel darüber gelesen habe, finde ich es immer noch unglaublich schwer, die Nazi-Zeit zu verstehen. Auf jeden Fall haben die Nazis bewiesen, dass eine moderne, hochtechnisierte Sensibilität kein Schutz gegen das Böse ist. In dieser Hinsicht verstärkt die Nazi-Zeit meine Sorge, dass das Internet als überlegene Plattform für plötzliche Massengewaltausbrüche von Rudeln oder Clans dienen könnte.
Doch ich glaube auch nicht, dass die strikte Ablehnung von Rudel- oder Clan-Identitäten der beste Weg wäre, die damit verknüpfte Gewalt zu vermeiden. Anscheinend brauchen die Menschen sie. Länder wehren sich in den meisten Fällen dagegen, ihre Identität zugunsten größerer Konföderationen aufzugeben. Nur sehr wenige Menschen sind bereit, als Weltbürger zu leben, von jeder nationalen Bindung losgelöst. Es ist etwas Unwirkliches, Abstraktes an einem solchen Versuch, den menschlichen Charakter zu perfektionieren.
Das Beste wäre vielleicht, wenn jedes Individuum vielen verschiedenen Gruppen angehörte, sodass kaum klare Clans erkennbar wären, die gegeneinander antreten könnten. Während der digitalen Anfänge vor ein paar Jahrzehnten war genau das meine Hoffnung für digitale Netzwerke. Wenn sich in einer besser verbundenen Welt jeder Mensch zu einer verwirrenden Vielfalt von »Teams« zugehörig fühlte, wären die Loyalitäten vielleicht zu komplex, als dass traditionelle Rivalitäten eskalieren könnten.
Das ist auch der Grund, warum mir der Trend sozialer Netzwerke Sorgen bereitet, die Leute in Gruppen zusammenzutreiben, um sie zu besseren Zielscheiben für das zu machen, was sich heute Werbung nennt, in Wirklichkeit wohl eher das Mikromanagement der billigsten Option, der Verlinkung.
Die Welt kommt mir jedes Mal vor wie ein besserer Ort, wenn mir jemand begegnet, der sich mehreren Sportmannschaften verbunden fühlt und sich bei einem Spiel nicht entscheiden kann, zu wem er hält. Dieser Mensch ist begeistert, aber er ist auch verwirrt, plötzlich ist er ein Individuum und kein Teil eines Rudels mehr. Der Schalter wird zurückgesetzt.
Diese Art von Rücksetzung ist interessant, weil es die äußeren Umstände sind, nicht der Ausdruck von Ideen, die die Veränderung des Blicks bewirken, denn genau das passiert in der Technologie ständig.
In der Vergangenheit konnte eine Idee in einem Buch überzeugend oder verführerisch sein, oder sie konnte den Menschen mit Gewehren und Schwertern aufgezwungen werden. Heute aber sind die Ideen in dem Computercode versteckt, mit dem wir unser Leben führen.
Datenschutz ist ein Beispiel dafür. Ganz gleich, was man über Datenschutz denkt, es ist der Code, der in fernen Cloud-Computern läuft, der bestimmt, welche Konzepte von Datenschutz gelten.
Die Idee von Datenschutz hat viele Facetten, breit gefächert und stets schwer zu definieren, doch der Code, der Datenschutz schafft oder verhindert, ist auf banale Weise konkret und allgegenwärtig. Datenschutz ist längst keine persönliche Entscheidung mehr, und damit nicht einmal mehr ein Thema, über das wir im alten Sinn nachdenken können. Nur fanatische Scholastiker verschwenden ihre Zeit mit irrelevanten Fragen.
Das einzig sinnvolle Nachdenken über Datenschutz wäre ein Nachdenken, dass zu Veränderungen im Code führt. Doch wir haben unsere Politik zum großen Teil an ferne Konzerne »outgesourct«, womit es oft keinen klaren Kanal zwischen dem Denken und dem Kodieren gibt, also zwischen dem Denken und der gesellschaftlichen Realität. Programmierer haben eine Kultur geschaffen, in der sie den Regulatoren davonlaufen können.
Wir verlangen von den Regierungen, sich mit größter Vorsicht in die bizarren Prozesse zu begeben, um zu regulieren, wie die Cloud-basierten Konzerne unsere Kommunikation und unsere koordinierten Interaktionen kanalisieren. Doch manchmal unterwandern Programmierer das, wozu die Unternehmen gezwungen wurden, und führen die Regierungseingriffe ad absurdum. Dieses Muster hat sich beim Urheberrecht gezeigt und auf andere Art bei Themen wie dem Recht auf Vergessenwerden und gewissen Bereichen des Datenschutzes, insbesondere der Privatsphäre von Frauen online. (Die derzeitige Praxis privilegiert anonyme Schikanierer gegenüber den Frauen, die schikaniert werden.)
In jedem Fall wollen viele der kreativsten und gutmütigsten Aktivisten nicht, dass Menschen die Möglichkeit haben, sich gegen die »Offenheit« des Netzes zu wehren. Gleichzeitig aber haben viele digitale Aktivisten eine scheinbar unendliche Toleranz gegenüber der gigantischen Ungleichheit, wer von dem allsehenden Auge profitiert.
Big Data schürt die algorithmische Konzentration von Reichtum. Zuerst ist es in der Musik- und Finanzbranche passiert, doch der Trend greift auf jeden zweiten Schauplatz menschlicher Aktivität über. Algorithmen erzeugen keine Garantien, doch sie zwingen nach und nach die breite Gesellschaft dazu, Risiken zu übernehmen, von denen nur einige wenige profitieren. Dies wiederum führt zu Austerität, rigorosen Sparmaßnahmen seitens der Politik. Da Austerität mit einer Sharing Economy gekoppelt ist (denn Sharing liefert die Daten, mit denen die Maschine läuft), erlebt jeder Einzelne, bis auf die winzige Minderheit ganz oben auf den Rechnerwolken, einen graduellen Verlust von Sicherheit.
Diese Entwicklung ist in meinen Augen die bisher größte negative Konsequenz der Netzwerktechnologie. Womit ich ein anderes Problem nicht ignorieren will, das viel mehr Aufmerksamkeit erhalten hat, weil es spektakulärer ist. Denn eine der Nebenwirkungen der algorithmischen Überwachungswirtschaft ist das zwangsläufige Durchsickern der gesammelten Daten in die Computer nationaler Geheimdienste. Das meiste, was wir heute darüber wissen, verdanken wir Edward Snowdens Enthüllungen.
Staatlicher Überwachung entgegenzuwirken ist grundlegend für die Zukunft der Demokratie, aber Aktivisten dürfen nicht vergessen, dass wir es im Moment mit einer Situation zu tun haben, in der durch Mechanismen von ungleicher Wohlstandsverteilung und Austerität die Regierungen zugunsten der Unternehmen geschwächt werden, die die Daten überhaupt einsammeln. Das gilt natürlich nur für Demokratien. Nicht-demokratische Regimes übernehmen die Kontrolle über ihre eigenen Clouds, so wie wir es zum Beispiel in China sehen.
Manchmal frage ich mich, ob wir unsere Demokratien an Technologiefirmen outgesourct haben, damit wir nicht selbst zur Rechenschaft gezogen werden können. Wir geben unsere Macht und unsere Verantwortung einfach ab.
Bevor es zu Missverständnissen kommt, möchte ich Folgendes klarstellen. Ich bin kein Gegner großer Konzerne. Ich mag große Konzerne, vor allem große Technologiekonzerne. Meine Freunde und ich haben ein Startup-Unternehmen an Google verkauft, und ich habe eine Stelle bei Microsoft Research. Wir dürfen einander keiner Reinheitsprüfung unterziehen, als wären wir Cloud-Algorithmen, die sich gegenseitig für gezielte Werbung analysieren.
Die verschiedenen Institutionen, die von Menschen erfunden werden, müssen sich nicht gegenseitig auslöschen, sondern können sich gegenseitig ins Gleichgewicht bringen. Wir können lernen, »loyale Opposition« innerhalb der Institutionen zu sein, die wir unterstützen oder zumindest tolerieren, seien es Regierungen, Unternehmen, Religionen und so weiter. Wir müssen nicht immer zerstören, um etwas zu erschaffen. Wir können und sollten in einem Knäuel von Loyalitäten leben. So könnten wir den Rudel-Schalter vermeiden.
Zu lernen, über den Standpunkt der Opposition hinauszudenken, kann Klarheit bringen. Ich widerspreche zum Beispiel sowohl denen, die für eine flache Verteilung wirtschaftlicher Vorteile sind, als auch denen, die das Starsystem nach dem Prinzip »The winner takes it all« favorisieren, das sich in der Hightech-Wirtschaft der letzten Jahre abzeichnet. Die Wirtschaft muss weder ein Turm sein, der über einem Meer törichter Anwärter aufragt, noch ein Salzsee, in dem alle von einer Kontrollinstanz zur Gleichheit gezwungen werden.
Ich spreche mich für eine Wirtschaft mit einer breiten Mitte aus. Alles, was in der Wirklichkeit vermessen wird, sollte eine Glockenkurve ergeben. Lassen sich die Erträge einer Wirtschaft als Glockenkurve darstellen, ist diese Wirtschaft nicht nur ehrlich, sondern auch stabil und demokratisch, denn die Macht ist breit verteilt. Wer wirtschaftliche Gerechtigkeit zum Ziel hat, sollte nicht aus Prinzip die Reichen verdammen, sondern stattdessen die Delle in der Mitte der Verteilung.
Der Konflikt zwischen der Linken und der Rechten ist schon so lange akut, dass wir nicht einmal über ein ehrliches Vokabular verfügen, um die ehrliche Mathematik der Glockenkurve zu beschreiben. Wir können nicht von einer »Mittelklasse« sprechen, denn der Begriff ist zu belastet. Und doch ist diese schwer zu artikulierende Mitte das Herz der Mediation, wo wir den Frieden suchen müssen.
So langweilig es zunächst klingen mag, tatsächlich ist die Mediation zwischen den Fronten sowohl der spannendste als auch der vielversprechendste Weg nach vorn. Ständig werden wir mit den Gegensätzen von Alt und Neu konfrontiert, ständig müssen wir uns entscheiden. Sollen wir altmodische Taxis mit ihren altmodischen Rechten für die Fahrer unterstützen oder neue Arten von Services wie Uber, die digitale Effizienz bieten?
Doch diese Entscheidungen sind falsche Entscheidungen! Die einzig ethische Option ist die Synthese aus dem Besten der prädigitalen und der digitalen Systeme.
Eine Schwierigkeit dabei ist, dass wir Technologen oft in alten Fantasien des Übernatürlichen gefangen sind, die uns daran hindern, ehrlich über unsere Arbeit zu reden. Einst träumten Wissenschaftler davon, Maschinen mit magischen Formeln zum Leben zu erwecken, sodass sie autark würden. Später sollten Algorithmen künstlicher Intelligenz Bücher schreiben, Treibstoffe abbauen, technische Geräte herstellen, Kranke pflegen und Lastwagen fahren. Auch wenn diese Entwicklung zu hoher Arbeitslosigkeit führen würde, würde sich die Gesellschaft allmählich anpassen, vielleicht mit einer Wende zum Sozialismus oder zum bedingungslosen Grundeinkommen.
Aber der Plan hat nie funktioniert. Stattdessen wird, was wie Automatisierung aussieht, in Wirklichkeit von Big Data angetrieben. Die größten Computer der Welt ernten Daten von dem, was echte Menschen tun – Schriftsteller zum Beispiel. Sie verhalten sich wie die flächendeckendsten Spionagedienste der Weltgeschichte, und diese Daten werden dann aufbereitet, um die Maschinen zu betreiben.
Wie sich zeigt, bedarf die »Automatisierung« also immer noch riesiger Massen von Menschen! Doch dem Traum einer maschinenzentrierten Zukunft zuliebe müssen diese echten Menschen anonymisiert und vergessen werden. Dieser Trend lässt die Bedeutung von Urheberschaft schrumpfen, doch über kurz oder lang schrumpft auch die Wirtschaft im Ganzen, während die Entwicklung nur die reich macht, denen die größten Spionagecomputer gehören.
Um scheinbar automatische Übersetzungsprogramme zu erschaffen, muss täglich die Arbeit von Millionen von echten Übersetzern gescannt werden (um Aktualität zu gewährleisten). Und dieses Arrangement ist ein ganz typisches Beispiel.
In der Regel verschleiert jede scheinbare Automatisierung die Entrechtung der Menschen, die hinter dem Vorhang die Arbeit leisten, was wiederum zu Austerität führt, die wiederum Sozialismus, Grundeinkommen und Ähnliches als Kompensation für die bühnenwirksam simulierte Arbeitslosigkeit ausschließt. Dieser Zyklus ist ein kolossales Beispiel dafür, wie sich schlaue Leute dumm verhalten.
»Disrupt« – zerstören – ist vielleicht das häufigste Wort in der digitalen Kultur und Geschäftswelt. Wir tun so, als wäre es schwer, »kreative Zerstörung« – ein besonders beliebter Tropus in der modernen Wirtschaftsrhetorik – im Unterschied zu reiner Zerstörung zu sehen.
Aber so schwer ist es gar nicht. Sehen Sie sich um, ob Menschen nicht ihre Sicherheit und Sozialleistungen verlieren, obwohl das, was sie tun, immer noch gebraucht wird. Die Peitsche ist überflüssig geworden, doch die Dienstleistungen, die in jüngster Zeit durch digitale Services effizienter gemacht wurden, sind meistens nur umformatiert, nicht abgelöst worden.
Jedes Mal, wenn jemand einen Cloud-Service einführt, um einen Aspekt des Lebens leichter zu machen – sei es der Zugang zu Musik, Mitfahrgelegenheiten, Verabredungen, Krediten und so weiter –, wird in Kauf genommen, dass die Menschen zuvor einen gewissen Schutz genossen haben, der nun in Vergleich zu früheren Regelungen seinen Wert verliert.
Künstler, die vom Urheberrecht profitierten, werden im neuen System ihr Recht verlieren. Arbeiter, die in einer Gewerkschaft organisiert waren, werden es nicht mehr sein. Fahrer, die bestimmte Lizenzen und Verträge hatten, müssen ohne sie auskommen. Und auch ganz normale Bürger, die ein Recht auf Datenschutz hatten, müssen sich der neuen Ordnung anpassen.
Der Anspruch, dass alte Vorrechte über Bord geworfen werden müssen – etwa Datenschutz oder die Errungenschaften der Arbeiterbewegung –, um neuer technologischer Effizienz Platz zu machen, ist grotesk. Technologie-Idealisten betonen häufig, dass die alten Vorrechte unvollkommen, unfair und korrupt waren – was in vielen Fällen stimmt –, aber sie geben selten zu, dass die neue Situation eklatant weniger Rechte und ein erheblich höheres Maß an Ungerechtigkeit bietet.
Allen Technologieschaffenden gebe ich zu bedenken: Wenn eine neue Effizienz von digitalem Networking auf der Zerstörung von Würde beruht, seid ihr nicht gut in eurem Fach. Ihr schummelt. Gute technologische Neuerungen müssen sowohl die Leistung als auch die Würde der Erbringer verbessern.
Wir Menschen sind Genies darin, uns durch den Gebrauch von Computern verwirren zu lassen. Das wichtigste Beispiel dafür ist, dass Computer so tun, als wäre Statistik eine adäquate Beschreibung der Realität. Dies mag klingen wie ein nebensächliches technisches Problem, aber in Wirklichkeit liegt genau hier der Kern der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit.
Es gibt eine exponentiell ansteigende Zahl von Hinweisen darauf, wie gigantisch »Big Data« heutzutage ist. Die Massen von Sensoren, die sich in unserer Umwelt verbergen, die immer größer werdenden Rechenzentren für Clouds an geheimen Orten, wo sie ihren Wärmeüberschuss verzweifelt an wilde Flüsse abgeben.
Was passiert mit all diesen Daten? Sie werden von statistischen Algorithmen analysiert!
Wenn Sie bitte einmal die Fingerspitze heben und langsam durch die Luft bewegen. Bei der Menge der Kameras, die es in der heutigen Welt gibt, ist wahrscheinlich irgendeine Kamera gerade auf Ihren Finger gerichtet, und wahrscheinlich sagt gerade irgendwo irgendein Algorithmus automatisch vorher, wo sich Ihr Finger im nächsten Augenblick befinden wird. Vielleicht wurde dieser Algorithmus von einer Geheimdienstorganisation, einer Bank, einer kriminellen Vereinigung oder einer Firma aus dem Silicon Valley entwickelt, wer weiß das schon? Die Entwicklung von Algorithmen wird immer billiger, und jeder, der kann, tut es auch.
Und dieser Algorithmus wird wahrscheinlich für kurze Zeit recht behalten. Das ist so, weil Statistik ein gültiger Zweig der Mathematik ist.
Außerdem ist die spezielle Wirklichkeit, in der wir leben, Statistik-freundlich angelegt. Das ist eine Facette unserer Realität. Unsere Welt, jedenfalls auf der Ebene, auf der Menschen funktionieren, hat eine luftige, geräumige Eigenschaft. Das heißt, dass die meisten Dinge ausreichend Platz zur Verfügung haben, um weiter das zu tun, was sie gerade tun. Newtons Gesetze (ein Körper in Bewegung behält seine Bewegung bei) würden zum Beispiel nicht in einem gewöhnlichen Schiebepuzzle gelten, in dem jede Bewegung so beschränkt und verzwickt ist.
Doch trotz der scheinbaren Luftigkeit täglicher Ereignisse funktioniert unsere Welt im Grunde doch wie ein Schiebepuzzle. Es ist eine Welt der Struktur, geregelt von Prinzipien der Konservierung und Ausschließung. Was das heißt, ist einfach: Mein Finger wird wahrscheinlich seine Bewegung fortsetzen, aber nicht für immer, denn irgendwann ist er am Ende der Spannweite meines Arms, oder er trifft auf eine Wand oder ein anderes Hindernis.
Das ist das besondere, schmackhafte Wesen unserer Welt: Es gibt eine allgemeine statistische Vorhersehbarkeit, aber sie gilt nur für begrenzte Zeitabschnitte, und ihre Beschränkungen lassen sich nicht universell vorhersagen. Cloud-basierte Statistiken funktionieren also oft am Anfang, und dann scheitern sie.
Zuerst glauben wir, wir könnten mit unseren Computern in die Zukunft sehen, doch dann plötzlich versagen unsere Systeme. (Gute Wissenschaftler, die mit Theorien arbeiten, nicht nur mit Statistiken, verstehen dieses Problem und bilden in ihren Modellen auch die Wand ab, die die Bewegung des Fingers stoppt. Doch so viel Mühe macht man sich im Cloud-Geschäft selten, da auch ohne sie Milliarden von Dollar gescheffelt werden können.)
Das ist ein allgemeines und verführerisches Muster des intellektuellen Scheiterns in unserer Zeit. Warum lassen wir uns so leicht verführen? Es ist schwer zu beschreiben, wie intensiv die Verlockung ist, wenn man sie nicht selbst erlebt hat.
Wenn zum Beispiel ein Kapitalgeber Cloud-statistische Algorithmen laufen lässt, fühlt er sich zunächst wie König Midas. Er lehnt sich zurück und sieht zu, wie sein Vermögen wächst. Doch dann passiert etwas. Vielleicht gehen ihm die Leute aus, denen er hohle Kredite anbieten kann, oder die Konkurrenz beginnt, ähnliche Algorithmen einzusetzen, oder so etwas in der Art.
Irgendeine strukturelle Grenze unterbricht den unglaublichen Lauf des vollkommenen Glücks, und jedes Mal bist du schockiert, schockiert, schockiert, auch wenn es nicht das erste Mal ist, weil die verführerische Macht der frühen Phase einfach so unwiderstehlich ist. (Eine Baseball-Mannschaft bei uns in Kalifornien war in dem Buch und dem Film Moneyball gefeiert worden, weil sie dank Statistiken an die Spitze kam, und doch gehört sie heute wieder zu den Verlierern. Das ist absolut typisch.)
Dahinter steckt auch ein gewaltiger Power-Trip. Denn man kann Muster in der Art, wie User sich ausdrücken oder handeln, nicht nur vorhersehen, man kann sie auch erzwingen.
Es ist heute eine gängige Methode, dass digitale Firmen einige User zu einem Service überreden, der eine neue Effizienz durch Algorithmen und Cloud-Konnektivität bietet. So werden Bücher auf Tablets vertrieben, Mitfahrgelegenheiten, Unterkünfte oder Kredite vermittelt, der Kontakt zu Familienmitgliedern und Freunden hergestellt oder Partner für Sex und Liebe verteilt.
Egal worum es geht, bald tritt ein Phänomen namens »Netzwerkeffekt« in Kraft, und schon leben die Nutzer nicht mehr in einer Welt der freien Entscheidung, sondern sehen sich zum großen Teil gezwungen, jeweils den Service zu benutzen, der die anderen übertrumpft. Eine neue Art von Monopol entsteht, häufig in Form einer in Kalifornien ansässigen Firma.
Typischerweise haben die Nutzer das Gefühl, sie machen ein unglaublich gutes Geschäft. Musik umsonst! Sie scheinen unfähig zu sein, die Verbindung zum Schrumpfen ihrer eigenen Möglichkeiten zu ziehen. Stattdessen sind sie dankbar. Wenn man ihnen durch die Anwendung von Algorithmen vorschreibt, mit wem sie ausgehen sollen oder wie sie sich ihrer Familie zeigen sollen, werden sie es tun.
Wer immer eine dieser Operationen betreibt, die ich »Sirenenserver« nenne, kann die Normen der Gesellschaft festlegen, zum Beispiel beim Datenschutz. Es ist, als wäre er König.
Das ist ein grober ökonomischer Schnappschuss, der viele Aspekte unserer Gesellschaft in den letzten Jahren beschreibt. Vor einiger Zeit ging es um Musik. Bald wird es um Produktionsverfahren (mit 3D-Druckern und der Automatisierung in Fabriken), das Gesundheitswesen (mit Pflegerobotern) und jeden anderen Zweig der Wirtschaft gehen.
Und natürlich hat diese Entwicklung in den USA längst die Idee der Wahlen erreicht, wo computerisierte Manipulationen der Wahlkreisgrenzen und gezielte Werbung Wahlen zu Wettbewerben zwischen großen Computern gemacht haben anstatt zwischen Kandidaten. (Bitte lassen Sie nicht zu, dass so etwas auch in Europa passiert.)
Es funktioniert immer wieder, doch es scheitert auch immer wieder an anderer Stelle. Die Musikindustrie kollabiert, doch dasselbe Regelwerk wird auf Bücher angewandt. Mit jedem Zyklus werden von den größten Computern Milliarden gescheffelt. Die egoistische Illusion der Unfehlbarkeit taucht immer wieder auf – der größte Serienschwindler unserer Zeit – und macht die intelligentesten, wohlmeinendsten technologischen Köpfe zum Teil des Problems statt zum Teil der Lösung. Wir machen Milliarden, bevor wir den Karren an die Wand fahren.
Wenn dieses Muster unabwendbar ist, spielt Politik keine Rolle. In diesem Fall könnte Politik höchstens für einen Aufschub der vorgezeichneten Auflösung sorgen.
Aber was ist, wenn Politik doch eine Rolle spielen könnte? In diesem Fall ist es traurig, dass die derzeitige digitale Politik oft so unsinnig ist. Der Mainstream der digitalen Politik, die immer noch als jung und »radikal« angesehen wird, pflügt immer noch mit einer Reihe von Ideen über Offenheit voran, die über drei Jahrzehnte alt sind, selbst wenn die spezielle Formulierung offensichtlich gescheitert ist.
Als meine Freunde und ich die sogenannte Twitter- oder Facebook-Revolution auf dem Tahrir-Platz beobachteten, von unserem bequemen Posten im Silicon Valley aus, habe ich gesagt: »Twitter wird diesen tapferen, klugen jungen Ägyptern keine Arbeit geben, also kann die Bewegung nicht glücken.« Freiheit, losgelöst von Wirtschaft (im weitesten Sinn), ist bedeutungslos.
Es ist schwer, darüber zu sprechen, weil man so viele Einwände einkalkulieren muss. So könnte man sagen, dass traditionelle gesellschaftliche Konstrukte wie »Jobs« oder »Geld« durch digitale Netzwerke überflüssig gemacht werden könnten und sollten, aber: Jede Erfindung, die sie ablösen sollte, müsste mindestens einige derselben Sicherheiten bieten, an die junge Leute häufig weniger gerne denken. Man kann sich nicht nur auf einen Teil vom Kreislauf des Lebens beziehen.
Dieses schwierige Thema verdient eine vorsichtige Erklärung. Die Sharing Economy bietet nur die Echtzeit-Vorteile von informellen oder Schattenwirtschaften, wie man sie bisher nur in Entwicklungsländern, vor allem in Slums, vorgefunden hat. Jetzt haben wir sie in die entwickelte Welt importiert, und junge Menschen lieben sie, weil das Gefühl des Teilens so sympathisch ist.
Doch die Menschen bleiben nicht für immer jung. Manche werden krank, oder sie müssen für ihre Kinder, Partner oder Eltern sorgen. Wir können nicht bei jeder Mahlzeit »für unser Essen singen«. Weil die Realität anders aussieht, muss die Sharing Economy letztendlich als Täuschungsritual der Todesverleugnung verstanden werden. Biologischer Realismus ist der Hauptgrund, weshalb regulierte Wirtschaften sich überhaupt herausgebildet haben. Wenn wir mit der Sharing Economy einerseits den Schutz, den Gewerkschaften bieten, aushebeln, und Regierungen in langfristige Muster von Austerität oder Sparpolitik und Schuldenkrisen zwingen, wer wird sich dann um die Bedürftigen kümmern?
Manchmal frage ich mich, ob die jüngeren Leute in der entwickelten Welt angesichts des unvermeidlichen Ansturms der demografischen Alterung nicht die Verlagerung zur digitalen Technologie unbewusst benutzen, um den erdrückenden Verpflichtungen gegenüber der wachsenden Zahl der Alten zu entkommen. Die meisten Länder der entwickelten Welt müssen sich in den kommenden Jahrzehnten mit diesem demografischen Wandel auseinandersetzen. Vielleicht haben die Jungen recht, wenn sie sich zu retten versuchen, aber es bleibt das Problem, dass auch sie eines Tages alt und bedürftig sein werden, denn so ist die Conditio humana.
Innerhalb der winzigen Elite der Milliardäre, die die Cloud-Computer betreiben, herrscht der laute, zuversichtliche Glaube, dass die Technologie sie eines Tages unsterblich machen wird. Google zum Beispiel finanziert eine große Organisation mit dem Ziel, »den Tod zu überwinden«. Und es gibt viele Beispiele mehr.
Ich kenne einige der Hauptbeteiligten der Anti-Tod- oder posthumanen Bewegung, die im Herzen der Silicon-Valley-Kultur sitzt, und ich bin der Ansicht, die meisten von ihnen leben in einer Traumwelt, die weit weg von jeder rationalen Wissenschaft ist. (Es sind auch ein paar gute Wissenschaftler dabei, einfach nur wegen der Finanzierung. Geld kommt in der Wissenschaft heute oft von merkwürdig motivierten Quellen, und ich würde es ihnen nie zum Vorwurf machen.)
Die Arithmetik ist klar. Falls die Unsterblichkeits-Technologie, oder auch nur eine Technologie der drastischen Lebensverlängerung, zu funktionieren beginnt, müsste sie entweder auf die kleinste Elite beschränkt bleiben, oder wir müssten aufhören, Kinder in die Welt zu setzen, und in eine unendlich fade Gerontokratie übergehen. Dies sage ich, um hervorzuheben, dass in der digitalen Technologie häufig das, was radikal scheint – was auf den ersten Blick wie kreative Zerstörung wirkt –, sich in Wirklichkeit, wenn es tatsächlich umgesetzt würde, als hyperkonservativ und unendlich fade und langweilig herausstellt.
Eine weitere populäre Idee ist, unser Gehirn in die virtuelle Realität »upzuloaden«, damit wir für immer in einer Softwareform weiterleben könnten. Und das trotz der Tatsache, dass wir noch nicht einmal wissen, wie das Gehirn funktioniert. Wir wissen nicht, wie Vorstellungen durch Neuronen repräsentiert werden. Wir stellen Milliarden von Dollar bereit, um das Gehirn zu simulieren, dabei kennen wir jetzt noch nicht einmal die grundlegenden Prinzipien, nach denen es funktioniert. Wir behandeln Hoffnungen und Glaube, als wären sie etablierte Wissenschaft. Wir behandeln Computer wie religiöse Objekte.
Wir müssen uns überlegen, ob Fantasien von maschineller Gnade lohnenswert sind. Denn wenn wir den Fantasien von künstlicher Intelligenz widerstehen, können wir zur neuen Formulierung einer alten Idee kommen, die in der Vergangenheit viele Formen hatte: »Humanismus«.
Der neue Humanismus ist, wie früher, der Glaube an den Menschen, doch speziell in der Form einer Ablehnung von künstlicher Intelligenz. Das hieße nicht, irgendeinen Algorithmus oder roboterhaften Mechanismus zu verwerfen. Jeder einzelne vermeintlich künstlich intelligente Algorithmus kann genauso gut als nicht-autonome Funktion verstanden werden, die dem Menschen als Werkzeug dient.
Diese Ablehnung gründet nicht auf dem irrelevanten Argument, das häufig vorgeschoben wird, nämlich dem der Grenzen der Möglichkeiten, sondern vielmehr darauf, dass es immer Menschen geben muss, um einen Computer wahrzunehmen, damit er überhaupt existiert. Ja, ein Algorithmus kann mit den Daten aus einer Cloud, die von Millionen und Abermillionen von Menschen erhoben wurden, eine Aufgabe verrichten. Man sieht die Flachheit von Computern auf praktischer Ebene an ihrer Abhängigkeit von einer verborgenen Masse anonymer Menschen, oder auch an einer tieferen, erkenntniskritischen Abhängigkeit: Ohne Menschen sind Computer Raumwärmer, die Muster erzeugen.
Wir müssen uns nicht darüber einigen, ob im Menschen ein göttliches Element vorhanden ist oder nicht, noch müssen wir entscheiden, ob gewisse »Grenzfälle« wie die Bonobos als Menschen betrachtet werden sollten. Auch müssen wir nicht absolute Urteile über die letztendliche Natur von Menschen oder Computern abgeben. Doch wir müssen Computer zumindest so behandeln, als wären sie weniger-als-menschlich.
Wenn man spezifische Auswege aus unseren dummen digitalen Wirtschaftsmustern anspricht, begibt man sich auf ein schwieriges Feld. Ich habe hauptsächlich einen Ansatz erforscht und vertreten, nämlich das ursprüngliche Konzept digitaler Medienarchitektur wiederzubeleben, das auf Ted Nelsons Arbeit in den Sechzigern zurückgeht. Ted schlug ein universales Mikro-Zahlungssystem für digitale Beiträge von Menschen vor. Um es noch einmal zu betonen, dies war keine radikale Reaktion, sondern der historische Ausgangspunkt aller Überlegungen zu digitalen Medien.
Ich habe versucht, Teds Idee auszuweiten auf die Art, wie das Leben der Menschen heute in riesige Big-Data-Sammlungen eingelesen wird. Wie schon erwähnt stützen sich kostenfreie Übersetzungsprogramme zum Beispiel auf das Scannen der Arbeit von Millionen echter menschlicher Übersetzer am Tag. Warum können wir diese Leute nicht bezahlen? Das wäre nur ehrlich und fair.
Wenn wir nur zugeben würden, dass immer noch Menschen gebraucht werden, um die Big Data herzustellen, und wenn wir willens wären, unsere Fantasien von künstlicher Intelligenz zu zügeln, dann könnten wir vielleicht ein neues Wirtschaftsmuster erschaffen, in dem auch in den Ergebnissen der digitalen Wirtschaft die Glockenkurve statt des Starsystems auftaucht. Daraus könnten tragfähige Gesellschaften entstehen, die nicht der Austerität zum Opfer fallen, ganz gleich wie gut oder scheinbar »automatisiert« die Technologie ist.
Diese Idee ist, um das Mindeste zu sagen, kontrovers, und ich kann sie in dieser kurzen Rede nicht vollständig erläutern. Es ist nur eine Idee, die wenigstens ausprobiert werden müsste und die sich dann vielleicht als haltlos herausstellt.
Doch der springende Punkt, die grundlegende Position, von der wir nicht abweichen dürfen, ist: Wir müssen anerkennen, dass es Raum für Alternativen gibt. Das Muster, das wir heute sehen, ist nicht das einzig mögliche Muster, es ist nicht unabwendbar.
Unabwendbarkeit ist eine Täuschung, die die Freiheit aushöhlt.
Je fortschrittlicher die Technologie ist, desto schwieriger wird es, zwischen Algorithmen und Konzernen zu unterscheiden. Was ist Google heute, oder Facebook? In diesen Fällen ist die Unterscheidung bereits esoterisch, und das wird sie bald auch für viele andere Konzerne sein. Wenn Algorithmen Personen sein können, dann sind es auch Konzerne, wie es in den USA schon jetzt der Fall ist. Was ich heute hier sage, ist, dass weder ein Algorithmus noch ein Konzern eine Person sein sollte!
Der neue Humanismus behauptet, es sei richtig, zu glauben, dass Menschen etwas Besonderes sind, nämlich dass Menschen mehr sind als Maschinen und Algorithmen. Es ist eine Behauptung, die in Tech-Kreisen zu rüdem Spott führen kann, und es gibt auch keinen Beweis, dass sie stimmt.
Wir glauben an uns selbst und aneinander, aber es ist eben nur Glaube. Es ist ein pragmatischerer Glaube als der traditionelle Glaube an Gott. Er führt zum Beispiel zu einer faireren und nachhaltigeren Wirtschaft und zu besseren, zurechnungsfähigeren Technologien. (Außerdem ist der Glaube an den Menschen kompatibel mit jedem Glauben oder fehlenden Glauben an Gott.)
Für manche Techies mag der Glaube an die Besonderheit des Menschen sentimental oder religiös klingen, und so etwas können sie nicht leiden. Aber wenn wir nicht an die menschliche Besonderheit glauben würden, wie könnten wir dann nach einer humanistischen Gesellschaft streben?
Darf ich vorschlagen, dass die Technologen wenigstens versuchen, so zu tun, als würden sie an die menschliche Besonderheit glauben, nur um zu sehen, wie es sich anfühlt?
Zum Schluss möchte ich diese Rede meinem Vater widmen, der, während ich diese Worte geschrieben habe, gestorben ist.
Ich war von Trauer überwältigt. Ich bin ein Einzelkind, und jetzt ist keiner meiner Eltern mehr am Leben. All das Leid, das meine Eltern ertragen haben. Die Familie meines Vaters hatte so viele Tode unter den Pogromen zu beklagen. Eine seiner Tanten war ihr Leben lang stumm, nachdem sie als kleines Mädchen nur überlebt hatte, weil sie vollkommen still unter einem Bett ausharrte, während ihre ältere Schwester vor ihr durch ein Schwert getötet wurde. Von der Familie meiner Mutter in Wien sind viele, viele in den Konzentrationslagern umgekommen. Und nach alldem bin nur noch ich übrig.
Doch dann überkam mich schnell eine noch größere Dankbarkeit. Mein Vater ist über neunzig geworden, und er hat meine Tochter noch erlebt. Die beiden kannten sich und hatten sich lieb. Sie haben einander glücklich gemacht.
Tod und Verlust sind unabwendbar, ganz gleich, was meine Freunde mit ihren digitalen Überlegenheitsfantasien und Unsterblichkeitslaboratorien denken und gleichzeitig ihre Liebe zur kreativen Zerstörung bekunden. Ganz gleich, wie tief uns das Leid darüber schmerzt, am Ende sind Tod und Verlust langweilig, weil sie einfach unabwendbar sind.
Es sind die Wunder, die wir errichten – die Freundschaften, die Familien, die Bedeutung –, die staunenswert, interessant, glorreich und berauschend sind.
Love creation.
(2014)
Teil 1Freude
Von den späten siebziger bis zu den frühen neunziger Jahren gehörte ich zum Kreis der IT-Pioniere und Technologie-Philosophen, die die Grundlagen der Digitalisierung und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen formulierten. Ich hatte Kontakt zu Ted Nelson, Richard Stallman, den ersten Silicon-Valley-Unternehmern, und vielen anderen, die dazu beitrugen, das Quellgebiet der politischen Ströme zu definieren, die seitdem die Welt überfluten.
Allerdings schrieb ich damals nicht viel über Politik oder Wirtschaft. Ich befasste mich mehr mit den ästhetischen, spirituellen, praktischen, wissenschaftlichen und mathematischen Aspekten der Informatik – eigentlich mit allem außer den damit verbundenen politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen. Ich glaubte damals, ja ich hatte das intuitive Gefühl, dass sich der gesellschaftliche Aspekt schon in die richtige Richtung entwickeln würde.
In jener Zeit bestand für mich das wichtigste gesellschaftspolitische Vorhaben darin, Computer weniger furchteinflößend zu gestalten, das Programmieren für ganz normale Menschen zugänglich zu machen und der Informationstechnologie das Elitäre zu nehmen.
Ich arbeitete deshalb viel an der Entwicklung grafischer Programmiersprachen. Eine davon wurde 1984 auf dem Cover der Zeitschrift Scientific American vorgestellt.
1986 wurde ein Buch mit Interviews mit Programmierern veröffentlicht. Das Buch fängt die Stimmung in der Frühzeit des Silicon Valley ein. Ich fand das Gespräch damals sehr schwierig, denn es war fast unmöglich, die Ideen zu vermitteln, für die ich mich interessierte. Das zeigte sich etwa darin, wie mühsam man die virtuelle Realität erklären musste.
Zu der Zeit war das ein gängiges Problem. Innerhalb der kleinen Welt der Informatik, die beinahe einem Kult glich, sprachen wir bereits über die Themen, die heute erst ins allgemeine Bewusstsein gerückt sind, etwa darüber, wie die Kontrolle über Informationen die Grundlage für Macht und Einfluss bildet und wie wir dadurch das gesellschaftliche Zusammenleben verändern. Doch mit Nichteingeweihten über solche Dinge zu sprechen war extrem schwierig.
Zumindest schien es so. Vielleicht dachten wir auch zu sehr an uns selbst und ließen das Thema technisch komplizierter und fremdartiger wirken, als es tatsächlich war.
Auf jeden Fall bemühte ich mich, Nichteingeweihten Ideen wie die virtuelle Realität zu vermitteln.
Das Interview über virtuelle Realität, das 1989 in der Zeitschrift Whole Earth Review erschien, sorgte für einiges Aufsehen und machte viele zum ersten Mal mit der Idee vertraut. Oft liest und hört man, das Interview habe 1989 stattgefunden und sei von Kevin Kelly geführt worden, ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass es bereits 1987 geführt wurde, und zwar von Adam Heilbrun, Kevin Kelly schrieb nur die Einleitung dazu.
Der Essay »Es war einmal« zeigt wiederum eine ganz andere Seite von mir in jenen Jahren. Damals hielt ich Vorträge über Spiritualität und Technologie. Mein Ton ist wohl teilweise Alan Watts geschuldet. Der Essay ist ein kleines Beispiel für die Art von Parabeln, die ich in jener Zeit erzählte.
Kapitel 1Die Freuden der virtuellen Realität damals und heute
Virtuelle Realität – Ein Gespräch mit Adam Heilbrun
Eingeleitet von Kevin Kelly
Jaron Lanier ist einer der wichtigsten Visionäre des Cyberspace oder, wie er lieber sagt, der »virtuellen Realität«. Vor kurzem besuchte ich ihn abends in seinem Büro in Redwood City, Kalifornien, weil ich Illustrationen für das anstehende Interview mit ihm abholen wollte. Es wurde ein historischer Abend. Direkt vor meinen Augen baute Jaron Lanier eine künstliche Realität auf und stieg hinein. Und ich folgte ihm.
Derzeit gibt es etwa zwanzig Gruppen (überwiegend in den Vereinigten Staaten), die an virtuellen Realitäten arbeiten oder sie aufbauen. In der letzten Ausgabe berichteten wir von den Fortschritten einer Gruppe bei der NASA, die ein System aus Helm, Handschuh und einer einfarbigen dreidimensionalen Realität entwickelt hat. Eine Gruppe in North Carolina hat bereits fortgeschrittene Modelle in Farbe vorgestellt.
Jaron Lanier ist der Mann, der den von der NASA verwendeten Datenhandschuh konstruiert hat. Der Datenhandschuh reproduziert eine echte Hand mithilfe von Lichtwellenleitern als virtuelle Hand. Dazu steckt man die reale Hand in einen Handschuh, an dem Glasfaserkabel angebracht sind. Man deutet mit der Hand auf etwas, und entsprechend deutet die virtuelle Hand in der virtuellen Realität. Das ist sehr elegant. Laniers Firma VPL Research will das Konzept des Handschuhs auf einen Ganzkörperanzug übertragen. Dieser Anzug ist allerdings noch alles andere als elegant. Durch die sperrigen Kabel, die von den Gliedmaßen und dem Rücken wegführen, ist er ziemlich unförmig.
VPL hat auch den Prototypen einer Brille für die virtuelle Realität konstruiert, die die Firma »Eye-Phones« nennt. Bei meinem Besuch probierten die Mitarbeiter gerade die erste aus ihrer kleinen Produktionsserie aus (sie können eine Brille pro Tag fertigen). Die Brille ist noch alles andere als leicht handhabbar. Bevor ein neuer Anwender die Brille nutzen kann, muss man eine ganze Zeit daran herumfummeln. Meine Augen stellen sich auch unter normalen, realen Bedingungen nicht schnell ein, deshalb konnten sie die vertikale Anordnung der Stereobilder nicht richtig abgleichen. Ich musste mich anstrengen, damit die 3D-Bilder funktionierten (auch bei stereoskopen Bildern habe ich oft Probleme). Die Brille ist außerdem schwer und hinterlässt Abdrücke auf der Stirn, wenn man sie wieder absetzt.
Bisher hatte ich die Drahtgittermodell-Welten der NASA für den neuesten Stand der Technik gehalten und nicht erwartet, dass sich der Bereich so schnell weiterentwickeln würde. Die virtuellen Welten, die VPL geschaffen hat, sind komplett in Farbe und haben schattierte, konturierte Oberflächen! Sie haben natürlich bei weitem nicht die Qualität von Fotos, wirken aber dennoch vollständig. Sie erscheinen real, so »real«, wie etwa ein Zeichentrickfilm von Disney real wirkt. (»Real« wird in Zukunft wohl einer der relativsten Begriffe überhaupt werden.) Insgesamt kommt man sich vor wie eine Zeichentrickfigur in einer Zeichentrickwelt. Die visuelle Qualität der Welt, die man auf den Außenmonitoren sieht, ist attraktiv – und hat etwa die Auflösung einer ganz normalen Computeranimation. Was man mit der Brille vor Augen hat, ist nicht ganz so gut, das Gesehene ist ein bisschen unscharf, außerdem fehlt die farbliche Tiefe des Bildschirms. Die Bilder erinnerten mich an einen kleinen Farbfernseher, der seine besten Zeiten hinter sich hat. Die Bilder in der virtuellen Realität werden von zwei Computern des Herstellers Silicon Graphics erzeugt, die etwa die Größe von übergroßen Gepäckstücken haben – und man benötigt einen Computer pro Auge.
Als ich an jenem Abend ins Büro kam, arbeitete Lanier gerade an seiner »Realität für zwei« und nahm letzte Veränderungen für eine anstehende Vorstellung bei der Telefongesellschaft Pacific Bell vor. In dieser virtuellen Welt tragen zwei Personen Anzüge mit Datenhandschuhen, Brillen und Kopfhörern. Sie befinden sich in einem dreieckigen virtuellen Raum, in der einen Ecke schwebt das Logo von Pacific Bell in Posterformat. Durch den Raum schwirren kleine bunte Dreiecke, wie man es von Tinker Bell kennt, die im Vergleich zu der Fee allerdings ziemlich hyperaktiv wirken. Man kann die Hand ausstrecken, ein Dreieck greifen und irgendwohin schieben, dann lässt man das Dreieck wie einen Vogel frei. Auch die andere Person kann das, und man selbst kann sie dabei in der virtuellen Welt beobachten. Die andere Person ist eine am Computer generierte Figur, eine Frau namens Joan, die aber jede andere Gestalt annehmen könnte, wie Jaron im Interview erklärt. (Ich sah leider nicht, wer ich in der virtuellen Welt war oder wie ich aussah. Aber in Zukunft wird es sicher auch virtuelle Spiegel geben.)
So beeindruckend diese Demonstration auch war, die Magie, auf die Jaron setzt, erschloss sich mir erst, als er für mich aus dem Stegreif eine eigene virtuelle Welt entwarf. Als ich um halb neun Uhr abends in sein Büro kam, sagte Jaron, er wolle eine Welt für mich erschaffen, eine verrückte, imaginäre Welt. Er behauptete, seit er und seine Kollegen das System in den letzten Wochen zum Laufen gebracht hätten, sei er so damit beschäftigt gewesen, Hardware zu konstruieren und Software zu entwickeln, dass er keine Zeit gehabt habe, ein bisschen herumzuspinnen und Welten zu erschaffen. Und so setzte er sich jetzt an seinen Computer und betätigte sich als Schöpfer.
Dazu benutzte er ein ganz normales, im Handel erhältliches Grafikprogramm namens Swivel 3D (S 400: 415/543-3848), entwickelt von VPL, mit dem er einen Grundriss seiner Welt in Farbe zeichnete. Ein wilder, fantastisch gemusterter Boden – mit großen grünen, braunen und weinroten Vielecken und sternförmigen Fliesen. Darauf stellte er kreidefarbene obeliskartige Pfeiler, verziert mit riesigen rubinroten Edelsteinen, aus denen züngelnde orangefarbene Flammen aufstiegen. In der Mitte waren mehrere grüne Wedel, die bei genauerem Hinsehen eher wie Bandwürmer aussahen, oberflächlich betrachtet aber ganz brauchbare Farnwedel abgaben. Das alles zeichnete er mithilfe der üblichen Mac-Mal-Tools, während ich damit beschäftigt war, die Hardware und anderes zu fotografieren. Nach etwa zwei Stunden war die selbstgeschaffene neue Welt fertig. Die Diskette brachte Jaron schnell zu Chuck von Silicon Graphics, der jetzt den Inhalt in die virtuelle Realität hochlud.
Jaron setzte seinen Helm auf und stieg in die neu erschaffene Welt. Schon bald lag er ausgestreckt und mit offenem Mund auf dem wild gemusterten Fliesenboden und drehte sich langsam in eine neue Position, um die Geheimnisse seines winzigen, soeben entstandenen und noch namenlosen Universums zu erkunden. Er fand heraus, dass er die Fliesen auf dem Boden beiseiteschieben und zwischen den weinroten Sternen und den grünen und braunen Vielecken herumschweben konnte. Er robbte über den Boden auf der Suche nach ungewöhnlichen Perspektiven und gab Freudenschreie von sich, wenn er einen kuriosen Blickwinkel fand, den er nicht erwartet hatte. Wir anderen standen um den Monitor herum und schauten uns an, was er sah. Einer nach dem anderen setzten wir die magische Brille auf. Jeder bewegte sich dann ganz langsam, ging vorsichtig wie auf dünnem Eis oder wie in Zeitlupe, bis wir schließlich auf dem Boden lagen oder in einer Ecke kauerten, weil uns die echten Wände des Büros daran hinderten, die virtuelle Welt weiter zu erkunden. Jarons Freundin, die von einer vorherigen Demonstration immer noch einen blauen Ganzkörperanzug trug, stieß einen leisen erstaunten Schrei aus, als sie entdeckte, dass die kreidefarbenen Pfeiler hohl waren und man hineinkriechen und die Unterseite der Rubine sehen konnte! »Das ist der Weltrekord für die bisher verrückteste virtuelle Welt!«, rief Jaron. Immerhin wurde bislang der Großteil der Forschung ausschließlich vom Militär durchgeführt.
Mittlerweile war es halb zwölf Uhr nachts. Jarons Freundin in ihrem blauen Anzug drehte sich auf dem Boden, versuchte »die richtige Stelle« zu finden, wobei sie einer seltsamen eigenen Logik folgte. Auch Jaron lag auf dem Boden und warf seine dicke Rastamähne hin und her. Man hätte meinen können, wir hätten irgendwelche psychedelischen Drogen eingeworfen. »Tja, ich bin auf jeden Fall angefixt«, sagte ich nach meinem Besuch in seiner winzigen Traumlandschaft.
»Bitte verwende das Wort nicht in dem Zusammenhang«, bat Jaron sanft. »Denk dran, was mit den Pilzen passiert ist.« Im darauf folgenden Gespräch erzählte er, dass einige alte Freunde, darunter auch seine Freundin, wissenschaftliche Untersuchungen zum Konsum psychoaktiver Substanzen durchgeführt hatten, allerdings war ihre wissenschaftliche Karriere jäh ins Stocken geraten, als die Substanzen neu bewertet und als illegal eingestuft wurden. Es amüsierte ihn sehr, dass einige, die mit den Substanzen experimentiert hatten, etwa Terence McKenna, in derselben Ausgabe zu Wort kommen würden, in der auch dieses Interview erscheinen sollte. »Ich mache mir echt Sorgen, dass virtuelle Realitäten für illegal erklärt werden könnten«, seufzte Jaron.
Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass virtuelle Realitäten eine so enorme Wirkung haben könnten. Ich gebe das Interview in voller Länge wieder, weil die machtvolle Wirkung noch nie so akkurat und leidenschaftlich beschrieben wurde.
Wo sind die Visionäre der nächsten Generation? Hier ist einer von ihnen. Jaron Lanier ist neunundzwanzig Jahre alt, hat keinen Highschool-Abschluss, obwohl er mit seiner Forschung selbst namhaften Universitäten weit voraus ist, und er ist ein begeisterter Musiker, der Gitarre spielen wollte, ohne eine echte Gitarre in der Hand zu haben. Das Interview führten Adam Heilbrun, technischer Redakteur und Übersetzer für Portugiesisch, Französisch und Persisch, sowie Barbara Stacks.
Adam Heilbrun Das Wort »virtuell« ist Informatiker-Jargon. Könnten Sie es für diejenigen erklären, die mit dem Begriff nicht vertraut sind?
Jaron Lanier Ich weiß. Mir gefällt es auch nicht: Es ist eher etwas für Computerfreaks, aber bisher ist mir nichts Besseres eingefallen. »Virtuell« bedeutet, dass etwas nur als elektronische Abbildung existiert, dass es also keine andere konkrete Form der Existenz gibt. Als ob etwas da wäre, obwohl es gar nicht da ist. Das ist nicht unbedingt der richtige Begriff. Aber er gefällt mir besser als »artifiziell«. Und besser als »synthetisch«. »Geteilter Traum«, »Telerealität« – ich weiß nicht. Das trifft es auch nicht. Manche reden vom »Cyberspace«, frei nach William Gibson, aber das finde ich furchtbar. Und sehr einschränkend und noch viel computersprachlicher.
Die virtuelle Realität ist kein Computer. Wir sprechen über eine Technologie, die computerisierte Kleidung verwendet, um eine gemeinsame Realität herzustellen. Sie erschafft unsere Beziehung zur realen Welt neu, stellt sie auf eine neue Ebene, nicht mehr und nicht weniger. Sie wirkt sich nicht auf die subjektive Welt aus, sie hat keine direkten Auswirkungen auf das, was in unserem Gehirn vorgeht. Sie hat nur etwas damit zu tun, was unsere Sinnesorgane wahrnehmen. Die »physische« Welt, also das, was sich auf der anderen Seite unserer Sinnesorgane befindet, wird durch fünf »Löcher« wahrgenommen, über die Augen, die Ohren, die Nase, den Mund und die Haut. Natürlich sind das keine richtigen Löcher, und es gibt noch viel mehr Sinne als diese fünf, aber das ist das althergebrachte Modell, deshalb bleiben wir fürs Erste dabei.