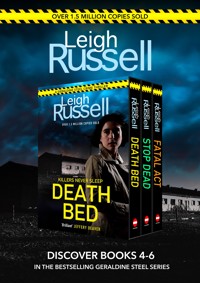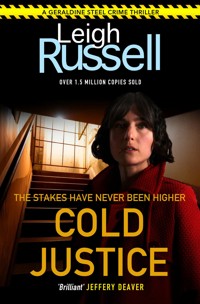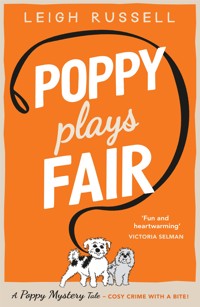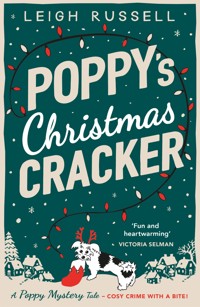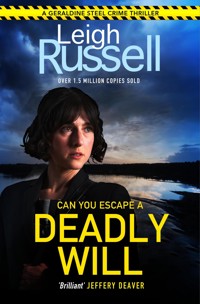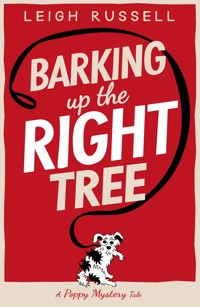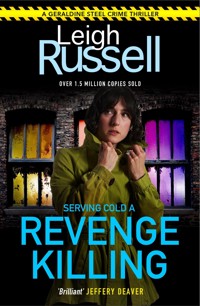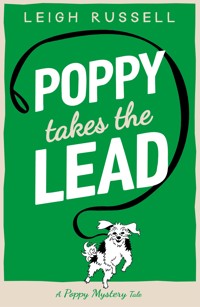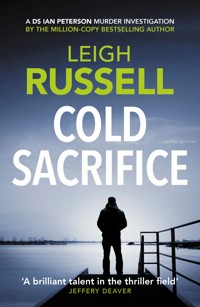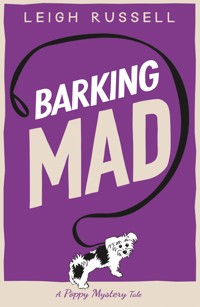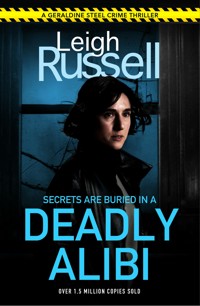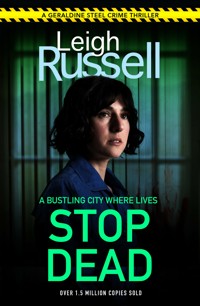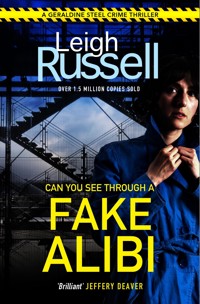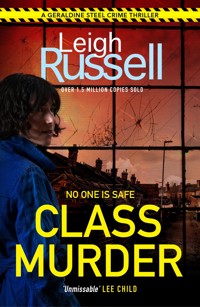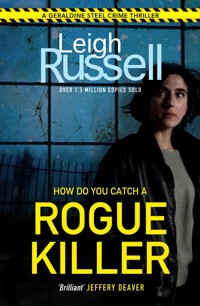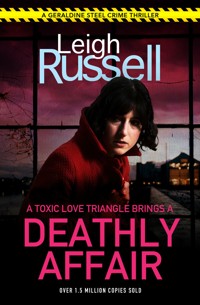9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: DI-Steel-Reihe
- Sprache: Deutsch
Nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten wagt Detective Inspector Geraldine Steel den beruflichen Neuanfang in Woolsmarsh, einer beschaulichen Kleinstadt im Herzen Englands. Doch auch hier lauert das Verbrechen, denn bereits kurz nach Geraldines Ankunft geschieht ein furchtbarer Mord: Im Stadtpark wurde eine junge Frau erwürgt. Alle Spuren, die Geraldine und ihr Team verfolgen, führen ins Nichts. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Geraldine weiß: Dieser Mörder wird nicht aufhören, zu töten, bis ihn jemand aufhält...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Danksagung
Zitat
Teil 1
1 Lebwohl
2 Sophie
3 Der Umzug
4 Das Team
5 Gerta
6 Das Café
7 Johnny
8 Pommes frites
9 Beim Honda-Händler
10 In der Gerichtsmedizin
11 Die Nachbarn
12 Im Pub
Teil 2
13 Zu Hause
14 Fakten
15 Der Verdächtige
16 Terry
17 Das Geheimnis
18 Die Presse
19 Überprüfung
20 Melanie
21 Lakeland
22 Celia
23 Die Zeitung
Teil 3
24 Die Verabredung
25 Frauen
26 Streit
27 Ein Zeuge
28 Der Name
29 Die Gärtner
30 Die Pflegerin
31 Mellor
32 Rogers
33 Reporter
34 Die Garage
35 Abschied
Teil 4
36 Die Party
37 Allein
38 Die Meerjungfrau
39 Vermisst
40 Die Rückkehr
41 Der See
42 Protest
43 Exklusiv
44 Die Leiche
45 Das Interview
46 Das Auto
47 Montag
48 Ramsden
49 Aufmerksamkeit
Teil 5
50 Der Freund
51 Das Zimmer
52 Die Akte
53 Der Brief
54 Informationen
55 Geduld
56 Das Versteck
57 Trautes Heim
58 Brüder
59 Die Flucht
60 Der Friseurbesuch
61 Das Mädchen
62 Der Alarm
63 Die Nachtwache
64 Das Verhör
65 Die Feier
Über die Autorin
Leigh Russell schloss ihr Literaturstudium an der Universität von Kent ab. Als Gesamtschullehrerin spezialisierte sie sich anschließend auf die Förderung von Schülern mit Lernbehinderungen. Ihre Kriminalromane um DI Geraldine Steel begeistern Leser und Kritiker auf der ganzen Welt. Leigh Russell ist verheiratet und lebt mit ihrem Ehemann und zwei Töchtern in Hertfordshire.
Leigh Russell
WER AUFBÖSENWEGENWANDELT
Ein Fall für Geraldine Steel
Aus dem Englischen vonSabine Schilasky
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2009 by Leigh Russell
Titel der englischen Originalausgabe: »Cut Short«
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Judith Mandt
Textredaktion: Anita Krätzer, Schwarzenbek
Titelillustration: © shutterstock/Ulrich Mueller; © shutterstock/caesart;
© shutterstock/Steve Heap; © shutterstock/Andrey Yurlov;
© shutterstock/Ollyy; © Arcangel Images/Steve Stenson
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1458-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Michael, Jo und Phil
Danksagung
Ich danke Dr. Leonard Russell für seinen medizinischen Rat, William Goddard von der South Harrow Police Station und Robert Dobbie von der British Transport Police für ihre Anregungen, Matt Biggadike für seine technische Hilfe, Hazel Orme und Keshini Naidoo für ihre Anleitung und vor allem Annette Crossland für ihren inspirierenden Enthusiasmus.
»Rück deinen Stuhl nahe an den Abgrund,und ich erzähle dir eine Geschichte.«
F. Scott Fitzgerald
Teil 1
nicht mitleid zeige dieser geschäftigen, menschenfeindlichen bestie. fortschritt ist eine behagliche krankheit: dein opfer (tod und sicheres jenseits) spielt mit der größe seiner winzigkeit
E.E. Cummings
1Lebwohl
Mit seinen durch Handschuhe ungelenken Fingern scharrte er das trockene Laub zusammen. Dann duckte er sich tief und kroch durch die Büsche. Bevor er über den Weg fortging, blickte er sich um, ob ihn auch niemand gesehen hatte. Er hatte es schlau angestellt und keine Spuren hinterlassen. Niemand würde sie in dem Park finden. Es war sein Geheimnis, seines und ihres, und sie würde es nicht verraten. Niemals. Wer sie war, wusste er nicht, und auch das war schlau, denn es bedeutete, dass sie nicht wusste, wer er war.
Er hatte sie nicht ausgesucht, weil sie hübsch war. Eigentlich hatte er sie überhaupt nicht ausgesucht. Sie war einfach da gewesen. Doch sie war hübsch, und das gefiel ihm. Seit seiner Schulzeit hatte ihn keine Frau mehr angesehen. Sie hatte ihm in die Augen gestarrt. Gesagt hatte sie nur ein Wort: »Nein!« Aber sie hatte mit ihm geredet, und er wusste, das bedeutete Vertrautheit – nur sie beide. Es war ein Jammer, dass er sie nicht wiedersehen würde. Doch andere würden folgen.
Es regnete heftig. Er sang leise vor sich hin, weil man nie wissen konnte, wer zuhörte. »Sweet the rain’s new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall, on the first grass, praise for the sweetness of the wet garden …«
Der Regen würde sie reinwaschen.
Er zögerte, als er eine Wegbiegung erreichte, denn ihm kam eine Frau entgegen. Dann sah er, dass sie älter war und nicht hübsch wie die Frau, die er unter dem Herbstlaub versteckt hatte. Sie fragte ihn nach einem Musikgeschäft, Bretts. Weil er nicht wusste, was er sagen sollte, ging er schnell weiter. Er durfte nicht mit ihr reden.
»Sprich nie mit Fremden«, hatte Miss Elsie gesagt. Der Park war gefährlich, und er wusste, dass er Leuten, die ihm Süßigkeiten anboten, nicht trauen durfte. Er durfte nie in einen Wagen steigen, wenn sie ihm anboten, ihn nach Hause zu fahren, nicht einmal, wenn sie seinen Namen riefen. Die Welt war voller Sünde. Die Frau sah ihm nach, als er an ihr vorbeieilte. Er fürchtete sich.
»Hab keine Angst«, sagte Miss Elsie. »Ich pass auf, dass dir keiner was tut.« Er ging noch schneller und sah sich nicht um.
2Sophie
Ein schriller Schrei durchschnitt die Luft. Ratlos betrachtete Judi ihre Tochter. Sophies blonde Locken bebten, und ihr Engelsgesicht war wutverzerrt.
»Nein!«, kreischte Sophie, stampfte mit dem Fuß auf, rannte zum Tisch und stieß ihre Plastikschale auf den Boden. Coco Pops und bräunlich verfärbte Milch spritzten auf die Amtico-Fliesen. Judi sprang nach vorn, packte Sophies kleinen Unterarm und gab ihr einen Klaps auf die Hand.
Das Kind war starr vor Schreck, bevor es losheulte. Fast eine Stunde brauchte Judi, um die Kleine zu beruhigen. Kaum war wieder Frieden eingekehrt, läutete es an der Tür. Judi fiel ein, das sie die Nachbarin mit ihrem kleinen Sohn eingeladen hatte. Sie öffnete und sah Alice mit zwei Kindern im Schlepptau.
»Entschuldige«, sagte Alice. »Ich hatte völlig vergessen, dass ich versprochen hatte, auf Jamies Freund aufzupassen. Wir können das verschieben, wenn du willst.«
Ehe Judi antworten konnte, kam Sophie herbeigelaufen und schrie freudig: »Jamie! Jamie!«
Judi lächelte. »Ach was, kommt rein. Kein Problem. Gerta kann mit ihnen in den Park gehen.«
Judi und Alice tranken Kaffee und aßen Kuchen, während die drei Kinder hinter Gerta hertrotteten.
»Wir gehen in den Park!«, sang Jamie, und Otto wiederholte seine Worte in einem leiernden Singsang.
Der Spielplatz lag am anderen Ende des Lyceum Parks. Gerta hoffte, dass sie den jungen Gärtner wiedersah, der manchmal dort arbeitete, und lächelte, als sie durch das offene Tor ging. Eifrig blickte sie sich um, doch der Park war verlassen. Es war ein gewöhnlicher Stadtpark mit struppigen Rasenflächen und einem Teich, in dessen Mitte ein Wasserstrahl aufsprühte, für den die Bezeichnung »Fontäne« entschieden zu hoch gegriffen wäre. Einige Enten watschelten am Rand des schmutzigen Wassers umher, und ein paar fette Tauben hatten sich zu ihnen gesellt. Gerta und die Kinder gingen um die letzte Biegung des asphaltierten Weges und sahen rechts den Spielplatz. Der Boden dort war mit gehäckselter Baumrinde ausgelegt. Als sie die hohe Baumgruppe mit den Sträuchern zur Linken erreichten, liefen die beiden Jungen an Gerta vorbei zu den Spielgeräten, dicht gefolgt von der quengelnden Sophie.
Sophie spielte immer mit Jamie, denn er war ihr Freund. Sie spielten auf der Rutsche im Park. Nicht der Baby-Rutsche, sondern der richtig großen Rutsche. Mummy hatte gesagt, sie sollten schön zusammen spielen. Aber jetzt spielte Jamie nur mit Otto. Sophie wollte ihn von der Rutsche schubsen, doch Gerta saß auf der Bank und sah ihnen zu. Gerta musste erst weg sein, bevor Sophie Otto wegschubsen und mit Jamie spielen konnte. Sie und Jamie wechselten sich brav mit dem Rutschen ab. Wie Mummy es gesagt hatte. Mummy mochte Jamie. Otto mochte sie nicht, weil Otto gemein war.
»Sag Otto, er soll weggehen«, quengelte Sophie. Aber Gerta schüttelte den Kopf und sagte zu Sophie, sie solle nicht doof sein. Dabei war Sophie gar nicht doof. Gerta war doof, und Otto war doof. Dann würde Sophie eben weggehen und sich verstecken, wo sie keiner fand. Und Mummy würde Gerta einen richtig großen Klaps geben, und Gerta würde weinen.
Sophie flog mit Feenflügeln über den Weg und in die Zauberbäume. Die Blätter waren rot und gelb und braun und grün. Das war ein gutes Versteck. Sophie beobachtete eine gierige Raupe, die einen Baumstamm hinunterkroch. Es dauerte lange, trotzdem kam keiner sie suchen. Sie hob einen Stock auf und stocherte im Laub. Mummy ließ sie nie mit Stöcken spielen, doch Mummy war nicht hier.
»Sophie!«, hörte sie Gerta rufen. Ihre Stimme klang ängstlich. Sophie musste kichern.
»Sophie!«, rief Jamie.
»Fopie!« kam Ottos Echo.
»Geh weg, Otto«, flüsterte Sophie so leise, dass es keiner hörte. Sie krabbelte tiefer in die Büsche. Die waren feucht und kratzig. Als sie einen Käfer über den Boden huschen sah, stach sie mit ihrem Stock nach ihm. Eine Biene summte neben ihrem Ohr. Da war eine Hand im Laub. Sophie stach danach, und eine Wolke ekliger Fliegen stob auf. Sophie beachtete sie nicht, denn sie hatte etwas viel Schlimmeres in den Blättern entdeckt. Die böse Hexe lag im Dreck und starrte Sophie an. Jetzt gefiel es Sophie hier nicht mehr. Sie wollte zu Mummy.
»Mummy!«, rief sie. Sie hörte ein Geraschel in den Büschen und sah Gerta, die auf sie herabblickte wie der Hund mit den tellergroßen Augen aus dem Märchen. Ihr Mund stand weit offen, und dann schrie sie.
Sophie hielt sich die Ohren zu. Sie wollte nicht, dass die böse Hexe aufwachte. »Geh weg, Gerta!« Sie wollte zu ihrer Mummy. Sie wollte nach Hause.
3Der Umzug
Geraldines Wangen waren rot vor Aufregung. Sie umklammerte den Schlüssel so fest, dass sich das scharfkantige Metall in ihre Haut grub. Nach monatelangem Warten konnte sie endlich ihr neues Zuhause in Besitz nehmen. Sie unterdrückte den Drang, laut »Jippie!« zu rufen, denn der Makler beobachtete sie. Also lächelte sie, während sie innerlich albern kicherte.
»Sie sind neu in der Gegend, nicht wahr?«, fragte der Makler, und Geraldine nickte. Ihr gefiel nicht, wie unverhohlen er sie musterte. »Was führt Sie her?«
»Die Arbeit«, antwortete sie.
»Es ist eine sehr schöne Wohnung«, bemerkte er. »Was sagten Sie doch gleich, was Sie beruflich machen?«
»Ich habe nichts gesagt.«
»Na, vielleicht finde ich das noch heraus.« Er grinste.
Geraldine war sich nicht sicher, ob er mit ihr flirtete, und fühlte sich prompt wie ein unsicherer Teenager. Offensichtlich hatte er ihre Angaben nicht durchgelesen, wenn er nicht wusste, dass sie Polizeikommissarin war. Daran gewöhnt, über anderer Leute Leben Bescheid zu wissen, behagte es ihr nicht, dass sie nicht einmal seinen Namen kannte, er hingegen ihr Schlafzimmer von innen gesehen hatte.
Der Makler drückte ihr die Hand, gratulierte ihr nochmals zum Kauf und wandte sich zum Gehen.
»Ist es eine günstige Zeit, um zu kaufen?« Sowie sie es ausgesprochen hatte, fürchtete Geraldine, er würde ihren plumpen Trick durchschauen. Doch es funktionierte. Er drehte sich wieder zu ihr.
»Nun, die Immobilienpreise in England steigen seit fünfzehn Jahren.«
»Ja, nur denken Sie, dass sich dieser Trend fortsetzt?« Sie war versucht, ihn auf einen Kaffee hereinzubitten, doch sie hatte nicht einmal Milch im Haus.
»Viele Leute behaupten, dass die Blase irgendwann in den nächsten zwei Jahren platzen wird.«
»Und was glauben Sie, wie sich die Preise entwickeln werden?«
»Könnte ich die Zukunft des Immobilienmarktes voraussehen, müsste ich nicht mehr arbeiten.« Er zögerte, bevor er etwas auf eine Visitenkarte schrieb. »Hier ist meine Handynummer. Wie wäre es, wenn Sie mich anrufen, sobald Sie sich eingerichtet haben?« Sie nahm die Karte. »Normalerweise lerne ich auf diese Art keine Frauen kennen«, ergänzte er auf einmal verlegen. Dann drehte er sich um und ging festen Schrittes weg. Geraldine blieb an der Tür stehen, blickte ihm nach und bemühte sich, nicht an Mark zu denken.
Geraldine war nie auf den Gedanken gekommen, dass Mark sie verlassen könnte, bis sie eines Abends nach Hause kam und er, von Koffern umgeben, in der Diele stand. Mark blickte an ihr vorbei, als er ihr verkündete, dass er auszog.
»Nach sechs Jahren« – das war alles, was Geraldine herausbrachte.
»Wir wissen beide, dass das hier nirgends hinführt.«
»Das hier?«, wiederholte sie wie benommen.
»Wir. Unsere Beziehung. Wir haben uns zu lange gegenseitig als selbstverständlich betrachtet. Ich sehe dich kaum noch, weil du immer arbeitest. Es ist Zeit, dass wir uns beide weiterentwickeln.«
Geraldine wollte widersprechen, ihm versichern, dass sie sich ändern würde. Doch die Worte blieben ihr im Hals stecken. Mark hatte all seine Sachen gepackt. Sein silberner Brieföffner war vom Dielentisch verschwunden. Sein Mantel hing nicht mehr am Haken. Ihr ging durch den Kopf, dass bald keinerlei Hinweis mehr auf ihn in der Wohnung wäre, ausgenommen der Müll, den er in den Eimer geworfen hatte, und sein Geruch an ihrer Bettwäsche. Wenn der verflogen war, blieb ihr nichts mehr von ihm. Sie sahen einander an.
»Wo willst du hin?«
Plötzlich griff Mark nach einem der Koffer. Sein Blick war auf einen Punkt oberhalb von Geraldines linker Schulter fixiert. »Ich ziehe zu jemandem.«
»Jemandem?«, wiederholte sie, und das Wort bekam etwas Bedrohliches. »Wem?«
Mark zögerte. Dann wurde sein Gesichtsausdruck weicher, und er antwortete leise: »Ihr Name ist Sue.« Geraldine ballte die Fäuste, bis sie spürte, wie ihre Fingernägel in die weichen Handflächen schnitten. Marks Miene wurde wieder frostig. »Meine restlichen Sachen hole ich morgen«, rief er und wuchtete einen großen Koffer durch die Haustür. Sie fiel mit einem dumpfen Knall hinter ihm ins Schloss.
Nun war Geraldine allein. Sie umklammerte die Kante des leeren Tisches und heulte.
»Er ist es nicht wert, dass du um ihn weinst. Er ist ein verlogener Mistkerl! Vergiss ihn, er ist es nicht wert«, wütete ihre Schwester später an dem Abend am Telefon.
Geraldine hatte vorgehabt, den Rest ihres Lebens mit diesem verlogenen Mistkerl zu verbringen. »Was mache ich jetzt?«, schluchzte sie.
»Vergiss ihn«, wiederholte ihre Schwester. Es half nicht.
Mark hatte stets behauptet, dass er nichts von Heirat hielte. Das war auch eine Lüge gewesen. Er hatte nur Geraldine nicht heiraten wollen. Als sie nicht einmal ein Jahr später erfuhr, dass er verlobt war, wurde sie von einer solch überwältigenden Wut gepackt, dass kein Raum mehr für Selbstmitleid übrig war.
»Du lernst jemand anderen kennen«, versicherte ihre Schwester ihr.
Geraldine nickte und beschloss im Stillen, dass sie sich nie wieder so verwundbar machen würde. Es gab mehr im Leben als die Zukunft, die Mark ihr genommen hatte. Er hatte ihrem Beruf die Schuld am Scheitern der Beziehung gegeben, aber ihr Beruf würde sie nie verlassen. Sie schaffte es, sich einzureden, dass sie gern Single war und vollständig in ihrer Arbeit aufging.
Ihre neue Wohnung in der hübschen kleinen Allee war genau richtig für Geraldine. Sie war der ideale Rückzugsort vom Stress ihrer Arbeit beim mobilen Einsatzteam der Mordkommission Südost. Sobald sie konnte, nahm sie sich einige Tage frei, um ihr Wohnzimmer zu streichen. Cremeweiße Wände und ein beiger Teppichboden ließen den Raum größer wirken, was Geraldine noch durch einen großen Spiegel über dem Kamin verstärkte. Sie warf einen kritischen Blick auf ihr Spiegelbild. Dunkle Augen blickten ihr streng entgegen.
Nachdem sie alles renoviert und eingerichtet hatte, machte sie sich ans restliche Auspacken. Sie war so in ihre Kisten und Kartons vertieft, dass sie beinahe die Türglocke überhört hätte. Hastig lief sie zur Gegensprechanlage. Auf dem kleinen Bord über dem Apparat sah sie eine Visitenkarte: CRAIG HUDSON – IMMOBILIENMAKLER. Ihr Blick verharrte auf dem Namen.
»Waschmaschine«, krächzte eine Stimme in der Gegensprechanlage.
»Kommen Sie rein.« Geraldine drückte den Summer für die Pforte. Einen Moment später klingelte es an der Tür, und sie öffnete einem schlaksigen Mann mit feuchtem Haar und Regenflecken auf den Schultern.
»Miss Steel?« Sie nickte, und er warf einen Blick auf die Papiere in seiner Hand. »Ihr Wäschetrockner«, las er vor.
»Kommen Sie rein.« Der Mann folgte ihr beschwingten Schrittes in die Küche und maß den Platz aus.
»Ja, das passt.« Er blickte hoffnungsvoll zum Wasserkocher. »Scheußliches Wetter da draußen.«
Geraldine wollte dringend weiter auspacken. »Bringen Sie die Maschine dann bitte rein?«
Der Lieferant seufzte und ging langsam nach draußen, wobei er mit seinen großen Füßen über ihren neuen Teppichboden schlurfte.
Mit seinem Kollegen schleppte er die Maschine durch den Nieselregen den Weg hinauf.
»Hier lang«, sagte Geraldine. Ihr stockte der Atem, als sie den zweiten Mann sah und bemerkte, dass er sie erkannte. Während sie zur Seite trat, um die Männer durchzulassen, überlegte sie angestrengt, wo sie ihn schon mal gesehen hatte. Sie versuchte, ihn sich kahlköpfig oder mit langem strähnigem Haar anstatt mit der schmutzigen grauen Mütze vorzustellen, die er sich tief in die Stirn gezogen hatte.
Geraldine vermied es, ihn noch einmal direkt anzusehen. Schnaubend und ächzend manövrierten die beiden Männer die Waschmaschine in die Küche. Geraldine setzte keinen Tee auf, während sie die Maschine anschlossen. Sie wollte die zwei so schnell wie möglich wieder los sein, damit sie die Wohnung für sich hatte, und war froh, als sie die Tür hinter ihnen schließen konnte. Dann putze sie die Küche gründlich und wischte sämtliche Schmutzspuren vom Fußboden.
Nachdem sie die Hausarbeit erledigt hatte, machte Geraldine sich einen Kaffee und hockte sich wieder neben den großen Kartonstapel. Als sie mit einem wohltuenden Ratschen das braune Packband von einem Karton riss, läutete ihr Arbeitstelefon.
4Das Team
Als Geraldine auf dem Polizeirevier ankam, wurde bereits ein Raum als Einsatzzentrale vorbereitet. Die Kleinstadt Woolsmarsh war etwa anderthalb Stunden Fahrt von ihrer neuen Wohnung entfernt, was bedeutete, dass sie zu Hause schlafen konnte, statt sich eine Unterkunft vor Ort suchen zu müssen. Bei ihrer Ankunft herrschte rege Betriebsamkeit, und sie sprang rasch beiseite, als zwei Computer an ihr vorbei durch den schmalen Korridor getragen wurden. Eine gehetzt wirkende Polizistin mit einem Klemmbrett in der Hand kam auf sie zu, als sie in der Tür stehen blieb.
»Hi, ich bin Detective Inspector Geraldine Steel, MIT«, stellte sie sich freundlich vor.
»DS Peterson gehört zum Mordermittlungsteam. Er wird Sie auf den aktuellen Stand bringen«, sagte die andere Frau und nickte erleichtert, als ein junger Polizist auftauchte, der eilig auf sie zuschritt. Er trug einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine gestreifte Krawatte, was Geraldine sofort an einen Uniabsolventen denken ließ, der sich für seine erste richtige Stelle bewarb. Seine lebhafte Begeisterung stand im klaren Kontrast zu Geraldines erstem Eindruck vom Revier, das durch das Eintreffen des Mordermittlungsteams sichtlich ins Chaos gestürzt worden war. Der DS verlangsamte seinen Schritt und lächelte. Er war etwas über einen Meter achtzig groß, kräftig und breitschultrig. Anscheinend trainierte er viel. Geraldine mochte ihn auf Anhieb. Sie reichte ihm die Hand, die er sofort fest drückte.
»Ian Peterson, Detective Sergeant«, sagte er. Etwas an der Art, wie er sich vorstellte, legte nahe, dass er erst kürzlich befördert worden war.
»DI Geraldine Steel. Worum geht es?«
Während sie zusahen, wie ein Schreibtisch in den Raum bugsiert wurde, erzählte Peterson ihr, dass sie den Mord an einer jungen Frau aus dem Ort untersuchten. Mehr wusste er auch nicht und zuckte entschuldigend mit den Achseln, als sollte er eigentlich alle Einzelheiten parat haben.
»Das ist schon mal mehr, als ich bis eben noch wusste«, scherzte Geraldine, und er lächelte erleichtert. Seine blauen Augen waren aufmerksam und freundlich. Sie betraten ihre Einsatzzentrale, in der gleich die Besprechung beginnen sollte.
Die Schreibtische für die drei dem Fall zugeteilten Kommissare standen in einer Ecke, denn es war nicht genügend Platz, ihnen jeweils eigene Büros zu überlassen. Es war eng in dem Raum, und nach und nach kamen immer mehr Leute herein, die sich auf der kleinen Fläche drängten. Als sie sich ihren Weg hinüber zur Schreibtischecke bahnte, erblickte Geraldine Ted Carter, einen grauhaarigen, im klassischen Sinne gutaussehenden Mann, der ihr Mentor gewesen war, nachdem sie die Ausbildung zum DI abgeschlossen hatte und noch Probezeit hatte. Carter hatte sie stets höflich behandelt, und sie war froh, sein vertrautes, wettergegerbtes Gesicht zu sehen. Carter nickte und stand auf, um sie zu begrüßen, wobei seine langen Beine unglücklich hinter dem Schreibtisch eingeklemmt waren.
»Wie ist die Welt doch klein«, sagte sie grinsend. Die Fältchen in seinen Augenwinkeln kräuselten sich bei seinem Lächeln.
Carter drehte sich halb zur Seite und machte sie mit dem anderen DI bekannt. »Das ist Tom Merton, Geraldine Steel.« Sie schüttelten einander die Hände. Mertons Händedruck fühlte sich nach dem energischen Handschlag des jungen Sergeants kühl an. Ein flauschiger Rotschopf thronte wie bizarre Zuckerwatte über seinem geröteten Gesicht. Im Gegensatz zu Carter erwiderte Merton ihr Lächeln nicht, als er sie in einem näselnd-schleppenden Ton fragte, ob sie DCI Gordon kenne. Geraldine verneinte stumm. Die anderen beiden hatten bereits früher mit dem Detective Chief Inspector gearbeitet, und Geraldine hoffte, dass sie als Neue im Team nicht im Nachteil war.
»Aber den Namen habe ich schon gehört«, sagte sie unsicher. Mit einem Nicken zog Merton sich hinter seinen Schreibtisch zurück. Geraldine hatte den Eindruck, dass Carter mehr sagen wollte, als es still im Raum wurde.
»Wir reden später«, flüsterte er. »Der DCI ist da.« Geraldine ging zu ihrem Schreibtisch. Sie glaubte, einen bösen Blick von Merton zu Carter zu bemerken, als sie sich umdrehte und zu der Frau sah, die neben der Ermittlungstafel stand.
Die Kostümjacke schlabberte an Kathryn Gordons zierlichem Oberkörper. Blasse Haut spannte sich straff über ihrem Gesicht, hing jedoch schlaff unter ihrem Kinn, doch ihre Augen blickten entschlossen. Sie trug kein Make-up und hatte ihr graumeliertes Haar zu einem strengen, kinnlangen Bob frisiert. Ihre Blässe ließ die beiden roten Flecken auf ihren Wangen umso auffälliger hervortreten, was ihr etwas von einem Clown verlieh, obgleich sie nichts Fröhliches an sich hatte. Geraldine sah sich im Raum um. Sämtliche Augen waren auf Kathryn Gordon gerichtet.
»Nun, da jetzt alle zuhören«, begann der DCI, »fangen wir an. Ich bin die Leitende Ermittlerin, DCI Kathryn Gordon.« Sie legte eine Pause ein und wandte sich zur Ermittlungstafel, um das Foto eines zerschundenen Gesichts zu betrachten, das starr in den Raum blickte.
»Wir sind hier, um herauszufinden, wer diese junge Frau gestern ermordet hat. Bisher haben wir noch keinerlei Hinweise auf den Täter.« Kathryn Gordon tippte mehrfach auf das Foto und wandte sich dann wieder dem erwartungsvollen Team zu. »Ihr Name ist Angela Waters«, fuhr sie fort. Abgesehen von ihrer raspelnden Stimme und dem leisen Surren der Computer war kein Mucks zu hören. »Auch bekannt als Angie oder Ange. Zweiundzwanzig Jahre alt, schlank, blond, wohnhaft Nummer 14a, Marsh Crescent. Sie wurde ungefähr vierundzwanzig Stunden vor dem Fund der Leiche getötet. Gefunden hat sie ein kleines Kind, das im Gebüsch im Lyceum Park spielte. Der Fundort wurde erheblich kontaminiert. Das Kind trampelte auf allen Spuren herum, die eventuell noch auf dem Boden waren, und das Au-pair-Mädchen ist der Kleinen ins Gebüsch gefolgt. Außerdem haben mehrere Wildtiere den Boden aufgewühlt: Füchse, Ratten, Eichhörnchen, vermutlich auch ein Hund. Irgendein Tier war über Nacht dort und hat die wenigen Hinweise vernichtet, die es vielleicht noch gab, bevor das Kind kam und den Rest erledigte. Die junge Frau wurde wahrscheinlich am Fundort getötet, aber die Spurensicherung konnte keine verlässlichen Fußabdrücke oder Bewegungsspuren mehr sichern.« Sie verzog das Gesicht. »Das Opfer wurde erwürgt, also suchen wir nicht nach einer Waffe, auch wenn die uniformierten Kräfte die Umgebung gründlich durchkämmen. Am Ende dieser Besprechung werden sich einige von Ihnen dem Suchtrupp anschließen.«
Die leitende Ermittlerin verstummte, sah wieder zu dem Foto und sagte: »Die Handgelenke des Opfers wurden fixiert, allerdings oberhalb des Ärmelstoffs, sodass wir nicht sagen können, womit. Sie war sehr dünn, daher könnte der Angreifer ihre Arme auch lange genug mit einer Hand gehalten haben, um sie zu Boden zu zwingen. Näheres wissen wir erst, wenn wir den vollständigen Bericht der Forensiker haben, doch es scheint nicht so zu sein, dass irgendetwas am Tatort hinterlassen wurde, das uns hilft, den Täter zu identifizieren. Was an Spuren da gewesen sein mag, wurde durch Laub, Schlamm und Tierfäkalien verwischt. Dem Muster der Hämatome am Hals nach glauben wir, dass der Mörder Lederhandschuhe trug, doch sonst gibt es keinerlei Spuren, kein Blut vom Opfer oder Täter, keinen Speichel, keine Schuppen, weder Blut noch Hautabschürfungen unter ihren Fingernägeln. Die Suche nach Fingerabdrücken im Wundbereich ergab bisher nichts. Hoffentlich haben wir morgen ein bisschen mehr, wenn wir den Autopsiebericht bekommen, aber bislang weist nichts auf Abwehrverletzungen hin.«
Gordon blickte sich um. »Wir brauchen schnell Resultate«, sagte sie. »Wir werden die üblichen Verdächtigen befragen und jeden, der das Opfer kannte: den Freund, die Angehörigen, Bekannte, jeden, der mit ihr zu tun hatte. Wir müssen auch bei den Nachbarn herumfragen, in den Geschäften und im Pub. Angela lebte mit einem Mann zusammen, John Drew. Drew arbeitet bei einem …«, sie blickte nach unten auf ihre Unterlagen, »Autohändler. Dem Honda-Autosalon am Hinckley-Kreisel. Wir müssen uns dort erkundigen. Das machen wir noch heute Vormittag, solange er nicht dort ist. Er ist nach Hause gegangen, nachdem wir ihn über Angelas Tod informierten. Sehen Sie, was Sie von seinen Kollegen über ihn in Erfahrung bringen, wenn er nicht dabei ist, und seien Sie nicht zu zartfühlend. Wir suchen auch nach jedem, der schon einmal wegen eines tätlichen Angriffs auffiel. Ich will, dass sämtliche Wohnheime und Jugendherbergen überprüft werden, und dass jeder gründlich vernommen wird, der kürzlich aus der Haft entlassen wurde oder auf Bewährung draußen ist. Was es auch ist, finden Sie es.« Als Geraldine sich umblickte, bemerkte sie, dass DS Peterson sie ansah und grinste.
»Gut, der Einsatzleiter sagt Ihnen, wofür Sie eingeteilt sind. DC Mellor, können Sie sich um Rotherhithe kümmern, wo Angela Waters herstammt? Bitten Sie die Kollegen, mit der Mutter und Angelas Bruder zu reden, und finden Sie heraus, wie es sich mit ihrem Vater verhält.« Sarah Mellor sah von ihrem Notizblock auf und nickte. Ihr Lächeln inmitten all der angespannten Mienen war eine angenehme Überraschung.
Geraldine wurde losgeschickt, das Kind und das Au-pair-Mädchen zu befragen, und sie stellte erfreut fest, dass sie mit DS Peterson arbeiten sollte.
Während sich das Team zerstreute, stand Kathryn Gordon noch eine Weile dort und betrachtete das Gesicht des Opfers. Nicht der Anblick des Todes bedrückte sie, sondern die Aussicht, dass der Täter ungeschoren davonkommen könnte. Die Natur und ein kleines Kind hatten jedwede Beweise vernichtet. Sie schaute sich in der stillen Einsatzzentrale um, bevor sie in ihrem Büro verschwand. Dort schloss sie die Tür hinter sich, öffnete einen der Aktenschränke und holte eine Flasche Whisky heraus.
5Gerta
Auf der Veranda waren zwei Leute. Der breitschultrige Mann überragte die Frau deutlich, die sehr ruhig und aufrecht dastand, das dunkle Haar sorgfältig nach hinten gebunden. Judi wusste sofort, wer sie waren, überprüfte die Dienstausweise aber trotzdem eingehend. Sie war sicher, dass die Polizisten ihre kluge Vorsicht zu schätzen wussten.
Die Stimme der Frau war tief und beruhigend, geübt darin, Menschen in kritischen Situationen zu beschwichtigen. »Mrs Judith Brightley? Sie haben heute Morgen mit Detective Constable Mellor gesprochen. Ich bin Detective Inspector Steel, und dies ist Detective Sergeant Peterson. Wir würden gern mit Ihrem Au-pair, Gerta Hersch, sprechen. Wenn ich es recht verstanden habe, kann sie ohne Dolmetscher reden.«
»Ja, das stimmt. Kommen Sie doch herein, Inspector Steel und … äh …«
»Sergeant Peterson.«
»Ja, hier entlang. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Tee? Kaffee?«
Sie führte die beiden ins Wohnzimmer und rief die breite Treppe hinauf: »Gerta! Kannst du bitte mal nach unten kommen?« Für so eine winzige Frau hat sie eine erstaunlich kräftige Stimme, dachte Geraldine. Sie blickte sich um und schmunzelte, als der Sergeant mit einem ehrfürchtigen Brummen auf das große Chintz-Sofa sank.
Gertas Augen waren rot und geschwollen vom Weinen, als sie geräuschvoll schniefend ins Zimmer kam. Sie setzte sich und begann, leise zu schluchzen, wobei sie ein Taschentuch in ihren kleinen Händen knetete.
»Miss Hersch, kannten Sie die Tote? War sie eine Freundin von Ihnen?«, fragte Peterson schroff. Geraldine stellte verwundert fest, dass ihn der Anblick einer in Tränen aufgelösten Frau offenbar ärgerte. Dann fiel ihr wieder ein, dass sie auf dem Revier einen Gesprächsfetzen aufgeschnappt hatte, demzufolge Peterson gerade Probleme mit seiner Freundin hatte. Geraldine lächelte dem Au-pair mitfühlend zu.
»Nein.« Das Schluchzen hörte auf, und sie putzte sich laut die Nase.
»Danke. Vielleicht können wir jetzt anfangen. Bitte erzählen Sie uns genau, was heute Morgen passiert ist, Miss Hersch.« Peterson hatte seinen Notizblock im Anschlag.
»Ja. Ich war mit meiner kleinen Sophie im Park, und mit James und Otto.«
»James und Otto?«
Judi betrat mit einem Tablett mit Tee und edlen Keksen leise das Zimmer. Ihr folgte ein kleines Kind. Sie reichte den Besuchern die Tassen, bot ihnen Kekse an und setzte sich mit der dritten Tasse hin. Kein Tee für Gerta. Das ungefähr vier Jahre alte kleine Mädchen starrte Geraldine mit riesigen blauen Augen an.
»Jamie ist der Sohn meiner Nachbarin«, erklärte Judi. »Und Otto ist sein Freund.« Das Kind jammerte los. »Ach du liebe Güte, was ist denn, mein Schatz?«, fragte Judi und stellte ihre Tasse hin. Geraldine verschluckte sich beinahe, weil Sophies Mutter das Gequengel so übertrieben ernst nahm. Peterson hüstelte, um ein Grinsen oder eine Grimasse zu überspielen – welches von beidem, ließ sich schwer sagen. Er legte den Stift ab und trank hastig einen Schluck Tee. Die Porzellantasse wirkte in seiner Hand wie Puppengeschirr.
»Jamie ist mein Freund!«, rief das Kind. Geraldine entging nicht, dass die Kleine berechnend durch die Finger zu ihrer Mutter linste, welche diesem vorgespielten Kummer aufsaß.
»Ist ja gut«, säuselte sie, »Jamie ist dein Freund. Keiner hat gesagt, dass er das nicht ist.«
»Vielleicht könnten Sie Sophie nach draußen bringen, damit wir mit Miss Hersch reden können?« War da ein Anflug von Gereiztheit in Petersons Tonfall, fragte sich Geraldine. Er machte sich gut, war umgänglich, aber seine schnelle Auffassungsgabe verleitete ihn offenbar dazu, übereilt seine Meinung zu äußern.
»Böse, böse Gerta!«, schrie Sophie und bedachte das Au-pair mit einem derart bitterbösen Blick, dass Geraldine aufmerkte.
»Warum?«, fragte sie und bemerkte, dass Peterson sich erleichtert zurücklehnte. Zweifellos konnte sie auf ihn zählen, wenn es darum ging, eingefleischte Schurken einzuschüchtern. Doch eine Vierjährige war unbekanntes Terrain für ihn, und diese hier war es offensichtlich gewohnt, ihren Kopf durchzusetzen. Geraldine kniete sich hin und flüsterte der Kleinen verschwörerisch zu: »Erzähl mir von Gerta.« Sofort waren die Tränen weg.
»Jamie ist mein Freund. Wir spielen schön, wie Mummy gesagt hat.« Bald war klar, was Gertas Vergehen gewesen war: Sie hatte Otto erlaubt, mit Jamie zu spielen. Geraldine atmete tief durch. Sie hatte keine besondere Ausbildung im Befragen von Kindern, aber sie konnte geduldig sein. »Gerta ist böse und doof. Wegen ihr hat Jamie mit Otto gespielt, und nur wegen ihr bin ich mit einem Stock unter die Blätter gegangen.« Sie sah zu ihrer Mutter auf. »Ich habe mit einem Stock gespielt. Einem großen Stock. Wegen Gerta. Und Gerta ist schuld, dass ich die Hand angefasst habe. Die ist immer größer geworden, bis sie riesengroß war, und da habe ich geschrien, weil …« Sie machte eine Pause, um sich zu vergewissern, dass auch alle auf sie achteten. »… das war die böse Hexe!« Nun steckte sie ihren Daumen in den Mund und griff nach ihrer Mutter.
»Also, Miss Hersch«, sagte Geraldine, während sie sich wieder auf das Sofa setzte, »die Kinder«, sie vermied es, Namen zu nennen, »haben gespielt und …«
»Sophie hat gespielt.« Das Au-pair blickte ängstlich zu ihrer Arbeitgeberin. »Sie sich in den Büschen versteckt hat. Sie weiß, dass sie nicht darf das. Sie darf nicht in die Büsche krabbeln. Ich ihr das gesagt habe.« Mrs Brightley schnaubte leise, und Geraldine fragte sich, ob dieses häusliche Drama mit einem Rausschmiss und einem Anruf bei der Agentur endet. Andererseits würde Gerta vermutlich ungleich leichter zu gängeln sein, nachdem sie sich diesen Patzer geleistet und zugelassen hatte, dass Sophie weggelaufen war.
»Ich sehe gleich, dass sie ist weg«, fuhr Gerta fort. »Schnell ich suche, und ich finde sie in den Büschen.« Sie erschauderte bei der Erinnerung. »Und ich sehe etwas unter dem Busch. Unter den Blättern sehe ich die Hand. Es ist die Hand von einer Frau. Ich bringe Sophie sofort weg von den Blättern. Ich mache sie sauber und rufe gleich Mrs Brightley an, und sie sagt, ich soll nach Hause kommen. Also bringe ich Sophie nach Hause. Und die kleinen Jungen auch. Und Mrs Brightley ruft die Polizei an.«
Peterson schrieb hastig mit. Gerta sackte auf ihrem Sessel zusammen und sah unglücklich zu Sophie, die sie mürrisch beäugte. Eine einzelne Träne rollte dem Au-pair über die Wange, und Geraldine fiel auf, wie jung Gerta aussah – achtzehn, neunzehn Jahre höchstens. Zu jung, um weit weg von zu Hause in eine fremde Tragödie verstrickt zu werden. Wahrscheinlich hatte sie sich gefreut, nach England zu kommen. Armes Ding.
»Vielen Dank, Miss Hersch. Sie haben uns sehr geholfen.« Mit einem höflichen Nicken zu Mrs Brightley stand Geraldine auf.
»Danke für den Tee«, ergänzte Peterson, der sich ebenfalls erhob.
»Wir haben es mit einem schnellen, gezielten Mord zu tun, keinem aus dem Ruder gelaufenen Überfall«, sagte Geraldine auf der Fahrt zurück zum Revier. »Was sagt uns das?«
Peterson blickte zu ihr hinüber. »Wollte jemand ganz sicher sein, dass sie tot ist?«
Geraldine überlegte. »Es gibt keine Anzeichen für einen Kampf.«
»Vielleicht kannte sie ihren Mörder«, sagte der DS, »und rechnete nicht mit einem Angriff. Aber wir wissen, dass er sie von hinten attackierte, also könnte es auch ein Fremder gewesen sein, der sie überraschend anfiel.«
»Es sieht nicht wie ein willkürlicher Überfall aus«, entgegnete Geraldine, »eher wie eine absichtliche Tötung. Fast klinisch. War das geplant? Wollte ihr Mörder sie aus irgendeinem Grund aus dem Weg haben?«
»Was bedeuten würde, dass er sie kannte.« Peterson hielt an einer roten Ampel und sah zu Geraldine hin.
»Weist das darauf hin? Dass der Mörder sie gehasst hat, genug, um sie umzubringen?« Sie dachte nach. »Es ging relativ schnell. Hoffentlich blieb ihr nicht die Zeit zu begreifen, was geschah. Er schlich sich von hinten an sie heran, packte ihre Arme, zog sie ihr auf den Rücken, fesselte sie womöglich, um sie bewegungsunfähig zu machen, wobei ich nicht weiß, ob er dazu die Zeit hatte, drehte sie zu sich – ich frage mich, warum? – und erwürgte sie. Er ist stark. Es war alles ziemlich schnell vorbei. Wohl mit Absicht. Er muss Angst gehabt haben, dass er gestört wird.«
»Oh, gestört war der schon!«, sagte Peterson.
Geraldine versuchte, sich den Tathergang vorzustellen. »Ein plötzlicher Ansturm von Angst und eine hektische Gegenwehr, bevor sie das Bewusstsein verlor. Es dürfte innerhalb weniger Minuten vorbei gewesen sein. Ihr blieb keine Zeit, um Hilfe zu schreien.«
»Sie könnte auch zu verängstigt gewesen sein, um zu schreien, oder zu geschockt. Andererseits wissen wir nicht, ob sie nicht doch um Hilfe geschrien hat«, sagte Peterson. Die Ampel wechselte auf Grün, und er fuhr weiter. »Denken Sie, der Mörder wollte schnell sein, damit sie nicht litt?«
»Ein rücksichtsvoller Mörder? Möglich wäre es, sofern er sie kannte. Aber er musste es auch zügig erledigen. Immerhin hat er sie im Park erwürgt.«
»Ja«, stimmte Peterson ihr zu. »Er musste schnell sein, egal wie er empfunden haben mochte.«
»Aber warum hat er solch einen öffentlichen Ort gewählt?«
»Das legt eine Gelegenheitstat nahe. Jedenfalls wollte er nicht länger als nötig dableiben.«
»Also stellt sich die Frage: Wollte er sie umbringen? Oder wollte er ihren Tod?«, sagte Geraldine, und als Peterson sie verwirrt ansah, schüttelte sie den Kopf. »Das ist nicht dasselbe, oder? Nein, ganz und gar nicht. Denn wenn er einfach töten wollte … ungeachtet der Identität seines Opfers …« Sie schwieg, und beide überlegten. »Aber der Mörder wollte das Gesicht seines Opfers sehen. Er hat sich vergewissert, dass er die Richtige hatte«, ergänzte sie unsicher.
»Oder er genoss es, sie zu beobachten«, sagte Peterson verbittert. Geraldine zuckte zusammen, als er ihre eigene Befürchtung aussprach. Sie beide wussten, dass der Mörder, wenn er Angela Waters aus einer perversen Lust heraus getötet hatte, wahrscheinlich wieder zuschlagen würde.
Die Ermittlungstafel war aktualisiert worden. Nun steckten dort auch die Namen von Angela Waters’ Mutter und Bruder. Carter war mit einem Sergeant zu dem Autohändler gefahren, zwanzig Minuten Fahrt entfernt, und wollte von dort aus weiter, um die Nachbarn zu befragen. Merton überprüfte die einschlägig Vorbestraften. Geraldines nächste Aufgabe bestand darin, zu dem Café zu fahren, in dem Angela gearbeitet hatte, und danach ihren Freund, John Drew, aufzusuchen. Sie bemühte sich, ihre Freude zu unterdrücken. Schließlich war der Freund rein statistisch gesehen der Hauptverdächtige.
6Das Café
Im Erkerfenster des Bella Cafés hing eine Speisekarte neben einem Schild, das den Kunden mitteilte, das Café wäre »Von 7 bis 7 geöffnet – Wir servieren den besten Kaffee und eine Auswahl echter italienischer Backwaren.« Im neonbeleuchteten Inneren schrien Geraldine scheußlich orangene Wände und Stahlrohrstühle mit fies grünen Plastiksitzflächen entgegen. Bis auf ein Mädchen in einer schwarzen Hose und einer weißen Bluse, das sie ernst begrüßte, war das Café leer.
»Ein Tisch für zwei?«
Geraldine hielt ihren Dienstausweis in die Höhe. Wortlos wies das Mädchen sie zu einem Ecktisch.
»Sie sind wegen Angie hier, oder? Steckt sie in Schwierigkeiten? Sie ist nämlich gestern nicht zur Arbeit gekommen, und der Chef hat getobt. Sie hat immer noch nicht angerufen. Ich habe versucht, sie zu erreichen, aber sie geht nicht an ihr Handy. Ist ihr was passiert?« Sie blieb zwischen Geraldine und Peterson stehen, als die sich setzten.
»Bitte nehmen Sie auch Platz, Miss …?«
»Christina.« Sie sank auf einen Stuhl und stützte den Kopf in die Hände. »Der Chef kommt gleich raus.« Dabei nickte sie finster zu einer kleinen weißen Tür mit der Aufschrift »NUR PERSONAL«.
»Wie gut haben Sie Angela Waters gekannt?«, fragte Geraldine sie behutsam und legte ein Diktiergerät auf den Tisch. Peterson legte einen Stift auf sein Notizblock. Christina blickte auf, und die Frage hing noch in der Luft, als ein untersetzter Mann mit schütterem Haar aus der »Personal«-Tür gestürmt kam und sie mit einer herrischen Geste zu sich befahl. Sofort sprang Christina auf und eilte zu ihm. Obwohl er leise redete, war deutlich zu erkennen, dass er mit ihr schimpfte. Schließlich kam sie zu Wort, und seine Haltung veränderte sich. Er blickte zu den beiden Polizeibeamten und ging auf sie zu, den Kopf devot zur Seite geneigt. Ein schwarzer Schnauzbart wippte beim Sprechen auf seiner Oberlippe.
»Sir, ich bitte um Verzeihung«, sagte er mit erstaunlich hoher Stimme. »Mir war nicht klar, dass Sie von der Polizei sind. Trinken Sie doch bitte einen Kaffee. Geht aufs Haus.« Er nickte Christina zu, bevor er sich lächelnd wieder an Peterson wandte.
Geraldine erwiderte: »Wir würden gern ungestört mit Christina reden, und danach mit Ihnen, Mr …?«
»Umberto. Antonio Umberto.«
»Schließen Sie doch bitte das Café, solange wir uns unterhalten, Mr Umberto. Wir fangen mit Christina an. Es wird auch nicht lange dauern«, ergänzte sie, als der Besitzer sich merklich aufplusterte. Dann huschte er zur Eingangstür, um das Schild von »Open« auf »Close« umzudrehen, bevor er sich hinter den Tresen zurückzog, um zu lauschen.
Geraldine sprach leise. Auf der anderen Tischseite sah sie Peterson angestrengt lauschen, damit er jedes ihrer Worte verstehen konnte. Christina sah nervös zu ihrem Chef hinüber, der Sandwiches zurechtrückte, die auf einem weißen Teller vertrockneten.
»Christina, leider muss ich Ihnen schlechte Nachrichten über Angela mitteilen. Sie wurde gestern im Park überfallen und ist tot.« Die junge Frau starrte auf die Tischplatte. Sie gab keinen Laut von sich, doch ihr Kinn bebte, und sie presste die Hände im Schoß so fest zusammen, dass die Fingerknöchel weiß wurden. Geraldine wartete.
»Ermordet?«, fragte sie nach einer Weile flüsternd.
Geraldine erzählte ihr, was passiert war. »Sie hat nicht gelitten, aber wir müssen herausfinden, wer das getan hat. Deshalb möchte ich, dass Sie mir ein paar Fragen beantworten.«
Christina hatte sieben Monate lang mit Angela Waters zusammengearbeitet, doch es stellte sich bald heraus, dass sie ihnen keine weiteren Informationen liefern konnte. Außerhalb der Arbeit im Café hatten sie nichts miteinander zu tun gehabt. Sie wusste so gut wie nichts über ihre Kollegin, abgesehen von dem, was sie ihrem oberflächlichen Geplauder in ruhigen Momenten entnehmen konnte. John Drew kannte Christina nicht.
»Wer?«
»Angelas Freund.«
»Ach, Johnny. Ja, Entschuldigung, ich wusste nicht, wie er mit Nachnamen heißt. Ange hat dauernd von ihm geredet. Sie war ganz verrückt nach ihm. Ich habe ihr gesagt, dass sie viel zu jung ist, um auch ans Heiraten zu denken. ›Zieh erstmal los und tob dich aus‹, habe ich zu ihr gesagt.«
»Hatte Johnny ihr einen Antrag gemacht?«
»Nein, das glaube ich nicht. Sie hat bloß davon geredet. Sie wissen schon, wie es einige Mädchen eben so machen. Ich glaube, sie hat sich einiges von ihm bieten lassen, aber anscheinend haben sie das hingekriegt.«
»Was hingekriegt?«, fragte Peterson.
»Das mit seiner Bindungsphobie. Das Übliche.« Sie zuckte mit den Schultern. Eine einzelne Träne rollte ihr über die Wange, und sie blinzelte. Offenbar wurde ihr erst jetzt richtig klar, dass ihre Kollegin tot war. Christina stützte die Ellbogen auf den Tisch und bedeckte ihr Gesicht mit einer Hand. Ihre vorübergehende Offenheit erlosch.
»Sie sagten, dass Christina sich einiges von ihm bieten ließ. Was genau meinen Sie?«, fragte Geraldine. Christina schüttelte den Kopf. »Hat sie mal einen Streit erwähnt? Oder sich beklagt, dass er trinkt? Dass er sie in einem Wutanfall geschlagen hat?«
»Hören Sie, ich habe den Typen nie gesehen. Alles, was ich weiß, ist, dass sie dachte, er ist der Richtige. Er hat ihr immer Blumen geschenkt, was süß war, aber sie hatte Angst, dass er nicht der Typ zum Heiraten ist. Sind die Guten normalerweise nie.« Geraldine musste an Mark denken, verdrängte ihn aber sofort wieder aus ihrem Kopf und konzentrierte sich auf das, was Christina sagte. »Aber sie hat nie irgendwas von Auseinandersetzungen erzählt.«
»Trotzdem ließ sie sich einiges von ihm bieten, wie Sie sagten. Was?«
»Bloß, dass er sich nicht festlegen wollte. Das wollen die nie.«
Geraldine achtete darauf, ihre Stimme neutral zu halten. »Denken Sie, dass einer von ihnen noch jemand anderen traf?«
»Fremdgehen, meinen Sie? Also sie nicht. Sie war verrückt nach ihm. Und überhaupt ist sie nicht so. Wie gesagt, sie ist … sie war nett.«
»Und ihr Freund?«, hakte Peterson nach. Doch die Befragung hatte eindeutig an Schwung verloren.
»Ehrlich, ich will ja der Polizei helfen und so, aber ich weiß gar nichts über ihren Freund. Ich habe ihn nie gesehen. Was Ange angeht, die war wirklich nett, aber ich habe sie nur gesehen, wenn sie hier gearbeitet hat. Ich weiß nicht mal, wo sie wohnt.« Christina wirkte wieder den Tränen nahe.
»Danke, Christina. Sie haben uns sehr geholfen.« Geraldine holte eine Visitenkarte hervor und reichte sie der jungen Frau. »Rufen Sie uns bitte an, falls Ihnen noch etwas einfällt, das uns helfen könnte, mehr über Angela zu erfahren.« Geraldine sah auf und ertappte den Besitzer dabei, dass er sie beobachtete und aufmerksam lauschte. Er blickte rasch weg und machte sich an dem Essen auf dem Tresen zu schaffen. »Mr Umberto«, rief Geraldine ihm zu, »jetzt würden wir gern mit Ihnen reden.« Er sah finster auf den Boden, als er zum Ecktisch kam.
»Geh die Küche putzen«, knurrte Umberto und setzte sich. Christina sprang auf und verschwand durch die »Personal«-Tür.
Umberto sah misstrauisch von Peterson zu Geraldine. »Ist viel zu tun«, sagte er. »Meine Küche ist immer blitzsauber. Nur eine meiner Hilfen, sie ist weg. Einfach so. Ohne einen Pieps zu sagen.« Er warf die Hände in die Höhe und pfiff lautlos. »So ist das mit den jungen Mädchen heute. Sie kommen, sie arbeiten ein bisschen, sie gehen. Wer weiß, wo sie hin ist. Den einen Tag ist sie hier, den nächsten ist sie weg. Nicht mal ein Anruf. Kein Wort. Ist nicht wie in Italien mit den jungen Frauen. Hier kümmert sich keiner, hat keiner Familie, die ihnen beibringt, was richtig ist und was falsch.« Er seufzte. »Und was mache ich jetzt?«
Geraldine unterbrach ihn: »Angela Waters ist tot, Mr Umberto.«
Er wirkte entsetzt, und sein nervöses Geplapper erstarb. »Angela tot?«, wiederholte er, bekreuzigte sich und schloss für einen Moment die Augen.
Geraldine bat ihn um Angela Waters’ Daten, und Umberto eilte durch die Hintertür, um sie zu holen. Er lief verblüffend leichtfüßig auf den Zehenspitzen und kehrte kurz darauf mit einem Zettel zurück. Auf dem standen in einer kindlichen Schrift mit schmierigem blauem Kugelschreiber notiert Angelas Name, Adresse und Handynummer. Nach sieben Monaten war dies alles, was von ihr blieb. Andere Unterlagen zu ihr hatte Umberto nicht. Er hatte sie bar bezahlt, und er versicherte, dass er alles lückenlos belegte, da könnten sie jederzeit nachsehen, nur wären die Papiere gerade nicht hier im Café. Die befanden sich angeblich bei seinem sehr ehrlichen Buchhalter, einem aufrichtigen Mann, eher wie ein Priester, der ihm half.
Geraldine unterbrach seine wortmächtigen Beteuerungen: »Wir wollen nicht Ihre Bücher prüfen, Mr Umberto, auch wenn ich sagen würde, dass die Steuerbehörde das interessant finden dürfte.«
Umberto erklärte mit großem Bedauern, dass sein Buchhalter gerade im Urlaub wäre. »Alle meine Papiere er hat mitgenommen.« Seine Äußerungen zu Angela waren ähnlich abstrus. Er verkündete, das Café würde sich niemals von ihrem Verlust erholen. »Sie hat nicht geklagt. Sie ist sauber, und sie immer lächelt, wenn mich sieht.« Das Einzige, was halbwegs nach der Wahrheit klang, war: »Immer sie kriegt gutes Trinkgeld. Ist gut für alle, nicht?«
»Wir würden uns gern ein bisschen umsehen«, sagte Peterson.
Mr Umberto wurde rot. »Sie wollen umsehen?«, wiederholte er, als hätte der Sergeant eine obszöne Bemerkung fallen lassen. Widerwillig öffnete er ihnen die Tür mit der Aufschrift NUR PERSONAL und folgte ihnen. Christina war nicht dort. Als Geraldine sich zu Umberto umdrehte, kam das Mädchen durch die Brandschutztür herein. Sie roch nach Zigarettenrauch. Geraldine und Peterson wechselten einen Blick.
»Ich war nur kurz an der frischen Luft«, murmelte Christina und wandte sich zum Spülbecken, das sie energisch zu scheuern begann.
Mr Umberto nickte und zuckte mit den Schultern, als wollte er sagen: »Was soll man machen? Heute bekommt man einfach kein anständiges Personal. Ist nicht wie in Italien.« Sie schauten sich in der Küche um.
»Ich würde Sie gern noch einmal kurz sprechen, Christina. Dort drinnen.« Geraldine führte die junge Frau zurück ins Café, und sie setzten sich außer Hörweite von Umberto. »Eine letzte Frage, Christina. Haben Sie gestern Morgen hier gearbeitet?« Auf deren stummes Bejahen hin fügte sie hinzu: »Wann haben Sie angefangen?«
»Ich hatte die Morgenschicht, aber als Angie um eins nicht kam, hat mich der Chef gefragt, ob ich länger bleibe. Er hat getobt vor Wut. Es war ja nicht das erste Mal. Sie rief dauernd an und meldete sich krank. Aber gestern hat sie nicht angerufen, und der Chef hat geschworen, dass er sie diesmal rausschmeißt. Ich musste zwölf Stunden durcharbeiten, ohne Pause.« Petersons Augen verengten sich ein wenig, doch Geraldine blieb bei ihrer Linie.
»War gestern Vormittag viel los?«
»Wie immer«, antwortete Christina achselzuckend.
»Und wie läuft das so ab, Christina? Sie bedienen an den Tischen, und Mr Umberto ist wo? In der Küche?«
Die junge Frau lachte. »Der? In der Küche? Niemals! Das mache ich alles, also ich stehe in der Küche, bediene, räume ab, wasche ab. Er macht nichts anderes, als hinter der Kasse stehen und Sandwiches schmieren. Das traut er keinem anderen zu. Keiner schneidet so wie er, sagt er.«
»Ich wette, er kann Gurkenscheiben so dünn schneiden wie kein anderer«, warf Peterson ein, und Christina lachte spöttisch.
»Ja, ganz richtig.«
»War er irgendwann mal in der Küche?«
»Nein. Wie gesagt, da geht er nie rein. Er steht immer an seiner kostbaren Kasse, schneidet und grinst die Leute an, wenn sie ihre Sandwiches bestellen.«
»War er gestern den ganzen Vormittag hier, Christina? Ist er nie weg gewesen? Überlegen Sie genau.«
Christina antwortete prompt: »Er verlässt das Café nie, solange es geöffnet ist. Weil er keinem traut. Er geht nicht mal zum Klo. Und er gibt keinem den Schlüssel oder lässt uns auch nur in die Nähe der Kasse.« Geraldine lehnte sich zurück. Sie hatte ihre Antwort. Antonio Umberto konnte sich am Mittwochmorgen nicht zum Park geschlichen haben.
»Das Gesundheitsamt könnte ein Wort mit dem Charmeur wechseln wollen, nachdem die Steuerbehörde mit ihm fertig ist«, murmelte Peterson, als er mit Geraldine wieder in den Wagen stieg.
Sie nickte. »Erinnern Sie mich daran, nie im Bella Café zu essen.«
»Was halten Sie von Umberto? Ich glaube, er verschweigt etwas.«
»Auf jeden Fall ist er ein Kotzbrocken«, stimmte Geraldine ihm zu. »Aber die Kellnerin hat ihm ein Alibi gegeben. Und unehrlich zu sein, macht ihn nicht zu einem Verdächtigen in einem Mordfall. Welches Motiv sollte er haben?«
»Umbertos Buchhaltung ist fragwürdig«, sagte Peterson. »Vielleicht hatte Angela Waters das herausgefunden.«
»Das ist wohl kaum ein Mordmotiv.«
»Könnte sie ihn nicht erpresst haben?«
»Hmm, wäre möglich. Christina gibt ihm ein Alibi, aber wir werden das trotzdem überprüfen.« Peterson grinste begeistert, weil sie seine Theorie nicht gleich von der Hand wies, was sie wieder daran erinnerte, dass er erst kürzlich zum DS befördert worden war. »Ich setze einen Constable darauf an«, versprach sie. »Wir können mal sehen, ob wir irgendwelche Unregelmäßigkeiten auf seinen Konten finden, Änderungen bei Abhebungen oder Ausgaben, obwohl ich wetten würde, dass ein Großteil seiner Einnahmen nie die Bank erreicht.« Eine Pause trat ein.
»Was denken Sie?«, fragte Peterson.
»Ich denke, dass wir Johnny Drew besuchen sollten«, antwortete sie. »Und ich denke, dass es an der Zeit ist, dass Sie mich Chefin nennen.«
»Da haben Sie recht, Chefin.« Er grinste.
Geraldine blickte in den Spiegel, als sie wegfuhren. Das Schild an der Tür des Cafés war wieder umgedreht worden. Dort ging das Geschäft wieder normal weiter.
7Johnny
Die Wohnung, in der Angela Waters mit ihrem Freund zusammengelebt hatte, lag über einer schäbigen Ladenzeile am Rande einer baufälligen Wohnsiedlung. Die weiße Fassade war längst gelblich braun verfärbt wie Nikotinfinger, die Schaufenster unten waren schmierig, und Abfall wehte über das Pflaster: zerrissene Zeitungen, Fast-Food-Verpackungen und Plastiktüten, die verschrumpelten Ballons ähnelten. All das hatte längst städtische Wildtiere herbeigelockt, und Füchse und Ratten streiften durch die Gegend. Dennoch besaß die Straße eine Vitalität, die den teureren Gegenden der Stadt fehlte, eine Gemeinschaft, die ihren Lebenswillen geradezu herausschrie: So hart es auch sein mochte, das Leben war kostbar.
Geraldine hörte die Schritte des Sergeants im betonierten Treppenhaus über sich. Es bildete die Verbindung zwischen einer geschlossenen Druckerei und einem Blumenladen, aus dem die Polizisten von einer dunkelhaarigen jungen Frau in einem sehr kurzen Rock neugierig beäugt wurden. Im Treppenaufgang stank es. Als Geraldine oben ankam, trat sie in den Laubengang, der oberhalb der Läden verlief. Hier war es zugig und befremdlich still. Sie blickte über die Brüstung. Weit unter ihr kickte eine Gruppe Jungen in grauen und braunen Kapuzenpullis eine Dose am Rinnstein entlang. Eine alte Dame, die aus Geraldines Warte winzig anmutete, schlurfte auf die Jungen zu. Geraldine verkrampfte sich, doch die Jugendlichen waren viel zu sehr mit ihrer Dose beschäftigt.
Geraldine war bewusst, dass sie ihr Urteilsvermögen nicht von ihren Ahnungen trüben lassen durfte, trotzdem war sie schon gegen Johnny Drew eingenommen, bevor sie ihn gesehen hatte. Er ließ sie zu lange vor der Tür warten, und als er endlich öffnete, war seine Elendsmiene entschieden zu starr. Auch wenn er alle Symptome eines unter Schock stehenden Trauernden zeigte, war Geraldine davon überzeugt, dass er ihnen etwas vorspielte. Als sie ihm durch den dunklen Flur folgten, musterte Geraldine ihn von hinten: schmaler, knochiger Oberkörper unter einem engen T-Shirt. Er führte sie in ein hinten liegendes Zimmer, wo es nach abgestandenem Bier und Zigaretten roch. Dort setzten sie sich auf ein durchgewetztes Sofa und einen Sessel, die nicht zusammenpassten. Rastlose Augen in einem kantigen Gesicht huschten mit der hektischen Beweglichkeit einer gefangenen Fliege über Geraldine hinweg.
Sie blickte stirnrunzelnd auf ihren Notizblock und hatte einige Mühe, mit Drews prompten Antworten mitzuhalten. Wahrscheinlich hatte er schon Stunden für dieses Gespräch geprobt. Er musste gewusst haben, dass sie kommen würden. Die Woche über verkaufte der Mann Autos. Jetzt verkaufte er seine Unschuld. Geraldine nahm ihm seine Trauermiene nicht ab, aber sie glaubte ebenso wenig, dass er Angela Waters umgebracht hatte. Wieder konnte sie nicht sagen, was es war, doch etwas fühlte sich falsch an. Seine Trauer mochte unecht wirken, nur machte ihn das nicht zum Mörder.
Angela hatte sich angeblich beklagt, dass Johnny nicht bereit war, sich fest zu binden, was jedoch kaum ein Mordmotiv darstellte. Sein Alibi hingegen war interessant. Es war alles andere als wasserdicht, denn wie er ihnen erzählte, hatte er am Morgen des 26. Septembers Termine für Probefahrten arrangiert. Die Einzelheiten zu den Wagen kamen ihm sehr geschmeidig über die Lippen, allerdings konnte er keine befriedigende Auskunft darüber geben, was er zwischen zehn und halb elf getan hatte. Wie er erzählte, hatte er auf dem Hof mit einem Kunden gesprochen. Das konnte stimmen, nur erinnerte er sich nicht mehr an den Namen. Er glaubte, dass es ein Mr Shah gewesen war.
Angelas Mutter und Bruder hatte er erst ein Mal gesehen, und er gestand, dass er sie nicht sonderlich mochte. Ihren Vater hatte Angela nie erwähnt. Johnny wusste nichts über ihn, noch nicht einmal, ob er noch lebte. Sie hatten nicht über ihre Familien gesprochen.
»Traf sie sich noch mit jemand anderem?«, fragte Geraldine geradeheraus. Johnny schnaubte und strahlte ein überbordendes Selbstvertrauen aus. Arroganter Idiot, dachte sie.
»Hatte sie irgendwelche Feinde? Fällt Ihnen jemand ein, der sie genug gehasst haben könnte, um ihr so etwas anzutun?«, fragte Peterson.
»Hören Sie mal«, platzte Johnny heraus, und plötzlich blitzte Wut in seinen Augen auf. »Ich tue mein Bestes, das alles überhaupt zu begreifen. Nicht bloß, dass ich mein Mädchen verloren habe, was schon schlimm genug ist, aber …« Er vergrub das Gesicht in den Händen, und seine Schultern bebten. Das war nicht gespielt, denn so gut war er nicht. Geraldine ließ ihm einen Moment.