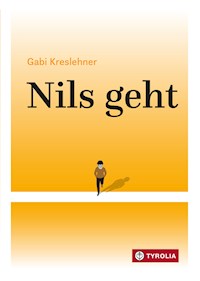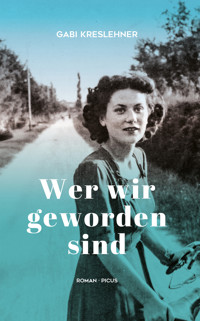
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebt Juli gemeinsam mit ihrem Mann August auf dem Berg am Unterhof. Dass auch nach mehreren Ehejahren noch immer kein Nachwuchs da ist, betrübt sie zutiefst. Voller Neid blickt sie auf die Nachbarn am Oberhof, wo bereits drei Kinder herumtoben. Erst nach dem Krieg, den August wie durch ein Wunder überlebt, bringt Juli im November 1919 eine gesunde Tochter zur Welt: Anna wächst zu einem fröhlichen Mädchen heran und verliebt sich später in Karl, den Erben vom Oberhof. Bald heiraten die beiden, denn Anna ist schwanger und Karl hat seinen Einberufungsbefehl erhalten – drei Tage nach der Hochzeit muss er an die Front. Ob sie sich je wiedersehen werden? Kurz vor der Jahrtausendwende entdeckt Joanna, Annas Tochter, im Haus ihrer Mutter außerhalb von New York das Foto eines kleinen Jungen. Sie ist gleichzeitig fasziniert und beunruhigt, steckt es ein und nimmt es mit nach Hause. Über Wochen hinweg beschäftigt Joanna dieses Bild, bis sie schließlich ihre Mutter zur Rede stellt. Und ihre Mutter beginnt endlich zu erzählen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Marianne von Willemer-Preis der Stadt Linz 2015 Projektstipendium für Literatur der Kunstsektion des Bundeskanzleramtes 2016/17 Arbeitsstipendium des Landes OÖ 2019
Copyright © 2025 Picus Verlag Ges.m.b.H.
Friedrich-Schmidt-Platz 4/7, 1080 Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien
Umschlagabbildung: © Donald Jean / Arcangel Images
ISBN 978-3-7117-2163-1
eISBN 978-3-7117-5535-3
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter www.picus.at
GABI KRESLEHNER
Wer wirgeworden sind
ROMAN
PICUS VERLAG WIEN
Für meine Eltern Rosa und Josef
Er drehte sich zu ihr, öffnete die Augen, schaute sie an, legte sein Gesicht an ihren Hals und schlief wieder ein.
Sie jedoch blieb die ganze Nacht wach, sog ihn in sich ein, seinen Duft, den weichen Körper, sein Seufzen im Schlaf, die Dunkelheit auf seinem Gesicht, die Schatten, als der Morgen kam, das erste Licht auf seinem Haarschopf. Sie wusste, das war alles, was sie haben würde, mehr würde es nicht geben, nur diese Erinnerungen, die eingesogenen, die festgedachten, die nachgespürten.
Inhalt
1. TEIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2. TEIL
1
2
3
4
5
6
3. TEIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. TEIL
1
Die Kerze flackerte und zischte, bevor sie erlosch. Ächzend und mühevoll drehte sich Juli im Bett von einer Seite zur anderen. Wieder eine Nacht, in der sie ständig aufschreckte, weil der Wind um die Mauern des alten Hofes pfiff und an den Fenstern rüttelte. Sorgenvoll dachte Juli daran, dass es jederzeit schneien konnte und sie dann eingesperrt waren hier oben auf dem Berg. Was würde dann sein? Wer würde ihr helfen, das Kind auf die Welt zu bringen, wenn die Hebamme nicht durchkam?
Gerade war der Große Krieg vorbei. Gerade fing man sich wieder, gewöhnte sich an den Frieden. Viele Männer waren heimgekehrt, viele nicht. Manchem Heimgekehrten fehlte ein Bein, ein Arm, ein Auge, manch einer hatte das Reißen am ganzen Körper. Zu Krüppeln hatte der Krieg sie gemacht, innen und außen. Aber wer überlebt hatte, kämpfte sich zurück, so gut es ging. Nichts anderes konnte man tun.
Und nun sollte dieses Kind zur Welt kommen. Auf diesem Hof auf dem Berg, dem die graue Zeit in den Mauern stecken geblieben schien. Es war wie ein Geschenk, wie ein Wunder.
Dieses Kind. Juli musste lächeln und legte die Hände auf den Bauch. Nichts hatte sie mehr erhofft. So lange hatte sie gewartet, viele Jahre lang, da erhoffte man nichts mehr.
Juli wusste nicht viel über ihren Körper, nie hatte es erklärende Worte gegeben, nicht in der Schule, nicht von der Mutter. Alles, was sie wusste, alles, was man ihr beigebracht hatte, war, ihre Arme und Beine zu öffnen, wenn August da hineinwollte, und ihn tun zu lassen, was er dann da wollte. Dann, hatte die Mutter gesagt, würde das erste Kind nicht lange auf sich warten lassen und dann würde alles gut werden dort oben auf dem Hof. Juli hatte ihr geglaubt, weil sie es hatte glauben wollen und weil es keinen Grund gab, es nicht zu tun.
Aber die Jahre vergingen und nichts geschah und Julis Sehnsucht wurde immer größer. Sie hatte niemanden hier auf dem Berg, keine Freundin, keine Vertraute, und die Schwester war so weit, drei Stunden dauerte der Gang hinunter vom Berg ins Tal und den Fluss hinauf bis in das Dorf, in dem Theres mit ihrem Mann lebte. Unzertrennlich waren sie gewesen, Juli und Theres, nicht nur Schwestern, sondern Zwillinge, eine glich der anderen bis aufs letzte Haar, bis ins Innerste, eine Verbindung, die mit den Hochzeiten jäh zerschnitten war.
Juli vermisste die vertrauten Gespräche, die warmen, weichen Berührungen, das leise Lachen, den Heuduft im Haar der anderen. Eine Tochter, hatte sie gedacht, würde ihr all das wiederbringen. Eine Tochter …
Aber die Jahre vergingen und das Bild, das Juli in ihren Träumen gesehen hatte, das kleine Mädchen, das zu ihren Füßen mit Kastanien und Nüssen spielte, verblasste mehr und mehr und sie verbot sich, an die Puppe zu denken, die sie dem Kind schon im ersten Jahr heimlich genäht hatte, eine mit zwei Zöpfen aus gelber Wolle und einem hübsch geblümten Kleidchen. Immer tiefer grub sich die Traurigkeit in Julis Körper und Seele und nichts konnte ihr helfen, schon gar nicht August, denn auch seine Enttäuschung war groß und Juli spürte die Schuld, die er ihr anhängte, weil ihr Körper nicht tat, was man von ihm erwartete.
Trotzdem waren es keine schlechten Jahre, die sie erlebten, Juli und August Pfaller vom Unterhof, sie mochte ihn, seine stille, zurückhaltende Art und dass er sie vor der Schwiegermutter verteidigte, weil keine Kinder kamen.
Auf dem Nachbarhof, dem Oberhof, wurde Hochzeit gefeiert. Johann, ein bedächtiger, kluger Mann in den frühen Dreißigern, hatte lange zugewartet, ehe er sich für eine Frau entschied. So manche Magd hatte gehofft, ihn zu erobern, er war stattlich und groß, eine angenehme Erscheinung, und im Dorf hatte man sich schon zu fragen begonnen, warum er sich denn keine finde.
Aber er hatte sich schon lange eine gefunden. Susanna, die Tochter vom Schlachter-Wirt. Gerade neunzehn war sie, ein schönes Mädchen, groß, schlank, dunkelhaarig, gesegnet mit Verstand und Herzenswärme und einer Singstimme, die alle berührte und verzauberte. Manch einer fragte sich, warum sie sich das antat, hinaufzugehen auf den Berg. Eine wie sie konnte ganz andere haben, einen Großbauern aus der Ebene, einen Bürgerlichen aus der Stadt, da winkte ihr ein anderes Leben, ein schönes, bequemes, eines, das nicht nur aus Arbeit und Mühsal bestand, aber sie hatte nur ihn haben wollen, den Johann Ebenhauser vom Oberhof, und nach viel Streit und Zorn hatte sie es durchgesetzt bei den Eltern.
Kaum war das erste Ehejahr herum, war der Hoferbe geboren, Karl, ein kleiner wuschelhaariger Kerl, drollig anzuschauen in den kurzen Hosen, in denen er zur Freude der Mägde tollpatschig durch seinen ersten Sommer stolperte.
Im nächsten Jahr folgte ein weiteres Kind und noch eines im übernächsten, Franziska und Mathilde, und je lauter das Kindergeschrei wurde und je mehr Winzlinge auf dem Oberhof herumtollten, desto stiller wurde es zwischen Juli und August auf dem Unterhof.
In der Welt draußen hingegen herrschte Lärm und Unruhe. Der Kaiser im fernen Wien war alt geworden, eine steinerne Figur am Ende des Glanzes. Lange war es her, dass die junge Elisabeth von Bayern auf dem Brautschiff die Donau heruntergezogen war. Burgl, Julis Schwiegermutter, die Altbäuerin vom Unterhof, war dabei gewesen und immer noch bekam sie glänzende Augen, wenn sie davon erzählte. Jubelnde Menschen hätten die Ufer gesäumt und der Liebreiz der jungen Prinzessin sei selbst über das Wasser hinweg spürbar gewesen.
Gemeinsam waren sie alt geworden, die Kaiserin von Österreich und die Bäuerin vom Unterhof, und mit keiner von beiden hatte es das Leben wirklich gut gemeint. Es war alles so lange her, die Jugend der Burgl, die Jugend der Kaiserin und auch die guten Tage, denn eines Tages brachte Alois, der Knecht, eine Neuigkeit aus dem Wirtshaus mit auf den Berg. »Sie haben den Thronfolger erschossen! Man sagt, es wird Krieg geben.«
Alle schreckten auf. »Was?«
Ein kalter Schauer überlief Julis Rücken. Sie fröstelte. Wie ein Jännerwind, dachte sie, wie ein Eiswind im Jänner kommt das über uns. Sie wandte sich um, schaute ihrem Mann in die Augen und griff nach seiner Hand. Draußen ging die Sonne unter und sie spürten, wie es dunkler und kühler in der Stube wurde.
Vier Wochen später begann der Krieg. Es war Sommer, heiß mit wenig Regen, man fürchtete Dürre. Die Marschbefehle kamen. August musste gehen, auch Johann, der Nachbar, und Alois und mit ihm alle anderen Knechte von den Berghöfen. Manche gingen leicht und beschwingt, manche nachdenklich, manche wollten gar nicht gehen. Die Frauen hielten ihre Sorgen bedeckt, ihre Klagen über das plötzliche Übermaß an Arbeit und wie das nun zu schaffen sei, wollte keiner hören. Zu Weihnachten, hieß es, zu Weihnachten sei doch schon wieder alles vorbei. Bis dahin sei es nicht lange. Und es wären ja die Alten da. Und die Kinder. Und jeder müsse halt anpacken. Die Männer gingen, die Frauen blieben, keiner hatte eine Wahl.
Um vier Uhr morgens waren sie aufgestanden, Juli packte Brot und Speck in die Rucksäcke, die Männer schlüpften in schweres Gewand und festes Schuhwerk, ein letzter Blick durch die Stube, ein letzter Gang durch den Stall, dann marschierten sie los. Vorne die Männer, hintennach die Frauen, eine schweigsame Prozession im Morgendämmern. Am Nachbarhof schloss sich das nächste Grüppchen an, man nickte einander zu, zu sagen gab es nichts.
Schweigend marschierten sie hinunter zur Biegung bis dorthin, wo der Wald begann. Abschied nun in innigen Umarmungen, dann gingen die Männer weiter, die Frauen blieben und blickten ihnen hinterher. Verschämt wischte sich Susanna, die Nachbarin, über das Gesicht, die kleinen Mädchen schmiegten sich an ihre Beine, während Karl, der Fünfjährige, still an einen Baum gelehnt stand und den Vater nicht aus den Augen ließ, bis er im Wald verschwunden war. Langsam stieg die Sonne auf.
Juli senkte den Kopf, sie mochte den Schmerz der Nachbarin nicht sehen, denn sie selbst empfand ihn nicht. Ihr eigener Schmerz war ein anderer, ihr eigener Schmerz griff nach ihr, sobald sie die Kinder sah, Karl und seine kleinen Schwestern. Sie schämte sich zutiefst, aber dass August nun fort war, war für Juli eine Erleichterung, denn sie würde Ruhe haben. Vor August, vor der Pflicht, schwanger zu werden; nicht jedoch vor ihren quälenden Gedanken.
Sie drehte sich um und begann langsam den Heimweg. Die anderen folgten ihr, im Rücken hörte sie die leisen Stimmen der Frauen und die hellen der Kinder.
In der Küche setzte sie sich kurz auf den Schemel im Eck, lehnte sich an die Wand, schloss die Augen und fragte sich, was werden würde. Immer noch hing der Duft des Brotes, das sie gestern gebacken hatten, im Raum, tief sog Juli ihn ein und betete, dass der Krieg nicht für lange sei.
Aber er war für lange.
An den Kindern sah man, wie die Zeit verging.
Karl kam in die Schule, marschierte jeden Tag vom Berg hinunter ins Tal, lernte leicht und liebte es zu lernen.
Manchmal, bevor er nach der Schule den Heimweg antrat, schlüpfte er in den dämmrigen Gang des Wirtshauses, wo der Schlachter-Wirt, sein Großvater, die Zeitung aufgehängt hatte, die er einmal in der Woche bekam. Er holte sich den Schemel aus der Ecke, stellte sich darauf und begann zu lesen. Der Geruch der Druckerschwärze fuhr ihm in die Nase, während er vom Krieg las, von tapferen Soldaten, von fremden Ländern, Städten, Flüssen und Gebirgen, er las von Verdun, vom Monte Meletta, vom Isonzo, und wenn er leise diese Namen und Wörter vor sich hinmurmelte, hatte er das verwirrende Gefühl, als zergingen sie ihm auf der Zunge und als schaute er durch ein Fenster hinaus in eine andere Welt, hinunter vom Berg, hinaus aus dem Dorf, weg vom Fluss und hin zum Vater, der irgendwo dort draußen sein musste, irgendwo jenseits des Flusses, jenseits der Hügel und Bergketten, die bei klarem Wetter an der fernen Linie des Horizonts sichtbar wurden.
Karl dachte sich dorthin und darüber hinaus. Er dachte daran, dass es Meere gab, Ozeane sogar, denn davon hatte der Lehrer erzählt, also musste es stimmen, und jenseits der Meere und Ozeane gab es andere Länder, kleinere, größere, Kontinente sogar. Er stellte sich einen Ozean vor und dahinter Amerika und Afrika und dass sich über alles Land und alles Wasser ein Himmel spannte, ein einziger. So zumindest hatte er es gelernt und er nahm sich vor, den Vater zu fragen, wenn er endlich einmal heimkam, ihn zu fragen, ob das tatsächlich so war, das mit dem Himmel – dass es nur diesen einen gab, diesen einen einzigen, der für alle Menschen galt, für alle Tiere und für alles Leben, denn dann wären doch alle gleich und ein jeder hätte seinen Platz.
Einmal erwischte der Schlachter-Wirt seinen Enkelsohn beim Zeitunglesen und Von-der-Welt-Träumen. »Ach, der Karl!«, sagte er und legte ihm die Hand schwer auf die Schulter, dass Karl zutiefst erschrak, weil er ihn nicht hatte kommen hören. »Magst auch etwas vom Krieg erfahren? Sorgst dich um den Vater?«
Da bekam Karl ein schlechtes Gewissen. Krieg? Sorgen um den Vater?
Darauf hatte er völlig vergessen.
Verlegen und beschämt starrte er den Großvater an. Der lachte gutmütig. »Bist ja ein gescheiter Bub, wie man hört. Schau in die Küche! Die Großmutter hat Buchteln gemacht. Hol dir eine für den Heimweg!«
Er lächelte, strich dem Kind über den Kopf und ging seiner Wege. Karl schlüpfte in die Küche zur Großmutter. Die freute sich, ihn zu sehen, drückte ihm drei Buchteln in die Hand und schaute zufrieden zu, wie er eine sofort und in Windeseile verdrückte. »Das Lernen macht wohl hungrig«, lachte sie, packte ihm noch eine ein und schickte ihn heim. »Grüß mir die Mutter!«, trug sie ihm auf. »Und morgen nach der Schule hab ich wieder etwas für dich!«
Karl nickte dankend und schaute, dass er weiterkam, denn die Mutter brauchte ihn zur Arbeit, im Sommer für die Heumahd, im Winter zum Füttern der Tiere.
Er war ein drahtiger kleiner Bursche geworden, klug und ernsthaft, und manchmal fragte Susanna sich, was in seinem Kopf vor sich ging, wenn er still die abendliche Suppe in sich hineinlöffelte.
»Fürchtest du dich vor mir?«, hatte der Vater gefragt, als er im letzten Juli plötzlich in die Stube getreten war und Karl damit so überrascht hatte, dass er erschrocken zurückgewichen war.
Der Vater strahlte etwas Dunkles, etwas Müdes aus, etwas, was Karl früher an ihm nicht gekannt hatte, und ja, er fürchtete sich.
»Nein«, sagte er, »nein!«, und schüttelte heftig den Kopf.
Johann schaute seinen Sohn an, als blickte er durch ihn hindurch. »Du hast ja recht. Ich würde mich auch vor mir fürchten.«
Er kam aus dem Lazarett, war angeschossen worden, zog ein wenig das linke Bein hinter sich her und war heimgeschickt worden, um sich noch ein wenig zu erholen, doch schon nach vier Tagen musste er zurück.
Diesmal begleitete Susanna ihn nicht bis zur Biegung. Diesmal blieb sie in der Haustür stehen, als wagte sie nicht, das Haus zu verlassen. Sie umschlang ihn, hielt ihn, so fest sie konnte. Sie schauten einander in die Augen, konnten sich nicht lösen und Karl wünschte sich aus tiefstem Herzen, dass die Zeit stehen bliebe jetzt und für immer.
Aber die Zeit blieb nicht stehen und Johann löste sich aus den Armen seiner Frau. »Es tut mir so leid«, murmelte er, »es tut mir so leid. Du bist noch so jung. So eine junge Frau. Du darfst nicht allein bleiben, falls …«
Sie schüttelte den Kopf. »Hör auf damit«, sagte sie heftig. »Hör auf damit!«
»Schsch«, machte er, »schsch«, streichelte ihren Kopf, drückte ihn an seine Brust. »Versprich es mir«, sagte er.
Sie weinte. »Versprich du mir, dass du wiederkommst.«
Er ging. Als er kaum noch zu sehen war, begann Karl zu laufen und zu schreien. Johann drehte sich um und wartete. Schweigend gingen sie nebeneinander her, Karl spürte die Hand des Vaters auf der Schulter.
An der Kuppe, dort, wo der Weg steil bergab führte und schließlich im Wald verschwand, blieb Johann stehen, beugte sich nieder und schaute seinem Sohn eindringlich in die Augen.
»Hilf deiner Mutter«, sagte er, »versprichst du mir das? Du bist so groß geworden, Karl, so groß. Geh ihr zur Hand! Mit der Arbeit, mit den Kleinen. Du kannst das schon! Hilf ihr!«
Karl nickte. Johann strich dem Sohn über Haar und Wangen und ging.
Karl legte seine Hand dorthin, wo er gerade noch die Finger des Vaters gespürt hatte, schaute ihm hinterher, lauschte den Tritten, die klangen ruhig und tröstlich, als ginge der Vater nur zum Pferdemarkt oder ins Wirtshaus oder in die Sonntagsmesse. Er blieb stehen, bis er ihn nicht mehr sah, und auch dann kehrte er noch nicht um. Er blieb stehen und schaute ihm hinterher, schaute auf den Fleck, der er gerade noch gewesen war, schaute und schaute. Den Berg hinunter, den Wald entlang.
Vom Tal blinkte der Fluss hoch wie reinstes Gold und Karl dachte an die Sonntage, wenn sie alle zusammen den Berg hinuntergegangen waren in die Kirche zum Messbesuch, die Mutter, die Schwestern, er und der Vater. Und danach ins Wirtshaus. Und während der Vater sich an den Stammtisch setzte und mit den Männern laut politisierte, musste er, Karl, mit den Frauen in die Küche gehen, widerstrebend anfangs, aber dann ganz zufrieden. Er biss in die krachende Buttersemmel, die frisch aus dem Ofen des benachbarten Bäckers gekommen war, schaute den Schwestern zu, wie sie sich an bauschige Frauenröcke schmiegten, hörte das Lachen der Frauen und sog die betörenden Gerüche ein, die aus Töpfen und Bratrohren kamen.
Wie lange das alles her war!
Eintönig flossen die Tage dahin. Ein erster, sonnenloser Dezembertag mit Schneegeruch in der Luft und schneller Dämmerung und mit ihr kam der Briefträger um die Biegung und auf die Höfe zu.
Barbara, die jüngste Magd auf dem Unterhof, erkannte ihn schon aus der Ferne, seine ächzende, sich abmühende Gestalt, und sie wusste, was er brachte, jeder wusste, was er brachte – schwarz geränderte Briefe mit immer gleichem Inhalt. Totengräber nannte man ihn mittlerweile hinter vorgehaltener Hand, eine undankbare, ungerechte Bezeichnung, war er doch nur der Bote, der Überbringer des Unglücks und nicht sein Verursacher.
Barbara schlug die Hände vor den Mund und lief in die Küche zur Bäuerin. »Der Briefträger«, ächzte sie mit schreckgeweiteten Augen, »der Briefträger kommt!«
Ein Stich traf Juli ins Herz, sie stellte ab, was sie in Händen hielt, lief hinaus, da sah sie ihn nur mehr von hinten, er war vorbeigeeilt, auf den Nachbarhof zu. Erleichtert spürte Juli sich aufatmen, spürte, wie ihr Körper nachließ und sie in ein tiefes Zittern fiel. Sie schlang fest die Arme um sich, zwang sich zur Ruhe und schloss die Augen. Es würde nicht sie treffen, nicht sie, diesmal nicht. Wieder einmal war der Sensenmann vorbeigegangen, wieder einmal war sie davongekommen.
Später schämte sie sich. Als sie sich rasch ein Schultertuch umgelegt hatte und hinübergeeilt war, um der Nachbarin beizustehen. Sie schämte sich, weil sie Susanna all die Jahre hindurch beneidet hatte. Um den Kindersegen. Um das Glück. Und sie schämte sich wegen der Erleichterung. Weil es nun nicht sie traf, sondern die andere. Die andere bekam den Brief mit dem schwarzen Rand, diesen Brief, den man gar nicht öffnen musste, weil man ohnehin um seinen Inhalt wusste.
Susanna war nicht vorbereitet. Susanna richtete das Abendbrot, summte ein Lied und hing ihren Gedanken nach, die Mädchen quengelten um ihre Beine und Karl, der Siebenjährige, las in der Zeitung, die er sich nach der Schule vom Großvater geholt hatte, vom Tod des Kaisers im fernen Wien.
Plötzlich stand der Briefträger in der Tür, räusperte sich, klopfte. Susanna wandte sich um und alle Farbe wich aus ihrem Gesicht.
Sie starrten den Eindringling an. Die Kinder, die Frau, die Magd. Dann gab Susanna ein leises Raunen von sich, ein Ächzen und Klagen, die Schüssel glitt aus ihren Fingern, traf auf den Boden mit lautem Klirren und zersprang.
»Mein Beileid, Bäuerin«, murmelte der Briefträger verlegen, überreichte den Brief, senkte die Augen, wagte nicht, ihr ins Gesicht zu schauen, und huschte hinaus.
Natürlich öffnete Susanna den Brief. Und las von Heldentod, von gefallen für Kaiser und Vaterland.
Karl schmiegte sich still an die Mutter, als sie weinend zusammenbrach. Sie hielt ihn im Arm, wiegte sich klagend hin und her und sagte: »Jetzt bist du der Bauer, Karl, jetzt bist du an der Reihe.«
Und Karl nickte und dachte an das Versprechen, das er dem Vater beim Abschied gegeben hatte.
Still war die Nachbarin durch die Tür getreten und half dem Siebenjährigen, die Mutter in die Stube zu bringen. Sie setzten sie auf die Bank, schlugen sie in eine Decke ein, schmiegten die kleinen Töchter an ihren Körper, zündeten eine Kerze an und begannen die langen Gebete des schmerzhaften Rosenkranzes.
Leise kamen die Mägde in die Stube, kamen aus dem Stall und aus der Scheune und vom Unterhof, in Windeseile hatte die Nachricht sich verbreitet. Sie setzten sich dazu und folgten weinend der Vorbeterin in den monotonen Singsang des Rosenkranzes und dachten wohl an die eigenen Liebsten, an Brüder und Väter, die irgendwo an den Fronten kämpften, irgendwo verloren im Grau dieses Krieges.
Karl setzte sich der Mutter zu Füßen und lehnte sein Gesicht an ihre Knie. Ein letztes Mal Kind sein, ein letztes Mal Tränen. Verschämt wischte er sie fort und befahl das Bild des Vaters vor sein inneres Auge.
Die ersten Hungerflüchter kamen. In den Städten gab es nichts mehr zu essen und am schlimmsten war es in Wien. Um alles musste man sich anstellen in langen Schlangen und wenn man Glück hatte …
… aber irgendwann war jedes Glück aufgebraucht und es gab nichts mehr, nur noch den Hunger und die Kälte, und die setzten sich fest im Bauch, in der Seele, im Gehirn.
Hinaus aufs Land wollten die Menschen, hinaus aus den Hungerkesseln der Städte. Draußen auf dem Land, so hofften sie, würden sie ein Stück Leben wiederfinden, würden vergessene Erdäpfel in den Äckern liegen und Äpfel an den Bäumen hängen, verschrumpelt und gefroren vielleicht, aber doch immer noch Äpfel.
So kam Klara auf den Unterhof. Stand eines Abends mit ihrer Mutter in der Haustür und starrte Juli ins Gesicht. Ein dunkler, dünner Strich war sie, ein Kind wie viele in dieser Zeit und doch … da war eine Sehnsucht in diesen Augen und um dieses Mädchen herum, eine Sehnsucht, die Julis eigene anrührte.
Vor drei Tagen hatten Klara und ihre Mutter in Wien den Zug bestiegen und waren gefahren, so weit der Zug eben fuhr. Dann folgte ein langer Fußmarsch aus der Stadt hinaus aufs Land und nun waren sie endlich hier gelandet, die Höfe hatten ins Tal geblinkt wie Hoffnungsschimmer und sie waren ihnen zugegangen. Schließlich standen sie in der offenen Haustür vor der Bäuerin, Wärme waberte ihnen entgegen und das flackernde Licht einer Petroleumlampe und mit der Kraft einer Mutter, die ihr Kind schützen musste, wusste Klaras Mutter, dass sie nicht gehen, dass sie sich nicht abweisen lassen würde.
»Schick sie fort«, keifte eine Stimme im Hintergrund, »wir haben selbst nicht mehr genug!«
Die Frau schüttelte den Kopf und streckte ihre Hände aus. »Bitte«, sagte sie, »bitte! Wir haben nichts mehr. Nur noch das. Nehmen Sie es, aber lassen Sie uns bitte bleiben.«
Juli schaute auf die klammen Finger, in denen ein mit winzigen roten Steinen besetztes Kreuz an einem goldenen Kettchen lag. »Bitte«, sagte die Frau, »bitte!«
Julis Herz krampfte sich zusammen. Viele waren schon da gewesen, hatten um Obdach und etwas zu essen gebeten, aber man konnte nicht allen helfen, man musste doch schauen, dass man die eigenen Leute durchbekam. Eine warme Milchsuppe konnte man geben, ein Stück Brot, eine Nacht im Heu, aber mehr ging nicht.
»Bitte«, sagte die Frau, »bitte! Und wenn es nur für ein paar Tage ist. Dass wir ausruhen können.«
Hilflos starrte Juli auf die beiden Menschen in der Tür, hohlwangige Gespenster, ein halbwüchsiges Kind versteckt hinter seiner Mutter, die nun zu reden begann wie um ihr Leben.
Dass ihr Mann in den Dolomiten gefallen sei. Dass der Hunger nage in Wien. Dass sie es nicht mehr ausgehalten hätten. Dass alle wie graue Gespenster daherkämen. Dass sie es einfach nicht mehr ausgehalten hätten. So allein. Und immer hungrig. Und sie würden nicht viel essen, sie seien das gewöhnt. Und sie würden arbeiten, daran seien sie auch gewöhnt. Und es seien Rubine, kleine zwar, aber immerhin Rubine. Und sie gebe sie gern. Wenn die Tochter und sie nur bleiben dürften.
Die Frau brach ab, atmete heftig, öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Es war alles gesagt. Bitten konnte man noch. Auf die Knie fallen und bitten. Von drinnen erneut die keifende Stimme: »Schick sie weg!«
Die Frau schloss die Augen und sah Brot vor sich, eine warme Suppe, ein Bett zum Ausruhen. Sie hoffte auf ein Wunder, sie hoffte so sehr, aber sie wusste, Wunder geschahen selten. Jedoch dieses hier, tatsächlich, dieses geschah.
Das Mädchen trat einen Schritt zur Seite, trat hinter der Mutter hervor, hob das Gesicht und schaute Juli an, und da konnte Juli sie nicht mehr gehen lassen.
Der Schwiegermutter war es nicht recht. »Noch zwei unnütze Esser mehr«, keifte sie, »und für unsereinen bleibt nichts mehr.«
»Du bist noch nie am Verhungern gewesen«, sagte Juli scharf, »also sei still!«
Da wandte die Schwiegermutter sich ab, wischte über ihren Mund und ging leise schimpfend in den Stall zum Vieh, da fand sie Trost.
Juli stellte der Frau und dem Kind Suppe und Brot hin. Sie aßen, schweigend und schnell, als hätten sie lange nichts gegessen und als fürchteten sie, dass man es ihnen wieder wegnehmen könnte. Als sie fertig waren, brachte Juli sie in eine der leer stehenden Knechtekammern.
»Wie heißt du denn?«, fragte Juli das Kind und zupfte vorsichtig an einem der dünnen Zöpfchen, die ihm links und rechts über die Schultern fielen. Das Kind schaute Juli in die Augen und schwieg.
»Klara«, sagte die Mutter, »sie heißt Klara.«
Juli wandte sich der Frau zu und schaute ihr fragend ins Gesicht. »Sie redet nicht mehr«, flüsterte die Frau, »seit wir den Brief bekommen haben, redet sie nicht mehr.«
Sie brach ab, wischte mit der Hand flüchtig über die Augen. »Sie hat einfach damit aufgehört.«
Juli nickte. »Hier könnt ihr schlafen«, sagte sie, »ruht euch jetzt einmal aus.«
Die Frau ergriff Julis Hand und drückte sie. »Danke!«
Juli ging zurück in die Stube, nahm ihr wollenes Schultertuch, zog es eng um sich, trat hinaus in die Kälte und hinters Haus und starrte in die einfallende Dunkelheit und das leichte Glimmen, das vom Fluss noch zu sehen war.
Am nächsten Morgen nach der Morgensuppe nahm sie das Mädchen an der Hand und zog es mit sich hinaus vor die Tür und hinter das Haus. Da lag ihnen das Tal vor Augen, der Fluss, der sich in ruhigen Serpentinen hinschlängelte, das Licht, das sich darin spiegelte, Häuserreihen entlang der Ufer, dicht bewaldete Hügel rundherum, dazwischen duckten sich Dörfer und einzelne Gehöfte, Kirchtürme ragten auf und über all dem Sonne und Himmel, Wolken und Schatten und in der Ferne, als Schemen nur erahnbar, das Gebirge.
»Schau«, sagte Juli leise. Und Klara schaute, ergriffen von der Schönheit des Anblicks, ergriffen vielleicht auch von der Ruhe und Wärme, die sich langsam in ihr ausbreitete, seit die Bäuerin ihre Hand genommen hatte.
»Was immer du gesehen hast«, sagte Juli leise wie zu sich selbst, »was immer du gesehen und gehört und erlebt hast, überdecke es damit.«
Klara legte ihre Wange an Julis Hand und nickte, schwieg aber. Tag für Tag und Wochen und Monate schaute sie von nun an in die Weite, in den Himmel, in die Sonne, in den Fluss, aber nichts konnte ihr die Wörter abringen, die hatten sich fest in ihr verknäuelt und lösten sich nicht aus der Erstarrung.
Der Frühling kam, der Sommer, und eines Abends, Ende Juni, klagte die Schwiegermutter über Bauchweh und Müdigkeit. Sie legte sich in ihrer Kammer ins Bett, schlief ein und wachte nicht mehr auf. Der Pfarrer kam angefahren und segnete sie ein. Sie brachten sie ins Tal und begruben sie. Es war nichts Besonderes zu sterben. Nicht in diesen Tagen. Nicht in diesem Krieg.
Und als meinte der Tod, dass es noch nicht genug sei, schlug er gleich noch einmal zu.
Das Unglück geschah völlig unerwartet an einem hellen Julimorgen des Jahres 1917, als sie das Heu einbrachten, das in den letzten Tagen geschnitten worden und auf den Wiesen getrocknet war. Klaras Mutter stand auf dem Futterboden und verteilte es mit der Gabel in den Ecken unter dem Dach. Seit Stunden schon arbeitete sie auf den Wiesen und nun auf dem Heuboden und langsam spürte sie Hunger. Ein zufriedenes Grummeln schlich sich in ihr Herz, denn sie wusste, gleich würde sie essen und den Hunger stillen. Und sie wusste auch, an Julis Tisch würde ein Platz für sie sein, für sie und ihre Tochter, solange sie einen brauchten. Das Leben hatte es doch noch einmal gut mit ihnen gemeint.
Zufrieden und dankbar griff sie nach dem rubinroten Kreuz, das immer noch um ihren Hals hing, weil Juli es nicht hatte haben wollen. »Ihr helft bei der Arbeit«, hatte sie gesagt, »das ist genug.«
Dankbar hatte Klaras Mutter der Bäuerin die Hand gedrückt.
Sie lächelte, als sie sich daran erinnerte, hielt das Kreuz fest in ihrer Hand, sog den würzigen Geruch des frischen Heus in sich ein, vermischte ihn in Gedanken mit dem des Brotes, das sie vor zwei Tagen gebacken hatten, zwanzig Laibe, die nun in der Vorratskammer lagerten und deren berauschenden Duft und Geschmack sie noch immer in Nase und Mund hatte, berauschend wie ein tiefes Glück oder eine umfassende Zufriedenheit, trat einen Schritt zurück, einen kleinen nur … und fiel. Stürzte hinunter durch die Luke im Boden, stürzte hinunter auf den Futterplatz, der leer und hart sie in Empfang nahm, kein Heu, das die Wucht des Sturzes gemildert und abgefangen hätte, nichts, nur die Härte des Bodens, Knochen, die brachen, eine Rippe, die sich in die Lunge bohrte, ein Körper geschwächt durch monatelange Entbehrungen.
Dieser eine Moment war es gewesen, dieser eine Moment, als sie sich sicher gefühlt hatte wie lange nicht, versöhnt mit dem Schicksal und allem, Julis Tisch, die Morgensuppe und zwei Scheiben des frischen Brotes.
Der Arzt kam und wusste nichts mehr zu tun, der Pfarrer kam und segnete sie ein, sie kämpfte zwei Tage, dann starb sie. Sie brachten sie ins Tal und begruben sie. Das Leben ging weiter. Und nachdem Juli am Gemeindeamt alle Formalitäten erledigt hatte, hatte sie plötzlich eine Tochter.
2
Die Kerze flackerte und zischte, bevor sie erlosch. Ächzend und mühevoll drehte sich Juli Pfaller im Bett von einer Seite zur anderen. Sorgenvoll dachte sie daran, dass es jederzeit schneien konnte und sie dann eingesperrt waren hier oben auf dem Berg. Wer würde ihr dann helfen, das Kind auf die Welt zu bringen, wenn die Hebamme nicht durchkam?
Dieses Kind. Juli musste lächeln und legte die Hände auf ihren Bauch. Es war wie ein großes Geschenk, wie ein Wunder. Der Krieg war zu Ende gegangen, August war heimgekommen und sie wurde schwanger, als wäre es das Selbstverständlichste, das einer Frau geschehen konnte, und mit Staunen und Bangen hatte Juli sich dieser Schwangerschaft hingegeben, zögerlich am Anfang und ständig in Sorge. Aber das Frühjahr ging herum und das Kind war immer noch da, auch im Frühsommer machte es keine Anstalten zu gehen, und als im August die große Hitze kam, beschloss Juli, endlich an das Glück eines Kindes in ihrem Bauch glauben zu dürfen.
Eines Tages nach getaner Arbeit nahm sie August an der Hand und ging mit ihm den Hügel hinunter bis zu der Stelle, wo der Wald sich lichtete und den Blick ins Tal und auf den Fluss öffnete.
»Zimmerst du mir eine Bank zusammen, August?«, fragte Juli ihren Mann und legte die Hand auf ihren Bauch. Das Kind strampelte und trat von innen dagegen und Juli musste lächeln. »Und stellst du sie mir hierher?«
Sie nahm seine Hand und legte sie an das Strampeln des Kindes. Erschrocken fuhr er zurück, aber sie hielt ihn fest. »Danke, August, für deine Geduld!«
Er nickte und lächelte und liebte sie in diesem Augenblick wie seinen besondersten Besitz.
Am nächsten Morgen ging er nach der Stallarbeit in den Schuppen, suchte Holz zusammen und zimmerte eine Bank, die sich sehen lassen konnte. Ein paar Tage später schon war sie aufgestellt. Im Rücken die knorrige Rinde und den machtvollen Schutz eines Baumes, den Blick frei auf den Fluss und das Tal, verbrachte August nun mit seiner Frau so manchen milden Sommer- und Frühherbstabend, nur dem Augenblick hingegeben und diesem besonderen Frieden, der sich einstellte, wenn man sich hinsetzte und hinunter ins Tal und in die Weite schaute.
Nun näherten sie sich dem Ende der Schwangerschaft, Juli und das Kind, die Hebamme hatte gemeint, mit etwas Glück würde es ein weihnachtliches Wunder werden, ein Christkind, aber das Kind in Julis Bauch dachte nicht daran, sich an derlei Berechnungen zu halten, es wollte ein vorweihnachtliches Wunder werden und drängte mit aller Kraft auf die Welt, als wüsste es, dass es nach den Schrecken des Krieges dieses neue Leben brauchte. Es wollte kommen. Jetzt. Und zeigte es seiner Mutter deutlich.
Der Schmerz traf Juli mit großer Vehemenz. Sie hielt den Atem an, spürte in sich hinein, hörte das Schnarchen des Mannes neben sich und hoffte, das Kind, das sich da plötzlich gemeldet hatte, würde wieder Ruhe geben.
Aber es gab keine Ruhe. Es wollte heraus, den schützenden Raum der Mutter verlassen, jetzt und auf der Stelle.
Eine neue Welle des Schmerzes überrollte Juli. Sie schrie auf, fasste sich an den Bauch. Panik ergriff sie. Zu früh, viel zu früh!
August schreckte hoch. »Juli?«
»Es geht los!«, ächzte sie. »Hol Hilfe, August! Es geht los!«
»Aber es ist doch zu früh«, stammelte er.
»Ja«, sagte sie und versuchte ruhig zu atmen, »aber darauf nimmt es keine Rücksicht.«
Die nächste Wehe kam. »Hol Hilfe!«, schrie sie. »Hol die Nachbarin!«
»Nicht die Hebamme?«
Sie schüttelte den Kopf. »Keine Zeit mehr! Hol Susanna! Und Barbara!«
Da rappelte er sich auf, fuhr in seine Kleider und stürmte polternd aus der Kammer. Während Susanna und Barbara sich aufmachten, der Bäuerin beizustehen, spannte August den Haflinger ein, um doch noch die Hebamme auf den Berg zu holen.
Das Kind schrie aus Leibeskräften, als es sich endlich aus der Enge und Wärme seiner Mutter herausgestrampelt hatte. Es streckte Ärmchen und Beinchen und vermutlich fror es in der zugigen Kammer auf der Rückseite des Hofes, um den der Wind heulte, aber Susanna wickelte es rasch in Tücher und Decken und legte es seiner Mutter in die Arme.
»Ein Mädchen«, flüsterte sie ergriffen und schämte sich ihrer Tränen nicht. »Es ist ein Mädchen. Ein warmes, weiches, rosiges Mädchen.«
Juli fühlte einen winzigen Stich, August würde enttäuscht sein. Er hatte auf einen Sohn gehofft, einen Erben. Der sollte den Hof in eine bessere Zukunft führen. Einem Mädchen war das nicht zuzutrauen. Die Zeiten waren hart, die Krisen des Krieges nicht verdaut, aber es musste weitergehen, es musste, und ein Sohn wäre ein Zeichen dafür gewesen. Söhne bedeuteten Kraft und Mut, Söhne waren der Beweis, dass das Leben sich weiterbrachte. Mädchen hingegen waren nur Mädchen.
Juli hatte genickt, wenn er leise davon sprach, wenn seine Hand zärtlich über ihren wachsenden Bauch strich. Sie hatte gehofft, für ihn, dass sein großer Wunsch in Erfüllung gehen würde. Sie war ihm zugetan, dem August, mehr als je zuvor, sie war ihm zugetan, denn er war heimgekehrt aus dem Krieg und hatte ein Kind in ihren Leib gesetzt, mehr konnte ein Mann seiner Frau nicht tun. Heimlich jedoch wünschte sie sich ein Mädchen, immer noch. Zwar hatte sie die langersehnte Tochter schon längst, Klara war ihrem Herzen so nah wie dieses Ungeborene, aber trotzdem spürte sie, dass es ein Mädchen sein sollte, eines wie sie selbst gewesen war, eines wie die Zwillingsschwester, ungebärdig und froh, weich und warm und schön und voll von Geheimnissen, wie nur Mädchen sie hatten.
Und nun war ihr heimlicher Wunsch tatsächlich in Erfüllung gegangen. Erschöpft und noch zitternd von den Anstrengungen der Geburt, nahm sie das winzige Bündelchen entgegen, schaute die Finger an, die sich wie Krabbelkäfer streckten, strich ihrer Tochter über das Köpfchen, das suchend hin und her ruckelte, sah den offenen Mund und wie die Stirn sich in Falten legte und die Mundwinkel zu zittern begannen, und gerade, als das Kind jämmerlich anfangen wollte zu weinen, legte Juli es an ihre Brust.
Augenblicklich entspannte sich das Kind, gierig schnappte es zu und Juli fühlte das Glück wie eine heiße Fontäne durch ihren Körper strömen und fühlte die Kraft des Kindes, die Kraft seiner Lippen, die sich um sie schlossen wie kleine Zangen, wie kleine Widerhaken im Leben.
So, dachte Juli und fühlte einen kleinen Schmerz, als die Lippen des Kindes fester schnappten, fester saugten, so ist das jetzt also. So wird das jetzt immer sein. Ein Kind. Eine Tochter.
»Wie soll sie denn heißen, Bäuerin?«, fragte Barbara. »Notburga? Nach der Großmutter?«
Juli blickte hoch. »Ich weiß es gar nicht«, sagte sie, und als ob es einen Zusammenhang gäbe: »August hat sich einen Sohn gewünscht. Ich weiß es nicht.«
Sie dachte an die verstorbene Schwiegermutter, daran, wie hart und unerbittlich sie gewesen war, und sie fragte sich, was sie so hatte werden lassen, das Leben auf dem Hof, das Leben mit ihrem Mann, das Leben allgemein?
Auch jetzt wäre sie enttäuscht gewesen, das wusste Juli, denn es war eben nur ein Mädchen geworden.
Nein, dachte sie, so wird sie nicht heißen, meine Tochter, nicht diesen schroffen Namen voller Ecken und Kanten wird sie tragen. Dieses Erbe will ich ihr nicht mitgeben.
Ein weicher Name musste es sein, einer, dessen Trägerin nicht nur Pflicht, Entsagung und Arbeit kannte, sondern auch um die Schönheit des Lebens wusste.
Und während Juli plötzlich tiefes Mitgefühl für die Schwiegermutter verspürte, kam ein krächzendes, fremdes Stimmchen von irgendwoher aus der Kammer.
»Anna!«
Überrascht wandte Juli sich um.
Wer sprach da? Wem gehörte diese Stimme, die klang, als wäre sie lange heiser gewesen, eingerostet wie ein altes Wagenrad, die klang, als müsste sie sich erst langsam wieder ins Leben tasten.
Juli kniff die Augen zusammen. Wer kauerte dort in der Ecke, in die das Licht der Petroleumlampe nur schemenhaft reichte?
»Klara?«
Ja. Klara.
Klara saß dort im Schatten der Tür. Ein zusammengeklappter, vor Angst schlotternder Strich. Sie hatte Augusts Poltern gehört und dann die lauten aufgeregten Stimmen. Sie war hochgeschreckt und aus dem Bett gesprungen. Was war geschehen? Das Kind? Wollte es kommen? War es nicht zu früh?
Vorsichtig und von allen unbemerkt hatte die Dreizehnjährige die Tür zur Schlafkammer geöffnet, sie hatte den Schmerz der Bäuerin gesehen, den Schweiß, das Blut, die helfenden Frauen, erschrocken kauerte sie sich in die dunkle Ecke hinter der Tür, presste das Gesicht auf die Knie und die Hände an die Ohren, hatte Angst, Angst, Angst, wartete auf das Ende, wartete, dass …
… sie sich wieder auf der Straße befände, allein diesmal, ganz allein …
… aber plötzlich schrie das Kind, es schrie laut und zornig und die Frauen lachten. Es war geschafft. Juli und ihre Tochter hatten es geschafft. Glücklich klang ihr Schluchzen und Seufzen.
Und nun der Name?
Es war so klar. So eindeutig. Anna. Das Kind musste Anna heißen.
Und dann plötzlich war diese Stimme im Raum, dieses leise Krächzen, eine Stimme, die hier am Hof und im Dorf noch nie jemand gehört hatte, weil sie wie eingefroren gewesen war, wie erstarrt im Körper und im Gehirn.
Klaras Herz begann zu klopfen, laut wie nie. Schweiß brach ihr aus allen Poren.
War das möglich?
War das ihre Stimme gewesen?
Oder hatte sie sich verhört? Waren es nur ihre Gedanken gewesen, die sie zu hören geglaubt hatte, weil sie so laut waren und so drängend?
Noch einmal versuchte sie es. »Anna.«
Und wieder gelang es. Und es war lauter, als Gedanken sein konnten. Und es übertönte alles. Selbst das Pochen ihres Herzens, selbst das Rauschen ihres Blutes. Es war ihre, Klaras, Stimme. Klara konnte sprechen. Klara sprach. Dass alle es hörten.
»Klara?«, fragte Juli staunend, »Klara? Bist du das?«
Klara nickte, stand auf, trat aus dem Schatten der Tür und machte ein paar Schritte durchs Zimmer, ein wenig schwankend, wie planlos, wie ohne Ziel.
»Ja«, flüsterte, krächzte, sagte sie und lauschte ihrer Stimme nach. So fremd klang sie ihr, so fremd. Aber auch so schön.
Die Frauen hielten den Atem an. »Klara«, flüsterte Juli fassungslos, »Klara, du sprichst! Das ist ja wie ein Wunder!«
Und es war ein Wunder. Das zweite in dieser Nacht des 19. November 1919.
Susanna kam heran, legte von hinten ihre Arme um das zitternde Mädchen, schob es sachte vorwärts.
»Ja«, sagte Klara, musste sich räuspern, machte Schritt um Schritt. »Ja.«
Juli streckte die Hand aus. »Komm, Klara«, sagte sie, »komm her zu uns. Komm! Und sag mir noch einmal, wie soll sie heißen?«
»Anna«, sagte Klara, »sie soll Anna heißen.«
Juli nickte, Tränen liefen ihr über die Wangen. »Natürlich«, sagte sie, »du hast recht. Dass ich da nicht selbst darauf gekommen bin. Sie soll Anna heißen. Natürlich. Wie deine Mutter. Anna. Das ist der einzig mögliche Name für sie.«
Ein Lächeln legte sich über Klaras Gesicht, durchstrahlte ihren ganzen, kleinen, dünnen Körper.
»Schau sie dir an«, fuhr Juli fort und legte der Dreizehnjährigen die Hand an die Wange, »schau sie dir an. Ist sie nicht wunderschön?«
Und Klara schaute das Kind in Julis Armen an. Die Augen, die Nase, der Mund, seidiger Flaum auf dem Kopf, die Finger, alles winzig und klein, aber so, wie es sein sollte, so, wie es sich gehörte.
»Streichle ihr übers Köpfchen, Klara«, sagte Juli, »und über die Wangen«, und staunte, wie einfach es war. Wie einfach es war, ein Kind zu haben und es in seinen Armen zu bergen. »Sie braucht eine große Schwester, unsere Anna. Wirst du ihr eine sein?«
Da schluchzte Klara auf. Ja, das wollte sie, das wollte sie gerne sein!
Aus tiefstem Herzen schluchzte sie, als hätte sie so viele Tränen zu weinen wie keiner je zuvor, als wäre alles Leid der Welt unbeweint geblieben bis jetzt, als könnte die Freude über dieses Kind und seinen Namen nun alles heilen, alles, was geschehen war, den Krieg, den Hunger, den Vater, die Mutter, dass sie gestorben waren, alles. Und alles wurde leicht und still. Wie Flaum, wie Schnee.
Juli zog das Mädchen an ihre Seite und spürte, wie der zitternde Körper sich fest an ihren schmiegte und sich langsam beruhigte, sie blickte auf und hin zum Fenster.
Der Tag brach an, langsam kam das Licht.
Juli spürte, wie Müdigkeit sich auf sie legte wie ein warmes Tuch, sie schaute ihre Töchter an, eine nach der anderen, die winzige, die größere, und wünschte sich Schnee.
Weiß soll die Welt sein, wenn der Tag anbricht, dachte sie, eine weiße Welt, die alle Geräusche schluckt und den Tag heller und leiser macht, als er ist. Weiß soll sie sein, die Welt, dachte Juli, damit Anna sieht, dass nicht alles schwer ist im Leben, dass es auch Dinge gibt, die leuchten und einem einfach geschenkt werden.
Und als hätte das Kind ihre Gedanken gehört, löste es sich von der Brust seiner Mutter und wandte sein Gesicht dem Fenster zu und dem Licht, das zaghaft hereinfiel; und als hätte der Schnee Julis Wünsche gehört, begann er zu fallen, dicht und stetig, verwandelte den Berg, den Hof, den Wald in weiße flaumige Gebilde.
Und es wurde still. Und nichts störte das Fallen und nichts die Stille, nur das Flüstern der Frauen in der Kammer, die das Kind willkommen hießen, es würde geliebt werden und sicher sein und seiner Schwester und seiner Mutter endlich eine Heimat geben.
Juli erholte sich nur langsam von den Strapazen der Geburt. Sie spürte, welch großes Geschenk das Kind war, aber sie fieberte tagelang, spürte die Last der Jahre und wie müde und wund ihr Körper war. Sie hatte die leisen, mahnenden Worte der Hebamme noch im Ohr, sie solle nun nichts mehr herausfordern, es könne sonst um eines zu viel sein. »Du musst auf dich schauen, Juli«, hatte sie gesagt, »du musst auf dich schauen!«
Nachdem sie es in Augusts Wagen endlich auf den Berg hinaufgeschafft hatten, hatte sie alle aus der Kammer geschickt und sich in Ruhe und Sorgfalt der Untersuchung von Mutter und Kind gewidmet.
»Aber August«, sagte Juli und seufzte, »August wünscht sich einen Sohn.«
Die Hebamme nickte und strich ihr sanft über Stirn und Wangen. »Ja«, sagte sie, »ja, das glaub ich dir.«
Dann schwieg sie eine Weile, stand schließlich auf und ging zur Tür. Doch bevor sie sie öffnete, wandte sie sich noch einmal um. »Möchtest du sehen, Juli, wie deine Anna aufwächst?«
Juli schaute ihr hinterher, hörte, wie die Tür sich leise schloss, schaute in die Wiege neben dem Bett, in der Anna im Schlaf ein wenig greinte und ihre Ärmchen streckte, schaute in das leise Fallen des Schnees vor dem Fenster, und während sie selbst langsam in den Schlaf und einen Traum glitt, wusste sie, ja, dass sie sehen wollte, wie Anna aufwuchs, dass sie unbedingt dabei sein wollte.
Mühsam und langsam genas sie und endlich kam Weihnachten und endlich war Juli wieder auf den Beinen und August spannte den Haflinger vor den Schlitten und brachte seine kleine Familie hinunter ins Tal in die Kirche zur Christmette.
Während sie den Segen der Weihnacht empfingen und im Kreis der Gemeinde dem Kind im Stall in der Krippe huldigten, während Juli ihr eigenes Kind fest an sich drückte und spürte, wie es sich reckte und streckte trotz der dicken Decken, in die es gehüllt war, dankte sie dem Herrgott aus tiefster Seele für dieses Geschenk. Zugleich aber bat sie ihn um Verzeihung, dass sie sich von nun an an August versündigen werde. Denn August würde sein Recht einfordern, das Recht eines Ehemannes an seiner Ehefrau, jenes von Gott, Kaiser und Staat ihm übertragene Recht an ihrer Seele, ihrem Körper und ihrem Geist, aber Juli würde es ihm verweigern. Mit aller Kraft, die ihr eigen war.
Denn auch wenn sie viel davon verloren hatte in diesen schweren letzten Jahren, sie hatte immer noch genug, um zu spüren, dass sie leben und dabei sein wollte, wenn ihre Töchter heranwuchsen, und dass sie das um nichts in der Welt aufs Spiel setzen würde. Auch nicht um den Preis, dass August und sie einander verlieren würden. Denn das taten sie.
Müde saßen sie nebeneinander am Ende der Tage. Er sehnte sich nach seiner Frau, aber sie konnte ihm nicht mehr sein, was er wollte, was er brauchte. Sie war erst fünfunddreißig Jahre alt, aber ihr Körper war geschwächt durch die harte Arbeit auf dem Hof, durch die Entbehrungen der Kriegszeit, durch eine schwere Geburt.
Nun war das Kind endlich da und ein zweites noch dazu und das war mehr, als sie je ersehnt hatte. Dafür war sie August dankbar. Dafür liebte sie ihn, aber mehr ging nicht. Sie konnte nichts mehr wagen, nichts aufs Spiel setzen. Der Herrgott hatte es gut gemeint, hatte ihr dieses Pfand geschenkt, sie wollte ihn nicht noch einmal herausfordern.
Natürlich wusste sie, dass August sich eine andere suchen würde, eine, die ihm mehr gab als ein hilfloses Streicheln und eine rasche Umarmung. Sie erwartete es, nahm es hin, hoffte es sogar, denn sie selbst sah sich außerstande, in dieser Weise noch etwas für ihn zu tun. Und also fuhr er einmal im Monat zu den Käuflichen in die Stadt und brachte Eier und Speck mit und manchmal einen Laib frisches Brot. Dafür durfte er manches.
Anna. Ein fröhlicher Wildfang, ein Flederwisch, eine kleine Zopfmamsell. Sobald sie laufen konnte und sich auf ihren Beinchen sicher fühlte, jagte sie die Hühner quer über den Hof, lachend vor dem erschreckten Gackern und Krächzen, bis irgendwann die Stimme der Mutter sie stoppte: »Anna! Staub die Hühner nicht!«
Dahinter das Gelächter der Männer und der Vater, der grinsend meinte: »Ach, Juli, lass sie doch! Sei nicht so streng!«
Aber das ließ sie nicht gelten, die Juli, sie verschränkte ihre Arme vor der Brust und musterte den August kühl und ein wenig von oben herab. »Wenigstens einer von uns muss hier manchmal ein wenig streng sein!«
August grinste immer noch, dankte im Stillen Gott und allen Heiligen für dieses Kind und die Frau und sagte begütigend: »Ist schon recht!«
Dann packte er das Kind sanft an den Zöpfen, holte es sich zwischen die Knie und schaute ihm eindringlich in die Augen. »Wenn du die Hühner staubst, Anna, dann legen sie keine Eier mehr und dann haben wir nix mehr zum Essen!«
Anna, zutiefst erschrocken, schmiegte sich an die Knie des Vaters und begann zu weinen. Nix mehr zum Essen?
Nix mehr zum Essen hieß verhungern, das wusste sie schon, das erzählte Klara oft und oft. »Schatten, Anna«, erzählte sie, »sind wir gewesen, nur noch Schatten. Wenn die Mutter uns nicht aufgenommen hätte, wären wir verhungert.«
»Nana«, sagte der Vater dann jedes Mal begütigend, »das ist lange vorbei. So wird es nie mehr werden.« Da nickte Klara. »Ja«, sagte sie, »das ist wohl wahr.« Und Anna konnte weiterspringen, gut, dass der Vater es besser wusste.