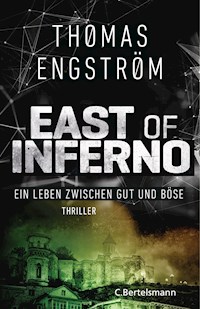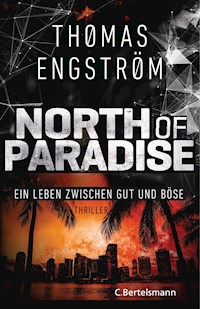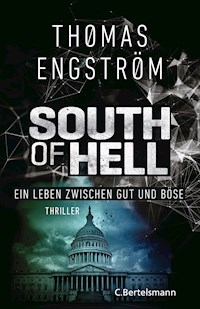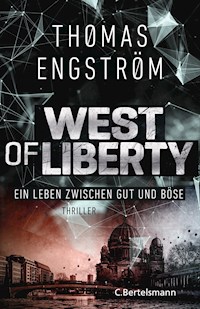
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Thriller-Serie um Ex-Agent Ludwig Licht
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Ein Agent, der nichts mehr zu verlieren hat. Politische Feinde, denen keiner entkommt …
Ludwig Licht nimmt aus purer Geldnot immer wieder Aufträge des amerikanischen Geheimdienstes an. Diesmal soll der ehemalige Doppelagent eine Frau überwachen, die als Anwältin der Whistleblower-Organisation Hydraleaks arbeitet. Die schöne, aber unberechenbare Frau ist ihm alles andere als geheuer. Was führt sie im Schilde? Und wie viel weiß sie über Lucien Gell, den umstrittenen Gründer von Hydraleaks, der in Deutschland untergetaucht ist und nach dem flächendeckend gefahndet wird?
Ein packender Spionage-Thriller und der großartige Auftakt einer internationalen Serie. Auch in den drei weiteren Bänden »South of Hell«, »North of Paradise« und »East of Inferno« muss Ludwig Licht gegen gefährliche politische Drahtzieher und brisante Machenschaften kämpfen – seine Aufträge führen ihn zu einem schmutzigen Wahlkampf nach Pennsylvania, in eine neue Kuba-Krise nach Miami und in die finsteren Regionen Georgiens.
»Thomas Engström entwickelt den klassischen Agententhriller genial weiter: Sein Stil ist rasant, die Spannung gigantisch und sein Humor absolut erfrischend!« Arne Dahl
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Ähnliche
THOMAS
ENGSTRÖM
WEST OF
LIBERTY
EIN LUDWIG-LICHT-THRILLER
Aus dem Schwedischen von Lotta Rüegger und Holger Wolandt
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel Väster om Friheten bei Albert Bonniers Förlag, Stockholm
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2013 by Thomas Engström
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
beim C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by agreement with Salomonsson Agency
Covergestaltung: bürosüd
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-18330-1V003
www.cbertelsmann.de
Eine Demokratie kann nicht Krieg führen.General Walter Bedell Smith
PROLOG
Marrakesch
Marrakesch-Tensift-Al Haouz
Marokko
So., 10. Juli 2011
[11:05 WEZ]
In Nordafrika gab es durchaus mutige westliche Diplomaten, doch leider gehörte der amerikanische Generalkonsul in Marokko nicht dazu. Liebend gerne hätte er diesen Vormittag auf andere Weise verbracht.
Die Königlich Marokkanische Gendarmerie hatte mehrere Straßen in der Medina von Marrakesch abgesperrt. Vor der Ben-Youssef-Moschee kam der Verkehr zum Stillstand, aber wie vereinbart erwarteten ein paar Polizisten den Konsul und bahnten ihm den Weg zum Tatort. Erwachsene Männer, die nicht rechtzeitig auswichen, wurden beiseitegeschoben, und Jungen mit Hosentaschen voller Touristengeld erhielten Tritte und Schläge. Nur Packesel und die verschleierten Bettlerinnen aus den Bergen blieben von der Rücksichtslosigkeit der Ordnungsmacht verschont. Die Straßen wurden immer schmaler, aber nachdem sie die inneren Absperrungen passiert hatten, gab es keine Zivilisten mehr.
Am Tatort standen etwa zehn uniformierte Polizisten und schwitzten, denn die Temperatur war bereits auf 36 Grad geklettert. Die Männer verstummten, als der amerikanische Konsul erschien. Einer von ihnen hielt vor dem Eingang des Lokals Wache. Er trug die überdimensionierten Achselstücke eines Hauptmanns, eine marineblaue Uniform, klinisch weiße Handschuhe und Biesen. Ein fünfeckiges Schild in Gelb und Zimtbraun mit dem Wort »Barbier« auf Arabisch und Französisch hing an funkelnd-sauberen Ketten direkt über dem kurzen, glänzenden Haar des Marokkaners.
»Willkommen, Monsieur«, sagte der Hauptmann und gab dem Konsul rasch die Hand. »Sie möchten vielleicht gleich hineingehen und sich einen Überblick verschaffen?«
»Mir ist nicht so ganz klar, was eigentlich geschehen ist.«
»Drei Ihrer Landsleute wurden ermordet.«
»Waren es nicht vier?«, wandte der Konsul ein. »Ihr Kollege am Telefon hat gemeint …«
Der Hauptmann nickte geduldig. »Drei von Ihren Leuten plus ein Marokkaner. Wir haben ihn eben erst gefunden. Offenbar der Barbier. Da hinten.« Er deutete auf eine eingestürzte Mauer, hinter der ein Baugrundstück vor sich hin dämmerte. Auf Glasscherben, Armierungseisen und Müll thronte ein ausgedienter Zementmischer. Neben der rostigen Maschine hatte man eine große türkisfarbene Plane ausgebreitet.
»Und alles da drin ist unberührt?«, fragte der Konsul und hob den Blick von der Plastikfolie, die vor dem Barbiersalon hing.
»Wir haben nur die Fingerabdrücke abgenommen.«
Der Amerikaner nickte. Jetzt war also der Zeitpunkt gekommen.
Zu seinem Entsetzen begleitete ihn niemand in den Salon.
Als Erstes fiel ihm der Gesichtsausdruck des Toten auf dem Stuhl auf. Eher Verwirrung als Schrecken: Als hätte ihm jemand in letzter Sekunde noch eine unfassbare Lüge aufgetischt. Der Konsul verschwendete einen großen Teil der ihm zur Verfügung stehenden Tagesenergie darauf, in eine andere Richtung zu schauen. Er senkte den Blick, doch auf dem Boden war alles voller Blut.
Direkt neben den Lachen auf den Schachbrettfliesen waren diffuse Fußspuren zu erkennen. Auf den Spiegeln hatten sich wilde Tropfenmuster von geronnenem Blut gebildet. Der Amerikaner putzte seine Brille. Er musste selbstsicher und gefasst auftreten, denn er war von draußen durch die Glasscheiben der dünnen, gelb gestrichenen Aluminiumtür zu sehen. Ein kleiner Fernseher hing an der Wand. France 24 zeigte Bilder von europäischen Düsenjägern über Benghazi, Tripolis, Misrata und vom Bodenpersonal in italienischen Luftwaffenstützpunkten. Der Ton war ausgeschaltet.
Die Wirkung der Neonröhren, der lila gekachelten Wände und der Klimaanlage hatte eine ernüchternde Wirkung im Vergleich zu dem warmen rötlichen Nebel da draußen. Drei Leichen, eine auf dem Friseurstuhl, zwei bäuchlings auf dem Boden. Alles Männer Anfang dreißig. Keiner gehörte hierher, weder zu Lebzeiten noch jetzt. Niemals.
Der athletische Mann auf dem Stuhl trug ein weißes Unterhemd, Khakishorts und ein Silberkettchen um den Hals. Um nicht in eine Blutlache zu treten, musste sich der Konsul auf die Zehenspitzen stellen, während er sich vorbeugte. Eine Hundemarke. Leutnant des US-Marine-Corps. Die Hosentaschen waren leer. Pass und Brieftasche fehlten. Eine Tätowierung verlief von der rechten Schulter bis weit auf den Arm hinaus: Zuoberst stand »USMC«, darunter ein Adler mit Handgranaten in den Klauen und ganz unten die Worte: »SEMPER FI, MOTHERFUCKER.« Einiges an Bargeld, aber keine außergewöhnliche Summe.
Die beiden anderen sahen wie Zivilisten aus. Der eine trug Jeans und ein verwaschenes T-Shirt mit dem fragmentarischen Rückenaufdruck: »Information Wants to …« Der andere war ähnlich gekleidet, nur blutverschmierter. Keine Brieftaschen. Einer der Männer trug Bart. Zwei blutbefleckte amerikanische Pässe lagen neben einer Schale Rasierschaum auf einem Rolltischchen, die Papiere der Ermordeten.
Alle drei waren von je zwei Kopfschüssen getroffen worden. Das war kein normaler Raubmord, sondern eine Hinrichtung. Möglicherweise ein Terroranschlag.
Der Konsul sann eine Weile nach. Hatte er etwas übersehen? Einige Minuten verstrichen. Die Leichen rochen kaum, zumindest war der Geruch noch nicht stärker als der Parfümduft in dem kühlen und recht sauberen Salon. Er hatte schon Schlimmeres erlebt. Oder eigentlich nicht. Aber es war ihm dabei schon schlimmer ergangen.
Diese Sache lag weit außerhalb seiner Zuständigkeit. Das Konsulat beschäftigte sich in der Regel mit verloren gegangenen Pässen. Die seltenen Todesfälle pflegten sich auf Rentner und Junkies zu beschränken. Und hier bestand außerdem noch eine Verbindung zur Army. Welch ein Glück. Dem Konsul blieb es also erspart, die Angehörigen zu verständigen und sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie die Ermittlung mit den amerikanischen Behörden zu koordinieren war. Er musste sich nicht um die Überführung der Toten in die USA kümmern, sondern konnte die Angelegenheit einfach weiterreichen. Plötzlich ließ sich die Bitterkeit über diverse vorenthaltene Beförderungen viel besser verkraften.
Die Hitze vor dem Salon war noch unerträglicher geworden. Der Polizeihauptmann hatte sich mit dem Rücken zur Tür postiert und drückte jetzt seine Zigarette aus. Marquise, wie dem Konsul auffiel. Eine hübsche grüne Schachtel, die an die koloniale Einrichtung des einige Kilometer entfernten Café de la Poste erinnerte. Der Duft des Rauchs erinnerte an Zigarillos.
Der Konsul führte den Hauptmann hinter einen Lastkarren mit Plastikverdeck und gestohlenen Reifen.
»Ich wüsste es zu schätzen«, sagte er gefasst, »wenn die Presse nichts erführe, zumindest bis auf Weiteres …«
»Bis auf Weiteres sind keine Journalisten hier«, erwiderte der Hauptmann. Sein Tonfall klang unverbindlich.
War eine Bestechung angezeigt?
Der Konsul schaute eine Sekunde zu lang auf die weißen Handschuhe des Mannes und auf sein blank poliertes, schwarzes Pistolenholster. »Schlimme Sache«, murmelte er und nickte zum Salon hinüber.
»Eine wirklich große Tragödie«, erwiderte der Hauptmann langsam. »Mein herzliches Beileid. Ganz Marokko trauert.«
»Danke.«
Bestechung überflüssig.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Monsieur. Niemand will etwas über ermordete Ausländer hören. Ein sehr ungewöhnliches Ereignis, kein Grund also, die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen.« Er lächelte schwach. »Schließlich sind wir hier nicht in Algerien.«
Der Konsul erlaubte sich, das Lächeln zu erwidern, obwohl es gegen die Regeln der Diplomatie verstieß, überhaupt zu reagieren, wenn jemand schlecht über ein drittes Land sprach. »Dann sind wir uns ja einig.«
Der Hauptmann warf einen Blick auf seine Uhr, eine Breitling-Kopie.
»Nochmals vielen Dank«, beendete der Konsul das Gespräch.
Der Hauptmann salutierte. Der Konsul nickte und lächelte verlegen, wie viele Zivilisten es tun, wenn Uniformierte ihnen Respekt zollen.
Jenseits der Absperrung herrschte immer noch Chaos. Die Mopeds: Magere rotznäsige Jungen und korpulente Frauen in Niqabs wetteiferten darum, möglichst schnell jemanden umzufahren. Die Wagen: überladen, schief und von den alten Männern schneller gezogen als von den Eseln. Die Autos: unmöglich. Dieses Mal gab es keine Polizeieskorte. Aber nachdem er das Schlimmste hinter sich gelassen hatte, gelangte der Konsul rasch zu dem Tor, das aus dem Stadtteil herausführte. Acht Jahre auf demselben Posten hatten ihn gelehrt, die örtliche Bevölkerung zu meiden. Und das war nur eine Frage der Ausstrahlung.
Durch die Stadtmauer hinaus. An der Route des Remparts erwartete ihn der Fahrer im konsulatseigenen weißen, staubigen Lincoln Navigator. Wegen der Klimaanlage stand er mit laufendem Motor da. Zurück nach Casablanca waren es dank der neu gebauten, segensreichen Autobahn knapp zwei Stunden. Genügend Zeit, um das Gespräch mit dem Botschafter in Rabat vorzubereiten. Die Fahrt war nötig, da das Konsulat in Marrakesch über keine sichere Telefonleitung verfügte.
Einer Sache war sich der amerikanische Generalkonsul jedenfalls sicher: Er würde nie erfahren, was in der Barbierstube wirklich wie und warum geschehen war und wer dahintersteckte. Er würde nicht einmal in Worte fassen müssen, worin das Rätsel eigentlich bestand. Einblick würde nur ganz wenigen gewährt werden. Einer Handvoll Übermenschen, die Vertrauen genossen und ihr Leben in einem Schattenreich verbrachten, das sie sich selbst geschaffen hatten. Sie befanden sich jenseits einer Grenze, die er nur erahnen konnte. Diese Erkenntnis war so tröstlich, dass der Konsul auf halbem Weg an die Küste während einer Unterhaltung mit dem Fahrer wegnickte und in einen entspannten Schlaf fiel.
SONNTAG
Amerikanische Botschaft
Pariser Platz, Berlin-Mitte
So., 17. Juli 2011
[09:10 MEZ]
Clive Berner, alias GT, stand auf dem Dach der amerikanischen Botschaft. Der Umriss seiner gedrungenen Gestalt im Anzug war durchaus beachtlich. Vor zwei Wochen war ihm aufgefallen, dass er seine Jacketts nicht mehr zuknöpfen konnte, weil er die 125-Kilo-Marke passiert hatte. Gleichzeitig war von seiner früheren Höchstlänge 174 ein Zentimeter spurlos verschwunden. Es galt, den Eindruck eines Fettkloßes herunterzuspielen, indem man den Betrachter mit auffälligen Details verwirrte. Daher trug GT einen grauen Walrossbart und eine goldene Pilotenbrille an einem leuchtend roten Band.
Für den 61-jährigen Stationschef der CIA in Berlin war es ein guter Sonntag. Der Morgen wartete mit strahlendem Wetter auf, und noch hatte keine Hitzewelle den Sommergenuss getrübt. In einiger Entfernung führte die Siegesgöttin auf dem Brandenburger Tor ihr Viergespann an, als wollte sie mit der Kavallerie die Stadt erobern. Eine Aura von Weltgeschichte und Feldherrentum umgab sie. Was die Deutschen angesichts dieses Siegesdenkmals im Herzen ihres auf ewig besiegten Reiches empfinden mochten, darüber konnte der Amerikaner nur Mutmaßungen anstellen.
GTs gute Laune entsprang dem Umstand, dass ihn ein Anruf seiner Sekretärin um halb acht morgens vor einem weiteren Gottesdienst bewahrt hatte. An acht aufeinanderfolgenden Sonntagen war er in die Anglikanische Kirche in der Preußenallee mitgeschleppt worden. Religiosität war das neue Lebensprojekt seiner Frau. Davon erhoffte sie sich eine Annäherung zwischen ihnen.
Fünf Meter hinter ihm wurde die Feuertür geöffnet. Johnson, der ein Jahr zuvor aus Langley eingetroffen war und noch mindestens vierzig Prozent seiner lehrbuchgemäßen Harmlosigkeit besaß, hielt die grau gestrichene Stahltür auf.
GT atmete noch eine Prise der zähen Berliner Hochsommerluft ein und verfolgte einen orangefarbenen Luftballon mit dem Blick.
»Es kann beginnen«, sagte Johnson. »Sir?«
»Ich komme.«
Sie gingen die Treppe hinunter. GT bemühte sich, nicht zu schnaufen. Vergeblich.
Johnson zog den Ausweis durch den Kartenleser und gab den Code ein: jede Woche ein neues sechsstelliges Elend, das gelernt sein wollte. Wieder einmal staunte GT über das irgendwie milchig-blumige Parfüm des Mannes. Vielleicht sollte mal jemand unter vier Augen mit ihm reden.
Auf dem breiten Flur, dessen hellblauer Teppichboden endlich gereinigt worden war, herrschte die Stille eines Leichenschauhauses. Alle Türen waren geschlossen. GT überholte Johnson und öffnete eine echtholzfurnierte Tür. Ein Messingschild rechts daneben verkündete:
DR. CLIVE BERNER
KOORDINATOR FÜR REGIONALE FRAGEN
Wie viele nichtssagende offizielle Titel hatte er wohl im Laufe der Jahre geführt? Es dürften zwanzig gewesen sein. In einem alliierten Land wie diesem handelte es sich dabei um reine Höflichkeit der Gastgebernation gegenüber, schließlich war Spionage überall verboten. In neutralen und gegnerischen Ländern hingegen war es ernster. Je länger es dauerte, bis der Nachrichtendienst der Eingeborenen begriff, wer in der lokalen Hierarchie der CIA welche Rolle spielte, desto besser.
Für einen »regionalen Koordinator« war es kein übles Büro. Fünfunddreißig Quadratmeter mit zwei schuss- und bombensicheren, sichtgeschützten Fenstern. Der große, im Boden verankerte Schreibtisch war mit demselben hellen Eichenfurnier versehen wie die Tür. Wobei er einen altmodischeren vorgezogen hätte, aber die für die Sicherheit zuständigen Hysteriker beim DSS hatten nun mal ihre fixen Ideen.
Dunkelroter statt hellblauem Teppichboden, wie im Empfangsraum des Botschafters. Wandregale mit den Klassikern der deutschen Literatur in den kükengelben Ausgaben des Reclam Verlags. Ein strapazierfähiger Bürostuhl. Eine moderne niedrige Couch mit grauem Wollstoffbezug und drei passenden Sesseln vor einem festgeschraubten kubistischen Tisch aus demselben verhassten hellen Holz. Natürlich keine Kissen. Auf dem Tisch eine gedrungene Kaffeekanne aus Edelstahl und drei weiße Tassen sowie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Economist, die Berliner Morgenpost, Die Zeit, das Wall Street Journal Europe, die Newsweek, Der Spiegel. Dazu Le Monde Diplomatique, die deutschsprachige Ausgabe. Eine angenehme Lektüre für jemanden, der seinen Kreislauf mit etwas antiamerikanischer Hasspropaganda auf Trab bringen wollte. GT lächelte selig. Wenn er nur die Kraft hätte aufbringen können, dann hätte er sich schon längst in seine Sekretärin verliebt.
Er hängte sein Jackett an den Haken neben dem Spiegel und reckte sich. Der oberste Knopf seines Hemdes war geöffnet, er trug keinen Schlips. Das dünne hellgraue Jackett war neu und saß über der Brust ganz passabel. Maßgeschneidert. Vielleicht sollte er sich gleich drei weitere in anderen Farben bestellen.
GT nahm breitbeinig auf der Couch Platz und legte die Ellbogen auf die Lehne. Johnson setzte sich auf einen Sessel und schlug die Beine übereinander. Alphamännchen und Betamännchen. Nach einer halben Minute erschien Almond, GTs Vize, der die operative Leitung hatte.
Wie jung seine Gefolgsleute doch waren. War das immer schon so gewesen?
»Die Situation ist folgende«, begann Almond mit einem Ernst, der sich nur schlecht mit seiner pathologischen Sonnenbräune vertrug. »Um 19.05 Uhr Ortszeit gestern Abend, also am Samstag, ruft eine englischsprachige Frau in der Telefonzentrale an. Sie bittet darum, mit Botschafter Harriman sprechen zu dürfen. Die Zentrale teilt ihr mit, dies sei nicht möglich, und bittet sie, am Montag wieder anzurufen.«
GT sah ihn ausdruckslos an. »Und?«
»Fünf Minuten später, also um 19.10 Uhr, ruft die Frau wieder an. Derselbe Telefonist nimmt das Gespräch entgegen. Die Frau klingt inzwischen aufgebracht.« Almond zog einen Palmtop aus der Brusttasche und drückte auf Play.
»Das kann doch nicht so schwierig sein?«, hörte man die Stimme der Anruferin. »Hören Sie zu.Ich verfüge über wichtige Informationen.«
»Ich kann dem Botschafter natürlich eine Nachricht übermitteln, wenn er wieder da ist«, erwiderte der Telefonist, dessen Kommunikationsstrategie GT bislang nicht sonderlich beeindruckend fand. »Worum geht es?«
»Um die ermordeten Amerikaner in Marrakesch«, antwortete die Frau. »Hallo?«
Schweigen. Und noch mehr Schweigen.
GT schüttelte den Kopf.
»Verstehe«, erwiderte der Telefonist. »Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Nummer hinterlassen könnten, dann …«
»Ich spreche nur mit Ron«, erklärte die Frau.
»Der Botschafter ist wie gesagt heute nicht hier. Daher schlage ich vor, dass Sie mir Ihren Namen und Ihre Telefonnummer sagen, dann …«
Ein Klicken.
Almond stellte das Gerät ab.
»Marrakesch?«, hakte GT nach.
Johnson räusperte sich. »Ich bin der Sache nachgegangen, Sir. Unser Generalkonsul in Casablanca hat bestätigt, dass …«
GT hob die Hand.
Johnson brauchte eine halbe Sekunde, um seinen Gesichtsausdruck und seine Tonlage anzupassen. »Vor einer Woche wurden drei ermordete Amerikaner in Marrakesch aufgefunden. Männer Mitte dreißig. Ein Soldat, zwei Zivilisten. Sie wurden in einem Geschäftslokal in der Stadt erschossen.«
»Einem Geschäftslokal.«
»Ja, Sir. Ich bedauere diese Ungenauigkeit. Die von der marokkanischen … wie heißen die doch gleich … die von der marokkanischen Gendarmerie werden sich mit mir in Verbindung setzen.«
»Vielleicht sollten Sie sie ja anrufen.«
»Das habe ich bereits …«
»Dann versuchen Sie es wieder.«
Johnson nickte und zog ab.
»Einer der Zivilisten war ein 37-jähriger IT-Experte aus Frankfurt«, sagte Almond, nachdem sich die Tür geschlossen hatte.
»Ein Deutscher? Ich dachte, alle drei waren Amerikaner?«
»Peter Mueller. Geboren in Kalifornien, kam im Alter von ungefähr zehn Jahren nach Deutschland. Er hat die doppelte Staatsbürgerschaft.«
»Woher stammen diese Informationen?«
»Von meinem gesprächigen Freund beim Verfassungsschutz«, berichtete Almond stolz. Es war zwar keine besondere Kunst, Mitglieder eines verbündeten Nachrichtendienstes als Informanten anzuwerben, aber immer noch bedeutend besser, als überhaupt keine Informanten zu haben. »Und dieser IT-Experte Peter Mueller«, fuhr Almond fort, »ist seit seiner Jugend mit unserem Freund Lucien Gell befreundet.«
GT erstarrte. »Nein.«
»Doch«, erwiderte Almond und nickte mehrmals.
Lucien Gell. Deutscher Staatsangehöriger. Gründer von Hydraleaks, der Organisation, die die CIA schon lange als die ernst zu nehmende Nachfolgerin ihrer geschwächten Vorgänger und Konkurrenten ausgemacht hatte. Lucien Gells Organisation war geschickter und scheute das Rampenlicht. Hydraleaks unterhielt keine eigenen Homepages, sondern vermittelte stattdessen Kontakte zwischen Whistleblowern und den Medien. Ohne die herkömmlichen Printmedien und Fernsehsender auszuklammern, wählte Hydraleaks mit großer Sorgfalt das jeweils geeignete Medium. Manchmal wurde gezielt ein Journalist für eine bestimmte Aufgabe auserkoren. Gelegentlich wurden Whistleblower auch aktiv rekrutiert, eine Methode, die GT an die Methoden des Kalten Krieges erinnerte, als er Agenten aus dem Osten angeworben hatte.
»Ich wusste, dass Ihnen das gefallen würde«, meinte Almond zufrieden.
GT erhob sich, trat ans Wandregal und starrte die Buchtitel an.
Die Deutschen standen unter ziemlichem Druck: Von amerikanischer Seite erwartete man ihre Unterstützung, wenn es darum ging, Hydraleaks endlich den Mund zu stopfen. Dabei machten sich die Hydraleaks-Aktivisten im Grunde nur dann eines Verstoßes gegen die deutschen Geheimhaltungsvorschriften schuldig, wenn die weitergegebenen Informationen auch in Deutschland der Geheimhaltung unterlagen, was tunlichst vermieden wurde. Deshalb waren die deutschen Behörden bis vor Kurzem keine besondere Hilfe gewesen. Aber es gab auch noch andere Vergehen als Verrat und Anstiftung zum Geheimnisverrat. Vor neun Monaten hatten die Deutschen gegen Lucien Gell Anklage wegen Steuerhinterziehung erhoben, da er trotz seines aufwendigen Lebensstils nicht dokumentieren konnte, woher seine Organisation ihr Geld bezog. Der Prozess konnte jedoch nicht stattfinden, da Lucien Gell kurz zuvor untergetaucht war.
In GTs Augen war Lucien Gell ein geltungsbedürftiger Drecksack, dem Einhalt geboten werden musste. Seit November 2010 hatte ihn niemand mehr gesehen. Gemäß steter Anweisung des CIA-Hauptquartiers musste er ausfindig gemacht und überwacht werden.
»Welche Position bekleidete Mueller bei Hydraleaks?«, erkundigte sich GT mit bebenden Nasenflügeln und nahm wieder Platz. Sein innerer Bluthund hatte Witterung aufgenommen.
»Er war die Nummer drei oder vier«, erwiderte Almond beflissen. Er hatte bereits Nachforschungen auf eigene Faust betrieben, und das war klug gewesen. Inwieweit Johnson eingeschaltet werden sollte, war ganz allein GTs Entscheidung.
»Wer ist mit der Ermittlung betraut?«
»Mit Sicherheit das FBI. Und die Deutschen. Wobei die beiden kaum kooperieren werden.«
»Und was ist mit unseren Abteilungen? Der Antiterrorgruppe in Hamburg zum Beispiel?«
»Schon möglich. Ich kann das überprüfen.«
»Nein, lassen Sie das lieber.« GT holte tief Luft und goss sich eine Tasse Kaffee ein. »Das könnte eine große Sache werden«, murmelte er.
»Ja, Sir.«
»Es ist schon eine Weile her, seit diese Abteilung nennenswerte Taten vollbracht hat.«
»Sie stellen hohe Ansprüche, Sir.«
»Sie wissen schon, was ich meine.«
»Ja, Sir.« Almond fuhr mit dem Zeigefinger über die Tischplatte und wollte gerade etwas sagen, als sein Handy klingelte. Das Telefonat dauerte nur fünf Sekunden.
»Wir haben die Frau lokalisiert«, sagte er an GT gewandt. »Sie hat aus einem Restaurant in Parchim angerufen.«
»Vor vierzehn Stunden.«
»Ja.«
»Das heißt, wir haben das Telefon ausfindig gemacht.«
»Genau.«
»Aber nicht die Frau.«
»So ist es, Sir.«
»Ich hoffe, dass unsere Leute bereits nach Parchim unterwegs sind.«
»Sie warten nur noch auf Ihr Okay, Sir.«
GT schloss die Augen, hörte, wie Almond eine Nummer wählte und sagte: »Zugriff, ich wiederhole, Zugriff.«
Eine halbe Minute lang schwiegen sie.
»Die Information über den dreifachen Mord war mir neu«, sagte GT dann. »Und Ihnen?«
»Auch.«
»Ist er durch die Presse gegangen?«
»Nein, Sir. Soweit ich weiß, nicht.«
Marokko war wohl bald die einzige Nation auf dem ganzen Planeten, die dichthalten konnte. Wenn es einem doch nur vergönnt wäre, in einer gemäßigt korrupten Polizeistaatsmonarchie zu arbeiten, dachte GT.
»Den Anruf in der Zentrale«, sagte er laut, »den könnte doch im Prinzip jeder abhören, oder?«
»Wie bitte, Sir?«
»DSS, NSA, DIA, FBI … Anrufe bei einer offiziellen Nummer einer diplomatischen Vertretung kann doch jeder Schwachkopf mithören.«
»Damit liegen Sie vermutlich richtig.«
GT trommelte mit den Fingern auf den rauen Couchbezug.
Die Frau hatte mit dem Botschafter sprechen wollen. Klar. Wünsche durfte jeder vorbringen. Darum ging es nicht, es ging darum, über welche Informationen sie verfügte.
Offenbar hatte jemand entschieden, den Vorfall in Marokko geheim zu halten. Vermutlich aus ermittlungstaktischen Gründen. Aber früher oder später würden die konkurrierenden Organe, der militärische Nachrichtendienst DIA, die Überwacher von der NSA, die Polizisten vom FBI, wer auch immer, dieselbe Aufnahme hören, die Johnson GT gerade vorgespielt hatte.
»Gibt es in den Datenbanken irgendwas Relevantes über Marrakesch, den ermordeten Soldaten, ermordete Amerikaner in Marokko, irgendetwas in dieser Art?«
»Wir haben nichts finden können. Soll ich mich anderweitig erkundigen?«
»Keinesfalls.«
Das FBI war eine Sache. Die konnte man immer abschütteln, indem man sich auf heikle Inhalte und laufende Einsätze im Ausland hinausredete. Bei der DIA und der NSA richtete man damit aber nichts aus. Hoffentlich haben die gerade Besseres zu tun, dachte GT. In jedem Fall würde es Stunden, vermutlich sogar Tage dauern, bis ihm jemand auf den Fersen war. Diese Frist wollte er nutzen, um sich zu orientieren. Es schadete nie, allen anderen einen Schritt voraus zu sein. GT wollte noch nicht in Rente gehen. Frühestens in fünf oder sechs Jahren, und es war lange her, dass er etwas Sinnvolles bewirkt hatte. Sich vorzeitig aus dem Amt drängen zu lassen oder die Zeit abzusitzen, bedeutete einen Unterschied von mehreren zehntausend Dollar Pension im Jahr.
»Sehen Sie zu, dass Sie sie ausfindig machen«, sagte GT und sah Almond an.
Der junge Mann wand sich verlegen. »Wir tun unser Bestes. Aber es hängt ganz davon ab.«
»Wovon?« GT beugte sich vor. »Wovon?«
»Na ja, wenn sie sich sofort aus dem Staub gemacht hat, könnte sie einen ungeheuren Vorsprung haben.«
Die Tür öffnete sich. Johnson trat mit erhobenem Notizblock ein. Nicht zum ersten Mal fühlte sich GT wie der Rektor eines verstaubten englischen Internats.
»Schießen Sie los«, sagte GT und lehnte sich zurück.
»Okay«, erwiderte Johnson und nahm diesmal auf einem anderen Sessel Platz, als hoffe er, dass es dort besser gehen würde. »Ein Leutnant der Marineinfanterie, der drei Mal im Irak gedient hat, Trent Wallace, 33 Jahre alt. Ein IT-Experte aus Frankfurt, Peter Mueller, 37 Jahre alt, deutsche und amerikanische Staatsbürgerschaft. Ein freier Journalist aus Boston namens Daniel Jefferson, 30 Jahre alt.«
»IT-Experte«, schnaubte GT und schüttelte den Kopf. »Was soll das schon sein? Wissen Sie, was bei meinem alten Herrn im Telefonbuch stand? Landwirtschaftsexperte. Wissen Sie, womit er sich tagsüber beschäftigt hat? Er hat bei einem Verwandten den Rasen gemäht. Wenn überhaupt.«
Es wurde ganz still.
»Soll ich fortfahren?«, fragte Johnson.
»Bitte.«
»Sie wurden in einem Friseursalon erschossen. Mit je zwei Kopfschüssen.« Johnson suchte die Blicke der anderen, genau wie er es im Pflichtkurs über Konferenzmethoden gelernt hatte. »Alle drei hatten sich auf dem Einreiseformular als Touristen eingetragen. Die beiden Zivilisten trafen drei Tage vor ihrem Tod mit einer Maschine aus England in Marokko ein. Wir wissen bisher nicht, wo sie wohnten. Auf dem Formular hatten sie ein größeres Hotel angegeben, in das sie dann allerdings nicht eingecheckt haben.«
GT dachte mitleidig an das arme marokkanische Hotelpersonal, das mit seiner Auskunft bei der königlichen Gendarmerie vermutlich keine Begeisterungsstürme ausgelöst hatte.
»Der Leutnant ist erst am Tag vor der Tat eingetroffen«, fuhr Johnson fort. »Er hat dasselbe Hotel wie die Zivilisten angegeben.«
»Und was meinen die Marokkaner?«
»Nicht viel, Sir. Keine Terrorgruppe hat sich zu der Tat bekannt, niemand hat etwas gehört. Nicht die Israelis, nicht die Jordanier, nicht die Algerier, nicht die Franzosen, nicht die Saudis, nicht …«
»Okay«, sagte GT leise.
Almond ließ aus seiner Sofaecke deutliche Ungeduld erkennen. Johnson, dem dies nicht entging, wurde nervös. Er spürte, dass es noch weitere ihm vorenthaltene Informationen gab. Almond wird es noch weit bringen, dachte GT, wenn er sich nur etwas Zurückhaltung angewöhnt. In der Begrenzung liegt die Kunst.
Johnson verstummte.
»Und es gab keine weiteren Opfer?«
»Doch. Einen Marokkaner. Den Friseur.«
»Aha, und warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Zählen Araber etwa nicht?«
Johnson errötete. »Mit Verlaub, Sir. Ich habe mir wirklich noch nie vorwerfen lassen müssen …«
»Das war ein Scherz.«
»Ach so, ich verstehe.«
Almonds Grinsen brachte ihn regelrecht auf die Palme.
»Konzentrieren Sie sich auf die Frau«, riet ihm GT, um ihn auf andere Gedanken zu bringen.
»Und wenn wir sie finden?«, wollte Almond wissen.
GTs Blick blieb an dem gerahmten Foto des Botschafters hängen, auf dem dieser dem Präsidenten im Rosengarten des Weißen Hauses die Hand schüttelte. Der Botschafter. Buchstäblich und auch im übertragenen Sinne befand er sich auf einer anderen Etage. Außerdem war Sonntag. Es war wirklich nicht nötig, ihn mit dieser Sache zu behelligen.
»Wenn wir sie finden«, sagte GT langsam, »bringen wir sie erst einmal in einem Hotel unter. Ich muss nachdenken.« Er schenkte den beiden einen Kaffee ein.
»Danke, Sir«, sagten sie wie aus einem Munde.
»To go«, murmelte GT.
Sie verschwanden.
Er legte sich aufs Sofa und starrte an die hellgraue Decke.
Die Tag Heuer mit dem dunkelblauen Zifferblatt und dem Chromarmband zeigte Viertel nach zehn. Er hatte sie selbst gekauft. Nicht gerade billig. Den Kollegen gegenüber hatte er behauptet, seine Frau habe sie ihm geschenkt, zu Hause hatte er sie als Geschenk des Botschafters deklariert. Die beiden begegneten sich nur selten.
Die Zeit verging.
Marokko.
Wer mochte hinter dem Dreifachmord stecken? Gab es eine neue Terrorgruppe? Oder handelte es sich um eine Abrechnung unter Kriminellen? Vielleicht hatten sich ein paar amerikanische Spinner auf Waffenschmuggel eingelassen? Drogen? Nein, die Verbindung zu Hydraleaks überschattete alles andere. Einer der Hydraleaks-Drahtzieher war zusammen mit einem Offizier und einem Journalisten hingerichtet worden.
Ob die CIA dahintersteckte? Schließlich verfügte sie über bestimmte Einheiten, die ausschließlich damit befasst waren, undichte Stellen aufzuspüren und Organisationen wie Hydraleaks zu erforschen. Einige Versuche, die Gruppe zu infiltrieren, waren bereits unternommen worden. Aber ein dreifacher Mord am helllichten Tag mitten in einer Stadt, ohne anschließende Beseitigung der Leichen? Aber würde man so weit gehen, eigene Staatsbürger zu ermorden? Noch dazu einen Offizier und einen Journalisten? Das kam ihm höchst unwahrscheinlich vor, so wurden diese Dinge nicht gehandhabt. Das wäre viel zu unsauber gewesen. Und zu welchem Zweck? Ein Hydraleaks-Mitglied wie Peter Mueller war von viel größerem Nutzen, wenn er am Leben war.
Zeit für neue Gedanken. GT arbeitete sich aus der Couch hoch. Im Büro wurde es langsam heiß. Am Schreibtisch lockerte er seinen Gürtel, damit sich sein Bauch etwas entspannen konnte, nahm die Brille ab und ließ sie vor der Brust baumeln. Er rieb sich die Augen, setzte die Brille wieder auf und schlug die Berliner Morgenpost auf. Nichts von Belang. Es gab Streit darüber, ob die USA – wie von Gott vorgesehen – den Einsatz gegen Libyen anführen oder sich, dem Wunsch des Präsidenten gemäß, der NATO-Bürokratie bedienen sollten. Erschossene Demonstranten im Jemen, in Syrien und auch noch im Oman.
Nichts. Rein gar nichts.
Er ging eine Weile im Zimmer auf und ab. Ertappte sich dabei, auf den Nägeln zu kauen. Ließ sich auf das Sofa sinken und riss sich zusammen.
Es klopfte. Almond.
»Wir haben eine Personenbeschreibung. Man hat sich im Restaurant an die Frau erinnert. Es kommt eher selten vor, dass Gäste telefonieren möchten.«
»Und wie lautet die Beschreibung?«
»Anfang vierzig, groß, mager, blond«, las Almond vor. »Gibt nicht viel her.«
»Überprüfen Sie zuerst alle Hotels und Jugendherbergen. Wen habt ihr vor Ort?«
»Nur Kinsley, Green, Weinberger und Cox. Wir können schließlich nicht mit zwanzig Leuten anrücken, dachte ich.«
Das stimmte. Manchmal musste man sich aus Gründen der Diskretion ein wenig zurücknehmen.
GT fragte sich, ob Almond sich den kleinen Einsatz wohl, wie vorgeschrieben, vom Hauptquartier in Langley hatte genehmigen lassen. Aber in dieser Phase seiner Karriere fühlte sich Almond seinem unmittelbaren Vorgesetzten mehr verpflichtet als einer anonymen Behörde jenseits des Atlantiks. Davon ging GT zumindest aus.
Momentan galt es, das Misstrauen der deutschen Polizei nicht zu wecken. Wobei sich die Polizei vor Ort nicht aktiv dafür zu interessieren schien, was in der Welt der Geheimdienste vorging. Sie wirkte eher aktiv desinteressiert. Und mit Leuten wie ihm, Almond und den Mitarbeitern im Feld wollten die Zivilisten wirklich nichts zu tun haben. Trotzdem konnten die Amerikaner auf fremdem Territorium leider keine Treibjagd veranstalten, um nach vermissten Personen zu suchen.
»Wie sieht’s mit der Tarnung unserer Agenten momentan aus?«, erkundigte sich GT.
»Wir haben vor einem halben Jahr eine neue Firma aufgekauft. Alle vier verfügen über Visitenkarten mit Berufsbezeichnungen und funktionierenden Handynummern und dazu natürlich die entsprechenden gefälschten Pässe.«
»Aufgekauft?«
»Ja. Es sieht besser aus, wenn die Firma nicht erst kürzlich gegründet wurde. Die Engländer machen das offenbar schon seit Jahrzehnten so. Die sind manchmal erstaunlich clever.«
»Klingt teuer.«
»Wenn ich das richtig verstanden habe, werden diese Aufkäufe mit den Engländern und den Franzosen koordiniert. Die gemeinsame Nutzung soll Geld sparen.«
»Das ist ja wie beim Car-Sharing.« GT seufzte. Er hielt nichts von Kooperation aus finanziellen oder überhaupt aus irgendwelchen Gründen. In der Spionage gab es eine Grundregel: Je sicherer das Vorgehen, desto weniger effektiv. Die Lösung, zusammen mit den Geheimdiensten anderer Länder Firmen aufzukaufen, um sie als Tarnung für die Agenten vor Ort zu verwenden, schien außerdem einen anderen Aspekt derselben Regel zu beleuchten: Je billiger, desto gefährlicher.
»Was macht Johnson?«
»Er überprüft die für die Allgemeinheit einsehbaren Informationen, wie er das gelernt hat.« Dieses Mal verzichtete Almond auf ein Grinsen. »Facebook und Ähnliches. Vielleicht müssen wir ja einige Konten hacken. Außerdem versucht er eine Person in Marokko ausfindig zu machen, die mehr weiß.«
»Gut.«
Almond starrte geradeaus. »War sonst noch etwas, Sir?«
GT hätte fast wieder begonnen, auf den Nägeln zu kauen. In Gegenwart eines Untergebenen wäre das ein unverzeihlicher Fehler gewesen. Er holte tief Luft.
So mussten sich Journalisten fühlen, die einer Enthüllung auf der Spur waren. Die Spannung war kaum zu ertragen. Und bereits zu Beginn der Jagd musste darauf geachtet werden, dass nicht auch noch andere Witterung aufnahmen. GT wollte die Frau nicht in der Botschaft, sondern ganz für sich alleine haben.
»Wenn sie gefunden wird«, sagte GT mit leiser Stimme, »will ich nicht, dass man ihre Identität überprüft. Keine Berichte, nicht einmal einen Eintrag. Okay? Sobald man sie gefunden hat, soll sie in einem Hotel untergebracht werden. Ich schicke dann jemanden hin, dem ich vertraue.«
Almond nickte langsam. »Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Und auf Johnson.«
»Natürlich. Aber es gibt einen Mann vor Ort, den ich mit dieser Sache betrauen möchte. Im Übrigen leiten wir die Operation von hier aus, Sie und ich.«
In Almonds Blick trat etwas Gehetztes. GT war sich bewusst, dass der junge Mann eine schwierige Gratwanderung vor sich hatte. Einerseits wollte er es sich mit seinem unmittelbaren Vorgesetzten nicht verderben, indem er allzu sehr auf die Einhaltung der Vorschriften pochte. Andererseits wollte er sich nur ungern mit jemandem verbünden, der ganz offensichtlich zu große Risiken einging und einen nicht genehmigten Sondereinsatz im Alleingang durchzog.
»Und das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit«, sagte Almond.
»Was?«
»Wir verlassen uns auch auf Sie, Sir.«
Ein mutiges Wort und gar nicht ungeschickt: vorwurfsvoll und bittend zugleich. GT betrachtete ihn und beneidete ihn um viele Dinge, nicht aber um seine momentane Lage.
»Ich halte jetzt ein Nickerchen«, beendete GT das Gespräch.
Falls Almond den Wahrheitsgehalt dieser Aussage bezweifelte, so ließ er sich jedenfalls nichts anmerken.
Sobald Almond gegangen war, trat GT an den Schreibtisch.
Es gab nur einen Mann, den er jetzt anrufen konnte.
Adalbertstraße, Berlin-Kreuzberg
So., 17. Juli 2011
[12:15 MEZ]
Nicht zum ersten Mal fühlte sich der ehemalige Stasi-Hoffnungsträger Ludwig Licht, der inzwischen freiberuflich für die CIA tätig war, ein wenig durch die Mangel gedreht, während er mühsam seine Augenlider öffnete. Die Jalousie in seinem Schlafzimmer wirkte dünner als sonst. Er begann zu husten, und seine Leber erweckte den Eindruck, als wollte sie sich gleich losreißen. Aber es ließ sich noch aushalten.
Der Fünfundfünfzigste war mit einem unglaublichen Tiefpunkt einhergegangen, was sein Äußeres betraf. Nach seiner Glanzzeit zwischen fünfunddreißig und fünfzig hatte ihn ein erfreulicher Umstand nach dem anderen im Stich gelassen. Aufenthalte an der frischen Luft, Besuche im Fitnessstudio, eine ausgewogene Kost, regelmäßiger Gebrauch eines Rasiermessers – all diese Dinge hatten nunmehr Seltenheitswert. Während seiner schlimmsten Phasen war er ein straßenköterblondes, unrasiertes, dickliches Wesen, dem die Leute auf der Straße ungefragt ein paar Münzen in die Hand drückten. Derzeit war es nicht ganz so schlimm. In solchen Zwischenphasen konnte man meinen, er sei ein ehemaliger Spitzensportler der DDR, der mit Ausnahme des Dopings alles an den Nagel gehängt hatte. Was sogar eine ziemlich korrekte Beschreibung war.
Hatte das Telefon geklingelt? Zwanzig Minuten lang konnte er sich nicht entscheiden, ob er weiterschlafen oder auf die Toilette gehen sollte. Richtig wach wurde er erst, als die Mikrowelle einen feuerwerksmäßigen Kollaps erlitt. Die Konservendose. Genau. Dieses Mal war er immerhin so schlau, eine Berührung mit dem heißen Metall, das die Kernschmelze verursacht hatte, zu vermeiden. Ein vor Schmutz starrender Topflappen schützte seine Finger, als er den Doseninhalt in einen teflonbeschichteten Topf kippte. Der Herd streikte jedoch und ließ sich nicht einmal durch Gewalt umstimmen. Offenbar war eine Sicherung rausgeflogen.
Die kleine Dreizimmerwohnung war in keinem guten Zustand.
Der Sicherungskasten hing im Flur, gleich neben der Küche, und zwar so hoch, dass man ihn nur mit einem Hocker erreichen konnte. Die Deckenhöhe von drei Meter vierzig war der einzige Umstand, der noch daran erinnerte, dass in dem verfallenen Haus früher einmal bessere Leute gewohnt hatten. Es konnte durchaus sein, dass ihn eine türkische Hausfrau in einer dunklen Hinterhauswohnung nackt auf dem Hocker stehen sah.
Erfolglos machte sich Ludwig an durchgebrannten Sicherungen und bedrohlichen Kabelenden zu schaffen. Schließlich gab er auf und trottete in die Küche zurück, die zugleich sein Wohnzimmer war. Dort löffelte er die weißen Bohnen stehend und kalt direkt aus dem Topf, was ihn nicht sonderlich in Ekstase versetzte. Danach schlürfte er aus einem Glas zwei rohe Eier, die er mit einer Gabel aufgeschlagen hatte. Anschließend genehmigte er sich ein paar Neopyrintabletten und einen Nescafé, den er mit warmem Leitungswasser zubereitet hatte. Eventuelle Bakterien und Parasiten waren aufgrund des hohen Promillepegels ihres neuen Wirtes vollkommen chancenlos.
Mittlerweile hatte sich sein Zustand ein wenig stabilisiert. Welcher Wochentag war wohl heute? Samstag oder Sonntag? Sonntag. Nun gut. Er kehrte zum Sicherungskasten zurück und stieß mit der Badezimmertür zusammen, als er auf den Hocker klettern wollte. Es roch nach Waschmittel, was bedeutete, dass er das Bad irgendwann in der vergangenen Woche mit Persil Megaperls geputzt hatte, weil der Allesreiniger zu Ende war. Neue Erkenntnis: Der Hauptschalter im Sicherungskasten war umgelegt.
Auf dem Boden entdeckte er ein Jackett. Es sah teuer aus. Vielleicht hatte er es versehentlich aus irgendeiner Kneipe mitgenommen. Eine Bilderserie aus einem Touristenlokal am Ku’damm zog an seinem inneren Auge vorbei. Spielautomaten, Mai Tais und Entrecôte. Reiche Japaner. Zum Glück keine Spieltische. Aber was war das für ein Jackett?
Er kletterte vom Hocker und hob es hoch. Die Brieftasche? Steckte in der Brusttasche des Jacketts. Mit hundertfünfzig Euro plusminus einige Zehner. Und da war auch sein Handy, das er im Rausch der letzten fünf Tage verlegt hatte und dessen Akku leer war.
Er bückte sich und steckte das Ladegerät in die Steckdose rechts vom Kühlschrank. Dann fiel er um. Blieb eine Weile liegen.
Das wiederbelebte Handy begann zu brummen. Wie bei einem Hornissenangriff. Eine Nachricht nach der anderen. Sieben Stück hatte er hinterlassen, der verdammte moldauische Hurensohn Pavel Menk, der Hermann Göring der Unterwelt. Die siebte war die denkwürdigste: »Ludwik. Ludwik. Lu-do-wik. Komm nach Hause zu Papi. Kein Problem.«
Wenn Pavel »kein Problem« sagte, dann hieß das: Ich will keine weiteren Probleme. Oder auch: Ich bin es leid, dass du ein Problem bist. Es bedeutete: Wenn ich beim Durchschneiden deiner Kehle nur einen Blutstropfen abbekomme, dann verfolge ich dich mit der Rechnung für die chemische Reinigung bis in die Hölle.
Seine Schulden beliefen sich auf fünfzehntausend Euro. Selbstmitleid war durchaus angebracht. Ludwig hatte den Kredit weder versoffen noch verspielt. Er hatte für Venus Europa, das eine seiner beiden Restaurants, ein paar neue Küchenmaschinen gekauft, einen Fettabscheider und ein Kühlaggregat. Nach außen hin war es ein charmantes Kreuzberger Lokal, vom Lonely Planet 2002 immerhin halbherzig empfohlen. Die Speisekarte bot einen bunten Mischmasch von Austern über Risotto bis hin zu Knödel und Käsekuchen. Unter der pittoresken Oberfläche verbarg sich ein abgrundtiefer Sumpf. Dabei war der Kauf der Maschinen gemäß den Anordnungen der Berliner Gesundheits- und Schwanzlutscherbehörde erfolgt. Er hatte einfach Pech mit einer Stichprobe gehabt, mehr nicht, woraufhin Ludwig ausgerastet war. Er hätte den Rat eines Kumpels befolgen, die Sache auf die lange Bank schieben und eine Weile untertauchen sollen. Aber in einem Anfall von Größenwahn oder Unterwürfigkeit – oder beidem – hatte Ludwig Licht beschlossen, sich wie ein gesetzestreuer Mitbürger zu verhalten. Einen Ausflug mit einem Mietlaster zu einer Konkursversteigerung bei Dresden und vierzehntausendachthundert Euro später entsprach Venus Europa wieder den Vorgaben. Die Investition hatte den Umsatz jedoch keineswegs gesteigert. Dass er überhaupt das Risiko eingegangen war, sich Geld von Pavel zu leihen, hatte mit seinen Plänen zu tun, das andere seiner beiden Lokale zu verkaufen, denn es lief ohnehin nur mit Verlust. Das Venus Pankow lag im hinteren Teil Pankows und zwei Kilometer von der nächsten U-Bahn-Station entfernt. Natürlich wollte niemand es kaufen.
Im Laufe seiner 55 Jahre hatte er gelernt, nie das Gute zu tun, sondern sich auf das absolut Notwendige zu beschränken.
Im Tresor des Venus Europa lagen zweitausend Euro. Mehr nicht. Wie viel Zeit konnte er sich mit dieser Summe erkaufen? Zwei Wochen? Oder drei? Pavel Menk knipste seinen Zeitgenossen bereits bei weitaus geringeren Schulden gut gelaunt den Daumen mit der Gartenschere ab. Und die Zinsen wuchsen. Fünf Prozent pro Woche. Eine Woche Saufen – und schon waren aus fünfzehntausend fast sechzehntausend geworden.
Ludwig rappelte sich auf und ging duschen. Das Wasser floss aus der ramponierten Kabine auf den Fußboden. Er übergab sich in den Abfluss. Dann schlüpfte er in seinen Bademantel. Unten auf dem Hof war plötzlich Lärm: Durch das Fenster in der Diele sah Ludwig zwei Schreiner mit einem Dachdecker wegen eines Baugerüstes oder Ähnlichem streiten. Auch die Sonntage waren nicht mehr so heilig wie früher, so viel war sicher.
Sein Festnetztelefon klingelte. Nur sein Auftraggeber kannte die Nummer. Ludwig betrat sein winziges Arbeitszimmer, das ihn an seinen Verschlag in der Stasi-Zentrale in der Normannenstraße erinnerte. Es klingelte drei Mal. Dann Stille. Keine Nummer auf dem Display. Er wartete, ließ es erneut klingeln. Jetzt läutete es zwei Mal, ehe wieder aufgelegt wurde.
Er war hellwach. Sorgfältig schloss er Tür und Fenster und zog die braunen Samtgardinen zu. Ab und zu hatte er sich schon überlegt, ob diese vorgeschriebenen Maßnahmen nicht vollkommen sinnlos waren. Doch sie verliehen ihm das Gefühl, wichtig zu sein: Was er tat, war entscheidend, jedes Detail war von Bedeutung.
Das Warten war eines dieser Details. Nach einer weiteren Minute klingelte es erneut.
»Ihre Verifizierung, bitte.« Die Stimme am anderen Ende klang neutral wie die einer Stewardess, was nicht immer der Fall war.
»Einen Moment.«
Ludwig ging um seinen Schreibtisch herum und fuhr sein leicht ramponiertes MacBook hoch, das er bei einem Schützenwettbewerb gewonnen hatte.
»Sir?«, sagte die Frau.
»Einen Moment«, murmelte Ludwig, dem es jetzt endlich gelungen war, den Browser zu öffnen und die Homepage von BigFatFashionista aufzurufen, auf der degenerierte Londoner Mode-, Einrichtungs- und Shoppingtipps austauschten. Die neuesten Postings standen zuoberst. Je nach Wochentag interessierten ihn die Absender Retro_Zlave oder NinaHaagendazs. Heute war Sonntag: also Nina. Die ersten drei Worte des Posts: »Duck egg green.« Das letzte Wort lautete »offering«. Die ersten Buchstaben jedes Wortes. Normalerweise war das nicht so schwer.
»EGO«, sagte Ludwig.
»Wie bitte?«
»Warten Sie, bitte.«
Panik. Was sollte das?
»DEGO«, sagte er schließlich.
»Danke, Sir. Ich verbinde.«
Es knackte.
Die schweren Atemzüge am anderen Ende klangen sehr vertraut. Sie gehörten GT, dem Berliner CIA-Chef, der sich hinter seinen bomben- und feuersicheren Wänden in der wenige Kilometer entfernten amerikanischen Botschaft verschanzte. »Lange her«, meinte Ludwig.
»Achtzehn Monate«, erwiderte GT.
»Die Zeit vergeht schnell.« Ludwig ärgerte sich mal wieder über seine eigene Stimme, heute war es besonders schlimm.
»Allerdings. Alles in Ordnung?«
»Durchaus.«
»Dir geht’s gut und so?« GT klang wie ein gelangweilter Facharzt.
»Ausgezeichnet.« Ludwig räusperte sich. »Worum geht’s?«
»Du musst etwas abholen. In Parchim. Kein schwieriger Auftrag.«
»Soll ich meinen eigenen Wagen nehmen?«
»Wenn du willst.«
Ludwig bemühte sich, die blinkenden Anzeigen auf dem Monitor zu ignorieren, und klappte den Laptop zu.
Das Auto. Ein Range Rover, der 170 000 Kilometer auf dem Buckel hatte und ihn bereits das Doppelte des betrügerischen Kaufbetrags an Reparaturen gekostet hatte. Wo stand der Wagen eigentlich? Wann war er zuletzt damit gefahren? Oft genug hatte er nach einer Kneipenrunde den ausgezeichneten Beschluss gefasst, das Auto stehen zu lassen. Mit der weniger ausgezeichneten Folge, dass er das verdammte Ding am nächsten Morgen dank seiner lückenhaften Erinnerung kaum noch orten konnte.
»Aus Sicherheitsgründen würde ich mir lieber einen Wagen leihen.«
»Nimm deinen eigenen«, erwiderte GT. »Das ist einfacher.«
»Und was soll abgeholt werden?«
»Eine Zivilistin. Sie hat einen Vorfall beobachtet, der uns interessiert, oder besitzt zumindest diesbezügliche Informationen.«
»Wohin soll ich sie bringen?«
»Erst einmal zu dir nach Hause. Momentan befindet sie sich in Parchim auf der Polizeiwache.«
»Wie bitte – bei den Bullen?«
»Sie ist vor Kurzem dort aufgekreuzt. Lange Geschichte. Wir haben bereits nach ihr gesucht. Sie … wir hatten Leute in der Nähe.«
»Was will sie von den Bullen?«
»Personenschutz.«
Ludwig wartete schweigend ab, was bei GT immer am besten funktionierte. Wenn man ihn mit Fragen bombardierte, gab er sich zugeknöpft.
»Na gut«, meinte GT nach einigen Sekunden. »Dann nichts wie los.«
»Wie lange soll sie bei mir wohnen?«
Der Gedanke, eine Frau in seine Wohnung mitzunehmen, war bizarr.
»Wir wissen noch nicht, was weiter geschehen soll, insofern ist die Frage schwer zu beantworten.«
Ludwig schüttelte den Kopf. »Und worin besteht die Bedrohung?«
»Momentan deutet nichts auf … Alles scheint in Ordnung zu sein, könnte man sagen.«
»Wunderbar.«
»Wie gesagt. Es droht keine Gefahr. Nimm sie mit zu dir nach Hause. Vielleicht geschieht gar nichts weiter.«
»Also keine Bedrohung?«
GT schwieg.