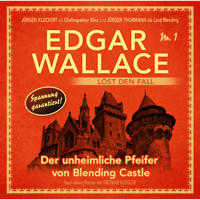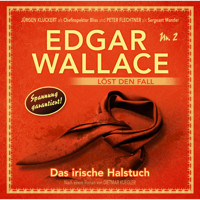3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
"Die Mission der Wölfe Lieutenant Beryll Fox hat eine Ladung Gewehre per Schiff von England nach Mexiko gebracht. Von dort aus plant er, die Waffen über die Grenze zu schaffen. Es ist der Vorabend des Bürgerkrieges und nur noch eine Frage der Zeit, bis die ersten Schüsse fallen. Und die Nordstaaten wissen über den Transport Bescheid. Die graue Schwadron Beryll Fox versucht im Auftrag des konföderierten General J.E.B. Stuart hinter den feindlichen Linien herausfinden, wann und wo der Nordstaaten-General McClellan den nächsten Vorstoß plant. Zusammen mit dem Soldaten Brad Hinkle startet Fox die hochbrisante Mission. Doch im Kommandostab Stuarts gibt es einen Verräter. Teil 1 der Mini-Serie NORD UND SÜD Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Dietmar Kuegler
Western Legenden 67: Die graue Schwadron
Nord und Süd No. 01
Inhaltsverzeichnis
Dietmar Kuegler
Die Mission der Wölfe
Die graue Schwadron
Anmerkung
Impressum
Dietmar Kuegler
4.06.1951 - 3.12.2022
Der BLITZ-Verlag trauert um seinen hervorragenden Autor und guten Freund.
Dietmar Kuegler war eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Er wird nicht zu ersetzen sein.
Er hinterlässt ein grandioses Lebenswerk, das für ihn noch längst nicht abgeschlossen war. Sein Amerikanistik-Magazin erfreute sich großer Beliebtheit, ebenso wie seine Fachbücher. Er wurde mitten aus seiner einzigartigen Schaffenskraft herausgerissen.
Der BLITZ-Verlag wird seine Romanwerke in Ehren halten und in seinem Sinne verwalten.
Die Mission der Wölfe
1.
Er wusste, dass er verfolgt wurde. Er hatte es schon den ganzen Tag vermutet. Seit einer halben Stunde war er seiner Sache völlig sicher. Wayne Bannon fühlte zwar eine wachsende Spannung in sich, aber nicht die geringste Nervosität. Denn er wusste genau, was er zu tun hatte.
Die Sonne sank westlich von San Fernando. Der Golf von Mexiko schimmerte wie flüssige Glut. Die milde Brise vom Meer vertrieb nach und nach die Hitze des Tages. Wayne Bannon lockerte den Revolver im Holster, einen Army Colt, Kaliber .44, ein nagelneues Modell. Unauffällig wandte er sich um und sah seinen Verfolger. Es war ein kleiner, stämmiger junger Bursche, ein Mexikaner in geflicktem Hemd, ausgebeulten Hosen und mit löchrigem großem Strohhut. Ein Fischer war er nicht, wie es sie in San Fernando viele gab. Dagegen sprach schon das große Messer, das er am Gürtel trug.
Bannon bewegte sich zum Hafen hinunter. Der scharfe Geruch von Tang, Salz und Teer hing in den schmalen Gassen. Die Häuser waren aus Lehm gebaut und mit Stroh gedeckt. Der Hafen war klein. Außerhalb der Stadt lag der Strand für die Fischerboote, die dicht an dicht im Sand lagen, bereit, in den Stunden nach Mitternacht wieder auszulaufen.
Bannon merkte, dass sein Verfolger sich näherte. Er hatte etwas vor. Bannon hatte vorgehabt, ihn in den Hafen zu locken, wo seine Leute warteten. Der andere würde nicht mitspielen. Bannon beschleunigte seinen Schritt, bog unvermittelt in eine Seitengasse ab und presste sich gegen die Hauswand. Die Gasse war leer. Bannon hörte die schnellen Schritte des Mexikaners. Gleich musste er die Gasse erreicht haben.
Er sauste um die Ecke wie eine Kanonenkugel. Bannon schob den rechten Fuß vor. Der Mexikaner stürzte der Länge nach auf das Pflaster. Er stieß einen Fluch aus, rollte herum wie eine Katze und stand schon wieder auf den Beinen. Er war flink und wendig und wollte davonlaufen, als Bannon ihn schon am Kragen hatte und zurückriss. Der Mexikaner taumelte, ging in die Knie, drehte sich und stieß dabei die Rechte hoch. Der Bursche war mit allen Wassern gewaschen. Bannon hämmerte ihm die linke Faust entgegen. Der Mann krümmte sich schnaufend zusammen und prallte gegen die Hauswand.
Bannon drehte den Hemdkragen herum, dass dem Mann die Luft ausging, und presste ihn fest gegen die Wand. „Endstation, Amigo“, sagte er.
„Was wollen Sie von mir, Señor?“, ächzte der andere. „Lassen Sie mich los! Sie bringen mich um!“
„Bestimmt sogar“, sagte Bannon. „Es sei denn, du erzählst mir, warum du mir den ganzen Tag nachschleichst.“
„Ich schleiche Ihnen nicht nach, Señor. Ich bin nur ein armer Fischer.“
„So?“ Bannons Stimme klang kalt. Mit einer blitzschnellen Bewegung riss er das Messer aus dem Gürtel des stämmigen Mannes. Die Klinge blinkte im Abendlicht.
„Eine merkwürdige Ausrüstung für einen armen Fischer, oder meinst du nicht, Amigo?“
Das Gesicht des Mexikaners verzerrte sich. Bannon sah Hass in seinen Augen glitzern.
„Wer hat dich geschickt?“, fragte Bannon. „Na los, rede schon, sonst ziehe ich dir das Fell bei lebendigem Leib ab.“
Der Mexikaner bog den Kopf zurück. Er röchelte. Er stand wie erstarrt, während er mit weit geöffnetem Mund rasselnd atmete. „Ich werde alles erklären“, keuchte er.
„Haga el favor, Amigo, ich bitte darum!“ Bannon lockerte etwas den Druck des Messers. Im selben Moment vernahm er rasche Schritte aus der Finsternis der schmalen Gassen. Er wandte den Kopf. Ein Schlag traf ihn. Zugleich ertönte ein schmerzerfüllter Schrei. Der Mexikaner vor ihm hatte das rechte Bein gehoben und zugetreten.
Er schlug die Hände vor das Gesicht, taumelte mit jammervollem Klagen zur Straßenecke hoch und brüllte: „Er ist hier!“
Wayne Bannon drehte sich und sah die Männer aus dem Schatten der Dämmerung heraneilen. Er konnte ihre Gesichter nicht erkennen. Sie trugen große Hüte und hielten Messer in den Fäusten.
Bannon wirbelte das Messer, das er seinem Verfolger abgenommen hatte, um den Zeigefinger. Es war ein wuchtiges, schweres Messer mit zehn Zoll langer Klinge. Bannon vollführte damit zwei schnelle Hiebe wie mit einem Säbel, und drei Kerle, die auf ihn hatten losgehen wollen, sprangen erschrocken wieder zurück.
Die anderen umkreisten ihn. Einer hob sein Messer zum Wurf. Da ließ Bannon das Messer in seiner Faust fliegen. Der Mann blieb wie angewurzelt stehen. Er beugte sich langsam nach vorn, starrte entsetzt auf den Messergriff, während er auf die Knie niedersank.
In diesem Augenblick griffen die anderen an. Bannon ließ sein rechtes Bein hochschnellen und empfing den Ersten mit einem Tritt in Gürtelhöhe. Der Mann wurde zurückgeschleudert und wälzte sich brüllend am Boden. Bannon fühlte einen Schlag in den Rücken, taumelte vor und zog trotzdem seinen Revolver. Er drückte ab, ohne zu zielen, als sich eine Faust um sein rechtes Handgelenk schloss. Ein gurgelnder Schrei: Ein Mann, der direkt vor ihm stand, war von der Kugel in den linken Oberschenkel getroffen worden. Die Hand des anderen Angreifers löste sich von Bannons Gelenk. Bannon drehte sich. Aus der Mündung seines Colts kräuselte sich eine Pulverdampffahne.
Die Männer wichen zurück. Bannon setzte mit zwei, drei Sprüngen auf die andere Straßenseite hinüber, drehte sich hier um und entfernte sich rückwärtsgehend zu der Gasse, die zum Hafen hinunterführte.
„Wir kriegen dich“, sagte einer der Männer. „Wir sehen uns wieder, Hombre.“
„Dann vergiss nicht, vorher mit dem Totengräber zu sprechen und dir einen Platz auf dem Friedhof auszusuchen.“
Bannon ging noch ein Stück zurück, bis die Angreifer in den toten Winkel der Seitengasse gerieten und er nur noch einen Mann sehen konnte. Der Mann lehnte an einer Hauswand und hielt noch immer die Hände vor das Gesicht. „Hoffentlich kriegst du keinen Schnupfen“, sagte Bannon. Dann wandte er sich ab und entfernte sich mit schnellen Schritten, wobei er immer wieder kurz stehen blieb und zurücklauschte.
Hinter ihm blieb es still. Aber Bannon blieb vorsichtig. Erst als er dem Hafen näherkam, war er sicher, dass er nicht mehr verfolgt wurde. Aber das galt nur für den Augenblick. Er wusste, wer die Männer waren, die hinter ihm her waren. Zumindest war er ziemlich sicher, es zu wissen. Woher sie allerdings über ihn Bescheid wussten, war ihm unklar. Was er und seine Leute in San Fernando vorhatten, war von Anfang an streng geheim gewesen. Er war mit sieben Männern hier. Jeden hatte er persönlich ausgewählt. Jeder wusste, dass er ihn gnadenlos niederschießen würde, wenn sich herausstellte, dass er geredet hatte.
Wayne Bannon sah den kleinen Hafen vor sich: zwei kurze, krumm gepflasterte Kais, mehrere schiefe Poller. Drei Frachtschiffe lagen ein Stück vor der Küste, so jämmerlich wie der Hafen selbst. Aber der Sonnenuntergang über der Laguna Madre war von berauschender Schönheit. Am westlichen Horizont verbrannte der Tag in einem lodernden Farbenmeer.
*
„Das Schiff wird noch im Laufe dieser Nacht erwartet“, sagte Pablo. Bannon kannte seinen Nachnamen nicht. Einfach Pablo, ein kleiner, wendiger Mann, der an ein Wiesel erinnerte. „Ein Fischer hat den Schoner draußen im Golf gesehen. Es war doch Ihre Absicht, dass er nicht bei Tageslicht einläuft, Señor?“
„Meine Absicht war, dafür zu sorgen, dass niemand, weder in San Fernando noch woanders, etwas davon merkt, dass es mit der Fracht dieses Schoners etwas Besonderes auf sich hat.“
„Diskretion, Señor, nicht wahr?“ Pablo grinste verstehend. „Naturalemente, Señor. Dafür ...“
„Dafür habe ich dir Schleimer fünfzig amerikanische Dollar gegeben“, unterbrach ihn Bannon. „Wie viel haben dir die anderen gezahlt?“
„Welche anderen, Señor? Was meinen Sie damit?“
„Ich meine die Kerle, die mir seit Tagen nachschleichen und vorhin versucht haben, mir den Bauch aufzuschlitzen.“
„Sie sind überfallen worden, Señor?“ Pablo verzog das Gesicht zu echter Trauer. Er war so etwas Ähnliches wie ein Hafenmeister. Im Grunde konnte man ihn aber nicht so bezeichnen, da San Fernando so etwas Ähnliches wie einen Hafen gar nicht hatte.
„Du bist ein verdammtes kleines Mistvieh!“ Bannons Rechte schoss vor und krallte sich um Pablos ohnehin zerknautschten Hemdkragen. „Du hast uns verraten, Mann. Ich sollte dich im Hafenbecken ersäufen. Weißt du, dass meine Leute draußen warten, um dich in Stücke zu reißen?“
„Lassen Sie mich los, Señor!“ Die Stimme Pablos überschlug sich. Er zappelte in Bannons eisernem Griff, aber er wagte nicht, Widerstand zu leisten.
„Wer steckt dahinter, Pablo? Du weißt, wo wir herkommen.“
„Ich weiß gar nichts, Señor.“
„An deiner Stelle würde ich nicht versuchen, mich zu reizen. Du stehst nahe davor, dass ich dir den Hals umdrehe.“
„Sie sind Tejano,1 Señor.“
„Dann weißt du auch, dass wir Ärger mit den Yankees haben.“
„Ich kenne solche Unterschiede nicht“, ächzte Pablo, als Bannon ihm den Hemdkragen immer enger drehte.
„Du weißt Bescheid, Pablo. Du weißt auch, was der Schoner geladen hat, auf den wir warten.“
„Señor! Bitte! Sie bringen mich um.“
„Verlass dich drauf, dass das nicht das Schlimmste ist“, sagte Bannon. „Wenn ich mit dir fertig bin, bist du dankbar, wenn du sterben darfst.“
„Señor!“ Die Stimme Pablos war die blanke Verzweiflung. „Was soll ich denn tun, wenn ein Mann wie Miguel Marquez Auskünfte von mir verlangt? Sie verlassen San Fernando bald, ich aber muss hierbleiben. Sie könnten mich töten, Señor. Aber Sie hätten keinen Vorteil davon. Miguel Marquez würde mich auf jeden Fall umbringen.“
Bannon blickte Pablo scharf an, dann versetzte er ihm einen Stoß und ließ ihn los. Pablo flog in einen Korbstuhl, der bedenklich schwankte, und blieb schnaufend sitzen, während er mit beiden Händen seinen Hals massierte.
„Es lässt sich nicht geheim halten, wenn sieben Gringos in eine kleine Stadt wie San Fernando reiten“, sagte Pablo. Seine Stimme wurde wieder kräftiger.
„Ich habe von ihm gehört“, sagte Bannon. „Hat er sich geäußert, was er von uns verlangt?“
„Er hat gar nichts gesagt, Señor. Miguel Marquez redet nicht mit einem kleinen, unwichtigen Mann wie mir über seine Pläne.“
„Hör zu, Pablo: Er wird nicht nur Fragen gestellt haben. Oder tauchen so oft sieben Tejanos in San Fernando auf?“
„Das ist es eben, Señor: In letzter Zeit lassen sich fast überhaupt keine Americanos2 mehr hier blicken. Deswegen ist es Miguel Marquez aufgefallen, dass Sie hier sind.“
Bannon dachte nach. Er trat an das einzige Fenster der schäbigen Hütte und blickte auf die Bucht hinaus, die sich jetzt in Dunkelheit hüllte. Draußen sah er die Umrisse seiner Männer. Sie warteten auf ihn. Er hatte sich eine Weile in Grenznähe aufgehalten, bevor er mit seinen Männern nach Mexiko geritten war. Er kannte den Namen Miguel Marquez. Das war einer der vielen Revolutionäre, wie sie in Mexiko so zahlreich waren. Man konnte denken, dass sie auf Bäumen wuchsen. Sehr oft war ihre Revolution nichts weiter als eine Vertuschung von Straßenräuberei mit dem einzigen wohltätigen Motiv, sich selbst die Taschen zu füllen. Hinter Miguel Marquez schien etwas mehr zu stecken. Aber wie auch immer: Für jeden Anführer einer Bande, die sich aus ehemaligen Campesinos und kleinen Rancheros zusammensetzte, musste die Aussicht, eine Ladung erstklassige Waffen erbeuten zu können, verlockend sein.
„Was hast du Marquez gesagt?“ Bannon drehte sich um.
Pablo musterte ihn furchtsam.
„Nur, dass Sie auf ein Schiff aus England mit einer wertvollen Fracht warten.“
„Du hast nicht gesagt, um was es sich dabei handelt?“
„Señor, er kannte Ihren Namen. Er hat gesagt: Bannon war Texas Ranger. Für wen arbeitet er heute? Er hat gesagt, die Americanos werden sich bald die Köpfe einschlagen. Bannon arbeitet für den Süden. Was braucht der Süden?“
„Ja, was braucht der Süden?“, fragte Bannon.
„Marquez hat nichts dazu gesagt.“
„Vermutlich hat er sich eine Menge gedacht.“ Bannon fixierte Pablo drohend. „Ist er in der Stadt? Liegt er in San Fernando auf der Lauer? Wird er uns angreifen, wenn der Schoner einläuft?“
„Oh, no, Señor!“ Pablo schüttelte voller Überzeugung den Kopf. „Marquez würde niemals in San Fernando angreifen. Er hat Freunde hier. Er würde nichts tun, was seine Freunde in Gefahr bringt.“ Pablo hob mit einer hilflosen Geste beide Arme. „Vermutlich hat er ein paar von seinen Leuten hier, aber höchstens zur Beobachtung.“
„Das heißt also, solange wir in San Fernando sind, sind wir sicher?“
„Es tut mir leid, Señor, wenn ich Sie in Schwierigkeiten gebracht habe.“
„Wo sitzt Marquez?“
Pablos Gesicht hatte einen nichtssagenden Ausdruck angenommen. Bannon überlegte, ob er die Antwort aus Pablo herausprügeln sollte, dachte aber dann, dass es der Mühe nicht wert war.
„Zu wem hast du sonst noch gesprochen, Pablo?“
„Zu niemandem, Señor.“ Pablos Stimme klang im Brustton der Überzeugung, geradezu empört, dass Bannon ihm zutraute, ein Klatschweib zu sein.
„Du hast nicht zufällig einem kaiserlichen Beamten gegenüber etwas erwähnt?“
„Ich schwöre! Niemals, Señor! Außerdem: Ich weiß ja gar nichts!“
Bannon ging zur Tür und öffnete sie. Mit gedämpfter Stimme sagte er: „Pale.“
Wie aus dem Boden gewachsen tauchte ein hagerer Mann vor ihm auf.
„Geh rein und gib auf ihn acht. Er darf sich nicht aus der Hütte rühren, bis das Schiff da ist. Du lässt ihn nicht aus den Augen. Er darf auch nicht ans Fenster. Lass ihn nicht mit der Lampe hantieren, etwa den Docht rauf- oder runterdrehen. Nichts, was danach aussieht, als gebe er jemandem auf irgendeine Weise Zeichen.“
„Und wenn er es versucht?“
„Bring ihn nicht um“, sagte Bannon. „Wir werden auch so Ärger genug kriegen.“
Bannon trat hinaus und ließ den anderen Mann eintreten. Er wandte den Kopf und sah Pablos angstvoll verzerrtes Gesicht, als er den anderen sich nähern sah. Bannon schloss die Tür.
Er ging zu seinen Leuten hinüber, die sich rings um die Hütte niedergelassen hatten: Männer mit scharf geschnittenen, dünnlippigen Gesichtern und kalten Augen. Ihre Gegenwart gab Wayne Bannon Sicherheit. Diese Männer fürchteten weder Himmel noch Hölle. Er konnte sich in jeder Situation auf sie verlassen.
„Ärger?“, fragte einer.
„Noch nicht“, sagte Bannon. Er spähte auf die Lagune hinaus. Das Mondlicht verwandelte das Wasser in flüssiges Silber. Aber seine Gedanken waren weit weg. Er fragte sich, was nördlich der Grenze in diesen Tagen geschah, wo die Krise zwischen dem Norden und dem Süden immer bedrohlicher wurde. Er hoffte, dass er noch genug Zeit haben würde. Aber die Unruhe, die ihn befiel, konnte er nicht verdrängen.
2.
Mit einer schwachen Brise, die die Segel kaum zu blähen vermochte, lief der Schoner in die Lagune ein. Nirgends an Bord brannte ein Licht. So war das Schiff gerade noch Teil der unendlichen Finsternis gewesen, die den Golf von Mexiko einhüllte, und lag im nächsten Moment im Silberstrahl des fast völlig gerundeten Mondes. Der Schoner glitt fast lautlos heran. Wie ein großes Tier, das den Tag in seinem Versteck abgewartet hat und bei Nacht auf Beute auszieht.
Am Bug stand ein hochgewachsener, schlanker Mann mit schmal geschnittenem Gesicht, kühn vorgewölbter Nase und strengem Kinn, das in der Mitte tief eingekerbt war. Er spähte aufmerksam nach voraus, als die mexikanische Küste im Mondlicht auftauchte und sich nach und nach die verschwommenen Umrisse des kleinen Fischerdorfes aus der Nacht schälten.
„Wir sind gleich da, Mister Fox“, sagte eine dunkle Stimme hinter ihm. Er wandte den Kopf und sah den Kapitän, einen bärtigen, stämmigen Mann. „Ich hoffe, die Männer, die Sie erwarten, haben alles vorbereitet. Ich muss noch vor Sonnenaufgang wieder ausgelaufen sein.“
„Die Verhältnisse sind etwas unsicher“, erwiderte Beryll Fox und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Küste vor dem Schoner. „Wir waren drei Wochen auf See, seit wir England verlassen haben. In drei Wochen kann eine Menge passieren.“
„Ich muss und ich werde die Fracht noch diese Nacht loswerden“, sagte der Kapitän. „Ich habe nicht vor, Schwierigkeiten mit den mexikanischen Behörden zu kriegen.“
„Keine Sorge, Kapitän.“ Fox wandte sich um und sagte: „Lassen Sie alles vorbereiten.“
„Wir werden uns wahrscheinlich nicht mehr sehen.“ Der Kapitän reichte Fox die Hand. „Ich wünsche Ihnen Glück. Ich an Ihrer Stelle würde in den nächsten Wochen amerikanischen Boden nicht mehr betreten. Waren Sie schon früher einmal in Amerika, Mister Fox?“
„Zweimal in den vergangenen fünf Jahren“, erwiderte Fox. „Ich habe Studien- und Jagdreisen durch das Mississippi-Tal unternommen, war in Texas, einigen Südstaaten und in Washington.“
„Ich bin jedes Jahr zwei- bis dreimal hier. Glauben Sie mir, dieses Land wird in Kürze explodieren. Nicht nur nördlich vom Rio Grande, auch hier in Mexiko rumort es. Die Mexikaner wollen den Kaiser aus Europa nicht. Sie wollen ihre eigenen Angelegenheiten regeln. Ich bin immer froh, wenn ich in unser gutes altes England zurückkehren kann.“
„Vielleicht explodiert dieses Land“, sagte Fox. „Aber ich glaube, dass es wert ist, dabei zu sein und zuzusehen. In diesem Land hat es schon viele große Explosionen gegeben. Jedes Mal ist etwas völlig Neues daraus entstanden. Ich glaube, dass in Amerika eine Kraft steckt, die uns in Europa fehlt, Kapitän. Was bei uns zur Katastrophe werden würde, wird hier zu einem Bündel neuer Chancen.“
„Dann wünsche ich Ihnen, dass Ihr Kopf lange genug oben bleibt, damit Sie sehen können, ob Sie recht behalten.“
Fox erwiderte den Händedruck. Er lächelte. Eine Narbe auf seiner linken Wange verlieh seinem Gesicht etwas Jungenhaftes. Fox sagte: „Unkraut vergeht nicht.“
Er ging in seine Kajüte. Seine Reisetasche aus festem Teppichstoff war fertig gepackt. Fox griff nach dem breiten büffelledernen Gurt mit einem Holster, in dem ein gewaltiger LeMat-Revolver steckte. Eine Waffe mit neunschüssiger Trommel, deren Achse zugleich ein Schrotlauf war. Fox schnallte den Gurt um, rückte das Holster zurecht und nahm den Peabody-Karabiner vom Tisch. Er schnallte ihn an der Reisetasche fest, stülpte einen breitkrempigen Hut auf und kehrte an Deck zurück.
Der Schoner hatte sich der Küste inzwischen auf Rufweite genähert. Die Segel waren eingeholt worden. Am Bug stand ein Seemann, der ein Windlicht in gleichmäßigen Abständen hob und senkte und es dann löschte. Der Kapitän war nirgends mehr zu sehen. Deutlich war das Ächzen und Knarren der Spanten und Wanten, der Planken und des Tauwerks zu vernehmen. Eine tief schwelende Erregung ergriff Fox. Er wusste, dass es kein Zurück mehr gab, wenn er den Schoner verlassen hatte. Trotzdem stieg er, ohne zu zögern, über das Schanzkleid und kletterte die Jakobsleiter hinunter. Ein Boot war zu Wasser gelassen worden. Fox nahm im Heck Platz, während der Seemann in der Mitte, der ihn keines Blickes und keines Wortes würdigte, kraftvoll zu pullen begann.
Das Boot glitt auf die Küste zu. Von dort löste sich ebenfalls ein Boot. In einigem Abstand begegneten sich beide Boote. Es wurden keine Zeichen gegeben. Wenig später glitt der Kiel von Fox’ Boot über Grund. Fox stand auf, sprang hinaus, watete das letzte Stück an Land und drehte sich nicht mehr um. Der Seemann war bereits dabei, das Boot zurück in die Lagune zu rudern.
Unterhalb des Hafens von San Fernando tauchten zwei schattenhafte Gestalten auf, die sich Fox näherten. Fox erwartete sie. Er schlug den Rockschoß zurück und legte die Rechte auf den Griff des LeMat-Revolvers.
„Fox?“
„Ja?“
„Ich bin Bannon.“ Der athletische Mann trat näher. Fox sah sein Gesicht. Er lauschte dem singenden Tonfall des Texaners, der seinen Ohren noch fremd war. „Ist die Überfahrt glattgegangen?“
„Keine Probleme. Und hier?“
„Es gibt Schwierigkeiten“, sagte Bannon. „Kommen Sie, Fox. Wir wollen uns nicht hier aufhalten. Meine Leute sind schon unterwegs, um die Gewehre zu holen. Wie viele haben Sie mitgebracht?“
„500 Lee-Enfield“, sagte Fox, während er neben Bannon und dessen Begleiter auf die Fischerhütten von San Fernando zuging. Seine Erregung war zwar nicht völlig geschwunden, ebbte jedoch ab. Fox warf einen Blick auf die Lagune hinaus, die im vollen Mondlicht lag. Das Boot, das er bei seiner Fahrt zum Strand gesehen hatte, kehrte bereits zurück. Es lag tief im Wasser.
Von den Schuppen seitlich vom Hafen lösten sich soeben drei Frachtwagen. Gezogen von Maultiergespannen, rollten sie zum Strand hinunter.
„Was für Schwierigkeiten?“, fragte Fox.
„Später“, sagte Bannon. Er blickte sich aufmerksam um. Oben auf den Kais sah er einen seiner Leute stehen. Zwei befanden sich auf dem Boot, das die Fracht von Bord des Schoners holte, drei lenkten die Frachtwagen, ein weiterer befand sich bei ihm und Fox. Er hätte zehn Männer mehr brauchen können. Insgeheim hatte er Fox als harten Burschen eingeschätzt. Vielleicht ein bisschen zu abenteuerlich veranlagt. Er erinnerte sich an das, was ihm über Fox gesagt worden war, als er seinen Auftrag in Austin erhalten hatte: Engländer, Angehöriger des Landadels, Offizier der britischen Armee, erfahren mit Waffen und Sprengstoff. Er sympathisierte mit den Pflanzern der Südstaaten, obwohl er ein Gegner der Sklaverei war. Auch jene Kreise des Landadels, die ihn für den richtigen Mann gehalten hatten, einen geheimen Waffentransport für die Südstaaten über den Atlantik zu bringen, waren für die Südstaaten, aber gegen die Sklaverei.
Bannon störte das nicht. Seine Familie hatte nie Sklaven gehabt. Für ihn war der Konflikt mit dem Norden, der sich unaufhaltsam anbahnte, keine Auseinandersetzung um die Sklavenfrage. Mochte im Norden auch noch so sehr darüber gezetert werden. Wichtig war ihm allein, dass er sicher sein konnte, sich auf Fox verlassen zu können.
Der zweite Mann stieß unvermittelt einen Laut aus. Bannon drehte sich um. Fox hatte bereits seinen LeMat-Revolver gezogen. Fünf, sechs schemenhafte Gestalten hasteten aus den Dünen zum Strand hinunter. Ihre breitrandigen Sombreros verliehen den Männern im Mondlicht bizarr verzerrte Silhouetten. Die Männer griffen die Wagen und das Boot an, das das Ufer gerade wieder erreicht hatte.
„Nicht schießen!“ Bannon drückte Fox den rechten Arm nach unten. Er stieß einen scharfen Pfiff aus und begann zu laufen. Der Posten, den er vor der Hütte des Hafenmeisters auf den Kais zurückgelassen hatte, stürmte heran. Sie hasteten über den Strand und erreichten die Wagen kurz nach den Mexikanern. Messer blitzten. Auch die Angreifer hatten offensichtlich kein Interesse daran, Lärm zu verursachen.
Einer der Kutscher stand auf dem Bock seines Wagens und schwang die lange Bullpeitsche, mit der er das Gespann anzutreiben pflegte. Sie knallte scharf wie ein Karabinerschuss. Einer der Männer, die das Boot herübergebracht hatte, sprang in das seichte Uferwasser.
Fox sah sich unvermittelt einem hageren Mexikaner gegenüber, dessen Gesicht verzweifelt verzerrt war, in dessen weit aufgerissenen Augen aber zugleich wilde Entschlossenheit glühte. Fox sah die Messerklinge dicht vor seinem Gesicht. Er ließ seine rechte Faust geistesgegenwärtig vorschnellen. Der Kopf des Mexikaners flog zurück. Mit der Linken packte Fox die messerbewehrte Faust und bog sie nach hinten. Der Mexikaner stürzte. Fox wurde mitgerissen. Er wälzte sich herum.
Der Mexikaner richtete sich auf. Er hatte sein Messer verloren. Als er zwischen den Wagen hindurch wollte, traf ihn von oben ein Hieb. Er stürzte der Länge nach aufs Gesicht und blieb in verrenkter Haltung liegen. In den nächsten Sekunden war der lautlose, verbissen geführte Kampf vorbei. Bis auf den einen Mann, der tot im Sand zurückblieb, flüchteten die anderen über die Dünen. Sie waren im nächsten Moment verschwunden. Die Nacht war so still wie zuvor.
„Aufladen!“, befahl Bannon und trat auf Fox zu, der sich gerade wieder aufgerichtet hatte. „Jetzt wissen Sie, was wir für Schwierigkeiten haben. Sie bluten.“
Fox griff zu seiner rechten Wange hoch. „Ein Kratzer.“
„Beeilt euch!“, herrschte Bannon seine Leute an.
Das Boot war bereits wieder unterwegs. Die Fahrer der Wagen luden die ersten Kisten auf. Sie arbeiteten schweigend, schnell und so, als hätten sie jede Bewegung geübt und nicht vor wenigen Minuten noch um ihr Leben gekämpft.
Bannon und Fox kehrten zum Stadtrand zurück. Fox ließ seine Blicke über San Fernando schweifen. Die kleine Siedlung lag wie tot im Mondlicht. Nirgends ein Licht. Nirgends eine Bewegung. Und doch hatte Fox das Gefühl, dass hinter vielen Fenstern Menschen standen und in die Nacht spähten. Sie erreichten einen Wagenhof. Es gab zwei Corrals hier, zwei große Remisen, eine Scheune. Bannon führte ihn in die Scheune. Als die Tür geschlossen war, zündete Bannon eine Petroleumlampe an. Er zog einen Tabakbeutel aus der Tasche und drehte sich eine Zigarette. Er war äußerlich völlig ruhig.
Fox stellte seine Tasche ab und setzte sich auf eine morsche Haferkiste. Er sagte: „Ich bin froh, wieder in Amerika zu sein.“
„So?“ Bannon musterte ihn, während er seine Zigarette anzündete. „Sind Sie sicher, dass Sie wissen, was Sie da sagen?“
*
Bannon brachte Kaffee. Im Hintergrund der Scheune befand sich ein Kanonenofen, auf dem ein Kessel mit kochendem Wasser stand. Hinter dem Ofen entdeckte Fox mehrere Deckenlager im Heu.
„Wie lange haben Sie mit Ihren Leuten hier zugebracht?“ Er nahm den Kaffee; er war stark, schwarz und bitter. Genau das Richtige, um die Lebensgeister neu zu wecken.
„Zehn Tage“, sagte Bannon. „So lange haben wir gebraucht. Wir mussten uns absichern, wir mussten die Wagen und die Mulis beschaffen, und wir mussten alles für die Übernahme der Ladung vorbereiten.“ Er blies den Dampf von seiner Tasse. „Und trotzdem war das meiste umsonst.“
„Wegen der Kerle, die uns angegriffen haben?“
„Das war nur ein Vorspiel“, sagte Bannon. „Ein laues Lüftchen, wenn ich an das denke, was uns wahrscheinlich bevorsteht.“
„Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz“, entgegnete Fox. „Ein Vertreter der Regierung von Georgia hat in London gesagt, dass eine Abspaltung des Südens vom Norden und ein Bürgerkrieg unmittelbar bevorstehen. Er hat 500 Lee-Enfield-Karabiner bestellt und gesagt, dass ich die Ladung nach Mexiko bringen soll, weil bei der Ankunft des Schoners vermutlich bereits Krieg herrsche. Hier sollte ein Sonderkommando einer neuen Armee die Ladung übernehmen und zusammen mit mir nach Virginia bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Plan inzwischen längst bekannt ist und uns ein paar Agenten auf den Hals geschickt werden, und zwar aus dem Norden. Aber die Kerle, die uns vorhin angegriffen haben, waren Mexikaner.“
„Es wäre vielleicht besser gewesen, die Ladung wäre bei Nacht und Nebel in irgendeinem unserer Häfen angelandet worden. Dann hätten wir es nur mit Yankee-Agenten zu tun gehabt.“ Bannon trank. „Die Lage ist tatsächlich anders, als Sie erwartet haben, Fox. Zwar stehen sich Norden und Süden inzwischen mit gefletschten Zähnen gegenüber. Aber noch hat niemand den ersten Schuss abgefeuert. Sonst ist alles richtig: Ich bilde mit meinen Leuten ein Sonderkommando, beauftragt vom Adjutant General von Texas. Ich war früher Texas Ranger, genau wie meine Leute. Wir werden alle sofort Mitglieder einer eigenen Südstaatenarmee sein, sobald der Schlamassel losgeht. Ich werde voraussichtlich eine Kompanie kommandieren. Aber das alles wird nur geschehen, wenn es uns gelingt, die Karabiner aus Mexiko rauszubringen.“
„Also keine Yankee-Agenten“, stellte Fox fest.
„Keine Yankee-Agenten“, bestätigte Bannon. „Mexikaner, die 500 Gewehre sehr dringend brauchen. Miguel Marquez, ein Campesino-Anführer. Seine Leute sind schlecht bewaffnet. Zum Teil barfüßige Bauern.“
„Wir werden mit ihm fertig“, meinte Fox.
„Marquez befehligt eine große Bande“, antwortete Bannon. „Entscheidend aber ist, dass wir uns in einem kaum besiedelten Gebiet befinden und die wenigen Rancheros, die es hier gibt, Marquez bedingungslos unterstützen. Schon aus Selbsterhaltungstrieb, da Marquez die Anwesenheit von Menschen, die nicht für ihn sind, nicht erträgt.“
„Und?“
„Wir haben keine Freunde hier“, sagte Bannon.
„Was schlagen Sie vor?“
„Wir werden nicht sofort aufbrechen. Damit irritieren wir die Spitzel, die er auf uns angesetzt hat. Gleichzeitig werden wir versuchen, einen Weg zu finden, den wir nehmen können, ohne dass Marquez rechtzeitig genug davon erfährt.“
„Ich bin einverstanden“, sagte Fox. „Sie kennen die Verhältnisse hier besser. Ich halte es allerdings für gefährlich, wenn wir uns zu lange in einem Nest wie diesem aufhalten. Auch wenn die Anlandung des Transports anscheinend nur diesem Marquez bekannt gewesen ist. Nach meinen Erfahrungen gibt es immer Menschen, die sehen, was sie nicht sehen sollen, und die Dinge erfahren, die nicht für sie bestimmt sind. Die Tatsache, dass eine Ladung Gewehre für die Südstaaten hier gelagert ist, wird sich herumsprechen, und wir werden es sehr bald nicht nur mit diesem Revolucionario, sondern auch mit der mexikanischen Armee zu tun haben. Ich frage mich, was für uns günstiger ist. Es ist in jedem Fall besser, nur einen Gegner zu haben, statt zwischen zwei Feuer zu geraten. Und garantiert kriegen wir weniger Schwierigkeiten, wenn wir ein paar Bandoleros erschießen, um den Transport durchzubringen, als wenn wir uns mit mexikanischen Soldaten herumschießen müssen, was womöglich diplomatische Probleme zur Folge haben wird.“
„Ich bin Ihrer Meinung, Fox. Wir werden uns keine Stunde länger als nötig hier aufhalten. Ich möchte aber auch das Risiko auf dem Weg zum Rio Grande möglichst klein halten. Jeder Kampf sorgt für Aufsehen, genau das können wir nicht brauchen.“
Draußen waren das Knarren und Ächzen von Wagenrädern zu hören, das Klirren von Geschirrketten und das Stampfen von Hufen. Bannon ging zum Tor und riss es weit auf. Fox sah die ersten beiden Frachtgespanne. Sie rollten auf den Hof und wurden sofort in eine der Remisen dirigiert.
Fox leerte seinen Becher mit einem großen Schluck und verließ die Scheune. Er sah den dritten Wagen vom Strand hochrollen. Das Boot, mit dem man die letzten Kisten geholt hatte, war hoch auf den Sand gezogen worden. Fox blickte auf die Lagune hinaus. Auf dem Schoner wurden Segel gesetzt. Der Wind blähte die Segel. Der Schoner neigte sich leicht auf die Seite. Geräuschlos glitt er aus der Bucht zurück in den Golf. Er war kaum mehr als eine scharf konturierte Silhouette im Mondlicht, die sich wie ein Schatten in Nichts auflöste, je weiter das Schiff sich entfernte.
Fox spähte dem Schoner nach. Jetzt war es endgültig: Er konnte nicht mehr fort. Unwillkürlich stützte er die Rechte auf den Griff des LeMat-Revolvers. Die Berührung mit dem kühlen Metall wirkte beruhigend.
„Wie benimmt sich Pablo?“, fragte Bannon den Mann, der am Hafen Wache gestanden hatte.
„Er wagt kaum zu atmen, ohne um Erlaubnis zu fragen.“
„Hol ihn her“, sagte Bannon.
„Ihn herholen? Man wird ihn vermissen, wenn er morgen früh nicht da ist.“
„Er wird in ein paar Tagen wieder in seiner Hütte auf den Kais sitzen.“
„Wenn er plötzlich verschwunden ist, könnten wir mehr Ärger kriegen, als wenn er weiter im Hafen herumläuft.“
„Er weiß zu viel“, sagte Bannon eisig. „Er redet zu viel. Hol ihn her.“
„Wer ist das?“, fragte Fox.
„Er fertigt die Fracht ab, wenn sich mal ein größeres Schiff nach San Fernando verirrt“, erwiderte Bannon. „Er ist neugierig, geschwätzig und feige. Er hat Marquez über uns informiert. Genau genommen haben wir ihm den Ärger zu verdanken.“
„Dann wissen die Kerle, die hinter uns her sind, ohnehin Bescheid. Aber seine Freunde in San Fernando könnten wir auch noch auf den Hals kriegen, wenn wir ihn verschwinden lassen.“
Bannon musterte Fox eine Weile. Er nagte an der Unterlippe. Dann nickte er und wandte sich wieder dem Posten zu: „Hol ihn her. Wir behalten ihn bis zum Morgengrauen hier und lassen ihn dann laufen. Bis dahin ist er vor Angst fast eingegangen. Wenn wir ihm dann noch sagen, dass ständig einer von uns in seiner Nähe bleibt und ihm den Skalp abzieht, wenn er zu viel redet, können wir ihn wahrscheinlich unter Kontrolle halten.“
Der Mann entfernte sich.
Bannon sagte: „Wir werden uns bald entscheiden müssen, Fox.“
„Wegen was?“
„Wer diesen Haufen anführt.“
„Es sind Ihre Leute, Bannon“, sagte Fox. „Ich bin für die Waffen verantwortlich. Wir sollten einfach darüber reden, wenn wir verschiedener Meinung sind.“
„Das wird manchmal schlecht gehen.“
„Warten wir es ab“, meinte Fox.
„Ich schicke vor Sonnenaufgang zwei Männer los, die einen Weg nach Norden erkunden werden, der uns die wenigsten Schwierigkeiten bereitet und der so unauffällig wie möglich ist. Außerdem werden sie versuchen, herauszufinden, wo sich Marquez verkrochen hat.“
„Dieser Pablo, was machen wir nun mit ihm? Aus dem Weg schaffen?“
„Nein, Fox.“ Bannon schüttelte den Kopf. Fox sah hinter ihm auf der Gasse zum Hafen den Posten auftauchen. Er schleppte einen kleinen, schmächtigen Mexikaner mit sich, dem er einen Knebel in den Mund gestopft hatte. Der Mexikaner war blass wie ein Laken. Die Augen quollen ihm fast aus den Höhlen, als er die Männer mit den schweren Waffen am Gürtel sah, inmitten der düsteren Schuppenansammlung, die endlos weit entfernt zu sein schien von seiner gewohnten Umgebung am Hafen, wo er zu Hause war, wo er Freunde hatte. Hier war er allein und den Gringos ausgeliefert.
„Ich habe nicht vor, einen kleinen Schwätzer umzubringen, der sich vor lauter Angst totprügeln lassen würde, weil Marquez ihm versprochen hat, ihn am Spieß bei lebendigem Leib zu rösten, wenn er uns etwas verrät.“
Pablo wurde vorbeigeschleift und in einen Holzverschlag geworfen. Bannon sagte: „Wir haben ein paar Stunden, um zu schlafen. Wir sollten sie nutzen. Es ist nicht sicher, ob wir solche Gelegenheiten ab jetzt noch oft haben.“
„Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir Gefangene sind“, sagte Fox. „Vermutlich liegen die Leute dieses Marquez bereits rings um die Stadt postiert und warten nur darauf, dass wir den Kopf rausschieben.“
„Meine Leute werden sich darum kümmern, Fox. Wir werden es bald wissen.“
3.
„Die Armee wird bald kommen“, sagte der kleine, spitznasige Mann. Er drehte seinen löchrigen Sombrero in den schwieligen Händen und blickte mit einer Mischung aus Respekt und Angst auf den riesigen Mann auf der anderen Seite des Feuers.
Der Mann maß mindestens sechs Fuß und sechs Zoll. Er war ein Koloss mit einem Leib wie eine Tonne, Schultern wie ein Büffel und Armen wie Schinken. Sein schwarzer Bart war struppig und strähnig, seine Augen, die in tiefen Höhlen lagen, glühten ständig wie feurige Kohlen.
Über dem Feuer befand sich ein Bratspieß, an dem ein Lamm gedreht wurde. Der riesige Mann schnitt sich ein gewaltiges Stück Fleisch aus der Keule, spießte es auf sein Messer und schlug seine Zähne hinein wie ein Raubtier. Das Fett troff ihm zu beiden Seiten aus den Mundwinkeln und rann in seinen Bart.