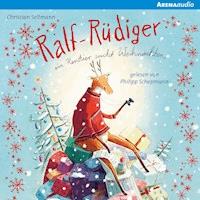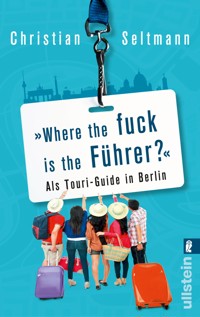
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Steht die Mauer noch?« — »Tut da die Merkel wohnen?« — »Where the fuck is the Führer?« Solche Fragen muss Christian Seltmann ertragen, während er Touristen durchs Verkehrs- und Geschichtschaos des Berliner Hauptstadtdschungels leitet. Amerikanische Fahrrad-Legastheniker kollidieren mit Kinderwägen. Rentner aus Bottrop blockieren auf Segways die Friedrichstraße. Australische Reisealkoholiker suchen nach den coolsten Kneipen. Nein, Touri-Guide ist kein leichter Job in dieser Stadt — wird aber versüßt durch die Bezahlung und durch bildschöne Frauen auf Junggesellinnen-Abschied ... Am Ende des Tages weiß Seltmann: Berlin geht nicht ohne Führer ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Der Weg durch Berlin ist der Weg durch die Hölle. Jedenfalls dann, wenn man sich auf zwei Rädern mit einem Tross ahnungsloser Provinzler durch tausend Baustellen aalen, mit wildgewordenen Autofahrern in den Clinch gehen muss und einem der Gestank und der Dreck der Stadt unablässig in die Nase und die Augen dringt.
Der Weg durch Berlin ist eine Wonne – wenn man das Glück hat, an einem lauen Spätsommerabend mit gutgelaunten klugen Menschen von einem Café zum nächsten zu mäandern, während der Fernsehturm in der Abendsonne glänzt und Musik durch die baumbestandenen Straßen strömt.
Christian Seltmann hat beides erlebt und noch viel mehr. Denn er hat jahrelang als Touri-Guide (altmodisch: Fremdenführer) in Deutschlands Hauptstadt gearbeitet. Eine Zeit, die gepflastert ist von Provinzdeppen und Großstadtaffen, netten Normalos und witzigen Irren, kleinen Begebenheiten mit großer Wirkung und großen Ärgernissen mit kleingeistigen Leuten. Dies alles umweht vom Berliner Lebensgefühl, von der deutschen Geschichte und dem Phantom des Führers. Denn der Adolf, der hier einst sein Unwesen trieb, verfolgt »unseren« Führer auf seinen Touren auf Schritt und Tritt …
Der Autor
Christian Seltmann, geboren 1968, floh in den Neunzigern aus Westdeutschland nach Ostberlin und schlug sich als Übersetzer, Fernsehredakteur, Rocksänger, Producer, Matratzenauslieferer, Rettungssanitäter und Drehbuchautor durch. Er war jahrelang Touristen-Guide und hat zudem Geschichte studiert (als es die DDR noch gab). Heute ist er erfolgreicher Kinderbuchautor.
Christian Seltmann
»Where the fuck
is the Führer?«
Als Touri-Guide in Berlin
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-taschenbuch.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage August 2015
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015
Umschlaggestaltung: semper smile Werbeagentur, München
Titelabbildung: Shutterstock/Odua Images (Personen);
Shutterstock/nikkytok (Anhänger);
Shutterstock/Jktu_21 (Stadt);
Shutterstock/Frank Fiedler (Hintergrund)
ISBN 978-3-8437-1113-5
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book: KompetenzCenter, Mönchengladbach
Inhalt
Wie ich zum Führer wurde
Die erste Tour
Die erste eigene Tour
Deutschland, uneinig Vaterland
Westfalen
Hamburger
Dorfbewohner
Trinkgeld
Nervensägen im Großstadtfieber
Statisten des Urlaubs
Sprachlehrer
Erich auf der Flucht
Zeitzeugen
UdL mit Provinzschnepfen
Langweiler
Anke ist schmerzfrei
Kinder und Eltern
Das Geschäftliche
Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
Team-Meeting
Street Credibility
Nerdy German Things
Gary de Sade
Der Führer
Das Urteil der Zeitgenossen
Die Neue Reichskanzlei
Fragen zum Führer
Hochsaison mit dem Führer
Berlin von unten
Bahnhof Zoo
Wir Kinder vom Alex
Wie man Führer wird
Die Anfangsphase
Wie man Provinzler einseift
Des Führers spätes Erbe
Umgang mit Frauen
Was geht, was fährt, was schwimmt
Mal langsam kommen lassen, mal schnell kommen lassen
Käpt’n Bimmel
ÖPNV
Extratouren
After-Terror-Tour
The-Führer-Tour
Die Nichtsehenswürdigkeiten-Tour
Im-Eimer-Tour
Jagd-Tour
Kiezdeutsch-Tour
Türkisch-für-Anfänger-Tour
Kampfzone Berlin
Zweirädrig im Verkehrsgemetzel
Radfahren als Mutprobe
Straßenbahnschienen
Der öffentliche Raum
Die Senatsfreaks
Rosenverkäufer
Ordnungshüter
Bärte
Pfandjäger
Lesesaal oder The German Angst
Reiche am Gendarmenmarkt
Fußgänger
Berlinische Ethnologie: Gentrifizierung
Schöne Touren – tolle Teilnehmer (gibt’s mehr, als man denkt)
Annika im Sony-Center
Gay Guide
Miss American Pie
Junggesellinnenabschied
Historistische Scheiße
Gefühle
Unverhoffte Freundschaften
Der beste Job der Welt – trotz allem
Tour-Ende
Dank
Quellennachweis
Wie ich zum Führer wurde
Ich habe einen Sonnenbrand, vielleicht sogar einen Sonnenstich. Ich liege auf einem alten Perserteppich. Auf dem bin ich eingeschlafen. Am helllichten Tag. Vor Erschöpfung. Ich bin völlig erschlagen.
Wie konnte ich bloß in diese Lage geraten?
Nun ja, das ist normal. Denn ich bin ein Guide.
Angefangen hat alles damit, dass ich immer wieder diese bunten Fahrräder gesehen habe. Oder hat alles damit angefangen, dass ich einen Roman schreiben wollte? Oder hat es schon früher angefangen? Damit, dass ich bei ProSieben rausgeflogen bin? Oder noch früher? Als ich nach Berlin gegangen bin?
Irgendwo zwischen jetzt und der Lektüre von Hemingways Roman Fiesta, in dem das Hipster-Leben, dass damals noch Bohème hieß, beschrieben wird, irgendwo zwischen heute und meinem vierzehnten Geburtstag also hat es angefangen. Und hier hat es mich hingeführt. Auf den stinkenden Perserteppich. Zerschlagen, missachtet, ausgebeutet. Denn ich bin jetzt ein Guide.
Okay, es war genau genommen so: Meine Frau machte ein Praktikum, kurz vor Ende ihres Studiums. Bei einer NGO. Das steht für Non Governemental Organisation und umfasst Gutmenschen-Vereine wie Amnesty International, Greenpeace oder Foodwatch.
Sie passte da prima rein, meine Frau. Ich saß derweil in der Bibliothek und arbeitete an meinem Roman. Wobei arbeiten irgendwie komisch klingt und Roman auch. Denn ich hatte ständig das Gefühl, als sei ich zu blöd zum Schreiben. Möglicherweise fehlte mir auch einfach nur die traumatische Kindheit von X oder der gestörte Geist von Y. Ich tröstete mich damit, dass Goethe ein behütetes Bürgersöhnchen gewesen ist und trotzdem ganz ordentliches Zeug geschrieben hat.
Das Praktikum meiner Frau ging zu Ende, danach schrieb sie ihre Masterarbeit. Ich saß immer noch in der Bibliothek. Danach kam der Hammer: Sie bekam ziemlich fix einen festen Job in einer dieser schicken internationalen Hilfsorganisationen, wo die Leute den ganzen Tag Englisch sprechen und mit Laptops und PowerPoint-Präsentationen zu Meetings über die Flure flitzen. Da ging sie hin und ward nicht mehr gesehen. Morgens war sie um halb neun weg, abends kam sie um halb neun wieder, und dazwischen lagen viele lange Stunden, in denen ich mir so richtig nutzlos vorkam.
Es musste etwas geschehen. Mit mir.
Und so trete ich eines Tages aus dem Torbogen über dem Eingang der Staatsbibliothek Unter den Linden, die ich zu meinem Büro erklärt habe, und lasse meinen Blick über die Straße schweifen. Da fallen sie mir ins Auge: die bunten Fahrräder. Zehn, zwanzig … Schon oft habe ich sie gesehen, aber noch nie sind sie mir so aufgefallen wie in diesem Moment. Immer sehen sie nett aus, die Leute, die da drauf sitzen. Immer sehen sie jung aus. Braungebrannt.
Das Ganze sieht easy aus und free und frei – und schwupps, habe ich eine E-Mail geschrieben an den Laden mit den bunten Fahrrädern. Ich schwafele von meinen »Jahren als Lehrbeauftragter für Medienkommunikation« an der Technischen Universität Berlin (es waren vier Semester) und meinem »Geschichtsstudium«, das fast zwanzig Jahre zurückliegt.
Und so sitze ich eines Morgens Esther gegenüber. Esther ist die rechte Hand des Chefs von Colorful Bike Rides, dem wahrscheinlich größten Anbieter fremdsprachiger Touren in Berlin. (Wobei sie auch deutsche Touren haben.) Esther sieht aus wie die Personalberaterin eines DAX-Unternehmens: perfekt geschminkt, grau-schwarze Klamotten, akkurat frisiert. Umso merkwürdiger, dass wir uns in eine Ecke in dem Laden quetschen. Einem Laden, der so mit Fahrrädern vollgestopft ist wie … ja, wie der Zaubererartikelladen bei Harry Potter. Hier hocken wir, und umweht vom Geruchsgemisch aus Kettenschmiere, Bratwurst und Esthers dezentem Parfum absolvieren wir ein Einstellungsgespräch.
Ich komme mir vor, als würde ich mich für wer weiß was bewerben. Dabei habe ich in meiner Biographie schon ein paar Stationen stehen, die deutlich bedeutender sind als dieser Guide-Job: Redakteur beim Fernsehen, Radiomoderator, Krankenwagenfahrer. Aber ich bin plötzlich so nervös, als ginge es um mein Leben.
Na und? Es geht ja auch um mein Leben.
Denn ich habe meinen Lebenssinn verloren. Ich fühle mich nur noch wie ein vor sich hin kritzelndes Etwas. Ich bin von morgens bis abends allein. Und zwar mit meinen Dämonen. Meine Frau hingegen hat eine Visitenkarte, auf der Supervising SeniorProject Coordinator oder so etwas steht!
Ich habe gar keine Visitenkarte und muss trotzdem noch dreißig, vierzig Jahre rumkriegen. Und diese Romanschreiberei ist in dieser Hinsicht nicht so richtig vielversprechend. Schon allein der Plot: Mittvierziger aus der Provinz sieht nach Jahrzehnten seine Jugendliebe wieder und fragt sich, warum er damals Schluss gemacht hat, verliebt sich in die junggebliebene Mutter der Verflossenen und deren Vater sich in ihn. Viele dramatische Coming-out-Szenen sind geplant, entpuppen sich aber als irgendwie triefend melodramatisch, wenn sie erst einmal ausformuliert sind.
Immer öfter, Tag wie Nacht, bespringt mich wie ein kleines, gieriges Äffchen die Angst: Bin ich auch nur einer dieser vielen Hipster, die diese Stadt bevölkern mit ihren Träumen und Schäumen und Bärten und Brillen? Muss ich eines Tages einsehen, dass ich es nicht geschafft habe in Berlin? Muss ich zurück an meine Geburtsstätte – nach Lüdenscheid, die Stadt, wo es öfter und länger regnet als in Irland? Ob meine Frau dorthin mitkommt …?
Ich möchte am liebsten vor Esther auf die Knie fallen und schreien: »Rette mich! Rette mich! Gib meinem Leben einen Sinn.«
Schließlich spricht sie die erlösenden Worte: »Du kannst die deutschen Segway-Touren machen. Am besten, du fährst eine Tour mit Jerome. Er ist unser Bester.«
Die erste Tour
Man stelle sich einen Fakir vor mit Bart und Nickelbrille. Dann packe man ihm einen Fahrradhelm auf den Kopf und stelle ihn auf einen Segway. Fertig ist Jerome.
Ich gehe zu ihm hinüber. »Hi, ich bin Christian. Esther hat gesagt, ich soll mit dir mitfahren, weil ich jetzt die deutschen Touren mit den Segways mache.«
Er reicht mir die Hand. Ein Händedruck wie ein Salatblatt. Pampig, mit schnarrendem britischen Akzent, erwidert er: »Deutsche Turren? Die gibsso gannick.«
Ich halte die Klappe. Was weiß der denn schon?
Jerome wedelt mit einer seiner Salatblatthände zum Laden rüber. »Okay, Honey, dann hol mal die Helme.«
Ich gehe in den Laden, hole eine riesige, doppelreihige Kleiderstange, die mit Fahrradhelmen vollgehängt ist, und rolle sie unter einen der Stempel des Fernsehturms, der mit seinem in den Beton gerammten Dreieck eine Art Grotte bildet.
»Wonderful, dear«, sagt Jerome, ohne es wirklich zu meinen, denn er ist ein waschechter Szene-Schwuler: eiskalt, berechnend und durch tausendfache Machtspielchen und Demütigungen unter schwulen Männern gestählt und poliert. »Holst du bitte« – sein »bitte« klingt wie ein Peitschenhieb auf meinen Hetero-Arsch – »den Tisch?«
Natürlich, Meister, ich hole den Tisch.
Das Umfeld, in dem die Touren stattfinden, ist schnell skizziert: Es gibt zwei Läden von Colorful Bike Rides, in denen Fahrräder verliehen und Touren angeboten werden, und zwar in verschiedenen Sprachen: auf Englisch (da sind unsere Jungs wohl Marktführer), auf Spanisch und auf Deutsch. Es gibt bei Colorful Rides Touren mit Segways und mit Fahrrädern, wobei sie eine lange und eine kurze Segway-Tour anbieten, aber fast unendlich viele verschiedene Fahrradtouren: von Überblickstouren über Mauer-Touren bis zu Third-Reich-Touren – und natürlich Klassenfahrtstouren und Privattouren. Die Standardtouren sind, nun ja, standardisiert: Die fremdsprachigen starten alle am Fernsehturm (wie die von mindestens drei Konkurrenzanbietern auch), die deutschsprachigen Radtouren am Bahnhof Zoo. (Auch da startet ein gutes halbes Dutzend anderer Touren.) Die deutschsprachigen Segway-Touren starten wiederum am Fernsehturm. Das alles ist logistisch sehr ausgeklügelt.
Es gibt in diesem riesigen Geschäftsfeld Einzelkämpfer, kleine Historikergrüppchen, Vollprofis und eben mittelständische Unternehmen wie zum Beispiel CR (Colorful Bike Rides), Berlin on Bike, Berlin by Bike, Fahrradtouren.de, Berlin Sights und und und. Manche Unternehmen betreiben primär einen Fahrradladen – mit allem, was dazugehört: Werkzeug, Werkstatt, Helme, Fahrräder natürlich – und sind zusätzlich noch Tourenanbieter. Das ist ungefähr so, wie wenn ein KFZ-Schrauber auch noch Chauffeur wäre. Bei CR gibt’s neben den Touren nur Räder, Getränke, Postkarten und Merchandising. Manche Tour-Anbieter sind auch an ein Hostel angeschlossen. Daneben gibt es Einzelkämpfer, die sich jeden Tag mit ein paar Rädern an einen der touristischen Orte stellen.
Colorful Bike Rides am Fernsehturm hat einen winzigen Laden und unfassbar viele Fahrräder. In den Läden, die bei so einem US-amerikanischen Unternehmen, wie CR eines ist, natürlich Shops heißen, arbeiten die »Shoppys«.
Die Shoppys sind eine besondere Sorte Mensch. Sie sind Expats. Das sind so genannte Expatriierte. Was für den jungen Hemingway in den Zwanzigern Paris war, das ist Berlin heute für Tausende von Amerikanern, Australiern, Spaniern, Katalanen und Kanadiern. (Hab ich wen vergessen?) Sie kommen, um etwas zu erleben – ach was: um die Erfahrung ihres Lebens zu machen. Um berühmt zu werden! Um eine goldene Jugend zu erleben – eine, von der sie für den Rest ihres Lebens schwärmen können! Wegen der Drogen, wegen des Sex, wegen der Musik, wegen der Gefahren und wegen alldem, was sie sich sonst so alles unter Berlin vorstellen.
Sie kommen von weit her, nur um hier zu sein, und stemmen dafür auch schon mal bei 30 Grad nach zehn Stunden Maloche noch 150 Fahrräder über Kopfhöhe an Deckenhaken. Denn die Läden bei CR sind nicht nur vollgestellt, sie sind auch vollgehängt. Mit Rädern. Und die müssen vom Personal abends, nach einem langen Tag, an die dort angebrachten Haken gehängt weden.
Das Personal von CR besteht neben anderen aus folgenden sehr unterschiedlichen Personen:
Kurt – ein schwuler Texaner, der sich langsam in der CR-Hierarchie hocharbeitet und irgendwann eine eigene Stadt von Stu bekommen wird. (Stu ist einer der vier Gründer – wörtlich »Owner« – von CR Europe.)
Margo – eine wunderschöne Hexe aus Schweden, die keiner versteht (weder was sie sagt, noch wie sie es ausspricht), aber das ist egal, man ist ja im Urlaub.
Carl – ein verschlagener Halbfranzose, der immer wieder bei Colorful Rides landet, obwohl er dauernd was Richtiges arbeiten will.
Adam – ein total verpeilter Philosoph aus Australien, blass wie eine Kalkleiste und schlacksig wie eine Marionette.
Gary – in wenigen Sätzen nicht zu beschreiben.
Esther – schick und tough und bald nach meinem Unternehmenseintritt nach Südamerika geflohen. Vielleicht organisiert sie da den Aufbau von CR Buenos Aires und São Paulo. Das würde zu ihr passen.
Ryan – eine irischstämmige Amerikanerin, die morgens aussieht wie eine Kindergärtnerin und abends so, als habe sie den ganzen Tag bei Braveheart mitgespielt, was irgendwie auch stimmt. Es gibt kein Mädchen in ganz Berlin, dem Fahrradschmiere im Gesicht so gut steht wie Ryan.
Hinzu gesellen sich jede Menge saisonaler Kräfte aus den USA, Kanada, UK usw., die kommen und gehen.
Und dann ist da noch Jerome.
Jerome legt auf einige Dinge ganz gesteigerten Wert:
– Er ist aus London.
– Er trinkt nicht.
– Er raucht nicht.
– Er nimmt keine Drogen.
– Er ist »der beste Guide, den Stu hat« (laut Jeromes eigener Aussage).
Stu ist, nebenbei gesagt, ein netter Typ, der so lange kumpelig ist, bis man ihm doof kommt. Dann erfährt man von ihm genau, wo der Hammer hängt. Das unterscheidet ihn angenehm von den ganzen Möchtegerngründern dieser Stadt. Stus rechte Hand heißt Zack. Die beiden haben es mit harter Arbeit, die immer wie der größte Spaß aussieht, geschafft, ihren Laden zu einem der bedeutendsten in Berlins Tourismusindustrie zu machen.
Berlin hat eine ähnliche Wirtschaftsstruktur wie Mallorca: 80 Prozent der Bevölkerung lebt vom Tourismus, 10 Prozent von Produktion. Weitere 65 Prozent von Dienstleistung. 20 Prozent sind in der Verwaltung beschäftigt, 35 Prozent im universitären Sektor, 98 Prozent in der Kulturbranche. Und weitere 70 Prozent der Bevölkerung lebt von irgendwelchen staatlichen Transferleistungen. Diese Statistik wiederum entspricht den mathematischen Fähigkeiten der Berliner Finanzverwaltung.
Die größten Feinde des Guides
1. Touristen
2. Lehrer
3. Schüler
4. Autofahrer
5. Radfahrer
6. andere Guides
7. Touristen anderer Guides
8. alle anderen
9. man selbst
10. das Wetter
Jerome behandelt alle Tourteilnehmer wie Kinder. Er sagt zu jedem »Dear« und »Honey« und beantwortet Fragen mit Sprüchen wie »Don’t be so phony« (was ungefähr so viel bedeutet wie »Erzähl doch nicht so ein geschraubtes Blech!«)
Eigenartigerweise nimmt ihm das niemand übel. Offenbar hilft es, dass er die Strategie eines Clowns fährt oder, noch besser, die eines Shakespearschen Narren. Er ist eine riesige Tunte von offensichtlich indisch-pakistanisch-tamilischer Herkunft und mit einem Sack voller Komplexe. Außerdem sind seine Tourteilnehmer allesamt nicht des Deutschen mächtig, größtenteils am Vortag angekommen und zum ersten Mal in Berlin oder zum ersten Mal in Deutschland oder gar zum ersten Mal überhaupt im Ausland, also zumeist außerhalb der USA. Ihnen ist alles suspekt, die deutsche Sprache klingt schroff und nach Kaserne, sie wittern hinter jeder Ecke Terroristen und Nazis und unter jedem Pflasterstein einen russischen Soldaten, einen Bunker oder die Eier des Führers.
Paradoxerweise ist es genau das, was sie wollen: Sie wollen un-be-fucking-dingt Terroristen, Nazis und den FÜHRER sehen.
Jerome gibt ihnen alles, was sie wollen. Nur ganz anders, als sie sich das gedacht haben. So wie King Lear von seinem Narren ja auch dauernd aufs Maul kriegt … Ungefähr so vollziehen sich Jeromes Stadtführungen: Der ehemalige Regierende Bürgermeister (»the Lord Mayor«) Klaus »Wowi« Wowereit wird von ihm ebenso als schwuchtelige Party-Schwuppe verkauft wie Hermann Göring. Am Reichsluftfahrtminister Göring interessiert Jerome vor allem dessen Morphiumsucht und seine Vorliebe für pompöse Phantasie-Uniformen. Alles andere ist sekundär. Auch bei Goebbels erwähnt Jerome vor allem dessen Liebesabenteuer mit UFA-Größen.
Selbst derartig rosa eingefärbtes Geschichtswissen ist manchen englischsprachigen Gästen schon zu viel, wie ich feststelle, als ich mit Jerome auf Tour bin. Mit dabei sind Bill und Stacey aus North Dakota. Sie maulen. Sie wollen keine »lessons«, sie wollen »sights and the Führer«. Jerome macht eine Geste, ungefähr so, wie man quengelnde Kinder zur Ordnung ruft. Ich wundere mich, dass Bill und Stacey sich das gefallen lassen. Dann fährt Jerome fort. Zugegeben recht elegant.
Einen überraschenden, wenn auch kurzen Ausflug in die wirklich lang vergangene Geschichte macht Jerome am Opernplatz, indem er Altbekanntes referiert: Berlin hat nichts mit Mittelalter oder Römern zu tun, denn da haben sich hier nur Fuchs und Hase herumgetrieben und irgendwelche Völker, die geschichtstechnisch nicht satisfaktionsfähig sind. Dann gurrt Jerome »Fridrick the Great« und wedelt mit der Hand von der Oper zur Jurafakultät und zur Sankt-Hedwigs-Kathedrale und ruft: »This, this, that – that not …« (Er meint das Hotel de Rôme.) »This, that and this also!« Er tupft seinen fleischigen Finger auf die Baustelle der Staatsbibliothek Unter den Linden, wo ich so viele quälende Stunden an meinem literarischen Großwerk ringe. »Each and everything by Freddy the Great, the greatest Emperor of Prussia – apart from the Führer, of course.«
Nachdem Jerome damit seine Pflicht in Sachen Architekturgeschichte erfüllt hat, kommt er wieder zum eigentlichen Zweck seiner Tour: diesen versammelten reichen amerikanischen Hinterwäldlern, diesen notorischen Republikaner-Wählern, ein für alle Mal klarzumachen, dass die gesamte deutsche Geschichte eine Ansammlung von schwülen und schwulen Sex-Anekdoten ist, die nur ab und an durch kriegerische Auseinandersetzungen und Genozide unterbrochen wurde.
Glenn raunt Laura aus Connecticut zu: »Where the fuck is the Führer?«
Jerome scheint das zu kennen und ignoriert es. Ich tue so, als hätte ich mit der Sache nichts zu tun.
Am Opernplatz schafft es Jerome, gleich zwei superschwule Lovestorys der preußischen Geschichte unterzubringen: Erst erklärt er die zweiflügelige Architektur der Uni (in der Mitte ein Gebäude, links und rechts ein Gebäude, wie bei jedem barocken oder Rokkokogebäude) damit, dass Friedrich der Vierte und seine Gattin sich aus dem Weg gehen wollten – weil der König auf Jungs stand. Dann kommt Jerome zu Katte. Leutnant von Katte war ein Kumpel des Kronprinzen Friedrich (dem späteren Alten Fritz). Weil der Soldatenkönig (also der Vater vom späteren Alten Fritz) ein harter Knochen war, wollte der junge Fritz abhauen. Leutnant von Katte wollte ihm dabei helfen. Die Sache ging gründlich schief, und der Soldatenkönig ließ von Katte, also den besten Freund seines Sohnes, vor dessen Augen enthaupten. Eine mindestens so großartige Story wie jene in Brokeback Mountain.
Fazit: Der Opernplatz, der Platz der Bücherverbrennung, das Forum Fridricianum – all das ist echter Gay Ground. Schinckel, der Erbauer der Neuen Wache? Schwul. Die Brüder Humboldt, die Namensgeber der Universität? Schwul. Friedrich? Schwul. Friedrich IV? Schwul. Der Lord Mayor? Der Erzbischof? Na was wohl …
Damit kommt Jerome zum Führer. Endlich. »The Führer!« Der, auf den die andächtig Lauschenden sehnlichst gewartet haben.
Das Problem an der Tour ist nämlich ihr Startpunkt im Verhältnis zur Ausdehnung der Stadt und der Trägheit der Tourteilnehmer. Denn am Anfang befinden wir uns am Alex, da gibt’s nur sozialistischen Realismus und kapitalistischen Pauperismus. Das will kaum einer sehen. Dann steht am ersten Tourstopp zwar der Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus, aber beides ist nicht aufsehenerregender als ein Schulgebäude in Neuengland – und sogar jünger! Wir Tourguides finden das auch nicht so toll und halten da nur, weil wir sonst zu lange mit Leuten auf Segways durch den chaotischen Verkehr kurven müssten – mit Leuten also, die zu dem Zeitpunkt der Tour noch null Fahrpraxis draufhaben.
Die nächsten Haltepunkte wurden uns von der Stadtplanung genommen: Das Marx-Engels-Forum? Komplett zugebaut. Der Palast der Republik? Gesprengt. Und das Schloss ist noch nicht fertig. Gendarmenmarkt? Ja, gut, da stehen gleich zwei hübsche Kirchen, aber das können die Franzosen eigentlich besser und die Italiener sowieso.
Aber was sollen wir machen? Man kann ja nicht direkt zum Holocaust-Mahnmal rauschen – auch wenn das vielen Ingenieuren aus Süddeutschland gefallen würde. Die buchen die Tour nämlich nur, weil sie die Segways nicht ohne Guide ausleihen können. Würden wir vom Alex bis zum Mahnmal volle Sahne durchstarten, würden sich diese ungeübten Leute spätestens auf halber Strecke den Hals brechen.
Nachdem Jerome die Rednecks also durch den Dschungel der Baustellen und schwulen Anekdoten geführt hat, stehen wir nun alle vorm Holocaust-Mahnmal. Es liegt da wie ein Friedhof mit sehr hohen Grabsteinen und ohne Inschriften, dazwischen nur gepflasterte Wege. Das ganze Areal ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Rundherum stehen Reisebusse. Die Friedhofsbesucher tragen allesamt bunte Klamotten, die deutschen Rentner Allwetterjacken, die Ausländer Basecaps. Jeder Friedhofsbesucher hat eine Kamera in der Hand. Auf den Stelen springen Schulkinder herum. Security-Männer und -Frauen versuchen, so diskret wie möglich (wie es Berliner Security-Leuten eben möglich ist, also nicht sehr diskret) den Schulkindern, ihren Eltern oder Lehrern klarzumachen, dass man nicht auf den Steinen herumspringen darf.
Jetzt knattert Jerome die Fakten des Holocaust-Mahnmals runter: zweitausendundhastdunichtgesehen Stelen, Lea Rosh, sechs Millionen Juden und und und. Natürlich vergisst er nicht, darauf hinzuweisen, dass es auch ein Mahnmal für die ermordeten Schwulen und Lesben Europas gibt und eines für die ermordeten Sinti und Roma Europas und eines für die ermordeten Euthanasie-Opfer Europas.
Die Rednecks halten diesmal den Mund, denn Jerome macht hier den Lunch Break (wie die Mittagspause bei ihm heißt). Das kulinarische Verbrechensviertel am Rande des Holocaust-Mahnmals preist er als »Germanys best foreign fast food« an: Türken, die auf Mexikaner machen, Inder, die auf Italiener machen, Palästinenser, die auf Spanier machen, Vietnamesen, die auf Chinesen, Koreaner, die auf Japaner, und Brandenburger, die auf Berliner machen. Alle sind überteuert, und alle verkaufen letztlich den gleichen Industriemüll – die einen mit Guacamole, die anderen mit Wasabipaste oder Aioli.
Ich gucke, was Jerome macht: Er setzt sich auf eine Treppenstufe und holt eine Tupperware raus. Drin ist irgendetwas, was er selbst gemacht hat. Curry oder so. Der weiß, was er tut. Ich hingegen schaffe es, mir den Magen an einer Laugenbrezel zu verderben. Das geht, wenn man meint, sich am Holocaust-Mahnmal eine Laugenbrezel mit Cola Zero gönnen zu müssen.
Nach verzehrtem Mittagsmahl sammelt Jerome seine Schäfchen ein wie eine Grundschullehrerin ihre Erstklässler. Da kommt auf einmal Glenn mit hochrotem Kopf auf Jerome zu. »Du hast mich krank gemacht«, stöhnt er auf Englisch.
Jerome kaut noch immer auf seinem Curry herum und schaut ungerührt einmal von oben nach unten und zurück Glenns Körper an, so wie nur schwule Männer einen Körper taxieren können. Jeromes Blick sagt: Du bist eine beschissene Hete. Fett und hässlich. Dich würde ich nicht mal vögeln, wenn du der letzte Mann auf Erden wärst. Jeromes Stimme aber sagt: »Okay, man, what’s up?« Uuupssala, denke ich – unser Jerome kann ja tatsächlich auch klar und straight und trocken auftreten.
Das haut Glenn von den Socken. So scheint es jedenfalls, denn er fällt in sich zusammen, weil seine Beine nachgeben wie Zuckerstangen in der Sonne. Er sinkt zu Boden, kann seinen fetten Körper mit den dünnen Ärmchen nicht abstützen, sackt zur Seite. Jerome und ich springen hin und fangen gerade noch seine Omme ab, bevor er damit auf eine Kante klatscht.
Ich lege Glenns Füße hoch. Stacey kommt dazu, die anderen auch. Alle flippen rum.
Hysterie. Die Tour ist gelaufen. Die Amis haben sich miteinander verbündet und wollen nur noch weg von hier. Jerome zuckt mit den Achseln.
Ich rufe im Laden an. Sie schicken Lonny und Stephan aus der Werkstatt, um die Segways hier abzuholen. Jerome nimmt eines und fährt drauflos, ein weiteres führt er an der Hand. Jeder transportiert also zwei von den Dingern durch den Berliner Verkehrswahnsinn. Ich muss zum Glück nicht mitmachen und besteige stattdessen mit den Amis ein Großraumtaxi und fahre zurück zum Fernsehturm. Auf dem Rücksitz erholt sich Glenn wieder ein bisschen. Er quatscht die ganze Zeit davon, dass er uns verklagen wird, weil wir seine Beine »ruiniert« hätten. Stacey sieht mich dabei entschuldigend an. Die anderen schweigen und nicken. Wem sie zustimmen, also Glenn oder Stacey, weiß ich nicht. Ich nicke auch. Als sie aussteigen, geht es Glenns Beinen wieder besser.
Später sitzen Jerome und ich vor dem Laden. »That’s normal«, erklärt er, »… machen nie Sport oder so was, dann kommen sie hierher und denken, der Segway ist so eine Art Rollstuhl. Ist er aber nicht. Das ist fast so anstrengend wie Skifahren.«
Ich frage: »And where the fuck is the Führer?«
»Das, Honey, zeig ich dir beim nächsten Mal.«
Die erste eigene Tour
Meine erste Tour als Voll-Guide ist keine Segway-Tour, sondern eine Fahrradtour. Und auch nicht für Colorful Rides, sondern für einen anderen Anbieter, bei dem ich mich sicherheitshalber auch noch beworben habe. Es handelt sich um einen dieser Fahrradläden, die nicht genau wissen, ob sie neben dem Fahrradverkauf auch Touren machen oder ob sie Touren machen und nebenher auch Fahrräder verkaufen und Kinderwagen reparieren. Unentschlossenheit ist nicht gut fürs Geschäft. Meistens sind die Touren mies besucht – wenn sie überhaupt stattfinden.
Mein erstes Mal. Da verhält es sich mit Touren wie im Leben sonst auch: Man ist im Vorhinein ewig lang nervös, malt sich aus, wie alles wird, kriegt den Horror, was man alles falsch machen kann – und dann ist es schneller vorbei, als es angefangen hat.
Historiker, der ich bin, habe ich mich darauf vorbereitet, als stehe mir eine mündliche Prüfung an der Uni bevor: Zwei Wochen lang sitze ich zuvor in der Staatsbibliothek und schreibe Hefte voll mit den Geburts- und Sterbedaten von Herrschern, mit Zahlen der Einwohnerentwicklung, mit Kriegen, Schlachten, Verträgen, Namen von Generälen, Bauwerken, Architekten. Und warum? Damit mich nicht irgendein graumelierter spitzbärtiger Lehrertyp kalt erwischt mit Fragen wie: »Die Schlacht bei Lübzen – wie groß war die Armee der Österreicher da noch?«
Das Bekloppte am ersten Mal ist auch, dass man sich einbildet, alle anderen Guides wüssten genau, wie es geht, nur man selber nicht. Eine ähnliche Fehleinschätzung, wie Teenager ihr unterliegen. Dr. Sommer verdient damit seit Jahrzehnten sein täglich Brot.
Ich weiß jedenfalls nicht, woher diese perfektionistische Vorstellung kommt. Vielleicht vom Schreiben und Lesen? Oder vom Fahrradfahren? So etwas kann man ganz oder eben gar nicht. Ein bisschen können ist oft doof. Vielleicht denkt man deshalb als angehender Guide, die Touris kämen und hätten eine ganz genaue Vorstellung von solch einer Tour im Kopf. Bei mir war es jedenfalls so: Ich dachte, ich müsste eine Eins-a-Tour abliefern.
Wie gesagt ist der Tourenveranstalter, für den ich meine erste Tour fahre, nicht sonderlich erfolgreich mit seinen Tourangeboten. Das liegt an seiner Unentschlossenheit. Er weiß nicht, was er eigentlich sein will, aber auch daran, dass der Laden zwar ziemlich zentral in der Innenstadt liegt, dort aber ziemlich versteckt.
Es gibt bei allen Anbietern offene Touren. Das sind Touren, an denen man ohne Voranmeldung teilnehmen kann. Die offenen Touren dieses unentschlossenen Anbieters finden in drei Viertel der Fälle NICHT statt. Es kommt vor, dass man vorm Geschäft steht, die Sonne scheint, alles ist super, 21 Grad – und keiner kommt. Weil die Leute den Laden nicht finden. Und dann machen sie eben eine Bustour.
Meine erste Tour findet also nicht statt. Ich stehe zwanzig Minuten vor dem Laden und schaue erwartungsvoll, bin nervös. Schließlich wird es halb elf (was der Startzeitpunkt sein sollte), und keiner ist da, und um fünf nach halb ist auch keiner da, und als der Shoppy, also der Fahrradmechaniker mit den vielen Piercings im Gesicht, zum dritten Mal an mir vorbeigeht und leise den Kopf schüttelt, komme ich mir vor wie ein Schüler beim Blind Date, wo sie nicht kommt und die ganze Klasse hat’s gesehen.
Um zwanzig vor packe ich meine Sachen und rufe in den Laden: »Ich bin weg.« Ich versuche, ganz tapfer zu klingen und cool und unbeteiligt – so wie man in Berlin eben zu klingen hat, egal ob man gerade eine in die Fresse gekriegt oder den Jackpot gewonnen hat. Auf dem Weg zur Staatsbibliothek (wo ich zum »Trost« eine oder zwei Seiten an meinem Roman schreiben will) fühle ich mich wie eine Klorolle, die in eine Pfütze gefallen ist. Wem soll ich jetzt all die schönen Fakten an den Kopf werfen?
Aber man sieht sich immer zweimal im Leben. Drei Tage später rolle ich endlich mit Ute und Ingo vom Hof. Ich habe mir vorgenommen, ein mustergültiger Guide zu sein, habe die Klingeln und Bremsen erklärt, habe erläutert, dass man nicht parallel zu den Straßenbahngleisen und ebendiese in spitzem Winkel überfahren soll. Ich mache unheimlich korrekte Handzeichen mit dem ganzen ausgestreckten Arm zum Abbiegen, als hätte ich zwanzig Leute hinter mir und nicht zwei und als ob die noch nie gehört hätten, dass Fahrräder Handbremsen haben und keinen Rückwärtsgang. Ich bemühe mich, dieses unangenehme Gefühl zu verdrängen, dass die Stimme hervorruft, die in meinem Schädel keift: »Es sind nur zwei. Zwei! Das lohnt sich nicht. Die anderen sind nicht gekommen, weil du ein Anfänger bist. Du kannst es nicht.«
Ich ignoriere die Stimme und konzentriere mich auf meinen Text für die erste Station. Irgendwer – vielleicht ich selbst? – hat mir eingeredet, Touristen hätten ein Recht darauf und auch die Erwartung, Geschichte in chronologischer Reihenfolge präsentiert zu bekommen. Noch ist mir nicht klar, was mir bald klar sein wird: nämlich, dass weder die Tour-Organisatorin (eine 400-Euro-Jobberin) noch der Besitzer des Ladens (der sich in erster Linie für den Verkauf hochpreisiger Pedelecs interessiert) mich kontrolliert und dass die Touris sich vor allem amüsieren wollen. Weil ich das aber noch nicht weiß, rolle ich mit Prüfungsangst vorneweg und mit einem Kloß im Hals, der immer dicker wird, je näher wir der Stelle im Stadtgeschehen kommen, wo ich die erste urkundliche Erwähnung der Doppelstadt Berlin-Cölln verkünden will.
Mein größtes Problem in dem Moment ist, die beiden hinter mir könnten denken, die Strecke zwischen dem Fahrradladen und der kleinen Brücke, die vor vielen hundert Jahren der Eingang zur Stadt war, sei zu lang. Ich ahne nicht, dass die meisten Leute gerade deswegen eine Radtour buchen, weil sie unheimlich gern radeln, und dass man das reine Radeln durch diese faszinierende Stadt schon als Erlebnis an sich verkaufen kann.
Nun aber stehen wir an der Schleusenbrücke, wo ich Ingo und Ute mit Jahreszahlen zumülle, als gäbe es kein Morgen. Ich werfe mit den Namen von Bürgermeistern um mich, mit Schlachten und architektonischen Fachbegriffen. Ähnliches wiederhole ich an den folgenden Stationen, das Ganze über dreieinhalb Stunden hinweg. Als Ute irgendwann etwas ermattet zu mir sagt: »Irre, was du dir alles merken kannst«, nehme ich das als Kompliment. Bis mir anhand ihres glasigen Blicks dämmert, dass ich jetzt langsam aufhören könnte. Aber es ist eben mein erstes Mal …
Die besten Freunde des Guides
Im Alltag des Guides geht es vor allem darum, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Dafür hat er hilfreiche Freunde, und zwar in aufsteigender Reihenfolge:
10. Friedrich der Große (Hat schöne Sachen bauen lassen und war irgendwie so mysteriös, dass man stets gut über ihn reden kann.)
9. die Barbour-Jacke (Als Allwetterjacke stilistisch ungeschlagen: Man setzt sich mit ihr deutlich von modernen Outdoorjacken ab; alle mögen sie, die Reichen halten einen für einen der ihren, die normalen Leute finden einen cool.)
8. das Wetter (Wenns regnet, geht man rein, wenns nicht regnet, fährt man rum; es ist immer gut für ein Gespräch und als Entschuldigung für alles Mögliche zu gebrauchen.)
7. Holländer (Sind stets gutgelaunt, die Frauen sind hübsch und patent; sie verstehen Deutsch, haben aber keine Holocaust-Neurosen und wissen im Gegensatz zu den Deutschen nicht alles besser, bloß weil sie dreitausend Stunden lang Guido Knopp geguckt haben.)
6. Schweizer (Sind immer nett, machen alles mit, sind gebildet, haben ebenfalls keine Holocaust-Neurose und geben immer reichlich Trinkgeld.)
5. die Geschichte (Ist ein unerschöpflicher Fundus guter Geschichten, deshalb heißt sie auch so.)
4. der Sonnenuntergang (Gnädigerweise vollzieht sich dieser im Westen – und die historische Mitte Berlins liegt im Osten. Das heißt, während man von lauter altem Gemäuer umgeben ist, geht hinter dem Brandenburger Tor und der Siegessäule die Sonne unter. Das kann sehr theatralisch sein. Deshalb ist es ratsam, seine Tour nicht nur mit Faktenhuberei zu bestreiten. Hanni, Anni und Fanni, drei Hühner aus Bad Aibling, haben sich beispielsweise schier nicht mehr eingekriegt, denn selbst der ungeübteste Fotograf kriegt hier bei Sonnenuntergang Hammerbilder hin.)
3. die vielen Erfinder und Entwickler des Fahrrads
2. die Motorradstaffel der Polizei (Kommt besonders gut bei Briten an, wahrscheinlich wegen ihres YMCA/Frankie-goes-to-Hollywood-Stils: Die Berliner Moto-Bullen haben folgenden Dresscode: weiße Uniformen, weiße Lederhandschuhe, die im Greta-Garbo-Style fast bis zu den Ellbogen reichen, weiße BMW-Motorräder und weiße Helme, zu denen die meisten Ray-Ban-Pilotenbrillen tragen. Die Bullen selbst sind bullig wie Türsteher und cool wie Eisbärpisse, rasen mit achtzig über die Straßen und gucken gemein.)
1. The one and only: Adolf Hitler
Deutschland, uneinig Vaterland
Deutschland ist gar nicht so klein, wie man manchmal denkt. Man merkt es an seinen vielen Stämmen zwischen Nord, Süd, Ost und West, und daran, inwiefern sie sich unterscheiden – zum Beispiel als Touristen.
Westfalen
Westfalen etwa geben kein Trinkgeld. Sie quatschen einem dauernd dazwischen und erzählen Zeug wie: »Als ich in den Achtzigern hier war, da stand da ein riesengroßes Gerüst, eine Aussichtsplattform.« Mit diesen Worten weisen sie aufs Brandenburger Tor und kommen sich wer weiß wie klug vor.
Manche Leute rücken in der Mittagspause mit ihren ganz besonderen, zum Teil intimen Erfahrungen raus. Das ist nicht immer schön. Westfalen hingegen trompeten einfach alle ihre Allerweltsbeobachtungen in die Landschaft – das ist fast noch schlimmer. Nichts ist ihnen trivial genug. Die Westfalen sind der Grund dafür, dass ich nicht mehr mit der S-Bahn zu den Touren fahre, sondern mir einen Motorroller gekauft habe. Früher musste ich samstag- oder sonntagmorgens um halb zehn aus der S1 an der Friedrichstraße in die Ost-West-S-Bahn zum Bahnhof Zoo umsteigen. Sobald der Zug sich in Bewegung setzte, hob irgendein Westfale bedeutungsvoll den Zeigefinger. »Da, der Reichstag!« Er zeigt auf den Reichstag. »Da, das Kanzleramt.« Er zeigt auf das Kanzleramt. »Da, der Potsdamer Platz.« Und so weiter. Leider stehen entlang der Stadtbahn sehr viele Sehenswürdigkeiten – die jeder längst kennt.
Ja, jeder, Westfale! Kannst du nicht einfach mal die Klappe halten? Hier wollen Leute Zeitung lesen oder in Ruhe wach werden – unter anderem welche, die dir gleich erklären müssen, dass das der Reichstag ist und das der Potsdamer Platz.
Hamburger
Fast alle Deutschen können damit leben, dass Berlin die größte Stadt des Landes ist und die meisten Einwohner hat und die größte Ausdehnung. Selbst Bonner können inzwischen damit leben, dass hier der Sitz der Regierung und ein Großteil der Ministerien liegt und nicht in ihrem Dorf am Rhein. Nahezu alle akzeptieren, dass es hier etwas durchgeknallt, dreckig, laut und schnell zugeht. Die meisten fahren danach wieder in ihr Provinzstädtchen und sind froh, dass sie nicht in Berlin leben müssen, aber jederzeit hinreisen können.
Alle außer den Hamburgern. Hamburger kommen einem mit ständigen Vergleichen – die sie fast alle verlieren.
Mitte Juni. Im Schlepptau habe ich zwei Lesben aus der Schweiz, die beide aussehen wie Oliver Bierhoff und gefragt haben, ob sie am Ende der Tour früher wegkönnen, weil CSD sei. CSD ist die Abkürzung für Christopher Street Day, eine Art Protestkundgebung gegen die Ausgrenzung von Homosexuellen. In Berlin ist der CSD so etwas wie der zweite Karneval. Der erste Karneval ist der Karneval der Kulturen. Der findet an Pfingsten statt. Alle möglichen Völker aus aller Welt zeigen dann ihre Tänze und spielen ihre Musik auf der Straße. Der dritte Karneval ist wesentlich kleiner und findet tatsächlich von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch statt. Diesen »richtigen« Karneval gibt es erst seit dem Umzug der Bundesregierung von Bonn nach Berlin. Die Abgeordneten und Beamten brachten seinerzeit ein paar Kölsch-Kneipen mit und fingen ganz klein mit Karneval an. Und da die Berliner fast noch lieber auf die Kacke hauen als Rummeckern, haben sie nach einigem Meckern mitgemacht – drum gibt es heutzutage sogar einen Rosenmontagsumzug.
Eine der beiden Schweizer Lesben fragt, ob das groß sei, dieser CSD.
Ich grinse: »Sicher. Ziemlich groß. Da gehen nicht nur Schwule und Lesben hin, sondern die halbe Stadt. Für Berliner ist das so eine Art Karnevalsersatz.«
»Ah.«
»Ist der größte CSD Deutschlands«, sage ich. Tatsächlich ist es sogar der größte der Welt.
Da schaltet sich die Hamburgerin ein: »Der in Hamburg ist aber auch groß.«
Ich: »Aha.«
Sie: »Auf der Reeperbahn.«
Ich: »Kann sein.««
Sie: »Vielleicht ist der sogar größer.«
Sind wir hier beim Schwanzmessen?, frage ich mich. »Ihr habt vielleicht die teureren Villen«, erwidere ich, »aber wir haben immer noch die größeren Partys.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.