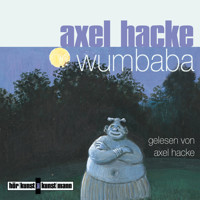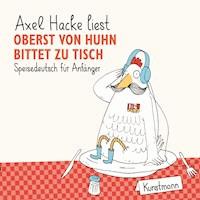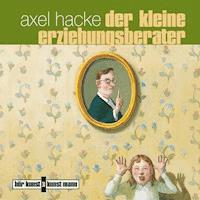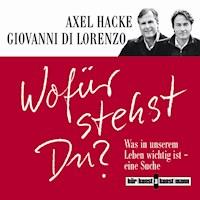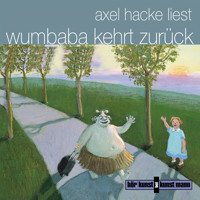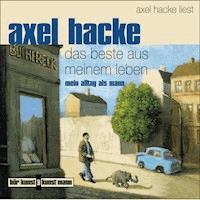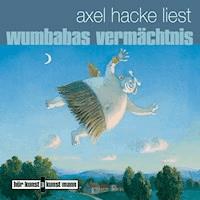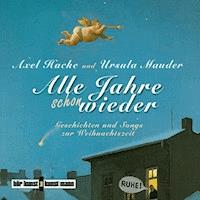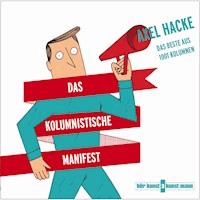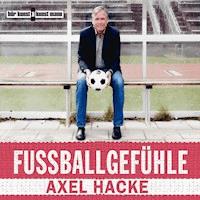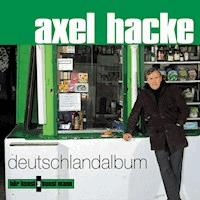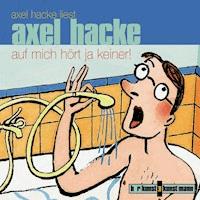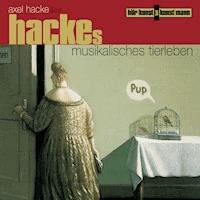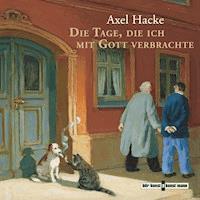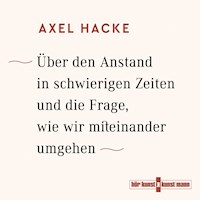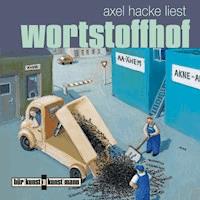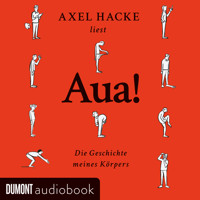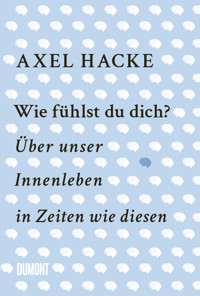
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie fühlst du dich? ist eine für unsere Zeit geradezu programmatische Frage. Denn ihre Beantwortung setzt die Fähigkeit voraus, Gefühle zu erkennen, sie zu reflektieren und über sie zu reden. In ›Wie fühlst du dich?‹ geht es um die Erkenntnis, dass man Gefühl und Vernunft nicht einfach trennen kann, vor allem aber um unsere Eigenständigkeit, um die Fähigkeit, sich zu wehren gegen jene, die uns so gern am Nasenring unserer Affekte durch die Welt führen würden. Überlassen wir unsere Gefühle nicht den Falschen, sondern fragen wir uns lieber selbst: Wie gehen wir mit der Angst um, die uns alle in Atem hält? Was ist mit der Verbundenheit zu anderen, nach der wir alle suchen? Was tun gegen das Gefühl der Hilflosigkeit, der Wut? Darf ich hassen, andere verachten? Und was ist mit der Lebensfreude, dem Glück? Woher bekomme ich Hoffnung? Kurz gesagt: Wie können wir all das Wissen über unser Innenleben dazu nutzen, in diesen Zeiten den Kopf über Wasser zu halten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wie fühlst du dich? ist eine für unsere Zeit geradezu programmatische Frage. Denn ihre Beantwortung setzt die Fähigkeit voraus, Gefühle zu erkennen, sie zu reflektieren und über sie zu reden.
In ›Wie fühlst du dich?‹ geht es um die Erkenntnis, dass man Gefühl und Vernunft nicht einfach trennen kann, vor allem aber um unsere Eigenständigkeit, um die Fähigkeit, sich zu wehren gegen jene, die uns so gerne am Nasenring unserer Affekte durch die Welt führen möchten.
Überlassen wir unsere Gefühle nicht den Falschen, sondern lernen wir lieber selbst, wie sie entstehen, was sie beeinflusst und wie sie unser Leben und die Welt verändern können.
© Matthias Ziegler
Axel Hacke lebt als Schriftsteller und Kolumnist des Süddeutsche Zeitung Magazins in München. Er gehört zu den bekanntesten Autoren Deutschlands, seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Für seine Arbeit wurde er u. a. mit dem Joseph-Roth-Preis, zwei Egon-Erwin-Kisch-Preisen, dem Theodor-Wolff-Preis und zuletzt dem Ben-Witter-Preis 2019 ausgezeichnet. Weitere Lebensläufe unter: www.axelhacke.de
Axel Hacke
Wie fühlst du dich?
Über unser Innenlebenin Zeiten wie diesen
Von Axel Hacke sind bei DuMont außerdem erschienen:
Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte
Aua! Die Geschichte meines Körpers
E-Book 2025
© 2025 DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Gehirn: rawpixel.com/Freepik
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-7558-1134-3
www.dumont-buchverlag.de
Für Ursula
Wie fühlst du dich?
Fangen wir mal so an: Ich habe schlecht geschlafen.
Das habe ich zuerst auf den grünen Tee geschoben, den ich nachmittags gegen meine Gewohnheit und in größerer Menge getrunken hatte. Normalerweise nehme ich nachmittags nur einen Kaffee zu mir, auch zwei. Aber nun hatte ich von einer Studie gelesen, deren Ergebnis war: Menschen, die nur vormittags Kaffee trinken, nicht am Nachmittag, haben eine höhere Lebenserwartung. Fragen Sie mich nicht, warum.
Und weil ich gern eine höhere Lebenserwartung hätte, beschloss ich, auf der Stelle ab zwölf Uhr keinen Kaffee mehr zu trinken, sondern nur noch grünen Tee. Der ist steingesund, das wissen wir alle. Meine Lebenserwartung wird weiter nach oben schießen, dachte ich. Wobei: Ich weiß gar nicht, wie hoch genau sie gerade ist, was seltsam ist, denn ich müsste doch der Erwartende sein, also Bescheid wissen.
Oder hat hier noch jemand Erwartungen mich betreffend?
Egal jetzt. Als ich nachmittags müde wurde: halber Liter Tee, Hashiri Shincha Tanegashima Shuntaro. Ich bestelle den im Internet, er kommt aus Japan, ziemlich teuer, aber auch erste Qualität, ohne dass ich davon viel verstünde. Ich schließe das einfach aus dem Preis. Ohne chemische Pflanzenschutzmittel angebaut, »butterzartes, leicht suppiges Umami, Grassüße, frisch vegetal in Folgeaufgüssen«. Das schmecke, wer will. Zum Folgeaufguss ist es nicht gekommen. Aber eben dazu, dass ich nicht schlafen konnte.
Später in der Nacht dachte ich dann, der schlechte Schlaf könnte seinen Grund darin haben, dass ich vor dem Einschlafen oder eben vor dem Nicht-Einschlafen (ich schlafe normalerweise sehr gut ein, Augen zu und weg) die erste Folge einer amerikanischen Serie namens American Primeval gesehen hatte, deren Realismus in dem Sinne gepriesen wurde, dass sie die Gewaltgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika glaubwürdig schildere. Kann ich jetzt bestätigen.
Allein in der ersten Folge wurden Menschen reihenweise erstochen, erschossen und aufgehängt plus die ungezählten Opfer eines Massakers gezeigt, in dem Pfeile eine große Rolle spielten. Einer jungen Frau schaute plötzlich eine Pfeilspitze zur Stirn heraus, der Schuss war von hinten gekommen. Auch eine Skalpierung kam vor. So was hatte ich zuletzt bei Karl May gelesen.
Jedenfalls gingen mir die Bilder nicht aus dem Kopf. Normalerweise schaue ich solche Serien nicht, weil ich mein zartes Gemüt zu schützen versuche. Ich lag noch eine Weile herum und sah im Dämmer Pfeile in Frauenköpfe eindringen. Wer soll da in den Schlaf finden, amerikanische Gewaltgeschichte hin, amerikanische Gewaltgeschichte her? Mir reicht die Gegenwart dort drüben, tagsüber. Aber dann geschah noch etwas.
Ich dachte daran, dass ich mit diesem Buch hier anfangen müsste. So ein Gedanke ist, ehrlich gesagt, der schlimmste Wachhalter überhaupt. Kaffee, Tee, Pfeilspitzen, Gewaltgeschichte, Gewaltgegenwart – das kann man alles vergessen gegen den Gedanken, endlich mit einem Buch anfangen zu müssen.
Lange Zeit habe ich das Schreiben vor mir hergeschoben. Ich muss noch dieses lesen, hatte ich gedacht, jenes recherchieren, über was anderes nachdenken. Aber jetzt: Etwas sagte mir, dass die Zeit des Verschiebens vorbei war. Was war das? Wer sagte das?
Mein Gefühl.
Das klingt nett, nicht wahr? Dass in mir etwas wohnt, das man Gefühl nennt und das mit mir spricht. Ich mag das. Aber woher kommt dieses Gefühl? Sehen Sie, das ist so eine von den Fragen, um die es hier gehen soll. Ich komme darauf zurück.
Mein Gefühl also sagte mir, dass, wenn ich jetzt nicht anfinge mit diesem Buch, Panikzustände auftreten würden, nach dem Motto: Jetzt ist es zu spät, du kannst es nicht mehr schaffen, du stehst vor einer Wand, die nicht zu erklettern ist. Leg dich hin und werde in Ruhe verrückt!
Ohnehin hatte ich Angst vor dem Buch. Dass es zu groß für mich sein könnte. Dass andere es besser machen würden. Dass ich es nicht schaffen würde und so weiter. Ich kenne diese Zustände seit Jahrzehnten. Aber diesmal kam ich mir vor wie jemand, der zu einer Antarktis-Wanderung aufgebrochen ist und nach fünfzig Kilometern merkt, dass er nur mit einer Badehose und Flip-Flops bekleidet ist.
Es reicht nicht, war der Gedanke, du kannst es nicht. Es ist zu weit, zu kalt, du bist zu schlecht vorbereitet. Überhaupt bist du zu schwach. Außerdem sind dir schon Körperteile abgefroren, merkst du das nicht?
Ich kenne das, wie gesagt. Ich habe allerdings auch gelernt: Das Gefühl von Selbstzweifel gehört zu mir wie die Farbe meiner Augen. Ich kann das nicht ändern. Und weil das so ist, sollte ich es am besten in mein Leben integrieren und nutzen für das, was ich tue. Zum Beispiel: nichts von dem, was ich schreibe, als Verkünden von Gewissheiten, sondern als offenen Prozess verstehen, als Gedanken, die nichts als eine Anregung sein sollen, die man weiterdenken kann und denen man widersprechen kann und sollte.
Ist er nicht interessant, dieser Satz? Mein Gefühl sagte mir …
Ich hätte sagen können: Ich dachte plötzlich … Oder: Da tauchte der Gedanke auf, dass …
Aber nein. Mein Gefühl sagte mir.
Ich fühle, also bin ich
Geht man der Frage nach, ob ich etwas dachte oder es fühlte, landet man bei Erkenntnissen über den Zusammenhang von Gedanken und Gefühlen, zum Beispiel bei dem Satz: »Gefühle und Verstand sind nicht die Gegner, zu denen wir sie in unserer abendländischen Kultur gemacht haben. Vielmehr arbeiten die Gefühle und der Verstand meist Hand in Hand.« So formuliert es der Wissenschaftsjournalist Bas Kast in seinem Buch Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft. Gefühle, so Kast, leiten uns durchs Leben, sie unterstützen den Verstand bei Entscheidungen, sie helfen uns zu überleben. Angst mahne zur Vorsicht, Ekel zur Hygiene, Hoffnung lässt uns morgens aufstehen.
Der Gegensatz, auf den der Autor anspielt, geht auf René Descartes zurück. Der formulierte 1637 einen der berühmtesten Sätze in der Geschichte der Philosophie, zunächst auf Französisch: Je pense donc je suis, dann 1641 lateinisch: Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Er begründete damit den Rationalismus, mit dem menschlichem Denken der Vorrang vor allen anderen Erkenntnisquellen gegeben wurde. Wissen, so Descartes, sei das Ergebnis von Vernunft, nicht (wie man bis dahin dachte) vom Grübeln über Gottes Willen, den umzusetzen der Daseinszweck des Menschen sei.
Das war damals ein revolutionärer und befreiender Gedanke.
Geist und Körper waren in Descartes’ Vorstellung getrennt: Das Denken fand unabhängig von den physischen Gegebenheiten des Denkenden statt. Und Gefühle oder Affekte (Leidenschaften nannte er sie in seinem 1649 erschienenen Werk Die Leidenschaften der Seele) hatten dort nichts zu suchen. Menschen entscheiden rational, so die These, die sich für Jahrhunderte in den Köpfen einnistete.
Wenn heute vom kühlen Kopf die Rede ist, mit dem Entscheidungen getroffen werden müssten, oder wenn ein Mann ratlos zu seiner Frau sagt Du bist viel zu emotional, dann steckt diese Vorstellung dahinter: dass Rationalität unser Leben bestimmt und bestimmen muss. Gefühle und Vernunft sind in diesem bis heute in uns fortwirkenden Denken wie Feuer und Wasser. Unsere politischen und wirtschaftlichen Systeme beruhen auf dieser Grundannahme: Menschen sind in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen und ihre Emotionen im Griff zu haben. Es sei denn, der Dampftopf in ihrem Inneren kocht mal über, oder sie sind generell nicht ganz frisch im Oberstübchen.
So ist es aber nicht.
Descartes’ Idee trat Ende des vergangenen Jahrtausends der portugiesisch-amerikanische Neurowissenschaftler António Rosa Damásio entgegen. Ich fühle, also bin ich und Descartes’ Irrtum heißen wichtige, schon in ihren Titeln pointierte Bücher von ihm.
Damásios Thesen beruhten auf Fällen, bei denen bestimmte Gehirnregionen von Patienten so geschädigt waren, dass sie in ihrer Entscheidungsfindung massiv behindert waren. Zusammen mit seiner Frau Hanna hatte er in den 1970er-Jahren das weltgrößte Archiv geschädigter Gehirne aufgebaut.
Ein Beispiel: Damásio war fasziniert von einem Patienten, der Elliot genannt wurde, ein erfolgreicher und ehrgeiziger Jurist und liebevoller Familienvater. Doch wurde bei ihm, direkt hinter der Stirn und oberhalb der Nasenhöhle, ein mandarinengroßer Tumor entdeckt und operativ entfernt, mitsamt erheblicher Teile des Frontalhirns, des Stirnlappens. Elliot hatte dabei nichts von seinem Wissen eingebüßt. Und doch war er nun ein anderer Mensch. Er war nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen, nicht mal einen Termin konnte man mit ihm noch vereinbaren. Er verlor sich bei der Arbeit in belanglosen Tätigkeiten, kam zu keinem Ziel und keinem Ende, ging erst seines Jobs verlustig, dann seiner Familie.
Damásio fiel vor allem Elliots kühles, distanziertes Verhalten auf. Als er ihn mit Bildern von Katastrophen konfrontierte, bei denen Menschen starben, blieb er so regungslos wie seinem eigenen Schicksal gegenüber. Es schien ihn nichts zu berühren, nicht mal sein eigenes Leben. Er hatte keine Gefühle mehr. Und obwohl seine Ratio nach wie vor funktionierte, war er unfähig zu einem eigenständigen Leben, weil ihm einfach die Emotionen fehlten, die uns offenkundig durchs Leben leiten.
Damásio verlegte – basierend auf diesen Untersuchungen – die Tätigkeit des menschlichen Geistes dorthin, wo sie tatsächlich stattfindet: in den menschlichen Körper. Und er zeigte, dass sie das Ergebnis äußerst komplexer Vorgänge ist, die nicht nur in einem Hirnareal stattfinden, sondern an vielen Stellen des Gehirns und im gesamten Körper. Auch wies er nach, so lese ich in Descartes’ Irrtum, »dass bestimmte Aspekte von Gefühl und Empfindung unentbehrlich für rationales Verhalten sind«. Und weiter: »Im Idealfall lenken uns Gefühle in die richtige Richtung, führen uns in einem Entscheidungsraum an den Ort, wo wir die Instrumente der Logik am besten nutzen können.«
Das, was wir gewöhnt sind, Seele und Geist zu nennen, sind komplexe und singuläre Zustände unseres Organismus.
Und noch ein Satz von Damásio, der für dieses Buch hier sehr wichtig ist. »Vielleicht ist das Wichtigste, was wir an jedem Tag unseres Lebens tun können, uns und andere an unsere Vielschichtigkeit, Anfälligkeit, Endlichkeit und Einzigartigkeit zu erinnern.«
Wie fühlst du dich?
Wenn unsere Empfindungen also kein Luxus sind, keine Dreingabe zu einem primär von Rationalität gesteuerten Dasein, sondern ein differenziertes, komplexes und unentbehrliches Hilfsmittel im Leben, dann ist vielleicht auch diese Frage eine, die wir uns täglich stellen und deren Beantwortung wir eine gewisse Aufmerksamkeit schenken sollten.
Also nicht nur: Was denkst du? Sondern regelmäßig: Wie fühlst du dich?
Ich beginne übrigens wieder zu zweifeln, ob der Satz Mein Gefühl sagte mir … überhaupt wahr ist.
Denn eigentlich ist es nicht das Gefühl, das zu mir spricht, es ist eher der Verstand, der sagt: Wenn du nicht aufpasst, wird ein Gefühl die Oberhand gewinnen, Angst nämlich, die zu Panik führt, die wiederum einen solchen Stress auslöst, dass du nicht mehr denken und nicht mehr schreiben kannst. Und wenn das wahr wäre, dann lassen sich Gefühl und Verstand gar nicht so genau trennen, wie wir das gerne hätten. Dann gehen sie zumindest immerzu Hand in Hand, das eine beeinflusst den anderen und umgekehrt.
Ohne Gefühle können wir nicht vernünftig handeln. Und die Vernunft sagt uns, dass wir unseren Gefühlen Raum zu geben haben, sie beachten sollten und sie nie vernachlässigen dürfen.
Das hört sich vielleicht banal an. Für mich handelt es sich aber um eine Erkenntnis, die ich in meinem Leben erst mühsam gewinnen musste.
Ich bin in einer Ära von Gefühlsblindheit aufgewachsen. Wollte ich als Kind von einem meiner Träume erzählen, fiel der Satz meines Großvaters: Träume sind Schäume. Was hieß: Vergiss es, das ist bedeutungslos. Klagte ich über Kopfschmerzen oder konnte nur einschlafen, wenn ich allein im Bett laut vor mich hinsang und dabei den Kopf unentwegt hin- und herbewegte (eine Gewohnheit, die heute sofort die Herbeiziehung eines Kinderpsychologen zur Folge hätte), so ging man mit mir zum Arzt. Als der sagte, das Kind sei recht intelligent und es bestehe kein Anlass zur Sorge, war die Angelegenheit erledigt.
Man sah nur Symptome. War für diese keine physische Ursache zu finden, dann waren sie eben da, die Symptome, fertig. Wird nicht schlimm sein, man kann eh nichts machen.
Jahrzehnte später, als ich nach einer Scheidung und der Trennung von meinen Kindern seelisch am Boden war und an manchen Tagen kaum mehr ein noch aus wusste, bedurfte es endlosen Leidens und monatelangen Redens meiner heutigen Frau, bis ich endlich (nach langem, durchaus aggressivem Widerstreben) meinen Fuß über die Schwelle einer Psychoanalytikerin setzte – ein Entschluss, ohne den ich all das kaum gesund überlebt hätte.
Es waren nüchterne, auch kalte Zeiten, in denen ich nach dem Krieg aufwuchs. Kalter Krieg. Man redete nicht über Empfindungen. Die Zeitungen waren nüchtern, das Fernsehen auch. In den Sechzigerjahren hatten wir einen Bundespräsidenten namens Heinemann, der so spröde war, dass er weder Musik hörte noch Romane oder gar Gedichte las, nur Sachbücher, »ich mag nur Dinge mit Knochen und Substanz«. Über Patriotismus sagte er, er liebe keine Staaten, nur seine Frau. Nennen Sie mich naiv, aber es verblüfft mich, wie radikal sich im Laufe meines Lebens die Zeiten geändert haben.
Mag sein, dass ich etwas überinterpretiere, aber ich finde es aufregend, dass wir nicht nur in Jahrzehnten leben, die wissenschaftlich, technisch und technologisch, politisch und gesellschaftlich revolutionär sind wie nur selten eine Zeit in der Menschheitsgeschichte. Sondern dass wir gleichzeitig über neue Erkenntnisse verfügen, die es uns ermöglichen und uns auffordern, die Sicht auf unsere Gefühle einer gründlichen Revision zu unterziehen. Dass wir sozusagen lernen können oder jedenfalls könnten, sehr viel aufmerksamer und besser mit uns selbst zu leben.
Leben wir nicht in einer Gefühlsgesellschaft, wie es sie kaum je gegeben haben dürfte?
Selbst Wahrheiten gelten heute manchen nicht mehr absolut, sondern nur gefühlt.
In Gefühlsgewittern
Sicher hat es auch früher Epochen gegeben, in denen Menschen viel über ihre Gefühle gesprochen haben, die Romantik wäre anders nicht denkbar. In einem Gespräch der feministischen Autorin Caitlin Moran mit dem Zeitmagazin las ich gerade, am Hof von Königin Elisabeth I. im 16. Jahrhundert sei die Stellung der Männer davon abhängig gewesen, wie sehr sie sich von Poesie beeindrucken ließen. Je lauter einer weinte, desto mächtiger wurde er.
Ebenso sicher gab es Zeiten, die von Kühle bestimmt waren. Der Germanist und Kulturwissenschaftler Helmut Lethen hat in seinem berühmten Buch Verhaltenslehren der Kälte die Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts als Frostphase beschrieben, in der die Menschen sich gegen Krisen und Unsicherheiten mit persönlicher Temperatursenkung gegen Verletzungen aller Art wappneten. Die Neue Sachlichkeit, die Malerei Christian Schads, Otto Dix’, George Grosz’, Max Beckmanns, die Literatur Kästners, Tucholskys, Falladas, Remarques, Joseph Roths, Brechts waren Ausdruck dafür; eine Kunst, die ihre Melancholie hinter Nüchternheit verbarg.
Und heute? Immerzu reden die Menschen davon, wie sich etwas für sie anfühlt, mit welchem Gefühl sie dies oder jenes unternommen haben, ja, jüngere Leute sind enorm bedacht darauf, bloß niemand anderen in seinen Gefühlen zu verletzen und nicht selbst verletzt zu werden. Wir hantieren routiniert mit oberflächlich angeeignetem Psycho-Vokabular von passiver Aggressivität bis depressive Verstimmung, von Narzissmus bis Trauerarbeit. Selbst bei den Temperaturen unterscheiden wir zwischen jenen, die wir auf dem Thermometer ablesen können, und gefühlten Werten. Jede bessere Führungskraft hat heute ihren Coach, der sie im Umgang mit den Empfindungen anderer schult. Wir leben mit der grundlegenden Vorstellung, authentisch sein zu sollen und zu müssen, just be und sei einfach du selbst. Wir kaufen unser Essen bei Leuten, die vorgeben, Lebensmittel zu lieben, und seit Jahrzehnten verwendet eine Kette von Schnellimbissen den Werbespruch I’m Lovin’ It.
Unsere gesamte Konsumindustrie ist ohne Gefühle nicht denkbar, sie basiert darauf, nutzt sie in jeder Sekunde. Jede Reise, jede Hose, jedes Deo, jedes Brot wird heute mithilfe von Gefühlsappellen und Gefühlserzeugung verkauft. Der Buchmarkt ist überschwemmt von Werken, die Menschen bessere Gefühle versprechen, Glück, Glück und noch mehr Glück. Postings in den sozialen Medien kommentieren wir mit Emojis. »Der Konsument gilt vor allem als ein fühlendes Subjekt: Der Konsum beruht auf Gefühlen, ja, er erfindet sie sogar«, hat die israelische Soziologin Eva Illouz in einem Gespräch mit der Zeit gesagt.
Aber auch das ist im Grunde nur ein Zwischenschritt. Die sozialen Netzwerke sind keineswegs nur Verbindungen zwischen Menschen, sondern eine äußerst komplexe Gefühlsveranstaltung und »primär als Leitungen zu verstehen, die emotionale Energieflüsse transportieren«, schreibt Illouz in Die Zukunft der Gefühle. Sie schaffen eine Aufmerksamkeitsökonomie, in der neue Berufsstände wie Influencer entstanden sind, »deren Geschäft es ist«, so Illouz, »Aufmerksamkeit zu erzeugen, indem sie eine emotionale Verbindung zu den Menschen herstellen, die ihnen folgen«. Sie maximieren die Zahl dieser Follower und münzen sie in den Geldwert ihrer Person um, eine »radikale Substanzlosigkeit« (Illouz) von Wertschöpfung. Und gleichzeitig steigern sie auf diese Weise die wirtschaftliche Potenz der Plattform, auf der alles stattfindet, eine neue Art der Ökonomie, in der Emotionen Teil der Technologie sind. Der »emotionale Kapitalismus«, von dem Illouz spricht, nutzt Affekte für die Ökonomie, er unterwirft aber auch unser Gefühlsleben seinem Marktdenken, wie wir noch sehen werden.
Gefühle sind Geld.
Jens Kersten, Claudia Neu und Berthold Vogel schreiben in ihrem Buch Einsamkeit und Ressentiment, seit etwa 2010 habe es in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften einen psychological turn, eine psychologische Wende, gegeben: Gehe es heute »um die Analyse und Reflexion sozialer und politischer, ökonomischer, ökologischer und rechtlicher Entwicklungen, wird überwiegend auf psychologische Begriffe, Konzepte und Prinzipien zurückgegriffen«. Sie lauten unter anderem Achtsamkeit, Empowerment, Identität, Kränkung, Nudging, Resilienz, Resonanz, Vulnerabilität.
Wie es eben so klingt, wenn Wissenschaftler sich einer Sache annehmen.
Sind das Aufkommen und der Erfolg populistischer Politiker denkbar ohne ihr Geschick im Umgang mit Gefühlen von Menschen, ihr Herstellen und Schüren und Ausbeuten von Ängsten, ihre Bewirtschaftung von Wut, ihr Management von Hass? Die klassischen Medien, mit denen ich aufgewachsen bin, waren alles in allem der (durchaus gelungene) Versuch, die öffentliche Debatte auf einer rationalen Ebene zu führen, mit Für und Wider von Argumenten, Trennung von Nachricht und Kommentar. Vernunftmedien, jedenfalls im Anspruch.
Mit den sozialen Medien hat sich das grundlegend geändert. In dem Buch Kampf ums Unbewusste von Christina von Braun und Tilo Held entdeckte ich den Begriff der Emokratie, 2022 geprägt von Bruno Patino, dem französischen Präsidenten des Senders Arte, der die Verwandlung der Demokratie in eine Gefühlsherrschaft beschreibt – und das hat eine Menge mit den sozialen Medien zu tun. Sie sind, wie gesagt, erstens emotionsgesteuert (oft rein affektiv, also von kurzem Aufflammen bedingt) und zweitens kommerziell orientiert, was bedeutet, dass die Algorithmen und ihre Konstrukteure im Dunkel der Konzernzentralen stets jene Gefühle verstärken, die intensiv genug sind, Menschen auf den Plattformen zu halten, mit denen deren Besitzer sich in den Status nicht mehr überblickbarem Hyperreichtums begeben haben.
Wir leben in Gefühlsgewittern, ja, bisweilen musste man in den vergangenen Jahren – quasi durchnässt von schlechten Nachrichten – Schutz suchen vor der Niedergeschlagenheit, die all diesen Niederschlägen folgte. Die Welt scheint emotional kaum auszuhalten, und am liebsten würde man sich wie ein Bettler an den Straßenrand setzen, einen leeren Hut vor sich und ein Schild dazu, auf dem man nicht um Geld bäte, sondern um gute Nachrichten für eine Aufbesserung des eigenen Gefühlshaushalts.
Diese Veränderung im Umgang mit Gefühlen im Laufe meines eigenen Lebens ist historisch gesehen nichts Neues. In der Geschichte haben Gefühle ihre unterschiedlichen Rollen, Bedeutungen, Gewichtungen gehabt. »Warum weinen Männer in Romanen des 18. Jahrhunderts und hören damit im 19. Jahrhundert auf?«, hat Eva Illouz gefragt. (Aha, damals haben sie also auch geheult!)
Und die Historikerin Ute Frevert (die sich in ihrem Werk mit der Rolle von Gefühlen in der Geschichte befasst hat) hat in Ehrenmänner – Das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft untersucht, wie grundlegend ein Gefühl von Ehre für die männliche Identität in einer bestimmten Gesellschaftsschicht gewesen ist. Nämlich so elementar, dass es aus geringsten Anlässen in Duellen um Leben und Tod ging. Wie befremdlich das heute erscheint, zeigt nur, wie sehr sich Gefühle und ihre Bewertung im Laufe der Zeit verändern und wie eng sie eben nicht nur an Individuen gekettet sind, sondern auch an die Gesellschaft, in der diese leben.
Wir haben nicht nur selbst Gefühle, wir sind von ihnen umgeben, geben sie ab, nehmen sie auf. Jeder von uns macht das anders. Manche kennen ihre eigenen Gefühle nicht, anderen sind die Gefühle um sie herum gleichgültig. Wieder andere tragen ihre Gefühle auf der Zunge, die nächsten verbergen ihr Leid hinter guter Laune. Alles ist möglich.
Mein Vater hätte die Frage Wie fühlst du dich? nicht so verstanden, wie wir sie heute meinen. Hätte er sie beantwortet, dann auf körperlicher Ebene. Er hätte von Beschwerden, Krankheiten, guter physischer Verfassung gesprochen, je nachdem.
Er war, in entspanntem Zustand, ein witziger Mann, wir lachten beim Abendessen, waren ausgelassen. Aber sobald etwas kippte, weil zum Beispiel mein jüngerer, oft kranker und für ihn, den Vater, in seiner Schwäche bedrohlicher Bruder etwas aus seiner Sicht falsch machte, schlechte Noten hatte, in seinem Stress so hastig aß, dass er würgen musste, oder unter dem Druck, unter dem er lebte, seine teure Zahnspange wieder zerbissen hatte, konnte alles in Sekunden anders werden und sich ein Sturm des Zorns entladen, den der Vater wahrscheinlich selbst am meisten bedauerte. Den er aber nicht beherrschen konnte. Er war ihm ausgeliefert.
Meine Mutter war anders. Sie war mit uns Kindern, wie man sich eine Mutter damals vorstellte. Sie nahm uns in den Arm, wenn wir weinten, barg uns an ihrem großen Busen, sorgte für unser Essen, unsere Wäsche, saß am Bett, wenn wir krank waren. Aber auch in ihr brodelte etwas, das ihr selbst und erst recht uns unerklärlich war. Sie konnte, wenn sie überfordert war, außer sich geraten, verprügelte mich bar jeder Selbstkontrolle und floh, wenn sie mit meinem Vater stritt, schreiend aus dem Haus, kehrte erst nach Stunden zurück.
Gefühle äußerten sich bei den Eltern vorwiegend im Drama, im Außer-sich-Geraten, im Kontrollverlust, ja in etwas, das sie selbst nicht mochten und später vermutlich bereuten. Es gab wenig Möglichkeiten, über Gefühle zu reden. Emotionen waren etwas Gefährliches, das man fürchtete und besser mied. Sie gärten vor sich hin und flogen irgendwann in die Luft. Man lebte mit ihnen. Aber man konnte sie nicht besprechen, nur beschweigen.
Die Generation meiner Eltern (mein Vater Jahrgang 1920, meine Mutter 1927) war nach dem Krieg in eine Art emotionale Starre verfallen, eine Kargheit, die in diesem Schweigen begründet war – und das Schweigen hatte wiederum seine tiefen Gründe in dem, was während der Nazi-Zeit geschehen war. Zwei meiner Freunde, der Journalist Stephan Lebert und der Psychologe Louis Lewitan, haben 2025 ein Buch geschrieben, Der blinde Fleck heißt es, in dem sie sich in vielen Gesprächen und Porträts mit Menschen beschäftigen, deren Familien von bleierner Stille, von manifester Aggression, hartnäckigen Lügen und tiefen Geheimnissen geprägt waren.
Schon 1963 hatte der Schriftsteller Günter Grass dem Verleger Klaus Wagenbach im Privaten von seiner Mitgliedschaft in der Waffen-SS erzählt. Die Öffentlichkeit aber erfuhr erst 2006 davon, als Grass schon Nobelpreisträger war, der er nie geworden wäre, wenn er früher von seiner Vergangenheit berichtet hätte. Ähnlich schlimme Dinge liegen in manchen Familien bis heute unter dicken Decken.
Ich glaube nicht, dass es so etwas bei meinen Leuten gab. Aber ich weiß es nicht, das ist es eben. Ich kenne nur dieses Misstrauen, das gegenüber den eigenen Eltern herrschte: Was genau habt ihr in dieser Zeit gemacht? Was haben eure Eltern getan, meine Großeltern? Warum ist es nicht möglich, darüber zu reden?
Wie fühlst du dich?
Ich finde, das ist eine für unsere Zeit programmatische Frage, nicht weil ich es gut fände, wenn wir in beständiger Selbstbetrachtung versänken, statt uns jener Außenwelt zuzuwenden, die wir gestalten sollten. (Gibt es da denn ein Entweder-oder? Nein!) Sondern weil die Beschäftigung mit der Frage und deren Beantwortung die Fähigkeit voraussetzen, über Gefühle zu reden, sie zu erkennen, mit ihnen umzugehen. Es geht um Kompetenz, ein Gefühlswissen, ohne das man sich in unserer Welt zwar bewegen kann, aber nicht sollte. Es geht um eine Fähigkeit zur Reflexion, um die Erkenntnis, dass man Gefühl und Vernunft nicht trennen kann, vor allem aber auch um Eigenständigkeit, darum, sich zu wehren gegen jene, die uns am Nasenring der Affekte durch die Welt führen möchten.
Denn in einer Welt, in der jede und jeder Einzelne umwellt und umschwallt ist von realen und manipulierten, geschwächten und verstärkten, eigenen und fremden Gefühlen, ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, sich darüber klar zu werden: Was ist eigentlich mein Gefühl? Und was kommt von ganz woanders?
Wie geht es mir wirklich? Wie fühle ich mich?
In fast jeder meiner Therapiesitzungen der vergangenen Jahrzehnte, von denen ich heute zehre, tauchte der Satz auf: Es lohnt sich, ganz genau hinzuschauen.
Womit gemeint war, Situationen, die mich wütend machten oder verzweifeln oder in Angst geraten ließen, nicht nur flüchtig anzusehen, sondern einer genauen Betrachtung zu unterziehen. Was ist geschehen? Und wie muss man die Gefühle, die da ausgelöst wurden, nennen?
In Leon Windscheids Buch Besser fühlen fand ich Forschungsergebnisse aus Tagebuchstudien zitiert, zu denen gehörte, dass Menschen, die ihre Wut genauer betrachteten, nicht so aggressiv waren wie andere und sich auch nicht leicht provozieren ließen. Andererseits konnten Menschen mit einer Depression oder einer sozialen Angststörung Gefühle wie Wut nicht präzise beschreiben. »Wenn wir den Dingen einen Namen geben«, schreibt Windscheid, »beginnen wir, sie zu verstehen.«
Das Verstehen von Gefühlen, der differenzierte Umgang mit ihnen, funktioniert über Sprache. Die in Boston lebende, lehrende und forschende Psychologin Lisa Feldman Barrett zitiert eine Studie des Yale Center for Emotional Intelligence, in deren Verlauf Schulkinder rund eine halbe Stunde pro Woche darauf verwenden sollten, ihr Wissen über Emotionswörter und deren Verwendung zu erweitern. Ergebnisse waren besseres Sozialverhalten und bessere schulische Leistungen. Feldman Barrett schreibt: »Reden Sie mit Ihrem Kind nicht über seine Empfindungen, behindern Sie damit tatsächlich die Entwicklung seines konzeptuellen Systems.«
Feldman Barretts 2017 erschienenes Buch How Emotions Are Made, das 2023 in Deutschland unter dem Titel Wie Gefühle entstehen erschien, ermöglicht Laien einen gründlichen Blick auf neurowissenschaftliche und psychologische Ergebnisse, die den Blick auf unsere eigene Gefühlswelt grundlegend verändern. Denn zu jener falschen Sichtweise auf Gefühle, die wir uns seit Jahrtausenden angewöhnt haben, gehört nicht nur die falsche Trennung von Gefühl und Geist, um die es Antonio Damásio ging, sondern genauso die Behauptung, Emotionen seien universell in unseren Gehirnen programmiert, sie seien in allen Kulturen gleich und würden unabhängig von unserem Willen und unserer Gestaltungsfähigkeit geschehen.
Das ist nicht der Fall.
Unsere Emotionen, so Feldman Barrett, sind uns nicht quasi von Natur aus eingebaut. Wir können sie deshalb auch nicht erkennen oder entschlüsseln. Im Gegenteil: Sie werden von unserem Gehirn durch ein äußerst komplexes Zusammenspiel von körperlichen Systemen konstruiert.
Wir lernen sie. Wir machen unsere Gefühle. So Feldman Barretts durch vielfältige Forschungen untermauerte These.
»Menschliche Wesen«, heißt es in Wie Gefühle entstehen, »sind keineswegs den mythischen Emotionsschaltkreisen ausgeliefert, die tief in den animalischen Anteilen unseres hoch entwickelten Gehirns verborgen sind: Wir sind die Architekten unserer eigenen Erfahrungen.«
Das klingt kompliziert, läuft vielen unserer bisherigen Einstellungen zuwider und ist in Kürze nicht leicht zu verstehen. Feldman Barretts übrigens sehr gut geschriebenes Buch hat fast 700 Seiten. Ich komme darauf zurück.
Für den Moment ist wichtig: Wir sind Gefühlen nicht ausgeliefert, wie wir oft denken. Und wir könnten mit ihnen besser umgehen, als wir glauben. Wir müssen uns aber mit ihnen beschäftigen. Sie sollten uns wichtig sein, heute wichtiger denn je. Wenn sie eine solche Rolle in Ökonomie und Politik spielen, können wir nur freie Menschen sein, wenn wir in der Lage sind, unsere Gefühle zu reflektieren.
Hier einige wichtige Fragen, um die es nun gehen soll: Wie gehen wir mit der Angst um, die uns alle in Atem hält? Was ist mit der Verbundenheit mit anderen Menschen, nach der wir alle suchen? Was ist mit unserem Gefühl der Hilflosigkeit angesichts der Stürme, die auf uns zurollen? Sollten wir wieder lernen, zu staunen und uns zu wundern? Was tue ich mit meiner Wut? Darf ich hassen, auf Rache sinnen, andere verachten? Was ist mit der guten alten Lebensfreude? Und, bitte, woher bekomme ich ein Glücksgefühl? Oder wenigstens Hoffnung?
Es könnte schön sein, sich damit zu befassen. Deshalb tue ich es.
Ach, und weil …
Einfach so.
Weil mein Gefühl mir das sagt.
Das Zeitalter der Müdigkeit
Ich bin müde, dämmere auf dem Bürosofa dahin und denke über meine Müdigkeit nach. Ja, es gibt Berufe, in denen das Nachdenken übers Müdesein mehr oder weniger Arbeit ist. Jedenfalls ist es praktisch, sich das einzureden. Zu diesen Berufen gehört meiner. Das gefällt mir.
Warum bin ich oft müde? Der Arzt hat gesagt, mein Blutdruck sei etwas zu niedrig und hat mir andere Blutdrucktabletten verschrieben, im Grunde nur ein kleines Drehen an den Stellschrauben