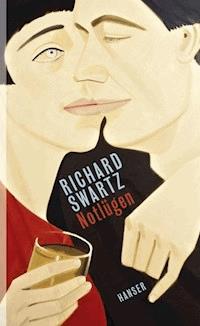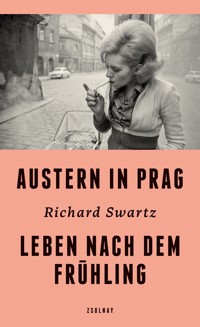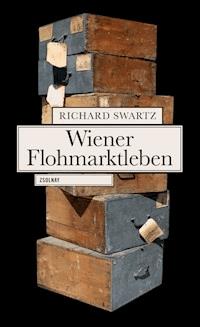
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf dem Flohmarkt in Wien entdeckt der Erzähler ein altes bemaltes Glas mit einer Wiener Stadtansicht. Ein solches Glas stand auch auf der Fensterbank der Großmutter, bis es eines Tages zu Bruch ging. Die Großmutter lebte mit einem verkrachten Künstler zusammen, der die Bilder anderer Maler „frisierte“ und dabei auch den kleinen Jungen zu Hilfsdiensten heranzog. Bis der Betrug eines Tages aufflog und Onkel Acke für eine Weile im Gefängnis verschwand. Richard Swartz erzählt vom Wiener Flohmarkt und dessen Rolle in seinem Leben, von den Händlern und Antiquitäten dort, und mit großer Klugheit davon, was die Zeit aus den Menschen und ihren persönlichen Dingen macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Auf dem Wiener Flohmarkt entdeckt der Erzähler ein altes bemaltes Glas mit einer Wiener Stadtansicht. Ein solches Glas stand auch auf der Fensterbank der Großmutter, bis es eines Tages zu Bruch ging. Die Großmutter lebte mit einem verkrachten Künstler zusammen, der die Bilder anderer Maler »frisierte« und dabei auch den kleinen Jungen zu Hilfsdiensten heranzog. Mal ergänzten sie nur eine Signatur, mal fügte Onkel Acke dem Bild noch eine Figur hinzu, zum Beispiel einen kleinen Hund. Bis der Betrug eines Tages aufflog und Onkel Acke für eine Weile im Gefängnis verschwand.
Richard Swartz erzählt vom Wiener Flohmarkt, der in seinem Leben eine besondere Rolle spielt, von den Händlern dort und seinen Erlebnissen mit ihnen, und mit großer Klugheit davon, was die Zeit aus den Menschen und ihren persönlichen Dingen macht.
Zsolnay E-Book
Richard Swartz
Wiener
Flohmarktleben
Aus dem Schwedischen
von Verena Reichel
Paul Zsolnay Verlag
ISBN 978-3-552-05755-5
© Richard Swartz 2015
Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2015
Umschlag: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Foto: © Fotolia.com – Brad Pict
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
»An Stradervarius is es net!«
(Stimme auf dem Wiener Flohmarkt)
Ein Teppich für den Flur musste her, ungefähr drei mal eineinhalb Meter, und ich fand einen auf dem Flohmarkt, in einem Muster gewebt, das auf den Kaukasus und ein gewisses Alter schließen ließ, hier und da ausgeblichen und überholungsbedürftig, trotzdem genau das, was ich suchte.
Aber wir konnten uns nicht auf den Preis einigen. Der Händler war barsch und unerbittlich, ich geizig und genauso starrsinnig. Bald mussten wir wieder von vorn beginnen. Erneut bemühten wir uns, bis wir das Hin und Her satthatten. Es war vergeblich. Also gaben wir das Schachern und Feilschen auf und legten stattdessen eine Pause für einen Ausflug ins Private ein.
Der Händler war in meinem Alter, ein russischer Jude aus Leningrad. Vor bald vierzig Jahren war er zusammen mit seinen Eltern, inzwischen verstorben, nach Wien gekommen. Hier war er geblieben, statt später nach Israel, New York oder Rom weiterzureisen. In Wien vermisste er nichts, bis auf das Wasser im Leningrad seiner Kindheit, heute Sankt Petersburg. Wien liegt ja nicht einmal an der Donau. Aber dem Russen zufolge kommt keine Stadt, die ihren Namen verdiente, ohne Hafen und Schiffe aus, ohne Kais und Sturmmöwen in der Luft oder auf Wellen schaukelnd, die im Sonnenschein von fettem Altöl glänzen.
Dass eine so große und historisch bedeutungsvolle Stadt wie Wien kein Wasser hatte, war seine erste Enttäuschung im Westen und schwer zu verkraften. Manchmal machte das Fehlen des Wassers ihn immer noch verlegen, als müsste er sich persönlich für die Stadt schämen, die eher zufällig als absichtlich seine neue Heimat geworden war.
Der Vater, Bibliothekar in der Leningrader Stadtverwaltung und kurzsichtig, hatte alles Deutsche geliebt. In der Familie war er der Einzige mit sogenannter Bildung, aber täglich dazu gezwungen, sich auf das Niveau seiner Frau und seines Sohnes herabzulassen. Dem Vater zufolge war das Deutsche die Sprache der Kultur und der Wissenschaft, außerdem die Muttersprache aller großen Komponisten. War Beethoven nicht deutsch? Oder Schumann? Eigentlich wohl auch Swjatoslaw Richter. Ohne Deutschland gäbe es keine Musik, die den Namen verdiene. Doch in seinem eigenen Heim in Leningrad hatte der Vater wegen seiner ungebildeten Familie nur wenige Wörter auf Deutsch verwenden können, wie jawohl, Achtung oder Pantoffeln.
Eine Katastrophe, sagt der Sohn zu mir. Blut ist doch dicker als Wasser.
Als die Familie mit den erforderlichen Stempeln und Dokumenten inklusive der beiden Koffer mit unverkäuflichen Besitztümern endlich die Erlaubnis zur Emigration erhalten hatte, flog sie direkt nach Wien. Eine solche Reise ist vorüber, ehe man versteht, dass sie überhaupt begonnen hat. Keiner in der Familie ist jemals im Ausland gewesen. In Wien überrascht sie als Erstes, dass völlig fremde Menschen ihnen zulächeln, auch die in Uniform, die ihre Pässe kontrollieren. Das bringt die Mutter dazu, in Tränen auszubrechen.
Am ersten Abend in Wien, benommen von so viel Freiheit und Lichtreklame auf einmal, wollen sie in einem einfachen Lokal am Naschmarkt essen. Bei dieser Gelegenheit entdeckt der Sohn, dass der Vater kein Deutsch spricht: dass er diese Sprache nicht einmal versteht. Erneut bricht die Mutter in Tränen aus, und alle drei sind enttäuscht, jeder auf seine Weise. Jahrein, jahraus hat der Vater seine Frau und seinen Sohn zu Hause in Leningrad mit einer Sprache terrorisiert, die dort nicht zur Anwendung kam, und jetzt sitzt er mit ihnen in einem Lokal in Wien vor einem leeren Teller, bleich und verlegen, und kann nicht einmal ein Wiener Schnitzel bestellen.
So klein ist mein Vater in Wien geworden, sagt der Händler und misst es mit Daumen und Zeigefinger ab.
Noch vierzig Jahre danach schrumpft der Vater und wächst die Enttäuschung des Sohns. Aber die deutsche Sprache besitzt eine solche Macht, dass ich die Enttäuschung des Sohns zu verstehen meine: Nicht viel vom Vater hat zwischen Daumen und Zeigefinger Platz.
Zum Trost erzähle ich, wie ich aus Stockholm hierherkam und dann blieb. Vielleicht muss man in dieser Stadt mit so etwas rechnen, sage ich, auch jemand, der nie Pläne gehabt hat, nach Israel, New York oder Rom weiterzureisen. Der Russe ist der gleichen Ansicht. Er für sein Teil hatte früher große Pläne für sein künftiges Leben, kam aber niemals weiter als bis zum Wiener Flohmarkt, einem Abladeplatz nicht nur für Krempel und Trödelkram, sondern auch für ganze Menschenleben. Ich verstehe, was er meint. Aber bei mir liegt der Flohmarkt sozusagen im Blut.
Wien ist eine schleichende Krankheit, sage ich, und wenn es Zeit wird, sich davonzumachen, ist es schon zu spät.
Auch dem stimmt der russische Händler zu.
Stockholm hat wenigstens Wasser, fährt er fort. Genau wie Leningrad.
Danach widmen wir uns wieder dem kaukasischen Teppich. Der Händler ist nachgiebiger geworden, nachdem er seine Geschichte hat erzählen können, ein Teppich für die Diele oder den Flur ist ja doch nur etwas, an dem man die Füße abstreift, und schließlich einigen wir uns auf den Preis; das eine ausgefranste Ende des Teppichs kann der Perser in der Stumpergasse richten. Dass das Geschäft zum Abschluss gekommen ist, freut uns beide.
Der Russe verspricht, mir den Teppich nach Hause zu liefern, nur ein paar Gassen vom Flohmarkt entfernt. Das passt mir gut, da ich an diesem Samstag noch verschiedene Besorgungen zu machen habe.
Ich weiß, sagt er, als ich ihm die Adresse gebe. In der Nähe vom Raimund Theater.
Als der Flohmarkt spätnachmittags vorüber und alles, was nicht verkauft wurde, wieder eingepackt ist, klingelt der Händler, nimmt den Aufzug in den zweiten Stock, wo er den Teppich in meinem Flur ausrollt, dann richtet er sich auf und verschnauft. Bezahlt habe ich schon, auch für den Transport, und sollte ihn jetzt eigentlich zu einem Kaffee einladen, fürchte aber, dass er es sich dann bei mir gemütlich machen könnte. Doch an diesem Samstag will ich meine Ruhe haben, will in Frieden auf meinem neuen kaukasischen Teppich auf und ab gehen, wozu ich keine Gesellschaft brauche.
Daraus wird aber nichts. Denn auch wenn man glaubt, sich nur einen Teppich angeschafft zu haben, hat ihn einer in die Wohnung heraufgebracht, dann auf dem Boden ausgerollt, einer, den man dann nicht mehr loswird. Selbst ohne Kaffee hat der Russe angefangen, es sich bei mir gemütlich zu machen, sieht sich neugierig um, und sein Blick bleibt im Flur an einem Bild hängen. Das Bild ist ein Ölgemälde, das ein paar kartenspielende Herren an einem Tisch zeigt. Einer davon ist ein Pfarrer. Unter dem Tisch sitzt ein Hund.
Der Händler sagt, er könne sich vorstellen, das Bild zu kaufen.
Ausgeschlossen, sage ich. Es ist eine Kindheitserinnerung. Ich habe es von meiner Großmutter geerbt. Außerdem ist es eine Fälschung.
Der Russe meint, das mache nichts. Gewöhnlich könnten nicht einmal Experten unterscheiden, was echt und was falsch sei, und seltener als gedacht interessiere sich der Käufer wirklich dafür. Kopien und reine Fälschungen seien außerdem oft besser als das Original, behauptet der Russe. Was ist in der heutigen Welt wirklich echt? Er schaut nach oben, als erwarte er sich von dort eine Antwort. Mit Sicherheit lasse sich nur feststellen, dass die echte Ware älter ist als die Fälschung. Und die Leute würden das Alte vorziehen, weil sie glaubten, was alt sei, sei auch kostbar.
Es steht nicht zum Verkauf, sage ich.
Am liebsten wollten die Leute einen echten Rembrandt finden, der nichts kostet, fährt der Russe fort. Für einen Spottpreis. Ein sogenanntes Schnäppchen. Oder sie wollten einen falschen Rembrandt für eine schreckliche Menge Geld kaufen, sodass sie dann allen erzählen konnten, dass die Welt voller Schurken sei.
Dafür brauche ich keinen Rembrandt, erwidere ich. Das weiß ich auch so.
Erneut mustert der Russe das Bild genau. Besonders lobt er den Hund: Der Hund sei wirklich intelligent gemalt. Er sehe fast aus wie ein richtiger Hund.
Der Hund gehört nicht einmal dazu, sage ich.
Macht nichts, sagt der Russe. Nach der Betrachtung des Hundes macht er sich jetzt daran, die Signatur in der rechten unteren Ecke des Bildes zu studieren, P.C. Ducray. Aus der Tasche hat er eine kleine Lupe gezogen.
Der Hund wurde später hinzugemalt, sage ich.
»Macht nichts. Der Hund kann ja nichts dafür.«
Auch die Signatur gehört nicht dahin, sage ich. Sie ist falsch.
Macht nichts, sagt der Russe. Ein solches Bild könne man ohne weiteres für ein paar Tausend verkaufen. Vielleicht für drei. Der Name klingt französisch. Französische Bilder gehen weg wie warme Semmeln. Obwohl die Deutschen natürlich mehr von Musik verstehen.
Ich weiß sogar, wer die falsche Signatur da hingesetzt hat, sage ich.
Ich meine, den Namen schon gehört zu haben, sagt der Russe und meint P.C. Ducray. Ein großer Künstler. Einer der allergrößten.
Das Bild steht nicht zum Verkauf, wiederhole ich.
Schließlich gibt der Russe auf. Er sieht dabei nicht einmal besonders betrübt aus. Die Lupe steckt er zurück in die Tasche und sagt, seine eigene Großmutter habe Larisa geheißen, obwohl man sie Lara nannte, weil das besser klang, und dass es das Wichtigste im Leben sei, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben.
Meine war glücklich, sagt der Russe. Mein Vater hat uns zwar immerzu mit seinen Deutschkenntnissen beschwindelt, aber das habe ich verkraftet. Der Rest war in Ordnung. Und hier in Wien hörten die Lügen ja von selbst auf.
Fünfhundert, sagt er plötzlich. Mein letztes Angebot. Fünfhundert, ich nehme das Bild und gehe.
Ich tue so, als hätte ich nichts gehört, und der Russe zuckt die Achseln.
Und Sie?, fragt er. Wie war Ihre Kindheit?
Ein anderes Mal, sage ich. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Sonntags war der Junge von der Großmutter zum Essen eingeladen und um bei der Fälschung von Kunst mitzuhelfen. Letzterer widmete er sich mit der Unvernunft des Schuljungen nur allzu gern. Einige Jahre lang wurde diese Tätigkeit im Dienst der Kunst sogar mit größerem Ernst betrieben als die Hausaufgaben.
Vor dem Spiegel im Badezimmer kämmte er seine Haare mit Wasser, zog einen Mittelscheitel, setzte die Schulmütze auf und lief dann die breite Ordenstrappan zum Karlavägen hinunter, wechselte gleich auf die andere Straßenseite und ging weiter an der Elch-Apotheke an der Ecke Engelbrektsgatan und Karlavägen vorbei. Die Apotheken hatten Tiernamen, während die Schulen entweder klein oder groß waren (die Kleine Engelbrekt oder die Große Engelbrekt), wenn sie nicht nach Himmelsrichtungen benannt waren (Gymnasium Nord oder Gymnasium Süd). Sonntags waren sie geschlossen. Aus seinem künstlichen Wald aus Gips und Verputz über der Tür zur Apotheke schaute ein mit Grünspan überzogener Elch auf den Verkehr hinunter.
Auf der anderen Straßenseite stand eine einsame Torte im Schaufenster der Konditorei Alliance. Vor der Konditorei und unter dem Elch waren sonntags nur wenige Menschen unterwegs. Der Junge wusste, dass die Torte im Fenster nicht zu verzehren war, dass Schlagobers und Erdbeeren kein richtiges Obers und keine richtigen Beeren waren. Ein älterer Mitschüler hatte erklärt, die Schaufenstertorten seien alle mit Sägespänen gefüllt, aber das wollte er doch nicht recht glauben; eine solche Sägespänetorte war wohl aus der Enttäuschung des Jungen gebacken, weil er sich auf der falschen Seite des Schaufensters befand.
Von der Ecke Engelbrekstgatan und Karlavägen aus ging er weiter Richtung Karlaplan, aber nicht auf dem Trottoir, sondern auf dem Kiesweg unter den großen Linden in der Allee zwischen den Fahrbahnen. Im Frühjahr blühten die Bäume. Im Sommer rauschten sie. Im Herbst fielen die Blätter. Erst fast unmerklich, dann immer stärker und immer öfter, auch die, die sich mit steifem Stiel und all ihren Säften bis zuletzt festgeklammert hatten. Das Herbstlaub war blassgelb oder hellbraun, blieb aber nicht besonders lang am Boden liegen, sofern die Blätter nicht das Glück gehabt hatten, auf dem Rasen unter den Bäumen zu landen, der noch grün war und sie wie entfernte, aber einigermaßen willkommene Verwandte empfing. Die Parkverwaltung war anderer Meinung. Von den Kieswegen und bald auch dem Rasen wurde das Laub mit Harken, Rechen und langen Stöcken mit stumpfen Metallspitzen entfernt, die immerhin scharf genug waren, um aufzuspießen, was die Natur aufgegeben und abgelegt hatte.
Manchmal ging ein Wind durch die Baumkronen. Flüsternd und murmelnd sprachen die Bäume miteinander oder schon mit der nächsten Jahreszeit. Im Spätherbst wurde das Flüstern zu einem trockenen Husten, raschelnd zog der Wind über dem Kopf des Jungen durch das Laub, das noch übrig geblieben war, es war fast dasselbe Rascheln, wie wenn im Sommer das Wasser des Sees über die Steine und Muschelschalen unter seinen Füßen floss. Aber hier in Östermalm war kein Wasser in Sicht, und die ersten Herbststürme kündigten sich schon an. Bald würden die Bäume nackt und stumm dastehen, und vor ihm lag jetzt die Sturegatan, die er zu überqueren hatte. Dort war der Verkehr dichter als auf dem Karlavägen und den dunklen und ziemlich düsteren Straßen, die ihn kreuzten, aber kurz bevor er den Karlaplan erreichte, diesen verlassenen Platz mit seiner Fontäne, die nur selten das Wasser in einem ranken und zitternden Strahl in den Himmel spritzte, bog der Junge nach links ab und in die Grevgatan ein, wo die Großmutter lebte.
Er war am Ziel und klingelte. Die Großmutter wohnte fast unterm Dach, im vierten Stock. Immer wenn der Junge klingelte, war sie es, die öffnete. Die Großmutter schloss ihn in die Arme, die Schulmütze hatte er schon auf den Stuhl neben der Tür gelegt. Ihre feuchten Küsse landeten in seinen Haaren und im Gesicht, wo ihr Lippenstift schmierige, purpurrote Flecken hinterließ, für die er sich an einem Schultag geschämt hätte. Aber heute war ja Sonntag.
Liebevoll, als wäre der Junge etwas besonders Zerbrechliches oder Seltenes, drückte sie ihn an ihre Brust; der Geruch von Schweiß und ihr schweres Parfum stachen ihm in die Nase und setzten sich in seinen Kleidern fest. Noch am Abend konnte der Junge beide wahrnehmen, wenn er sich zu Hause auszog, Hemd, Hosen und Unterwäsche zusammenfaltete und sie auf den Stuhl neben dem Bett legte, bevor es Zeit war, schlafen zu gehen.
Die Großmutter schaffte es nicht, sich mit derselben Sorgfalt wie früher zu waschen, oder es war ihr egal und sie versuchte dies mit teurem französischem Parfum zu verbergen. Aber die beiden Düfte, der natürliche und der künstliche, vertrugen sich nicht; sie wollten sich nicht mischen, sodass die Großmutter jedes Mal, wenn sie den Jungen in die Arme schloss, immer stärker nach Schweiß roch, während die Erwachsenen ihr Komplimente für ihre exquisite Parfumauswahl machten.
Aus dem dunklen kleinen Flur gingen der Junge und die Großmutter in das Zimmer zur Straße, wo ihr Liebhaber sie erwartete. Ein Liebhaber war wie der Vater des Jungen ein Erwachsener, der aber frei und nicht verheiratet war. Das Zimmer roch nach Tabak und Medikamenten. Mitten im Zimmer saß der Liebhaber der Großmutter in einem bunt bezogenen Stofffauteuil mit großen Papageien oder Dschungelvögeln. Seine Hände ruhten auf den Lehnen; die kleinen Puppenfinger umschlossen sie wie Klauen.
An den Sonntagen war es die Aufgabe des Jungen, ihm bei seiner Kunst zu helfen, bis die Großmutter mit dem Mittagessen fertig war. Diese Arbeit wurde hinter einem Lackschirm verrichtet. Vielleicht stand er da, damit die Großmutter so tun konnte, als wisse sie nicht, was dahinter vorging. Aber ihrer Aufmerksamkeit entging gewöhnlich sehr wenig, die Großmutter wusste bestimmt Bescheid, gab sogar hin und wieder Ratschläge, die sowohl Geschmack wie Kenntnisse für die Anforderungen verrieten, die diese Art von Arbeit an ihren Liebhaber und den Enkel stellte.
Der Paravent kam aus China. Mit praktisch aneinanderzufügenden Teilen ließ er sich ohne weiteres verlängern oder verkürzen, je nach Bedarf, ungefähr wie eine Ziehharmonika oder ein Fächer. Wenn eine große Arbeit im Gang war, erstreckte sich der Schirm wie eine Wand oder Mauer quer durchs Zimmer. Hinter einer ähnlichen, aber um ein Vielfaches größeren Mauer hatten die Chinesen Tausende von Jahren ungestört gelebt. Hier und da war der schwarze Lack in spinnwebdünne Risse zersprungen, fast wie die feinen Fältchen um die Augen der Großmutter. Ihr Liebhaber hatte dem Jungen erklärt, dass die Chinesen mindestens sieben verschiedene Nuancen von Schwarz kennen, die für ein europäisches Auge jedoch unmöglich zu unterscheiden sind. Chinesische Augen sehen mehr und klarer als die unseren. Der Liebhaber der Mutter bewunderte dieses Land, obwohl er nie dort gewesen war; eine Reise nach China war ja für einen Zuckerkranken leider nicht vorstellbar.
Der Junge kannte keine Chinesen und wollte lieber nach Afrika. Er kannte auch keine Afrikaner, aber das würde sich regeln, wenn man erst einmal dort war. Er wusste jedoch, dass die Augen der Chinesen schräg geschnitten waren, meistens dunkelbraun und wie die Mandeln geformt, die es an Weihnachten gab. Solche chinesischen Augen hatten sich schon Hunderte von Jahren damit beschäftigt, Schrift- und Bildzeichen auf richtigem Papier zu studieren, während man in seinem Land noch kantige Runen in Stein haute.
Auf dem Paravant waren Figuren, aus Jade geschnitten. Sie standen in kleinen Gruppen beieinander, oft an einem Fluss oder an einer Brücke, die mit spröden Pinselstrichen weiß auf den schwarzen Lack gemalt waren. Oder sie standen in einem Garten und sannen zusammen über etwas nach; die Hände hatten sie in die weiten Ärmel ihrer faltigen Seidengewänder gesteckt, und sogar die Falten waren in den Jadestein geritzt, sodass man sehen konnte, wie der dünne Seidenstoff geschmeidig den Körper eines solchen Chinesen umschloss, jede noch so kleine Bewegung durchscheinen ließ.
Eigentlich unterschieden sich Chinesen kaum voneinander. Erst aus der Nähe konnte man erkennen, dass einige von ihnen Männer waren, und die, die hockten oder die Beine unter dem Körper angewinkelt hatten, Frauen. Alle schienen sie ganz mit ihrem Tun beschäftigt, vor allem damit, was sie zueinander sagten, was jedoch für den Liebhaber der Großmutter und den Jungen ein Geheimnis blieb. Und selbst wenn sie hätten hören können, was gesagt wurde, hätten sie es nicht verstanden.
Der Erwachsene hatte dem Kind erklärt, die chinesische Kultur sei vornehmer als alle anderen Kulturen. Ihre Gelassenheit sei groß. Gelassenheit? Das bedeute, dass ein Chinese nie haste, es nie eilig habe, vielleicht weil eine solche Eile ihn lächerlich machen oder Schande über seine Familie bringen würde. Das war erstaunlich; der Junge liebte die Schnelligkeit und würde sie auch nicht wegen Chinesen aufgeben. Er hatte es eilig und keine Geduld. Aber so vornehm sei diese Kultur, dass der Chinese wisse, wie sehr man sich auch beeile, es sei doch alles vergebens oder zu spät. Ruhe und Frieden hingegen schätzten sie sehr. Und in der Tat: Der Junge konnte sehen, dass das, was der Liebhaber der Großmutter gesagt hatte, stimmte. Auch wenn die Chinesen auf dem Paravent in ewiger Regungslosigkeit verharrten, konnte man ahnen, dies hatte weder mit der Jade noch mit dem Lack zu tun. Diese Regungslosigkeit war dem Chinesen eigen: Hier wurden keine Sprünge gemacht, niemandem wurde auf die Schulter geklopft, keine Hand wurde unnötig erhoben. Alles, woran der Junge glaubte, war hier verpönt. Stattdessen ging es still und würdig zu, und falls etwas bewegt oder entfernt werden musste, stand ein Diener in der Nähe bereit. Aber bis zu dem Augenblick, in dem der Diener mit einer fast unmerklichen Geste angewiesen wurde, einen solchen Auftrag auszuführen, verhielt er sich genauso still und regungslos wie sein Herr.
Manchmal studierte der Junge jede einzelne Figur. Dann entdeckte er, dass einige Chinesen älter waren als die anderen. Hier und da entdeckte er einen krummen Rücken, einen gebeugten Nacken oder einen Kopf, der zwischen die Schultern gesunken war wie eine verfaulte Frucht in eine Schale. Es waren sehr alte und vielleicht kranke Chinesen. Die Allerältesten waren Männer mit hängenden Schnurrbärten, wie zitternde graue Striche auf den Paravent gemalt, die den Alten bis zur Taille oder noch tiefer reichten, bevor sie sich im Nichts auflösten.
Die Männer zogen es offenbar vor zu stehen. Und fast alle diese chinesischen Männer waren leicht vorgebeugt; ob durch die Weisheit der Jahre oder aus Höflichkeit gegeneinander, ließ sich nicht sagen. Aber dem Liebhaber der Großmutter zufolge war das in China fast dasselbe.
Der Junge wusste, dass die Großmutter in dem lebte, was die Erwachsenen Sünde nannten, aber da ihr Liebhaber ein angenehmer korpulenter Herr war, der gern Zigarre rauchte und Kinder mochte, hatte sich die Familie widerwillig an ihn gewöhnt. Eine Wahl hatte sie auch nicht wirklich gehabt. Die Familie wusste sehr wenig von ihm und von dem, was man seine Herkunft nannte, und was man nicht wusste, wollte man auch nicht herausfinden. Sicherheitshalber hatte die Familie es dennoch für nötig gehalten, der Großmutter zu verbieten, ihren Liebhaber zu heiraten. Das enttäuschte den Jungen, der gern einen Großvater gehabt hätte.
Trotz dieses Verbots war der Liebhaber meistens guter Laune, obwohl sein Lächeln nicht die Augen erreichte; sie nahmen nicht an dem teil, was der Mund machte, selbst ein Kind konnte das sehen. Die Augen blieben traurig. Sie schienen in ein ganz anderes Gesicht zu gehören, genau wie seine kleinen weißen Finger, flink und immer in Bewegung, nicht zu diesem großen Körper, der sich nur mit Mühe und unter Schnaufen von dem Vogelfauteuil zu dem Sessel am Schreibtisch in seinem Zimmer bewegen ließ, das zur Grevgatan hinausging.
Oft lächelte er dem Jungen zu. Lange konnte ein solches Lächeln in seinem Gesicht bleiben, obwohl es dann ohne Grund schien, als hätte er es dort vergessen oder verloren, während er in Gedanken schon anderswo war, ein Lächeln, das nichts mit echter Freude zu tun hatte, vielmehr dort zu sein schien, um einen Kummer zu verbergen.
Die Eltern des Jungen waren der Meinung, das Paar lebe nicht nur in Sünde, sondern auch in größter Unordnung. Besonders sein Vater war empört. Die Wohnung in der Grevgatan war vollgestopft mit altem Krempel, Antiquitäten oder angeblichen Antiquitäten, mit Dingen, die oft beschädigt waren oder denen ein Teil fehlte, etwa ein Bein, ein vergoldeter Beschlag, oder die größten Kristallprismen, mit Figuren, deren Bronzeschwert oder Porzellankopf abgeschlagen war, eine Anhäufung von Dingen, die aus Trödelläden, Dachböden und Versteigerungen in ihre Wohnung gequollen waren und sie in das verwandelt hatten, was der Vater des Jungen verächtlich einen Flohmarkt nannte.
Flohmarkt? Wenn die Rede auf die Grevgatan kam, waren die schlimmsten Schimpfwörter des Vaters Sünde und Flohmarkt. Sünde hatte damit zu tun, dass es bei der Großmutter keinen Großvater gab. Aber Flöhe hatte der Junge bei der Großmutter nicht angetroffen, obwohl Flohmarkt vielleicht ein anderes Wort für unordentliches Zimmer war. Diesen Flohmarkt in der Grevgatan musste der Vater hin und wieder besuchen, weil er es als Familienpflicht ansah. Der Vater des Jungen meinte, nur in der Natur sei dergleichen anzutreffen, und dort hätte er eine solche Unordnung vielleicht auch akzeptieren können, aber nicht in einer Wohnung in einem so noblen Stadtteil wie Östermalm. Hier sei der Untergang nahe, meinte der Vater, was in der Natur zu Erdbeben oder Überschwemmungen würde, in der Welt der Menschen jedoch gezügelt werden müsste.
Aber in der Grevgatan? Da hatte die Natur schon einen Fuß in der Tür. Dass die Natur Füße hatte, war dem Jungen neu. Aber der Vater war davon überzeugt, dass seine Schwiegermutter und ihr Liebhaber ihre Rechnungen nicht bezahlten (dafür hatte er handfeste Beweise), nie ihre Betten machten, ihre Zimmer nicht lüfteten und ungespülte Teller mit Essensresten bis zum nächsten Tag stehen ließen. Das empörte ihn, obwohl er selbst nicht in dem ungemachten Bett schlafen oder die Reste von dem gestrigen Teller aufessen musste, und wenn diese Unordnung in der Grevgatan zur Sprache kam, gerieten die Eltern des Jungen in einen Streit, der Tage währen konnte.