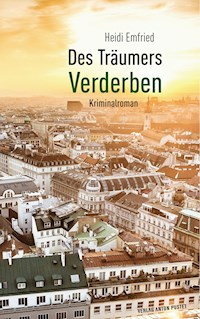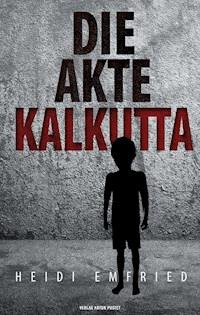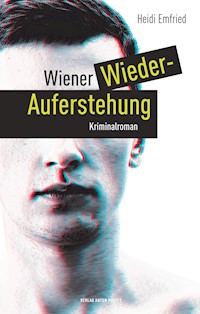
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Anton Pustet
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? (Lukas 24,5) Der Programmierer Adrian Stuiber kann mit seinen Algorithmen Unglaubliches bewirken. Selbst den Tod scheinen er und sein exaltierter Freundeskreis überwinden zu können. Sie kreieren neue perfekte Geschöpfe. Als Stuiber jedoch eines Tages leblos am Fuß eines alten Aussichtsturms aufgefunden wird, kann ihm kein Algorithmus mehr helfen. Der Griff nach den Göttern endete für ihn mit einem ganz und gar realen, tiefen Fall. Vieles ist nicht, was es scheint. Welche Rolle spielt der heimliche Turmbewohner? Hat die Tat etwas mit dem Doppelleben des Mordopfers zu tun, oder geht es um Geld? Die Vermischung von Tod, Leben und neu Geschaffenem ist nicht die einzige Lüge, die es aufzudecken gilt. Der "eiskalte Yuppieverein", zu dem der Ermordete gehörte, ruft bei Chefinspektor Leo Lang und seinem Team keine Sympathien hervor. "De ham olle an Huscher", diagnostiziert der dienstälteste Kollege Nowotny, doch das hilft auch nicht weiter. Mit Sorge beobachtet Lang, wie künstliche Intelligenz das Gefühlsleben derer, die sie nutzen, beeinflusst. Dazu kommt, dass ihn sein eigenes Gefühlsleben durch private Herausforderungen gehörig auf die Probe stellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2022 Verlag Anton Pustet
Bergstraße 12, 5020 Salzburg
Sämtliche Rechte vorbehalten.
Lektorat: Markus Weiglein
Grafik und Produktion: Nadine Kaschnig-Löbel
Coverfoto: Ray Bond/shutterstock.com
eISBN 978-3-7025-8093-3
Auch als gedrucktes Buch erhältlich:
ISBN 978-3-7025-1049-7
www.pustet.at
Heidi Emfried
WienerWiederauferstehung
Kriminalroman
Haben Sie niemanden, den Sie aus dem Tränental auf eine höhere Ebene heben wollen?
Inhalt
Prolog: Wien, Marie-Valerie-Warte 16. November
Kapitel 1: 17. November
Kapitel 2
Kapitel 3: 18. November
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9: 19. November
Kapitel 10
Kapitel 11: 20. November
Kapitel 12
Kapitel 13: 21. November
Kapitel 14: 22. November
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17: 23. November
Kapitel 18
Kapitel 19: 24. November
Kapitel 20
Kapitel 21: 25. November
Kapitel 22: 26. November
Kapitel 23: 27/28. November
Kapitel 24 29. November
Kapitel 25
Kapitel 26: 30. November
Kapitel 27: 1. Dezember
Kapitel 28: 2. Dezember
Kapitel 29: 3. Dezember
Kapitel 30: 3.–5. Dezember
Kapitel 31: 6. Dezember
Kapitel 32: 7. Dezember
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36: 8. Dezember, Feiertag
Kapitel 37: 9. Dezember
Kapitel 38
Kapitel 39: 10. Dezember
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42. 13. Dezember
Kapitel 43
Kapitel 44: 14. Dezember
Kapitel 45: 19. Dezember
Kapitel 46: 21. Dezember
Kapitel 47: 24.–26. Dezember, Weihnachten
Kapitel 48: 27.–30. Dezember
Kapitel 49: 1. Jänner
Kapitel 50: 4. Jänner
Kapitel 51: 7. Jänner
Kapitel 52
Kapitel 53: 10. Jänner
Kapitel 54: 11. Jänner
Kapitel 55: 12. Jänner
Kapitel 56: 13. Jänner
Kapitel 57: 14. Jänner
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60: 15.–21. Jänner
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65: 22. Jänner
Kapitel 66: 26. Jänner
Glossar
Personenverzeichnis
Prolog
Wien, Marie-Valerie-Warte16. November
Farzad blickte auf den Mann zu seinen Füßen hinab. In seinem Inneren wütete eine Mischung aus Verzweiflung und hilflosem Zorn, eine Mischung, die brodelte und loderte und sich auftürmte, höher als die Aussichtswarte neben ihm. Sie lähmte ihn, sie hinderte ihn, dem rationale Überlegungen ohnehin nicht in die Wiege gelegt waren, vollends am Denken. Er hätte schreien mögen, laut, hemmungslos und befreiend wie ein Kind, ohne Rücksicht auf Entdeckung. Doch ein letzter Rest Vernunft hielt einen größeren emotionalen Ausbruch im Zaum. Lediglich ein erstickter Laut, der viel von einem Schluchzen hatte, verließ seine Kehle.
Vom Lichtkreis seiner Stirnlampe beleuchtet, lag die Gestalt regungslos auf dem Bauch, Arme und Beine auf unnatürliche Weise abgewinkelt. Er stupste sie mit dem Fuß an. Nichts regte sich. Farzad zweifelte keine Sekunde daran, dass der Mann tot war.
Das hatte ihm gerade noch gefehlt! Was hatte dieser Hurensohn hier zu suchen gehabt? Jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Polizei wie verrückt hinter ihm her sein würde. Und zwar richtig gezielt, nicht so wie bisher, da er sich als einer unter vielen mit dem Fußgängerstrom durch sein Revier hatte treiben lassen, gekleidet in dunkler Streetwear ohne Aufschriften oder sonstige auffällige Merkmale. Wer so wenig aus der Masse herausragte wie er mit seiner zierlichen Gestalt, konnte wochen- und monatelang von der Polizei unbehelligt bleiben, vor allem wenn man es mit dem Dealen nicht übertrieb und keinem in die Quere kam. Und genauso hatte er es die letzten sechs Wochen, seit er das letzte Mal aus dem Bau entlassen worden war, gehalten. Bei dem Männerwohnheim, dessen Adresse man ihm mitgegeben hatte, hatte er sich gar nicht gemeldet. Er hätte dort doch nur seinen Abschiebebescheid und wahrscheinlich die Schubhaft abwarten können – oder was auch immer. Bei der unsicheren Lage daheim wusste man nie, wie der Stand der Dinge gerade war und was denen da oben als Nächstes einfallen würde. Nicht mit ihm. Er war sofort untergetaucht und hatte durch eine glückliche Fügung diesen baufälligen, gesperrten hölzernen Aussichtsturm gefunden, der ihm einen guten Unterschlupf geboten hatte. Zwar war es in letzter Zeit etwas kalt geworden, aber das hätte sich regeln lassen. Und jetzt diese Scheiße! Fieberhaft versuchte er, einen klaren Gedanken zu fassen.
Seine Spuren waren überall auf dem Turm, seine Sachen noch oben in der Kammer unterhalb der Plattform. Nicht, dass etwas Wertvolles dabei war. Das Geld und den kleinen Stoffvorrat trug er zum Glück immer bei sich. Er musste sofort von hier verschwinden, ins Ausland. Solange die Leiche noch nicht gefunden war, war er sicher.
Einen Augenblick erwog er, den leblosen Körper zu verstecken. Er packte die Füße bei den Knöcheln und zog mit aller Kraft. Der Tote bewegte sich kaum, er schien aus Blei und am feuchten Boden festgeklebt. Sofort verwarf er den Gedanken wieder. Zu schwer, zu wenig Gebüsch, zu groß die Gefahr, von einem Hundebesitzer – wie neulich die alte Schlampe – oder Jogger überrascht zu werden, selbst bei diesem kalten Nebelwetter und bei dieser Dunkelheit.
Nebenan auf dem Parkplatz stand das Auto des Unglückseligen, ein großer, neuer, verführerisch glänzender Mercedes-SUV. Ein Traum. Ob er sich die Schlüssel fischen und mit dem Auto abhauen sollte? Das würde ihm viel Geld bringen, auch wenn er es natürlich nur zu einem Bruchteil des Wertes illegal verkaufen konnte. Mit einem derart auffälligen Wagen über die Grenze? Nein, viel zu gefährlich! Wenn man den Kerl doch vorzeitig fand, würde sofort nach dem Auto gefahndet werden.
Mit etwas Glück konnte er es bis morgen mit dem Nachtzug tief nach Italien hineinschaffen, am besten, etwaiger Kontrollen wegen, mit gültigen Fahrscheinen, zumindest, bis er über die Grenze war. Würde sein Geld reichen? Und dort unten brauchte er auch etwas, um weiter zu kommen. Er hockte sich neben dem Toten hin und drehte ihn, ohne ihm ins Gesicht zu sehen, halb um, um an dessen innere Jackentasche zu kommen. Wie vermutet, fand sich darin die Brieftasche. Rasch griff er sich das Geld – über achthundert Euro – und steckte sie wieder zurück. Dann richtete er sich auf und fing an zu gehen, erst langsam, dann immer schneller, weg vom toten Mann, weg vom Turm, hin zur Bushaltestelle, während er sich die Wollmütze tiefer in die Stirn zog und die Kapuze darüber schlug.
1
17. November
Lang beugte sich über den Toten, nachdem ihm Sendlinger durch ein Kopfnicken bedeutet hatte, dass die Spuren auf dem Boden rund um die Leiche gesichert waren und er durch sein Näherkommen keinen Schaden anrichten würde. Er betrachtete den ziemlich schmächtigen, dunkelhaarigen jungen Mann mit dem dezenten kleinen Bärtchen und ebensolchem Oberlippenbart. Die grellen Scheinwerfer der Spurensicherer hatten eine überaus kalte Atmosphäre erzeugt, die sich – zusammen mit dem Anblick der Leiche – so manchem aufs Gemüt legte, nicht jedoch dem Gerichtsmediziner.
»Hallo Leo, wie geht’s? Und die Frau Oberlehner auch da, freut mich!«, begrüßte er die beiden Kriminalbeamten jovial. Also hat’s noch immer nicht zum Du-Wort mit Cleo gereicht, dachte Leo etwas schadenfroh im Wissen um Sendlingers Schwäche für seine attraktive Mitarbeiterin. »Hallo, Philipp«, grüßte er zurück. »Schon irgendwelche Erkenntnisse?«
Der Angesprochene nickte. »Ohne der Obduktion vorgreifen zu wollen, würde ich sagen: Tod durch Fall von der Aussichtswarte, irgendwann gestern, vermutlich am Nachmittag. Ob gestürzt, gesprungen oder gestoßen, kann ich natürlich noch nicht annähernd beurteilen. Obwohl, Ersteres scheint weniger wahrscheinlich – meine Leute sagen, die Brüstung dort oben wirkt wie mit großer Wucht aufgebrochen. Weiters haben wir eine Brieftasche ohne Geld, aber mit Personalausweis und Bankomatkarten, und ein ziemlich zerstörtes Handy, aber vielleicht können wir noch etwas rausholen. Gefunden hat ihn übrigens der junge Mann da drüben. Seine Fingerabdrücke haben wir schon.« Er zeigte mit dem Kopf auf einen kurzhaarigen blonden Mann von etwa dreißig, unter dessen Winterjacke rote Sportleggings und Laufschuhe die weitgehend unauffällige Erscheinung komplettierten.
Sein Name sei Stipe Vladic, gab er mehr aufgeregt als schockiert an. Man sah ihm an, dass er bereits innerlich den Bericht probte, den er atemlos den an seinen Lippen hängenden Freunden, Familienmitgliedern, Kollegen und Bekannten erstatten würde. Egal, solange es beim Innerlichen blieb und nicht bei der Sensationspresse landete. Unverheiratet, keine Kinder, aber Lebensgefährtin, beschäftigt in einem Callcenter.
»Dort arbeite ich immer Schicht von sechs bis halb drei, das ist ideal für mich, so krieg ich die Schichtzulage und kann mit dem Tag noch was anfangen. Ich geh oft laufen, so wie heute. Meistens hier in der Gegend. Ich hab vor, nächstes Jahr beim Wien-Marathon mitzumachen, da muss man rechtzeitig mit dem Trainieren anfangen.« Letzteres nicht ohne einen gewissen Stolz in der Stimme. »Ich stell mein Auto immer dort auf dem kleinen Parkplatz hinter der Hecke ab« – er deutete in die dem Turm entgegengesetzte Richtung – »und da ist mir die Luxuskarre natürlich sofort aufgefallen. Hätt ich auch nix dagegen, hab ich mir gedacht. Muss einem G’stopften gehören. Dann hab ich das schmale Wegerl am Turm vorbei zum Wald genommen, wie immer. Da hab ich ihn a bisserl abseits liegen gesehen, creepy. Hätt ihn fast übersehen. Hab ihn kurz am Hals berührt – sonst nix angerührt –, aber der war schon ganz kalt. Dann hab ich die Polizei und sicherheitshalber auch die Rettung angerufen. Um drei Uhr zwei, hab auf die Uhr geschaut.« Er blickte erwartungsvoll von Lang zu Cleo und wieder zurück, scheinbar in der Hoffnung auf ein Lob für sein vorbildhaftes Verhalten.
»Waren Sie gestern auch hier laufen?«, wollte Cleo wissen.
»Nein, gestern war’s sogar mir zu schiach«, gab der Marathonaspirant in Anspielung auf das nasskalte Nebelwetter des Vortages zurück. »Was ist denn eigentlich passiert?«, fragte er nun seinerseits die Kriminalbeamten.
»Wissen wir noch nicht«, erwiderte Leo knapp. »Wir ermitteln in alle Richtungen.« Mit dieser abgedroschenen Phrase und einem sparsamen »Danke« machte er Anstalten, das Gespräch zu beenden. Doch Stipe Vladic wollte noch wissen, wie er sich nun zu verhalten habe.
»Kann ich drüber reden, oder ist es geheim? Werden Sie mich später noch brauchen?«
»Von mir aus können Sie ruhig darüber reden – wenn möglich, bitte nicht mit der Presse. Die Information der Öffentlichkeit übernehmen wir selbst. Es kann sein, dass noch Fragen auftauchen, in diesem Fall würden wir auf Sie zukommen.«
Vladic nickte verständnisvoll und wandte sich dem Parkplatz zu, während er sein Smartphone zur Hand nahm. Für heute war das Lauftraining wohl abgesagt.
Während Cleo sich mit dem Personalausweis und dem Auto des Toten beschäftigte, kam eine der Mitarbeiterinnen Sendlingers auf Lang zu.
»Der Turm war wegen Baufälligkeit gesperrt und mit einer großen, vor die Eingangstür angenagelten Warntafel gesichert. Man hätte normalerweise gar nicht hinaufgekonnt, die Nägel waren aber ausgerissen und die Tafel lehnte umgedreht an der linken Seite des Turms, sodass sie für einen, der vom Parkplatz kam, nicht sichtbar war. Wir nehmen sie mit zwecks Laboruntersuchung. Und oben liegt eine Menge Zeug, das wollen Sie sich vielleicht noch anschauen, bevor wir es einladen? Die Fotos sind schon gemacht, es kann alles bewegt werden. Angreifen natürlich wie immer nur mit Handschuhen.«
Wegen dieser überflüssigen Bemerkung verzog Lang kurz das Gesicht, dann erklomm er den Turm langsam, auf Details achtend. Der Bau bestand aus einem natursteinernen Sockel mit geschlossenem hölzernem Aufbau, an dessen Innenwänden eine mit einem Geländer gesicherte, wackelige Holztreppe zu einer Aussichtsplattform führte. Mehrere Zwischenplattformen bildeten Stockwerke. Er zählte insgesamt fünf, die Aussichtsplattform nicht mitgezählt. Die Aussparungen für die Treppe waren so angeordnet, dass sie jeweils in versetzten Ecken lagen, sodass es keinen direkten Durchzug gab. Alles war voller Schmutz, Staub und Spinnweben. Es herrschte ein undefinierbarer Geruch, der Leo merkwürdigerweise nicht unangenehm war. Er hatte etwas Heimeliges, wie eine Erinnerung an die Jugendzeit. Als Kind war er einige Male hier oben gewesen, später dann nicht mehr. Dies war nicht »sein« Teil des Wienerwaldes. Außerdem war die Warte schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gesperrt. Der Verein, in dessen Eigentum sie stand, hatte kein Geld und offenbar auch zu wenig Energie, welches aufzutreiben. Es gab genügend andere Aussichtspunkte, und dieser hier bot trotz seiner Höhe von über dreißig Metern keine besonders sensationelle Aussicht. Abgesehen davon waren die Kinder von heute wahrscheinlich anders gestrickt, ging es Leo durch den Kopf: Sie hatten, wie er von seiner Nichte und seinem Neffen wusste, in Videospielen schwindelerregende Abgründe überquert, waren an Wänden von Wolkenkratzern hinaufgeklettert und hatten sich in Liftschächten abgeseilt, sodass ein simpler Aussichtsturm in der realen Welt keinen Kick mehr bot. Irgendwie traurig.
Die zahlreichen Fußspuren waren durch die Tatortleute schon dokumentiert, sonst hätten sie ihn nicht hinaufgelassen. Hier und da lag ein Stück Holz herum, an den Wänden hingen ein paar bis zur Unkenntlichkeit verblasste und angelaufene Fotos. Erst im vorletzten Stockwerk fanden sich Dinge aus der Gegenwart: ein Schlafsack, zwei Decken, ein paar Kapuzenshirts, eine Jeans, ein kleiner Campingkocher, angebrochene Packungen Reis, Fladenbrot und Trockenfrüchte, eine Dose mit Tee, ein Kochtopf, ein fast voller Fünfliterkanister Wasser, ein Seifenspender, ein paar Lappen und Tücher, vier Päckchen Zigaretten. Es war offensichtlich, dass hier jemand eine Zeit lang gehaust hatte oder immer noch hauste. Wohl kaum der Tote, wenn der der Eigentümer der Luxuskarre war.
Während er weiterstieg zum letzten, leeren Stockwerk und dann zur Plattform, hörte er rasche Schritte weiter unten auf der Treppe. Es war Cleo, die kurz nach ihm, kein bisschen außer Atem, oben ankam. Gemeinsam sahen sie sich das gebrochene Geländer an, das sich an der der Eingangsluke gegenüberliegenden Seite befand. Die ursprüngliche massive Brüstung existierte an zwei der vier Seiten nicht mehr. Irgendwann, offenbar schon vor sehr langer Zeit, hatte man die fehlenden Teile durch simple Querlatten ersetzt, an denen der Zahn der Zeit ebenfalls kräftig genagt hatte. Sendlinger hatte recht gehabt: Das Geländer wirkte mit großer Kraft gebrochen, als hätte man einen sehr schweren Gegenstand – oder einen menschlichen Körper – dagegen geschleudert. Die klaffende Lücke öffnete sich bedrohlich zu einem über dreißig Meter tiefen Abgrund. Dazu kam, dass die Überdachung der Plattform die Bodenbretter nicht vollständig vor Wind und Wetter hatte schützen können. Sie waren glitschig von Grünspan, teils morsch und trügerisch. Leo fühlte sich hier oben ausgesprochen unwohl. Das hinderte ihn allerdings nicht daran zu bemerken, dass auch hier schwache Fußspuren sichtbar waren.
»Der Tote heißt, oder hieß, Adrian Stuiber, MSc – Master of Science –, zweiunddreißig Jahre alt, Gesellschafter bei einer Firma namens BeingAlive, irgendetwas mit Software«, berichtete Cleo, als sie wieder unten waren. »Er ist auch der Halter des Wagens. Verheiratet, wohnhaft Zaditschgasse 24, das ist im Zweiten. Im Auto nichts Bemerkenswertes.«
»Gut, dann überbringen wir die traurige Nachricht jetzt gleich. Bis wir dort sind, wird es fast neun sein.«
2
Die Zaditschgasse befand sich in einer ruhigen Wohngegend mit vier- bis fünfstöckigen Gründerzeitbauten. Als sie das Auto abgestellt hatten, atmete Leo kurz durch. Es war keine angenehme Aufgabe, einer Frau das Ableben ihres Mannes mitteilen zu müssen, aber es gehörte nun einmal dazu. Auch deshalb, um beurteilen zu können, ob die Frau etwas mit dem Tod zu tun haben könnte. Aber noch waren sie ja nicht einmal sicher, ob es Fremdeinwirkung gegeben hatte, noch gab es die Möglichkeit eines Unfalles oder Freitodes.
Die Wohnung der Stuibers lag im zweiten Stock. Auf Cleos Klingeln öffnete eine Frau, bei deren Anblick Leo sofort der Begriff »spröde« einfiel. Etwa Mitte dreißig, schlank, kurze dunkle Haare, schmale Brille mit schwarzem Vollrandgestell, die ihr Gesicht dominierte und ihr eine noch strengere Ausstrahlung verlieh als die, welche sie von Natur aus schon hatte. Sie lächelte nicht, sagte auch nichts, sondern blickte die beiden unangekündigten Besucher nur fragend an.
Nachdem Leo sich als Chefinspektor Lang und Cleo als Bezirksinspektorin Oberlehner vorgestellt und sich vergewissert hatte, die Ehefrau Adrian Stuibers vor sich zu haben, ersuchte er, hereinkommen zu dürfen.
»Wenn Sie bitte die Schuhe ausziehen. Da drin sind Patschen«, sagte sie, auf eine kleine Truhe deutend. Leo hatte wenig Lust auf die Patschennummer, aber die besondere Situation ließ ihn widerspruchslos gehorchen.
Schweigend ging die Frau durch einen Gang mit mehreren Türen voraus zum zurückhaltend eingerichteten Wohnzimmer, das zur Straße ging. Beim Passieren der letzten Tür ertönte mehrmaliges Bellen, worauf Frau Stuiber einen pfeffer- und-salz-farbigen Mittelschnauzer herausließ. Mit einem »Scht, Lissy!« brachte sie den Hund zum Schweigen, worauf sich dieser dem ausführlichen Beschnuppern der Eindringlinge widmete.
Sie nahmen auf einer Sitzgruppe rund um einen niedrigen Couchtisch Platz. Frau Stuiber legte die Hände in den Schoß mit den Worten: »Also, worum geht’s?«
Cleo hatte eingewilligt, die schlimme Nachricht zu überbringen, sozusagen von Frau zu Frau. Sie redete nicht drum herum, sondern berichtete mit leiser, einfühlsamer Stimme zügig vom Geschehenen. »Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann verstorben ist. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir lediglich, dass er – vermutlich gestern – als Folge eines Herabfallens aus großer Höhe umgekommen ist. Wir können weder einen Unfall noch Suizid oder Fremdverschulden ausschließen. Es tut mir sehr leid.«
Die Frau schwieg weiter, Cleo mit einem verächtlichen Gesichtsausdruck betrachtend. Der Hund winselte leise.
Nach einer unendlich lang anmutenden Zeit des Schweigens sprach sie mit einer Stimme, in der sich die Verachtung eisig fortsetzte: »Ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Wenn das irgendein makabrer Scherz sein soll, werde ich Sie zur Rechenschaft ziehen. Seien Sie versichert: Es ist völlig unmöglich, dass mein Mann tot aufgefunden wurde. Absolut ausgeschlossen. Reine Idiotie.«
Der schlimmste Fall, ging es Lang durch den Kopf. Es kam vor, dass Angehörige von Opfern sich durch völlige Leugnung der Realität zu schützen versuchten. Solange man es in Abrede stellte, war es einfach nicht wahr. Dieser Situation waren Cleo und er nicht gewachsen. Sie brauchten psychologische Assistenz. Rotes Kreuz, Kriseninterventionsteam? Doch dann sprach Frau Stuiber weiter.
»Er kann nicht gestorben sein, egal ob gestern oder heute, weil er schon lange tot ist. Mein Mann ist im September vergangenen Jahres gestorben. Adrian hatte Leberkrebs, leider zu spät erkannt. Die sechs bis zwölf Monate, die ihm mit Palliativbehandlung geblieben wären, wollte er nicht abwarten. Er hat sich deshalb von mir und Lissy verabschiedet und in der Schweiz Sterbehilfe in Anspruch genommen. Ihre Behauptungen sind also völlig absurd. Ich werde mich beschweren.«
Diese Erklärungen erschütterten Lang noch mehr als die vorhin befürchtete Realitätsleugnung der Ehefrau. Wie war es nur möglich, dass Cleo bei der Identitätsfeststellung so nachlässig gewesen war? Wie hatte sie das Ableben des Mannes übersehen können? Normalerweise gab es niemanden, der gewissenhafter und sorgfältiger als Cleo arbeitete.
Aber Cleo ließ sich nicht so leicht ins Bockshorn jagen. »Haben Sie eine Sterbeurkunde? Wie wurden die Formalitäten abgewickelt? Gab es eine Beisetzung? Eine Verlassenschaftsabhandlung bei einem Notar?«, feuerte sie eine Frage nach der anderen in Richtung der Witwe ab.
»Da das alles zu Lebzeiten meines Mannes geregelt werden konnte, hat sich ein Freund um die Formalitäten gekümmert. Er hat alles Amtliche für uns erledigt. Patryk Trześniewski heißt er, ein Kindheitsfreund von uns beiden und Arbeitskollege meines Mannes, er hat mir danach auch mein Erbe ausgezahlt. Es war nicht sehr viel, da Adrians Firma sich noch im Aufbau befindet. Ich bin aber zum Glück ohnehin nicht drauf angewiesen, ich habe einen sicheren Job in der Universitätsverwaltung. Eine Sterbeurkunde habe ich zwar nicht, aber natürlich könnte ich eine bekommen, ein Anruf bei Patryk genügt. Beisetzung wollten wir keine, da Adrian Vollwaise und ich seine einzige Angehörige war. Seine sterblichen Überreste wurden verbrannt und die Asche auf einem Grundstück des Bestattungsunternehmens verstreut. Es gibt nicht den leisesten Zweifel daran, dass Adrian seit über einem Jahr tot ist. Wir haben vorgestern noch darüber gesprochen.«
»Sie und dieser Patryk?«, mischte sich Lang in die Diskussion.
»Nein, ich und Adrian. Ich spreche regelmäßig mit ihm, etwa zweimal wöchentlich.« Diesen Satz sprach sie mit der triumphierenden Gewissheit einer Person aus, die einen unwiderlegbaren Beweis vorgebracht hatte.
Lang tauschte einen vielsagenden Blick mit Cleo. Offenbar war der Geisteszustand der Frau noch viel komplizierter, als die bloße Realitätsverweigerung hatte befürchten lassen. Sie glaubte, dass ihr Ehepartner schon länger tot war und führte als Beweis dafür regelmäßige Gespräche mit ihm an. Per Séance, vermutlich. Er beschloss, auf die absurde Behauptung einzugehen.
»Wie funktionieren diese regelmäßigen Gespräche mit einem Toten, Frau Stuiber? Können Sie uns dazu Näheres sagen?«
Nun passierte etwas Unerwartetes. Olivia Stuiber lächelte plötzlich amüsiert.
»Sie halten mich für verrückt, ist ja klar. Das kann ich Ihnen eigentlich gar nicht verübeln. Ich kann aber alles erklären.«
Ihre beiden Zuhörer nickten. »Ja, bitte«, sagte Lang.
»Der Schlüssel liegt in der Tätigkeit meines Mannes. Er war schon in der Schulzeit fasziniert von virtuellen Welten und künstlicher Intelligenz. Zusammen mit zwei Klassenkameraden – Zora und Kevin – gründete er nach Abschluss seines Studiums das Unternehmen BeingAlive. Sie hatten eine ganz besondere, einmalige Idee und die Fähigkeiten, sie umsetzen zu können. Dieses Unternehmen sollte mittels künstlicher Intelligenz Tote wiederauferstehen lassen.«
Sie betrachtete die Gesichter der Kriminalbeamten, als erwartete sie einen Einwand, doch beide schwiegen.
»Sicher kennen Sie Avatare aus Videospielen und vielleicht als Assistenten bei Kundendiensten. Das Prinzip von BeingAlive ist ein Ähnliches, aber die Avatare beruhen in diesem Fall auf realen Personen und verkörpern diese perfekt. Die Programmier- und Modelliertechnik dahinter ist das Besondere, das Alleinstellungsmerkmal der Firma. Je besser das zur Verfügung stehende Ausgangsmaterial, desto realistischer ist das Resultat. Sie bekommen einen virtuellen 3D-Gesprächspartner, der von einem lebenden Menschen – dem Verstorbenen – nicht zu unterscheiden ist. Noch dazu passt er sich als lernendes System selbst an, das heißt, die Ergebnisse Ihrer Gespräche fließen in die virtuelle Persönlichkeit ein. Es kann sich also ein Verstorbener weiterentwickeln und auf Themen eingehen, die erst nach seinem Tod aufgekommen sind. Ihre Reaktionen lassen ihn reifen, genau wie einen richtigen Menschen. Es ist, als wäre er noch da. Als wäre er nie gestorben. Darum heißt die Firma BeingAlive.«
Leo fühlte, wie er Gänsehaut bekam. Je aufgeräumter Olivia Stuiber bei ihrem Bericht über den Untoten wurde, desto mehr rebellierte sein Inneres. Cleo war jedoch nicht so leicht aus der Fassung zu bringen.
»Sie führten also Videogespräche mit seinem Avatar und es war, als würde er Ihnen selbst gegenübersitzen? Wie lange waren Sie denn verheiratet?«
»Drei Jahre, plus vier Jahre Lebensgemeinschaft, aber wir kennen uns schon seit der Kindheit. Wir wuchsen in der gleichen Straße auf. Ich bin vier Jahre älter – für mich war er ursprünglich mehr so ein uninteressanter kleiner Scheißer, bis ich ihn nach einem längeren Englandaufenthalt wiedersah. Da hatte er gerade maturiert und wirkte viel erwachsener. Nach seinem Studienabschluss sind wir zusammengezogen und haben, wie gesagt, vier Jahre später geheiratet. Da fing die Firma an, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und er konnte es sich leisten, seinen Job als Programmierer bei der Xyxtel zu kündigen. Glauben Sie mir, ich kenne ihn wie meine Westentasche. Sogar seine unterschiedlichen Stimmungen fanden sich in seinem Avatar wieder, mal war er lustig, mal müde, mal interessiert, mal mehr zum Plaudern aufgelegt, mal weniger. Aber Lissy wollte er immer sehen.«
»Sehen? Wie meinen Sie das?«, fiel Cleo ein.
»Na ja, es findet natürlich ein Austausch in beide Richtungen statt, sodass der Gesprächspartner die Reaktionen des Gegenübers interpretieren kann. Via Webcam wird mein Bild übertragen, mein Mann – beziehungsweise das Programm – weiß also genau, was sich diesseits des Bildschirms abspielt. Er merkt es immer sofort, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit gestresst bin, ein neues Kleid anhabe, der Hund müde ist … oder, wenn ich etwas an der Einrichtung ändere.«
Lang holte sein Handy hervor mit einer der Nahaufnahmen, die er vom durch den Sturz kaum beeinträchtigten Gesicht des Aussichtsturmtoten gemacht hatte.
»Bitte sehen Sie sich dieses Bild einmal an, Frau Stuiber. Es wurde vor etwa zwei Stunden gemacht.«
Als ihr Blick auf das Foto fiel, wandelte sich ihr Gesichtsausdruck schlagartig zu einer erschrockenen Grimasse. Hatte sie zuvor schon fast liebenswürdig und beflissen gewirkt, starrte sie nun das Handybild mit offenem Mund an. Dann fasste sie sich jedoch rasch wieder.
»Dieses Bild sieht Adrian tatsächlich sehr ähnlich. Fast wäre ich drauf hereingefallen. Aber schließlich war er ein häufig vorkommender Typ, nicht, wie man so sagt, ein Charakterkopf. Ich frage mich nur, wozu jemand seine Identität angenommen hat. Was könnte der davon haben? Wirklich komisch.«
Wieder tauschten Lang und Cleo Blicke. Cleo sprach als Erste.
»Wir haben einen Personalausweis und einen Führerschein gefunden, beide gültig. Das Auto ist auf den Namen Ihres Mannes angemeldet. Das Ableben Ihres Gatten ist bei uns im Zentralen Melderegister nicht vermerkt, sonst könnte das Auto natürlich auch nicht auf ihn laufen. Er war laut unseren Unterlagen bis zu seinem Tod, gestern, unter dieser Adresse wohnhaft.«
Auch darauf wusste Olivia Stuiber eine Antwort: »Bestimmt deshalb, weil er in der Schweiz gestorben ist. Ein Kommunikationsfehler, oder Datenschutz, oder was weiß ich.« Ihre Stimme klang jedoch nicht mehr ganz so fest wie zuvor.
»Ich nehme an, dass Sie nach so langer Zeit kein DNA-haltiges Material von ihm mehr haben, eine Haarbürste mit Haaren oder so?«, ignorierte Cleo die Einwände. »Aber Sie können uns bestimmt seinen Zahnarzt nennen.«
»Klar, Dr. Neumann«, kam es sofort. »Ich bin auch Patientin bei ihm. Sie wollen ein Röntgenbild seiner Zähne anfordern?«
Cleo nickte. »Ja, beziehungsweise den Zahnstatus.«
»Dann wird sich ja herausstellen, dass es jemand anderer war«, kam es von Frau Stuiber umgehend.
Lang wollte diese absurde Debatte so schnell wie möglich beenden. »Bitte kommen Sie morgen früh in die Gerichtsmedizin in die Sensengasse, um halb acht. Dann können Sie den Toten noch vor der Obduktion betrachten.« Mit diesen Worten erhob er sich. »Ach ja, können Sie uns noch sagen, wo Sie gestern Nachmittag waren?«
»Gestern? Da hatte ich frei, Überstunden abbauen. Ich war den ganzen Tag zu Hause, nur einmal war ich mit Lissy draußen, so gegen fünf. Bevor Sie fragen – es gibt keine Zeugen.«
3
18. November
Lang, Cleo und Olivia Stuiber trafen sich um Punkt halb acht vor dem Department für Gerichtsmedizin, wie es offiziell heißt. Der vorher verständigte Dr. Sendlinger sperrte die Tür von innen auf und ließ sie – eine halbe Stunde vor dem offiziellen Amtsbeginn – ein.
Die Witwe, ob frischgebacken oder schon seit über einem Jahr, schien die Konfrontation mit dem ihrer offensichtlichen Überzeugung nach falschen Ehemann kaum erwarten zu können. Lang hatte den Eindruck, dass sie am liebsten mit langen Schritten vorangegangen wäre, hätte sie den Weg gekannt.
Als der Gerichtsmediziner das Laken zurückschlug, das den Verstorbenen bedeckt hatte, stand sie schon ganz nah neben dem Seziertisch. Drei Augenpaare beobachteten gespannt, wie sie die Luft scharf einsog und ihr Gesicht noch näher an das der Leiche brachte. Dann richtete sie sich wieder auf, den Blick unverwandt auf die zu Marmor erstarrten Züge gerichtet.
Eine volle Minute stand sie völlig ausdruckslos da. Keiner der übrigen Anwesenden wollte die Spannung durch eine Frage brechen. Sie ließen die Stille wirken.
Plötzlich ging sie mit zwei langen Schritten zum Fußende des Tisches und schlug das Laken auf dieser Seite zurück, sodass die nackten Füße zum Vorschein kamen. Sie nahm den rechten Fuß in die Hand und drehte ihn nach außen, wodurch der Innenrist sichtbar wurde. Hier zeigte sich, nur für den sehr aufmerksamen Beobachter sichtbar, eine feine, aber lange weiße Linie, noch weißer als der Rest des Fußes. Olivia Stuiber starrte sie eine Weile an, dann ließ sie den Fuß los.
Was nun folgte, hatte weder Lang noch Cleo und schon gar nicht Dr. Sendlinger vorhergesehen. Ebenso rasch wie zuvor zum Fußende bewegte sich die Witwe wieder zurück zum Kopfende und spuckte dem Leichnam ohne Vorwarnung mitten ins Gesicht. Während der Speichel über die kalte Nase die Wangen herunterrann, bahnte sich aus ihrem Inneren ein unartikuliertes, tierisches Geräusch den Weg hinaus. Es wandelte sich zu einem stimmhaften Schluchzen, steigerte sich zu einem Geheul und brach dann jäh ab.
Sendlinger und Lang hatten sie nach der Spuckattacke sofort links und rechts gepackt, um weitere Leichenschändungen zu verhindern. Bedrohlich krümmten sich ihre Finger – gewiss hätten sich ihre Nägel in die angespuckten Wangen vergraben, wenn sie nicht bewegungsunfähig gewesen wäre. Cleo versuchte, mit beruhigenden Worten durch die zusammenhanglosen Laute zu dringen, als diese sich zu Worten formten – geschriene, gespuckte Hassworte.
»Verdammtes Dreckschwein! Schweinehund! Arschloch! Hurenbock! Scheißkerl! Du Stück Dreck, du Aas! Du Ratte! Du Satan! Du … du … du …« Frau Stuibers altmodische Auswahl von Schmähungen wies darauf hin, dass sie wenig Erfahrung auf diesem Gebiet besaß. Schon bald gingen ihr die Beschimpfungen aus und die Tirade endete in einem weiteren, diesmal kläglichen Schluchzen.
Cleo versuchte wieder, die Frau zu beruhigen. Als das Schluchzen nachließ, nickte sie den Männern zu, worauf diese ihren Griff lockerten. Sendlinger steuerte ein Stück Papier bei, das er von einer großen Rolle abgerissen hatte. Olivia Stuiber vergrub ihr Gesicht zuerst darin, dann schnäuzte sie sich lautstark.
»Es ist Adrian. Ich habe ihn an der Narbe am Fuß erkannt. Ein ziemlich schlimmer Fahrradunfall, als er noch ein Kind war. Ein anderer Junge wurde dabei getötet und Adrian hatte einen tiefen Schnitt, von dem ihm diese Narbe geblieben ist.«
Sie hatte das leise, mit beherrschter Stimme gesagt. Dann flammte ihre Wut wieder auf, vermischt mit Traurigkeit.
»Warum hat er das gemacht, das Arschloch? Mich glauben lassen, dass er tot ist? Dann habe ich die ganze Zeit also noch mit ihm selbst geredet – nicht mit diesem Computerwesen? Oder doch? Der Patryk, der ist auch ein Riesenarschloch, dass der da mitgemacht hat! Spielt sich auf als Freund …« Ihre Stimme erstarb.
»Dann sind wir hier wohl fertig«, sagte Leo nach einer Weile. »Brauchen Sie Hilfe, Frau Stuiber? Sollen wir Ihnen ein Taxi rufen?«
Doch Olivia Stuiber schüttelte den Kopf. Sie wandte sich zur Tür, dann drehte sie sich noch einmal um.
»Eines sage ich Ihnen: Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihn selber umgebracht, da können Sie sicher sein!«
4
Als Lang und Cleo in der Berggasse eintrafen, platzten sie mitten in eine Anekdote, die Gabriel Schneebauer für Nowotny und Goncalves zum Besten gab. Wie immer, wenn es um seine Familie ging, war der sonst eher schweigsame lange Blonde sehr gesprächig. Für die beiden Neuankömmlinge fing er noch einmal neu an.
»Also wie gesagt, meine Schwiemu ist ja eher nicht von der besonders lockeren Sorte. Alles muss seine Ordnung haben, auch bei den Kindern. Gestern waren wir also bei ihnen zum Nachtmahl, vorher haben die Buben noch im Garten herumgetobt, sie waren schon ziemlich hungrig. Aber nein, alles ordentlich, Schuhe aus, Jacken aus, Hände und Gesicht waschen, zum gedeckten Tisch setzen, warten, bis alle da sind. Die Suppe stand schon am Tisch, aber ich kam direkt von der Arbeit, ohne mich konnte nicht angefangen werden. Die beiden waren schon ziemlich lästig: Wieso krieg ich noch nix, ich hab so einen Hunger und so weiter. Die Schwiemu musste ihre ganze Autorität aufbieten. Als ich dann endlich da war, war sie sehr erleichtert. Sie schöpfte sofort die Suppe ein und sagte zu den Zwergen: ›So, jetzt könnt ihr reinhauen!‹ Und was macht der Kleine, der Benny? Er strahlt übers ganze Gesicht, nimmt den Suppenlöffel und haut damit volle Kraft in den Teller, dass das Zeug nur so in der Gegend herumspritzt! Tomatensuppe, könnts euch vorstellen! Nachher voll das Chaos, die Schwiemu hat gekreischt, der Benny war sich keiner Schuld bewusst und die Maria und ich haben uns vor Lachen gebogen, was die Schwiemu natürlich noch böser gemacht hat. Ich sag euch …« Bei der Erinnerung an das Suppenchaos holte ihn das Lachen wieder ein.
Die anderen lachten mit, Nowotny auf seine »verinnerlichte« Art mit geräuschlosem Schulterschütteln, Goncalves nur halbherzig, weil ihn Erzählungen über Kinder nicht wirklich interessierten, Lang und Cleo etwas begeisterter, als dem Geschichtchen angemessen war, weil sie Gabriel mochten. Nach einer Zeit, die er als passend erachtete, kündigte Lang eine Teambesprechung um drei Uhr an.
»Wir haben vielleicht einen Fall. Bis drei wissen wir hoffentlich, ob es tatsächlich Fremdverschulden war. Schaut aber ziemlich danach aus.« Mit diesen Worten ging er in sein Büro in dem Wissen, dass Cleo nicht lange zögern würde, ihre Kollegen über den »Vielleicht-Fall« zu informieren. Außerdem würden sie und der Ehrgeizler Goncalves bis zum Beginn der Besprechung bestimmt alles recherchieren, was es zu diesem Zeitpunkt schon zu recherchieren gab.
5
Kaum hatte sich Leo widerwillig über einen Stapel Papierkram hergemacht, läutete sein Telefon. Erfreut hob er ab. Es war Karina Kovacs von der Zentrale.
»Hallo Leo. Ihr bearbeitet doch den Fall Adrian Stuiber, richtig? Wir haben eine Information hereingekriegt, dass es zu dieser Person eine Abgängigkeitsanzeige in der Nacht von vorgestern auf gestern gegeben hat, und zwar von einer Mona Schwarzäugl aus Graz. Zwar mit einigen Ungereimtheiten – der Mann, ihr Lebensgefährte, war zum Beispiel gar nicht bei ihr gemeldet –, aber sie hat die Grazer Kollegen anscheinend überzeugen können, dass etwas passiert sein müsse. Er war geschäftlich in Wien und hätte am Abend auf jeden Fall zu ihr nach Graz heimkommen müssen. Wegen des Wienbezugs wurde die Anzeige an alle unsere Posten weitergeleitet. Ich schicke sie dir jetzt gleich.«
»Danke, Karina«, erwiderte er, erstaunt, wie gut die stille Post offenbar funktionierte. Wenn doch die offiziellen Informationswege auch immer so effizient wären! Der »Noch-nicht-Fall« Adrian Stuiber war bisher gar nicht als Tötungsdelikt aktenkundig, aber die Zentrale in Person von Karina Kovacs wusste schon Bescheid, dass der Tote von der Aussichtswarte, zu dem sie ihn gestern geschickt hatte, diesen Namen trug.
Sorgfältig las er die Anzeige durch, die sich bereits in seinem Mail-Posteingang befand. Es handelte sich ohne Zweifel um denselben Mann, den Olivia Stuiber einige Stunden zuvor als ihren vermeintlich schon lange toten Ehegatten identifiziert hatte. Das Foto passte, die Personenbeschreibung auch. Sogar die Narbe am Fuß war erwähnt. Ob diese Mona Schwarzäugl etwas mit dem Untertauchen des Mannes zu tun hatte?
Aus der Anzeige ging auch hervor, dass die Grazer Polizei die Anzeigende zu beruhigen versucht hatte. Leo las: »Starker Nebel in Wien und Umgebung könnte ein Heimfahren verhindert haben. Fehlende Kommunikation evtl. wegen Schaden am Mobiltelefon oder leerem Akku.« Er konnte sich nicht vorstellen, dass sich die Frau dadurch hatte beschwichtigen lassen. Schließlich gab es noch andere Möglichkeiten der Verständigung, wenn ein Handy nicht funktionierte, und ein leerer Akku ließ sich aufladen. Sie waren ja nicht im Dschungel.
Frau Schwarzäugl hatte laut Protokoll zuletzt am Dienstag um halb vier mit ihrem Lebensgefährten telefoniert. Da hatte er einen letzten Termin für diesen Tag erwähnt, aber nicht gesagt, wann, wo und mit wem; er sei jedenfalls zum Abendessen wieder zu Hause. Am späten Abend hatte sie nur mehr die Mobilbox erreicht.
6
Wie erhofft, bekam Lang noch vor Beginn der Nachmittagsbesprechung die Ergebnisse der Obduktion in Kurzform. Vielleicht hat sich der Sendlinger besonders beeilt, weil ihn der Auftritt dieser Olivia selber neugierig gemacht hat, ging es ihm durch den Kopf.
»Eindeutig Fremdverschulden«, erklärte er seinen erwartungsvollen Zuhörern. »Todesursache war der Sturz, wie vermutet. Der Tote muss aber vorher einen sehr starken Schlag in den Rücken bekommen haben. Sendlinger und seine Leute konnten eines der herumliegenden Kanthölzer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Tatwaffe identifizieren. Es wird noch genauer auf Spuren untersucht. Sie haben rekonstruiert, dass er dadurch auf die Brüstung geschleudert wurde – die war, wie Cleo und ich gestern gesehen haben, mit großer Wucht gebrochen – und hinunterfiel. Das bedeutet: Mord. Keinerlei Anzeichen, dass er sich noch irgendwo festhalten konnte.«
Alle nickten. Lang bat Roberto Goncalves, eine Falltafel zu eröffnen und Cleo, die bisherigen Ereignisse inklusive der Reaktionen Olivia Stuibers zu schildern.
»De ham doch an Huscher«, ließ sich Nowotny vernehmen. Auf die fragenden Blicke seiner Kollegen ergänzte er: »Mit dem BeingAlive-Glumpert und den Videokonferenzn mit an untodn Todn, wauns mi frogts.« Eigentlich war Leo selten einer Meinung mit seinem gern provozierenden älteren Mitarbeiter, aber diesmal musste er ihm recht geben. Ihm selbst waren Gespräche mit Verstorbenen auch nicht geheuer.
»Also für mich klingt das recht interessant, besonders als Geschäftsidee«, warf Roberto Goncalves ein, vielleicht auch nur, um Nowotny zu ärgern, mit dem ihn ein besonderes, Vater-Sohn-ähnliches Verhältnis verband, das ständig zwischen freundschaftlicher gegenseitiger Verarsche und albernen Streitereien oszillierte. »Nur, dass es funktioniert, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Seine Frau hat dieser Stuiber jedenfalls nur am Schmäh gehalten.«
Cleo hatte schon ein wenig im Netz recherchiert. »Chatbots, die dir sozusagen das Chatten mit Toten ermöglichen, gibt es jedenfalls schon«, sagte sie. »Und dass er mit seiner Frau nicht via Avatar kommuniziert hat, heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, dass es nicht trotzdem funktionieren kann – logisch.« Hier stimmte Goncalves durch eifriges Nicken ein, weil er nicht von einer Frau für unlogisch gehalten werden wollte.
Lang war jedoch noch lange nicht fertig. »Der Todeszeitpunkt ist gut eingrenzbar, sagt Sendlinger, weil er zu Mittag einen Hamburger bei O’Brian gegessen hat. Der Kassenbon mit der genauen Uhrzeit wurde bei ihm gefunden. Demnach muss er zwischen vier Uhr und halb fünf am Nachmittag gestorben sein.«
»Gschmack hat er oiso kan ghabt«, trug Nowotny wieder bei. »Vielleicht beim Auto, aber ned beim Essn!« Zum zweiten Mal musste Leo ihm insgeheim recht geben, er mochte das wegwerfverpackte Hamburger-und-Pommes-Zeug in steriler Umgebung auch nicht. Beunruhigend, wenn ihm ausgerechnet Helmut jetzt schon das Wort aus dem Mund nahm.
Schneebauer war unruhig geworden. Er schickte sich schon an, die Hamburger-Kultur zu relativieren – mit zwei kleinen Kindern waren die Besuche dort wider aller pädagogischer Vernunft wahrscheinlich kaum vermeidbar. Doch Roberto kam ihm grinsend zuvor mit der Bemerkung: »Aber die Kinder können dort richtig reinhauen, stimmt’s, Schneezi?«
Bevor das Ganze in eine Diskussion über Junkfood, gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit ausarten konnte, schnitt Lang das Gelächter ab durch die nächste Information, jene der Abgängigkeitsanzeige Mona Schwarzäugls.
»Jetzt wird vieles klar«, meinte Goncalves. »Er hatte eine Neue gefunden und ist zu der gezogen, nach Graz. Die Alte hat er, wie gesagt, inzwischen am Schmäh gehalten.«
»Ja, aber warum?«, gab Cleo zu bedenken. »Es hätte doch gereicht, ihr das Gschichtl vom unheilbaren Krebs und dem Freitod in der Schweiz hineinzudrücken. Wozu dann noch diese unheimlichen Videokonferenzen?«
»Vielleicht hat das alles gar nichts mit dem Tötungsdelikt zu tun«, unterbrach Lang. »Sendlingers Leute haben nämlich noch etwas sehr Wichtiges herausgefunden. Ihr erinnert euch, dass oben in einer Turmkammer Habseligkeiten herumgelegen sind?« Alle nickten.
»Darauf und auf der Brieftasche wurden Fingerabdrücke sichergestellt. Auch DNA, aber die ist noch nicht fertig untersucht. Die Fingerabdrücke genügen aber schon völlig zur Identifikation von einem unserer Bekannten. Es handelt sich um einen gewissen Farzad Zahedi, 21 Jahre alt, Nationalität afghanisch, vor sechs Jahren als unbegleiteter Jugendlicher nach Wien gekommen. Sein Asylantrag ist in letzter Instanz abgewiesen worden. Er ist dreimal vorbestraft, davon zweimal für Gewaltdelikte in Zusammenhang mit Drogenhandel, und hat zweimal gesessen.« Während des Sprechens projizierte er das Polizeifoto eines schwarzhaarigen jungen Mannes mit bitterem Blick, Dreitagebart und modischer Frisur, die Haare seitlich ganz kurz und oben lang und zurückgekämmt, an die Wand. »Nach seiner letzten Entlassung – das war am 5. Oktober – ist er untergetaucht, entweder aus Angst vor der Abschiebung oder weil er ungestört weiter dealen wollte. Bei seiner zwei Jahre jüngeren Schwester« – er warf einen Blick in die Unterlagen – »Fariba Zahedi, die in Wien lebt, war er nicht. Sie ist Asylberechtigte und hat bereits unbefristetes Aufenthaltsrecht. Sie hat voriges Jahr maturiert und ist jetzt Studentin, steht hier.«
Kaum hatte er den letzten Satz gesprochen, fingen alle an, durcheinander zu reden. Der Tenor der Satzfetzen war klar: Adrian Stuiber war auf den Turm gestiegen und hatte Zahedi dort überrascht, worauf dieser ihn vom Turm geworfen hatte, weil er sich eine Aufdeckung seines Verstecks nicht leisten konnte.
»Aber was hat der Stuiber überhaupt dort zum Suachn ghabt?«, wollte Nowotny wissen, als die Gemüter sich beruhigt hatten.
»Und der Zahedi, um vier Uhr nachmittags? Und warum war das Schild entfernt, er hatte doch kein Interesse, dort entdeckt zu werden?«, so Schneebauer.
»Der Zahedi ist grade mal eins achtundsechzig, kleiner und leichter als das Opfer«, trug Lang bei. »Er hauste im vorletzten Stockwerk. Wie hat er Stuiber auf die Plattform bekommen und ihn dazu gebracht, dass er ihm den Rücken zugekehrt hat?« Er blickte in die Runde, doch alle waren verstummt.
»Ach ja, und da ist noch etwas: Es gibt dort oben Fußabdrücke vom Opfer – klar – und von drei weiteren Personen. Die vom Zahedi werden dabei sein, der hat Schuhgröße 42. Die beiden anderen haben 40,5 und 44. Das Interessante daran: An einer Stelle überschneiden sie sich mit Stuibers, und zwar so, dass die unbekannten Abdrücke, die kleineren, über denen Stuibers liegen. An zwei Stellen gibt’s Überdeckungen der Größe-42-Abdrücke, also Zahedis, durch die beiden anderen, an keiner Stelle sind Zahedis Spuren über denen der anderen.«
»Soll heißen, die Unbekannten waren wahrscheinlich nach Zahedi dort«, schloss Cleo.
»Das, oder gleichzeitig mit ihm«, nickte Lang. »Allerdings sind alle Fußspuren sehr schwach. Sendlinger war mächtig stolz, dass sie überhaupt so viel herausgefunden haben. Wie sicher und gerichtlich belastbar das Ganze ist, wollte er mir nicht sagen.«
Für Goncalves waren die unbekannten Fußspuren kein Widerspruch zu Zahedis Täterschaft. »Ganz klar, er hat dort mit zwei Kumpanen eine kleine Party gefeiert, als ihnen Stuiber dazwischenkam. Zu dritt war es keine Kunst, ihn hinaufzuschaffen und runterzustoßen.«
»Und was hat der Stuiber dort jetzt wirklich zum Suachn ghabt?«, wiederholte Nowotny seinen Einwand.
»Wir werden es herausfinden«, setzte Lang ein Ende an die Mutmaßungen.
»Vorher sollten wir aber einen Fallnamen festlegen. Wer hat eine Idee?«
»Graf Dracula. Untoter, Zombie, Vampir«, kam Nowotny wie aus der Pistole geschossen mit ebenso makabren wie unmöglichen Vorschlägen. Lang ließ sich nicht provozieren und nickte Roberto zu, die Begriffe auf ein Flipchart zu schreiben.
»Er ist vom Himmel gefallen – wie wär’s mit Meteor?«, trug Goncalves bei.
»Dann kannst aa glei ›Apfel‹ vorschlagen«, zog Nowotny diesen Gedanken ins Lächerliche. Auf die verständnislosen Blicke der anderen ergänzte er: »Newton, wissts eh, Opfe foit vom Bam, Schwerkraft entdeckt.«
Während Goncalves noch die Augen verdrehte, nannte Cleo: »Avatar. Oder Phaëthon«. Da sie anhand der verwirrten Gesichter erkannte, dass bei den anderen keine tieferen Kenntnisse der griechischen Mythologie vorhanden waren, fuhr sie fort: »Der durfte sich den Sonnenwagen für einen Tag ausleihen und machte Bruch damit, wodurch die Erde fast zerstört worden wäre. Zeus musste ihn zum Absturz bringen.«
»Da gab’s doch noch so einen Griechen, der vom Himmel fiel – Ikarus, oder?«, sagte Schneebauer, der im Internet herumgesucht hatte. »Oder wie wär’s mit ›impacto‹?«
»Gute Idee, ›Aufschlag‹ auf Portugiesisch, woher weißt denn du das?«, zeigte sich Roberto, Sohn eines Brasilianers, erstaunt.
»Das mit dem Portugiesischen wusste ich nicht, aber die Maria und ich, wir machen gerade einen Spanischkurs an der Volkshochschule, und dieses ›impacto‹ heißt auf Spanisch dasselbe.«
Auch Lang wollte nicht hintanstehen. »Mir ist ›Türmer‹ eingefallen, weil er einerseits von einem Turm gestürzt wurde und andererseits vor seiner Frau getürmt ist.«
Nach kurzer Diskussion wurde »Ikarus« zum Fallnamen gewählt.
Es gab eine Menge zu tun, wie sie bei der Erstellung der To-do-Liste feststellten. Patryk Trześniewski musste befragt werden, ebenso wie Mona Schwarzäugl. Lang hatte bereits vor Beginn der Besprechung den Kollegen Fladischer von der Grazer Polizei verständigt. Sie waren übereingekommen, dass er, Fladischer, noch die Lebensgefährtin informieren und dann an Langs Gruppe übergeben würde. Die Firma BeingAlive war zu analysieren, die Handydaten von »Ikarus« anzufordern und die Kontodaten bei den beiden Banken, von denen er Bankomatkarten bei sich gehabt hatte. Nach Zahedi sollte gesucht oder sogar öffentlich gefahndet und seine Schwester im Auge behalten werden, all das musste Leo noch mit Sickinger abstimmen.
Sie kamen überein, dass er und Cleo morgen nach Graz fahren würden, während Nowotny und Goncalves den Lügenbaron Trześniewski in die Mangel nehmen würden.
»Zitiert ihn hierher«, sagte Lang. »Dann könnt ihr ihn auch gleich über diese Firma ausfragen, er war ja laut Frau Stuiber sowohl Jugendfreund als auch Arbeitskollege unseres ›Ikarus’‹, oder müsste es jetzt ›Ikarusses‹ heißen? Na, egal.« Der Name dieses vom Himmel gestürzten Griechen war vielleicht doch nicht so günstig.
7
Langs Vorgesetzter Bruno Sickinger empfing ihn mit unverhohlener Neugierde. Offenbar war die Kunde von der »rasenden Witwe« auch schon zu ihm gedrungen.
Nach Leos ausführlichem Bericht lehnte sich der Oberst nachdenklich zurück. Die Sache drohte kompliziert und unangenehm zu werden.
»Das mit den Handy- und den Kontodaten werde ich gleich bei Brodnig beantragen«, sagte er nach einer Weile, den Staatsanwalt meinend. »Der Studentin können wir zwei Leute vor die Tür stellen. Aber was machen wir mit diesem Zahedi? Was hast du vor?«
»Na, ihn zur Fahndung ausschreiben, natürlich. Die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Alle Voraussetzungen sind gegeben. Er hat sich schon vorher der Festnahme entzogen, ist unbekannten Aufenthalts und war nachweislich am Tatort. Er hat die Brieftasche des Mordopfers berührt.«
»Das wird wieder eine Riesenaffäre in der Presse, da können wir uns auf etwas gefasst machen«, maulte Sickinger. Lang wusste, was er meinte.
Einerseits die Boulevardzeitungen, allen voran das »Neue Allgemeine Blatt«, von Lesern, Nichtlesern und heimlichen Lesern nur »Blatt« genannt, mit seinen versteckt rassistischen Angstmacher-Artikeln, alles natürlich garniert mit fetten Überschriften, hinter denen zur Sicherheit – man wollte ja nicht verklagt werden – ein Fragezeichen prangte. Ein polizeibekannter, gewalttätiger afghanischer Drogenhändler, nach dem im Zusammenhang mit einem Mord offen gefahndet wurde, noch dazu mit Foto – ein Fest für »Blatt« und Co., unsägliche Leserkommentare in den Foren inklusive. Die würden wahrscheinlich nicht einmal zögern, einen islamistisch-terroristischen Hintergrund in den Raum zu stellen, auch wenn weniger als nichts in diesem Fall darauf hindeutete.
Und andererseits die sogenannten Qualitätsmedien mit ihren subtilen Andeutungen von unterschwelligem Rassismus und ausländerfeindlicher Voreingenommenheit bei polizeilichen Ermittlungen. Leo hatte schon oft freundschaftliche, aber deswegen nicht minder leidenschaftliche Debatten mit Paul Erdinger ausgefochten, der sich als Reporterlegende der »Tribüne« natürlich dem obrigkeitskritischen Journalismus verpflichtet fühlte. Die »Tribüne« tat sich gern hervor in politischer Korrektheit und mit süffisant erhobenem moralischem Zeigefinger der Exekutive gegenüber. Sie lag ja auch manchmal richtig, wie Leo insgeheim zugeben musste. Er wollte sich aber nicht gemeinsam mit rassistisch eingestellten Kollegen – die es wohl tatsächlich gab – in einer Schublade wiederfinden.
»Afghanischer Drogen-Asylant Turmmörder?«, schreckte ihn Sickinger aus seinen Grübeleien auf, den »Blatt«-Stil imitierend, dabei sorgfältig darauf achtend, das Fragezeichen zu betonen.
»Keine Unschuldsvermutung für Asylwerber«, konterte Leo in der Art der »Tribüne«-Leitartikel. Dann setzte er fort: »Klar, da können wir uns ein nettes Platzerl zwischen allen Stühlen aussuchen. Leider geht es nicht anders. Er muss es nicht gewesen sein, aber auszuschließen ist es keineswegs. Stell dir vor, wir fahnden nicht öffentlich und der Kerl begeht eine weitere Gewalttat. Mehr brauchen wir nicht, dann haben wir die ganzen Medien gegen uns, politisch korrekt oder nicht. Ich schlage vor, wir sagen einfach, wie es ist – dass er in Zusammenhang mit dem Mord an Adrian Stuiber dringend gesucht wird, zunächst einmal als Zeuge. Wir ermitteln aber in alle Richtungen.« Er verzog das Gesicht bei der abgedroschenen Phrase.
»Sehr gut, so kennen sich alle aus. Es ist einerseits klar, dass der Bursche gefährlich sein könnte, andererseits kann uns niemand vorwerfen, dass wir die Unschuldsvermutung nicht beachten würden. Die Pressestelle soll das Ganze kommunizieren – ich ruf gleich nachher den Siegl an. Schick ihm bitte eine kurze Zusammenfassung, damit seine Leute Rede und Antwort stehen können.«
Die morgige Fahrt nach Graz mit »Oberlehner«, wie Sickinger Cleo immer nannte, fand dessen Zustimmung. Als Leo sich schon zum Gehen erhob, bedeutete ihm sein Vorgesetzter mit einer Handbewegung, dass er noch etwas auf seiner Agenda hatte – seiner zögerlichen Art und Weise nach zu urteilen, etwas Unangenehmes.
»Bevor ich es vergesse: Ich wollte noch etwas mit dir bereden. Du weißt ja, Weihnachten naht mit Riesenschritten, und wir sollten unsere Essenseinladung an die Belegschaft organisieren. Schließlich ist es unheimlich wichtig für die Motivation und das Zusammengehörigkeitsgefühl, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Das Wir-Gefühl, wie es so schön heißt. Die Psychologen tun so, als ob sie das erfunden hätten, dabei praktizieren wir das seit Jahren mit großem Erfolg.«
Leo fühlte Unwillen in sich aufsteigen. Wie jedes Jahr brachte Bruno das Thema viel zu spät aufs Tapet, wenn alle halbwegs geeigneten Gasthäuser für größere Gruppen schon ausgebucht waren. Mit »wir«, die etwas organisieren sollten, war unweigerlich Lang gemeint. Geeignete Restaurants waren nur solche, die Sickingers Schweinsbraten-Schnitzel-Gulaschgeschmack entgegenkamen und auch noch recht preisgünstig waren. Dazu kam, dass viele der Eingeladenen – Langs und Sendlingers Leute, die Mitarbeiter der Telefonzentrale und einige weitere – gar keine Lust hatten, ihre spärliche Freizeit mit Chefs und Kollegen zu verbringen. Oder sie waren Vegetarier oder Veganer, aßen laktose- oder glutenfrei oder was auch immer. Eigentlich hatte er sich vorgenommen, dieses Jahr von sich aus an Bruno heranzutreten, um eine Alternative zu dieser ungelegen kommenden Vorweihnachtsfresserei zu finden, und das rechtzeitig. Dass er das wieder einmal verabsäumt hatte, hob seine Stimmung nicht gerade.
Sickinger gab ihm seine üblichen Anweisungen, als Vorschläge getarnt – »Gutes bodenständiges Essen wird das Beste sein, was sagst du? … Du kennst doch bestimmt irgendwas Gemütliches mit vernünftigen Preisen, oder?« – und komplimentierte ihn zur Tür hinaus.
8
Er blickte auf die Uhr. Es war reichlich spät, um noch einzukaufen und etwas Gutes zu kochen. Außerdem hatte ihn Marlene vorgewarnt, dass sie heute vielleicht länger arbeiten würde, wie so oft in letzter Zeit. Brunos Restaurantdirektiven und seine eigene schlechte Laune hatten ihm die Lust auf einen Beislbesuch verdorben. Er würde einfach bei einem Würstelstand halten.
Während der Fahrt materialisierte sich in seiner Fantasie Helmut Nowotny, wie er eine »Eitrige mit an Schoafn« oder »a Burnheidl« verlangte. Vielleicht lag es daran, dass im Radio Voodoo Jürgens lief. Unlängst hatte es im Büro eine Diskussion über die Vorzüge der einzelnen Wurstwaren – natürlich zwischen Nowotny und Goncalves – gegeben. Letzterer vertrat die Ansicht, dass Käsekrainer und Burenwurst schon derartig touristisch vereinnahmt waren, dass ein anständiger Wiener sie sich kaum mehr im örtlichen Idiom zu bestellen getraute. »Steht bei jedem Reiseblogger: Du musst bei der ›Wurstbude‹ eine ›Eitrige mit an Schoafn‹ verlangen, und dazu werden dann noch Tipps für die richtige Aussprache mit Sounddateien gegeben. Richtig peinlich! Und dann halten sie mich für einen Ausländer!« Roberto wusste als dunkelhäutiger Einheimischer, wovon er redete.
Dazu fiel Leo die Debatte von vorhin über Hamburgerläden wieder ein, die, bar jedes Lokalkolorits, mit jeder Menge Anglizismen um Kundschaft buhlten. Waren Würstelstände und deren Produkte denn besser? Fast Food da wie dort, mit vielen Fragezeichen in Bezug auf Gesundheit und Nachhaltigkeit. Trotzdem lagen die Würstelstände in seiner Gunst weit vorn. Sie waren schließlich viel authentischer, dachte er, selbst nach Vereinnahmung durch teutonische Touristen.
In der Nähe eines Standes, bei dem er noch nie zuvor gewesen war, fand sich ein Parkplatz, weswegen er beschloss, diesem eine Chance zu geben. »Woiferl« prangte in großen Lettern auf der Hütte. Mit Interesse entnahm er der umfangreichen Speisekarte, dass es zwar Dinge wie neumodische Veggie-Burger und Würste vom Bio-Mangalitza-Schwein gab, aber eben auch ein urwienerisches Pferdeleberkässemmerl. Schließlich entschied er sich für eine Mangalitza-Käsekrainer, für die er eineinhalb Mal so viel hinblättern musste wie für eine herkömmliche. Aber schließlich waren die Tiere angeblich ganzjährig auf der Weide gehalten, langsam gewachsen und ohne unnötige Transporte geschlachtet worden. Und das schmeckte man auch, wie er feststellte. Er widerstand der Versuchung, dem fetten Schmankerl noch ein zweites folgen zu lassen – vielleicht eine Bosna, eigentlich von Salzburger Ursprung? –, machte »Woiferl« ein Kompliment für die Qualität seiner Würste und ging, begleitet vom boshaften Einfall, Sickingers Weihnachtsfeier hier stattfinden zu lassen. Bodenständig und vernünftige Preise, was will man mehr?