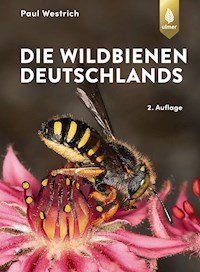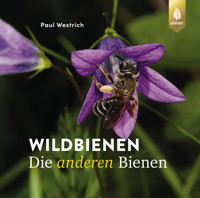
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Wildbienen-Experte Dr. Paul Westrich zeigt die faszinierende Welt der heimischen Wildbienen liebevoll und außergewöhnlich detailliert. Er erklärt das Verhalten und die Lebensweise der Tiere sowie ihre speziellen Ansprüche und Vorlieben beim Nestbau und Blütenbesuch. Mit Hilfe dieses Buches können Sie Wildbienen im Garten, auf Balkon oder Terrasse erfolgreich ansiedeln, mit den richtigen Pflanzen anlocken, gute Nisthilfen anbieten und so die Tiere wirksam fördern. Dazu gibt der Autor Tipps für Beobachtungen der Wildbienen und ihrer verblüffenden Verhaltensweisen. 120 Wildbienenarten, über 650 Fotos mit zahlreichen bewegenden Nahaufnahmen. Komplett aktualisierte und erweiterte Neuauflage 2024.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Paul Westrich
WILDBIENENDieanderenBienen
Inhalt
Vorwort
Die anderen Bienen
Wildbienen erkennen
Namensgebung (Nomenklatur)
Wespenverwandtschaft – Die Stellung der Bienen innerhalb der Insekten
Wildbienen beobachten, erfassen und bestimmen
Unverzichtbare Bestäuber
Einsiedler- oder Solitärbienen
Die Gehörnte Mauerbiene, eine typische Solitärbiene
Kommunale Bienen
Soziale Bienen
Primitiv eusoziale Lebensweise
Hocheusoziale Lebensweise
Parasitische Bienen
Wann und wo findet man Wildbienen?
Beispiele für charakteristische (Teil-)Lebensräume von Wildbienen
Eigenartige Schlafplätze
Blüten im Leben der Wildbienen-Männchen
Das Bienennest
Ein Platz zum Nisten gesucht
Pflanzliches für den Nestbau
Ohne Pollen keine Nachkommen
Rückgang, Gefährdung und Schutz der Wildbienen
Der Garten als Nahrungsraum von Wildbienen
Nisthilfen für Wildbienen
Lebensbilder hohlraumbesiedelnder Wildbienen
Lebensbilder im Boden nistender Wildbienen
Weitere Nutznießer der Nisthilfen
Stechen Wildbienen?
Service
Literatur, Weblinks, Bezugsquellen
Der Autor
Bildquellen
Ein Weibchen der grün schillernden Dünen-Furchenbiene (Halictus leucaheneus) sammelt Pollen an Echtem Johanniskraut (Hypericum perforatum).
Vorwort
Die Liebe zur Natur habe ich meinem Großvater zu verdanken, der mich schon als Kind auf seinen Spaziergängen mitgenommen und mir besonders einprägsame „Geschichten aus dem Wald“ erzählt hat. Als Jugendlicher erkundete ich voller Enthusiasmus die Tierwelt meiner Heimat und interessierte mich mehr und mehr auch für Pflanzen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass ich mich später entschloss, Biologie zu studieren. Ganz entscheidend für mein Leben aber war eine Exkursion nach Südfrankreich im Juni 1974, auf der mich ein in Naturkunde äußerst bewanderter Hochschullehrer für Wildbienen begeisterte. Diese bis ins Detail kennenzulernen und ihre Lebensweise zu erforschen, dafür bot mir Jahre später meine Doktorarbeit reichlich Gelegenheit. Seit mehr als 50 Jahren beschäftige ich mich also schon mit Wildbienen. Nach wie vor faszinieren mich diese Hautflügler und ihr Verhalten und meine Neugier, Unbekanntes zu erkunden, ist ungebrochen.
Aus dem Fundus der auf zahllosen Exkursionen, auf Reisen in die Nachbarländer und in den Mittelmeerraum entstandenen Fotos habe ich die besten und schönsten Aufnahmen für dieses Buch ausgewählt. Sie sollen Staunen wecken und für diese Insektengruppe begeistern. Auch wenn die Digitalisierung vieles erleichtert und kostengünstiger gemacht hat, braucht man beim Fotografieren von Wildbienen immer noch Ausdauer und Geduld und oft auch Glück. Bereit zu sein, stundenlang an einem Nistplatz auszuharren, um im richtigen Augenblick den Eintrag von Baumaterial oder Pollen im Bild festhalten zu können, ist eine der Voraussetzungen für gute Aufnahmen. Auf diese Weise haben viele der hier präsentierten Bilder ihre ganz eigene, für mich unvergessliche Entstehungsgeschichte.
Natürlich kann dieses Buch mein Werk „Die Wildbienen Deutschlands“ nicht ersetzen. Es soll auch kein Naturführer im üblichen Sinne sein mit dem Hauptziel der Bestimmung. Dessen ungeachtet können die im Buch abgebildeten 120 Arten helfen, bei detailgenauem Vergleich die Biene auch auf dem eigenen Foto zu erkennen. Meine Intention ist vielmehr, in der ersten Hälfte dieses Buchs darzustellen, wie unterschiedlich Wildbienen aussehen, wann und wo wir sie finden und wie vielfältig ihre Lebensweisen, ihr Brutfürsorgeverhalten und ihre Blütenbeziehungen sind. Wildbienen aus nächster Nähe auf Blüten oder beim Nisten kennenzulernen, zu beobachten und gleichzeitig zu fördern, dazu sollen die unterschiedlichen Methoden und Maßnahmen anregen, die im praxisbezogenen Teil des Buchs reich illustriert dargestellt sind. Wer sich an meine Ratschläge hält, dem garantiere ich Besiedlungserfolg und die Entdeckung einer unbekannten Welt.
Leider kursieren im Internet, aber auch in manchen Büchern, immer noch untaugliche Empfehlungen zur Förderung von Wildbienen. Deshalb sei mir am Ende des praktischen Teils erlaubt aufzuzeigen, welche Fehler wie zu vermeiden sind.
Das Studium der Natur war für mich immer untrennbar mit dem Anliegen verknüpft, sich für ihren Schutz einzusetzen. Meine Hoffnung ist: Wer durch eigene Beobachtungen an Wildbienen Freude hat, wird sich wahrscheinlich auch für ihren Schutz einsetzen und verstehen, warum auch außerhalb der Dörfer und Städte Erhaltungsmaßnahmen notwendig sind, beispielsweise durch den Schutz und die Pflege ihrer Lebensräume in und außerhalb von Naturschutzgebieten oder durch Hilfsprogramme für seltene oder gefährdete Arten.
Ich danke allen, die mich mit Informationen über Bienenvorkommen unterstützt oder mit mir gemeinsam Fundorte aufgesucht oder meine Arbeit in anderer Weise gefördert haben. Besonderer Dank gilt Hans-Jürgen Martin (Solingen), der das Manuskript kritisch gelesen und mir hilfreiche Hinweise zum Text gegeben hat. Ich danke dem Verlag Eugen Ulmer für die Herausgabe dieser überarbeiteten und deutlich erweiterten Neuauflage mit ihrer exzellenten Ausstattung und ganz besonders Frau Ina Vetter, Frau Birgit Heyny und Herrn Ulf Müller für die gute Zusammenarbeit. Meine Frau Lucia hat mich auf unzähligen Exkursionen begleitet, mich auf manches Bienennest aufmerksam gemacht und ist meiner Forscherleidenschaft stets mit großer Liebe und Toleranz begegnet. Ihr ist dieses Buch gewidmet.
Paul Westrich
Ein Weibchen der Fuchsroten Sandbiene (Andrena fulva) beim Besuch der Blüten der Roten Johannisbeere (Ribes rubrum), die gleichzeitig von dieser auffälligen, leicht zu erkennenden Wildbienenart bestäubt werden.
Die anderen Bienen
In gleicher Weise, wie man Wildpflanzen von Nutzpflanzen unterscheidet, werden alle wildlebenden Bienenarten als Wildbienen bezeichnet. Denn es gibt auch Nutzbienen, die für die Gewinnung von Honig und Wachs oder für die Bestäubung von Nutzpflanzen vermehrt und gezielt eingesetzt werden. Die bekannteste Nutzbiene ist die Honigbiene des Imkers.
Den Begriff „Biene“ verbinden die meisten Menschen mit der Honigbiene (Apis mellifera), dem bekanntesten Insekt überhaupt. Die landläufige Vorstellung von Bienen wird immer noch derart von der Honigbiene bestimmt, dass es vielen Menschen schwerfällt, außer ihr auch noch andere Insekten als Bienen zu bezeichnen. Tatsächlich aber ist die Hausbiene des Imkers nur eine von rund 600 allein in Deutschland nachgewiesenen Bienenarten, von mehr als 630 Arten in der Schweiz und von über 700 Arten in Österreich. Weltweit sind bislang über 20 000 Arten beschrieben und benannt worden. Da immer wieder neue Arten entdeckt werden, dürfte die tatsächliche Zahl der Bienenarten auf der Erde noch weitaus größer sein.
Schon im Jahr 1791 hat der Pfarrer und Insektenkundler Johann Ludwig Christ in seinem großen Werk „Naturgeschichte, Klassification und Nomenclatur der Insekten vom Bienen, Wespen und Ameisengeschlecht“ den Begriff „wilde Bienen“ gebraucht. Wortwörtlich schreibt Christ: „Es gibt nur eine Art von zamen oder Honigbienen, aber gar viele Arten dieses Geschlechts von wilden Bienen, die also genennet werden, weil sie in keine so gesellschaftliche Verfassung wie iene können gebracht werden, wenigstens nicht zu einem beträchtlichen Nuzzen bisher gebracht worden, sondern nur gleichsam wild, ihrem Schicksal überlassen, one unsere Aufsicht, meistens auch nur einsam leben und ihre Haushaltung füren, zum Bienengeschlecht aber gehören, weil sie mit ienen teils in dem Bau ihrer Glieder, teils in ihrer Natur, Fortpflanzung und Lebensart näher oder entfernter übereinkommen.“
Eine Arbeiterin der Honigbiene (Apis mellifera) beim Sammeln von Pollen an der Heidelbeere (Vaccinium myrtillus).
Es sind also diese anderen, fast durchweg wildlebenden Bienen, die im Mittelpunkt dieses Buches stehen. Zu ihnen zählen Seiden- und Maskenbienen, Sandbienen, Furchen- und Schmalbienen, Mauerbienen, Woll- und Harzbienen, Pelzbienen und nicht zuletzt die allgemeiner bekannten Hummeln, die mit der Honigbiene näher verwandt sind als andere Bienen. In einem Punkt können die heimischen Wildbienen die Honigbiene nicht ersetzen: Sie produzieren keinen Honig. Stattdessen haben sie aber eine lange weit unterschätzte Bedeutung als Bestäuber von Wild- und Nutzpflanzen. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat sie der Gesetzgeber bereits 1980 unter besonderen, unverändert geltenden Schutz gestellt. Ihre Erhaltung und Förderung liegt daher in unser aller Interesse.
Große Vielfalt an Farben und Formen
Die auf dieser und der folgenden Seite gezeigten Vertreter verschiedener Bienengattungen belegen eindrucksvoll die außerordentlich bunte Vielfalt der Wildbienen.
Große Keulhornbiene (Ceratina chalybea) ♀
Luzerne-Blattschneiderbiene (Megachile rotundata) ♀
Filz-Furchenbiene (Halictus pollinosus) ♀
Pracht-Trauerbiene (Melecta luctuosa) ♀
Spalten-Wollbiene (Anthidium oblongatum) ♀
Bunthummel (Bombus sylvarum) ♀
Rainfarn-Seidenbiene (Colletes similis) ♀
Gewöhnliche Maskenbiene (Hylaeus communis) ♀
Berg-Zottelbiene (Panurgus banksianus) ♀
Gestreifte Pelzbiene (Anthophora aestivalis) ♀
Weißbrust-Sandbiene (Andrena gravida) ♀
Auen-Buckelbiene (Sphecodes albilabris) ♀
Wildbienen erkennen
Die enorme Vielfalt der Wildbienen im Hinblick auf Größe, Farbe und Behaarung, die Existenz von Männchen und Weibchen sowie die äußerliche Ähnlichkeit mit anderen Insekten erschweren verständlicherweise dem Anfänger die Klärung, ob ein Insekt, das er z. B. auf einer Blüte entdeckt hat, eine Wildbiene ist oder nicht. Sehr häufig werden Wildbienen auch mit Honigbienen verwechselt. Für letztere sind abstehende Haare auf den Komplexaugen (Facettenaugen) typisch, die es sonst nur bei den Kegelbienen (Coelioxys) gibt. Der Honigbiene fehlt außerdem der Sporn an den Schienen der Hinterbeine, den alle anderen heimischen Bienenarten aufweisen. Regelmäßig werden auch Schwebfliegen mit Wildbienen verwechselt. Fliegen besitzen jedoch nur zwei statt vier häutige Flügel und viel kürzere Fühler. Auch manche Grabwespen ähneln in Gestalt und Färbung bestimmten Wildbienen, insbesondere Wespenbienen (Nomada). Selbst bei dem einen oder anderen Käfer glauben manche Menschen, es handele sich um eine Wildbiene.
Diese Mistbiene (Eristalis tenax) genannte Schwebfliege ähnelt einer Honigbiene und entwickelt sich in Jauche. Fliegen haben jedoch nur zwei häutige Flügel und einen völlig anderen Fühlerbau.
Der Pinselkäfer (Trichius fasciatus) erinnert an eine Biene, weswegen er im Englischen auch bee beetle (Bienenkäfer) heißt.
Wegen ihrer Behaarung und Färbung sind manche Schwebfliegen wie diese Volucella bombylans bestimmten Hummelarten täuschend ähnlich.
Diese Grabwespe (Lestica alata) ähnelt in ihrer Färbung einer Wespenbiene. Sie versorgt ihre Brutzellen mit erbeuteten Schmetterlingen.
Der großen Zahl von Bienenarten entspricht eine nicht weniger große Vielfalt in der äußeren Erscheinungsform. So gibt es einige Arten, die wie die Steppenbiene mit nur 4 mm Größe leicht zu übersehen sind und meist gar nicht als Bienen wahrgenommen werden. Andere wie die Holzbiene hingegen haben mit 28 mm eine vergleichsweise stattliche Größe, wieder andere sind durch rote, gelbe oder grün bis blau schillernde Farben auffällig. Viele Bienenarten sind pelzig behaart. Neben den Hummeln tragen auch viele Sandbienen (Andrena), Mauerbienen (Osmia) und Pelzbienen (Anthophora) ein dichtes Haarkleid. Im Gegensatz dazu können die kaum behaarten Maskenbienen (Hylaeus), Wespenbienen (Nomada) oder Buckelbienen (Sphecodes) leicht mit anderen Hautflüglern, vor allem mit Falten- und Grabwespen, verwechselt werden. Mit der Zeit wird man aber feststellen, dass es neben dem äußeren Erscheinungsbild vor allem das Verhalten ist, an dem man Wildbienen draußen in der Natur erkennt. Auch die unterschiedlichen Nistweisen helfen, Wildbienen leichter von anderen Insekten zu unterscheiden. Letztendlich sind auch hier ein immer besser geschultes Auge und die genaue Beobachtung, nicht zuletzt auch Ausdauer und Geduld wichtige Voraussetzungen, Wildbienen von Schwebfliegen, Käfern, Grabwespen oder Honigbienen zu unterscheiden.
Alle heimischen Wildbienenarten treten in zwei Geschlechtern auf. Die Männchen sind oft schlanker als die Weibchen, und ihre Fühler sind meist länger (13 Glieder, Ausnahme Biastes und Pasites mit 12 Gliedern) als die der Weibchen (12 Glieder). Sie haben außerdem keine Pollentransport-Einrichtungen, weil sie sich nicht am Brutgeschäft beteiligen. Die vielfach schlankeren Männchen sind oft durch ihr Flugverhalten auffällig, besonders wenn sie auf regelmäßigen Bahnen an Blüten oder Nistplätzen patrouillieren oder sich an immer gleichen Stellen sonnen oder rasten. Sie sind auch meistens anders gefärbt als ihre Weibchen, die besonders dann leicht zu erkennen sind, wenn sie mit Pollen beladen von Blüte zu Blüte fliegen.
Die sehr seltene Dünen-Steppenbiene (Nomioides minutissimus, Männchen links, Weibchen rechts) gehört mit 4 mm Größe zu den kleinsten heimischen Wildbienen.
Früher wurde angenommen, dass Männchen (links) und Weibchen (rechts) der Schmuckbiene (Epeoloides coecutiens) zu verschiedenen Arten gehören.
Große Unterschiede zwischen Männchen (links) und Weibchen (rechts) zeigt in beeindruckender Weise auch die Gallen-Mauerbiene (Osmia gallarum).
Die Weibchen der nestbauenden Bienen kann man am ehesten auf Blüten und hier an einzigartigen Haarstrukturen an Kopf, Brustabschnitt, Beinen und Hinterleib erkennen: Spezielle Haarlocken, außerdem sogenannte Bauchbürsten und Schienenbürsten sowie „Körbchen“ mit einem Borstenkranz dienen ausschließlich der Speicherung des Pollens auf dem Sammelflug und seinem Transport zum Nest. Darauf zu achten erleichtert das Erkennen von Bienen in besonderem Maße.
Das Weibchen der Malven-Langhornbiene (Eucera malvae) hat besonders lange Haare in seiner Schienenbürste, zwischen denen die weißen Pollen der Rosen-Malve (Malva alcea) gespeichert und transportiert werden.
Das Weibchen der Garten-Blattschneiderbiene (Megachile willughbiella) transportiert den lila Pollen der Zier-Glockenblume (Campanula isophylla) auf der Unterseite des Hinterleibs.
Auch das Weibchen der Wegwarten-Hosenbiene (Dasypoda hirtipes) hat mächtige Schienenbürsten, die der Gattung zu ihrem deutschen Namen verholfen haben.
Hummeln wie die Dunkle Erdhummel (Bombus terrestris) zeichnen sich durch oft große, mit Nektar angereicherte Pollenladungen aus.
Namensgebung (Nomenklatur)
Alle bisher bekannten Lebewesen und damit auch die Wildbienen haben einen wissenschaftlichen Namen. Nach der sogenannten binären Nomenklatur, die 1753 von dem schwedischen Naturforscher Carl von Linné (latinisiert Carolus Linnaeus, 1707–1778) eingeführt wurde, besteht jeder wissenschaftliche Name einer Art aus zwei Teilen. Der erste ist der Gattungsname, ein Substantiv, das immer mit einem Großbuchstaben beginnt. Der zweite Namensteil ist der eigentliche, immer klein geschriebene Artzusatz (Epitheton). Ist er ein Adjektiv, richtet sich sein Geschlecht nach dem der Gattung. Diesen beiden Teilen ist oft der Name des Autors beigefügt, der die Art benannt hat, und das Jahr, in dem er die Artbeschreibung veröffentlichte. Die Nennung von Autor und Jahreszahl ist nicht verbindlich. Da der Erstbeschreiber einer Art bei der Namensgebung völlige Freiheit genießt, führt dies manchmal zu kuriosen Namen. Die wissenschaftliche Namensschöpfung ist stets latinisiert (an das Lateinische angeglichen) und ihre Herkunft ist fast ausschließlich Latein und Altgriechisch.
Die Namensgebung sei am Beispiel der Gehörnten Mauerbiene Osmia cornuta (Latreille 1805) erklärt: Osmia bezeichnet die Gattung, cornuta die Art. Latreille ist der (französische) Autor, der die Art 1805 beschrieben und benannt hat. Der Name des Autors steht hier in Klammern, da die Art ursprünglich unter einem anderen Gattungsnamen, nämlich Megachile, beschrieben und später der Gattung Osmia zugeordnet wurde.
Jede Bienenart hat nur einen gültigen wissenschaftlichen Namen. Viele Arten sind aber im Laufe ihrer Entdeckungsgeschichte mehrfach beschrieben und benannt worden. Daher waren zeitweise mehrere Namen (Synonyme) in Gebrauch, von denen heute nur einer gültig ist. Welcher unter mehreren Namen gültig ist, wird durch die Internationalen Regeln für die Zoologische Nomenklatur (ICZN) festgelegt. Das Ziel dieser Konvention ist, die Stabilität und Universalität (Allgemeingültigkeit) wissenschaftlicher Tiernamen zu fördern.
In diesem Buch verwende ich auch deutsche Namen. Bei den Bienen gibt es lediglich für die Gattungen seit rund 160 Jahren deutsche Benennungen, die sich eingebürgert haben, z. B. Seidenbienen für die Gattung Colletes und Sandbienen für die Gattung Andrena. J. L. Christ hat 1791 in seiner Naturgeschichte der Insekten den Bienenbeschreibungen deutsche Namen beigefügt. So nannte er die unten abgebildete Art, bei der es sich nach heutiger Interpretation um Dasypoda suripes handelt, Wadenfuß. Andere Bienenarten heißen Einhorn, Gräber, Mauerfuchs oder Köhler. Diese Namen haben sich aber nicht durchgesetzt. Darüber hinaus gibt es für Hummeln deutsche Trivialnamen, z. B. Ackerhummel für Bombus pascuorum oder Steinhummel für Bombus lapidarius. Für einige gut kenntliche Arten benutze ich schon seit den 1980er Jahren bei Führungen, in Vorträgen und in manchen Schriften rund 200 von mir ersonnene deutsche Artnamen, die auf dem deutschen Gattungsnamen basieren und sich nach typischen Eigenschaften (Blütenbesuch, Lebensraum, Morphologie) richten.
Vor einigen Jahren wurden für alle Bienen Mitteleuropas deutsche Namen vergeben. Lange Wortschöpfungen wie Senf-Blauschillersandbiene oder Rotbeinige Körbchensandbiene lassen sich jedoch kaum gut behalten und verstehen. Am ehesten können sich neue, künstliche Wörter für häufige oder auffällige Arten etablieren. Aber nur wissenschaftliche Namen garantieren den internationalen Austausch unter Profi- und Bürgerwissenschaftlern (citizen scientists). Daher empfehle ich, sich mit der Binominalen Nomenklatur vertraut zu machen, wie dies für Gärtner, Biologen, Mediziner und weitere Berufsgruppen selbstverständlich ist. Selbst Kinder lernen leicht z. B. die Namen von Dinosauriern und wenden sie richtig an.
Abbildungen von Bienen aus der Naturgeschichte der Insekten von J. L. Christ. Der Autor hat die Art „Wadenfuß“ genannt. Die linke Zeichnung stellt das Weibchen dar, die rechte das Männchen.
Wespenverwandtschaft – Die Stellung der Bienen innerhalb der Insekten
Das moderne System der Lebewesen richtet sich nach ihrer Entwicklung im Laufe der Erdgeschichte (Stammesgeschichte oder Phylogenese). Dieses System ist hierarchisch aufgebaut. Seine Kategorien wie Klasse, Ordnung, Familie, Gattung und Art sind einander untergeordnete Rangstufen (Hierarchieebenen), die auf Carl von Linné zurückgehen. Innerhalb der Klasse der Insekten, zu denen auch die Ordnungen der Käfer, Schmetterlinge und Zweiflügler zählen, gehören die Bienen zur Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera), einer besonders artenreichen Verwandtschaftsgruppe mit fast 12 000 Arten allein in Mitteleuropa. Ihr Kennzeichen sind vier häutige Flügel. Fast alle Hautflüglergruppen tragen den Begriff Wespen in ihrem deutschen Namen. Dies ist unabhängig davon, ob der Hinterleib breit am Bruststück (Thorax) angewachsen ist wie bei den Holzwespen und Blattwespen oder ob eine Einschnürung zwischen dem 1. und 2. Hinterleibssegment (Wespentaille) vorhanden ist wie bei den Taillenwespen (Apocrita). Zu den Taillenwespen gehören viele Familien parasitischer Legimmen (Parasitica) wie Gallwespen, Erzwespen und Schlupfwespen sowie die Unterordnung der Stechimmen (Aculeata), zu denen die Ameisen, Faltenwespen, Weg- und Grabwespen und die Bienen zählen. Bei den Stechimmen ist der Eilegeapparat zu einem Stechapparat umgewandelt. Deshalb haben nur die Weibchen einen Giftstachel, der zur Lähmung von Beutetieren eingesetzt wird oder – im Falle der Bienen ausschließlich – der Verteidigung (Wehrstachel) dient. Früher hat man die Bienen auch „Blumenwespen“ genannt, was nicht nur ihre Verwandtschaft mit den anderen Hautflüglergruppen erkennen lässt. Der Begriff zeigt auch ihr wesentliches biologisches Merkmal an, nämlich die Versorgung der Brut mit Blütenprodukten (Pollen, Nektar, Blumenöl), während sich die Larven anderer Stechimmen von erbeuteten Insekten, Insektenlarven oder Spinnen ernähren.
Zu den Stechimmen gehört u. a. die Überfamilie Apoidea mit den Grabwespen (Spheciformes) und den Bienen (Apiformes), die von grabwespenartigen Formen abstammen. Spheciformes und Apiformes sind Sammelbegriffe ohne Rang, die der amerikanische Bienenforscher C. D. Michener in „The Bees of the World“ eingeführt hat. Ein alternativer, in jüngster Zeit häufiger verwendeter Sammelbegriff für die Bienen ist Anthophila. Er ist schon mindestens seit 1904 bekannt und verweist auf die Beziehung der Bienen zu Blüten. Die Bienen werden heute (meist nach Michener) in sieben Familien unterteilt: Die sechs Familien Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, Megachilidae und Apidae sind in Mitteleuropa mit rund 850 Arten vertreten, die Familie Stenotritidae ist mit 21 Arten nur in Australien beheimatet. Einige Schriften fassen die Bienen nur in einer einzigen Familie Apidae mit sieben Unterfamilien zusammen. Die Familien bzw. Unterfamilien werden ihrerseits auf der nächstniedrigen Rangstufe in Gattungen unterteilt, und mit den Gattungen wiederum werden nahverwandte Arten zusammengefasst. Eine nahe Verwandtschaft ist in wichtigen gemeinsamen Eigenschaften der Arten begründet, die alle im Idealfall von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen (ein „Monophylum“ darstellen); fehlen solche gemeinsamen Eigenschaften und stellen Biologen eine morphologische „Lücke“ fest, schaffen sie oft eine neue Gattung. Anders als eine Art (= Fortpflanzungsgemeinschaft) ist eine Gattung also ein künstliches Konstrukt: eine jener Kategorien, mit denen Menschen versuchen, die Abstammung der Lebewesen zu verstehen und nachzuzeichnen.
Blattwespe (Megalodontes, Tenthredinidae), ohne Wespentaille.
Solitäre Faltenwespe (Odynerus spinipes), mit Wespentaille.
Die Pollenwespe (Celonites abbreviatus) versorgt ihre Brut nicht mit tierischer Nahrung, sondern mit Pollen und Nektar von Lippenblütlern (Lamiaceae).
Der Bienenwolf (Philanthus triangulum), eine Grabwespe, mit einer durch einen Stich gelähmten Honigbiene als Beute.
Die Erforschung von Abstammungen (Phylogenetik) hat im Zeitalter der DNA-Sequenzierung große Fortschritte gemacht, wenn auch ihre Ergebnisse nicht immer eindeutig und manchmal sogar fehlerhaft sind. Eine auf der Phylogenetik beruhende Systematik kann zwar den Stammbaum der Arten in seiner immensen Komplexität immer genauer abbilden, ist jedoch mit Linnés übersichtlichem Ordnungssystem und binärer Nomenklatur von 1753 immer weniger kompatibel.
Neue Erkenntnisse sind aber für manche Bearbeiter immer wieder Anlass, vertraute Gattungen mit vielen Arten (etwa Anthidium) in immer kleinere Gattungen mit nur wenigen Arten (manchmal gar nur einer) aufzuspalten. Die Folge sind meist wiederholte Änderungen des Gattungs- bzw. Artnamens, die Experten wie Laien die Kommunikation untereinander und die Befassung mit früheren Schriften erschweren. Ich bleibe schon aus Gründen der Praktikabilität bei dem bekannten übersichtlichen System und unterteile die Bienen Deutschlands in 42 Gattungen.
Klassische Klassifikation am Beispiel Osmia bicolor (Zweifarbige Mauerbiene)
Männchen (oben) und Weibchen (unten) von Osmia bicolor.
System der Bienen Deutschlands – Familien und Gattungen
Familie Colletidae
Gattung Hylaeus – Maskenbienen (39)
Gattung Colletes – Seidenbienen (15)
Familie Andrenidae
Gattung Andrena – Sandbienen (126+)
Gattung Panurgus – Zottelbienen (3)
Gattung Panurginus – Scheinlappenbienen (3)
Gattung Camptopoeum – Buntbienen (1)
Gattung Melitturga – Schwebebienen (1)
Familie Halictidae
Gattung Halictus Latreille – Furchenbienen (18)
Gattung Lasioglossum – Schmalbienen (70+)
Gattung Sphecodes* – Buckelbienen (Blutbienen) (25)
Gattung Nomioides – Steppenbienen (1)
Gattung Rophites – Schlürfbienen (3)
Gattung Rhophitoides – Graubienen (1)
Gattung Dufourea – Glanzbienen (6)
Gattung Nomia – Schienenbienen (1) (einschließlich Pseudapis)
Gattung Systropha – Spiralhornbienen (2)
Familie Melittidae
Gattung Melitta Kirby 1802 – Sägehornbienen (6)
Gattung Macropis Panzer 1809 – Schenkelbienen (2)
Gattung Dasypoda Latreille 1802 – Hosenbienen (4)
Familie Megachilidae
Gattung Anthidium – Woll- und Harzbienen (einschließlich, Pseudoanthidium, Rhodanthidium, Anthidiellum, Trachusa) (12)
Gattung Stelis* – Düsterbienen (11)
Gattung Dioxys* – Zweizahnbienen (2)
Gattung Megachile – Blattschneider- und Mörtelbienen (23)
Gattung Coelioxys* – Kegelbienen (13)
Gattung Osmia – Mauerbienen (40) (einschließlich Hoplitis)
Gattung Chelostoma – Scherenbienen (5)
Gattung Heriades – Löcherbienen (3)
Gattung Lithurgus – Steinbienen (2)
Familie Apidae
Gattung Anthophora – Pelzbienen (13) (einschließlich Amegilla)
Gattung Melecta* – Trauerbienen (2)
Gattung Thyreus* – Fleckenbienen (3)
Gattung Eucera – Langhornbienen (8) (einschließlich Tetralonia, Tetraloniella)
Gattung Ceratina – Keulhornbienen (3)
Gattung Xylocopa – Holzbienen (3)
Gattung Nomada* – Wespenbienen (68+)
Gattung Epeolus* – Filzbienen (5)
Gattung Biastes* – Kraftbienen (3)
Gattung Ammobates* – Sandgängerbienen (1)
Gattung Ammobatoides* – Steppenglanzbienen (1)
Gattung Epeoloides* – Schmuckbienen (1)
Gattung Bombus(*) – Hummeln, Kuckuckshummeln (41) (einschließlich Psithyrus)
Gattung Apis – Honigbienen (1)
Bei einigen Gattungen sind die von mir als Untergattungen aufgefassten systematischen Gruppen in Klammern aufgeführt.
Alle Gattungen mit * sind parasitische Bienen, solche mit (*) sind teilweise parasitisch.
Um eine Vorstellung von der Diversität in den einzelnen Gattungen zu geben, ist in Klammern die Zahl der in Deutschland nachgewiesenen Arten angegeben.
Im Falle besonders artenreicher Gattungen ist die Artenzahl umstritten, da bezüglich des Artstatus und der Bodenständigkeit die Meinungen der Autoren auseinandergehen.
Bei drei Gattungen (Melitturga, Ammobatoides, Nomia) ist die jeweils einzige Art in Deutschland bereits ausgestorben bzw. seit langem verschollen.
Wildbienen beobachten, erfassen und bestimmen
Wer sich mit Wildbienen näher beschäftigt, möchte in der Regel auch wissen, um welche Arten es sich handelt, die an Nisthilfen oder beim Blütenbesuch im Garten oder auf dem Balkon zu beobachten sind. Erst recht gilt dies für alle, die sich der wissenschaftlichen Erforschung der Wildbienen widmen und zum Beispiel die Fauna eines Gebiets untersuchen, um seine Schutzwürdigkeit zu beurteilen. Leider macht es uns die große Zahl der Arten nicht gerade leicht, sich in die enorme Formenvielfalt einzuarbeiten, zumal auch noch zwei Geschlechter zu unterscheiden sind. Bleiben wir zunächst im Freiland, wo selbst ein erfahrener Spezialist wie der Autor dieses Buchs einen beträchtlichen Teil der heimischen Wildbienen zwar bis zur Gattung, aber nicht bis zur Art bestimmen kann. Glücklicherweise gibt es eine ganze Reihe von Arten, die aufgrund ihrer Größe und der Farbe ihrer Behaarung äußerlich gut zu unterscheiden sind. Wenn wir dann noch Lebensraum, Flugzeit, Blütenbesuch, Nistweise und Verhalten berücksichtigen, lassen sich doch eine ganze Reihe von Arten lebend, gegebenenfalls auch anhand eines guten Fotos einigermaßen zuordnen. Auf diese Weise können so – entsprechende Erfahrung vorausgesetzt – bis zu 200 Bienenarten bestimmt werden, allerdings mit der Einschränkung, dass dies nur für die Weibchen zutrifft, da Männchen generell mehr Schwierigkeiten bereiten. In diesem Buch sind viele Arten in Lebendfotos abgebildet, die bei der Bestimmung helfen können. Allerdings kann uns ein struktur- und blütenreicher Garten auf Jahre hinaus beschäftigen, denn in ihm können weit über 100 Bienenarten auftreten, wenn auch oft nur in Einzelexemplaren. Das hier Erlernte können wir dann auf Spaziergängen und Wanderungen anzuwenden versuchen. Je unterschiedlicher die aufgesuchten Lebensräume sind, desto verschiedener ist auch das Artenspektrum, dem man begegnet, und desto schneller lassen sich die Kenntnisse erweitern. Für eine annähernd vollständige Dokumentation eines Gebiets reichen jedoch Beobachtungen und Fotobelege nicht aus. Denn für eine möglichst vollständige Erfassung kommt man nicht umhin, einzelne im Freiland nicht genau zuzuordnende Exemplare als Belegtiere der Natur zu entnehmen, um sie später unter einem Stereomikroskop zu bestimmen. Dafür ist in der Regel bei der Naturschutzbehörde eine Erlaubnis einzuholen. Um einen Einblick in die Arbeitsweise der Biologen zu geben, sei deren Vorgehensweise nachfolgend grob umrissen. Eine übliche Methode ist der Sichtfang von Bienen mit einem Insektennetz an Blüten, an Nistplätzen oder an Schwarmplätzen der Männchen. Es ist leider nicht vermeidbar, die gesammelten Exemplare nach dem Fang in einem Tötungsglas zu betäuben, in das einige Tropfen Essigsäureethylester („Essigäther“) gegeben wurden. Selbstverständlich sind Belegexemplare noch in weichem Zustand sachgerecht zu präparieren (Insektennadeln aus rostfreiem Stahl, Genitalpräparation der Männchen) und zu etikettieren (Angaben zu Fundort, Funddatum und Sammler, eventuell besuchte Blüten). Für die spätere Bestimmung (Determination) zu Hause oder im Labor braucht man, vor allem bei den artenreichen Gattungen Andrena (Sandbienen), Lasioglossum (Schmalbienen), Specodes (Buckelbienen) und Nomada (Wespenbienen), aber auch bei manch anderer Verwandtschaftsgruppe neben der entsprechenden Fachliteratur Ausdauer, Übung und Erfahrung sowie eine Vergleichssammlung mit zuverlässig bestimmten Exemplaren. Da die Bestimmung von Wildbienen selbst für Geübte immer wieder eine Herausforderung darstellt, mögen die Hürden, die hierbei zu überwinden sind, manch anfänglich Interessierten abschrecken. Aber wenn man sich einmal eingearbeitet hat, wird man für die Mühe durch immer neue Entdeckungen belohnt, zumal es auf diesem Gebiet noch viel zu erforschen gibt.
Ein Hinweis für Kritiker des Insektensammelns: Hätten die Entomologen (Insektenkundler) nicht schon seit langer Zeit umfangreiches Bienenmaterial gesammelt und in den Museen hinterlegt, wären viele für den Artenschutz hilfreiche Untersuchungen (z. B. Pollenanalysen) nicht möglich gewesen. Deren Ergebnisse sind auch in diesem Buch berücksichtigt.
Für die Bestimmung müssen eine ganze Reihe von morphologischen Merkmalen sorgfältig geprüft werden. Hierfür benötigt man ein gutes Stereomikroskop (Binokular) mit Messeinrichtung. Lupen mögen im Gelände hilfreich sein, für die exakte Determination sind sie nur in Ausnahmefällen tauglich (Hummeln, manche größere Bienen mit gut sichtbaren Merkmalen). Bei der Verwendung eines Stereomikroskops wird man in den meisten Fällen mit 10- oder 20-facher Vergrößerung arbeiten. Sehr wichtig ist eine gute Lichtquelle. Ich selbst verwende eine flexible Schreibtischlampe mit einem LED-Leuchtmittel mit 9 W Leistungsaufnahme, Lichtfarbe warmweiß (3000 K) und Lichtstrom von 900 lm (Lumen).