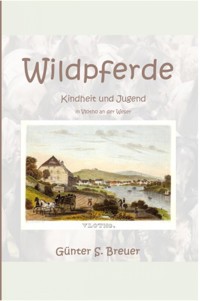
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Peter, wie wir ihn als Protagonisten in den Geschichten "Wildpferde" kennen lernen, steckt (oder steckte zumindest) in jedem von uns. Wer hat nicht schon einmal als Kind seine Hose zerrissen und anschließend "die Rechnung dafür kassiert"? Wer hat nicht seine ersten Rauchversuche mit Hölzern oder Gräsern gestartet und dafür derbe Prügel einstecken müssen, was tief in der Erinnerung verwurzelt bleibt? Manchmal sehr sensibel und feinfühlig, manchmal mit aller Kraft und Begeisterung der Jugend, "stürmt" Peter durch seine kleinen, alltäglichen Abenteuer und erfährt jeden Tag aufs Neue, dass gemeinsame Erlebnisse die Freundschaft zu seinen Spielkameraden immer wieder vertiefen und bestärken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter S. Breuer
Wildpferde
Trilogie
(Autoemotiografie)
Günter S. Breuer
- Kindheit und Jugendin Vlotho an der Weser
Wildpferde
Trilogie
(Autoemotiografie)
Impressum
Texte: © 2021 Copyright by Günter S. Breuer
Umschlag:© 2021 Copyright by Günter S. Breuer
Verantwortlich für den Inhalt: Günter S. Breuer
Dahlienweg 7
59320 Ennigerloh
www.gsbreuer.de
Druck:epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Juli 2021, neue Ausgabe, Trilogie in einem Band
Erzählt und
aufgeschrieben
für… meine Frau Ursula,
SebastianAnn-KristinDominik
und Levi
... meine geliebten Kinder,
und meinen Enkel,
die mich innerhalb von Sekunden
vor Zorn erbeben und
vor Glück taumeln lassen können!
… und deren Tante Gabi,
die sich an die Geschichten in Teil 1
nur rudimentär erinnern kann!
Kindheitsängste sind tückisch beharrlich.Schreiben ist ein Aktder Selbsthypnose:in diesem Zustandfindet oft eine Artvölliger emotionalerErinnerung stattund Schrecken,die längst totsein sollten,stehen wieder aufund wandeln.
Stephen King
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
Als die Ponys laufen lernten
Vorweg
Drei Kinder
Kindergarten
Bei Oma geparkt
Milch und Brot
Hausschlachtung
Teil 2
Die wilden Jahre
Vorweg
Peter
Die Flutmulde
Das Fußballspiel
Der Schrebergarten
Das Kleinbahndepot
Peter will in die Schule
Alte Ziege
Hohenrode
Osterspaziergang
Der neue Roller
Der 24. Dezember
Die große Pause
Diktate
Auf der Alm
Die Eisenbahn
Badetag
Das Huhn ohne Kopf
Die Feuerwehr
Wildpferde
Vom Eise befreit
Holzbein
Skifahren
Tolpatsch
Der Räuber
Die Wii
Pingu
Zum In-die-Luft-Gehen
Das Hobby
Nathaniels Nacht
Herr B. und die Kotzgurke
Teil 3
Die besten Jahre
Vorweg
Auf der Burg
Das Floß
Sport
Geld verdienen
Der Krug
Die Fahne
Der Tannenbaum
Bücher verbrennen
Anhang
Über dieses Buch
Zitate
Danksagung
Werbung
Vita
Literatur / Quellen / Links / Bilder
Teil 1
Als die Ponys laufen lernten
… bevor sie Wildpferde wurden
An der Weser 1951
Vorweg
Das Laufen Lernen (auch im übertragenen Sinn) ist ein äußert anstrengender Akt der Selbstüberwindung, den jeder Mensch nach einer gewissen Zeit des Heranwachsens beherrschen sollte.In den ersten fünf Lebensjahren hat der Mensch zudem den größten Lernzuwachs zu verzeichnen!Darum: Haut rein, strengt euch an!
(minder oder mehr autobiografisch – eher auto-emotiografisch!)
Günter S. Breuer (nach Arnold Gehlen, deutscher Philosoph, Anthropologe und Soziologe, 1904 - 1976)
In einigen Kapiteln kommt das Vlötsche (Vlothoer) Deutsch zum Tragen, hoffentlich nicht zu stark?!
Drei Kinder
Ich war anfangs der Zweite von Zweien!
Ich muss schon an dieser frühen Stelle meinen Erzählfluss unterbrechen und hier näher auf den Begriff „anfangs“ und auf die Konstellation „Zweiter von Zweien“ eingehen, um meinen weiteren Werdegang für den Leser verständlicher zu machen.
Das Adverb anfangs bezieht sich in Bezug auf meinen Werdegang auf die direkte Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Zeit war sehr entbehrungsreich, besonders für Familien mit Kindern. Es fehlte an allen Ecken und Kanten. Nahrungsmittel für hungrige Mäuler zu beschaffen, war schier unmöglich. Jeder Familienvater musste sehr erfindungsreich sein und manchmal auch neben dem Gesetz her organisieren können. In diese Zeit hinein wurde anfangs mein Bruder geboren. Er kam zu einer, zumal für Kinder, ungünstigen Zeit zur Welt. Aber als Geschöpf der Liebe war und ist es einem so kleinen Geschöpf egal, wie, wo und wann! Jedenfalls hatte mein Vater die damals überaus schwierige Aufgabe, natürlich mit meiner Mutter und allen Anverwandten zusammen, das kleine Bündel Mensch aufzupäppeln und für einen möglichst reibungslosen Start ins Leben zu sorgen.
Vorweggenommen kann ich sagen, es ist ihnen ein großes Stück weit gelungen.Der Mangel an Allem und die Nahrungsmittelknappheit führten jedoch unweigerlich dazu, dass der Junge zu Beginn seines neuen Lebens kränkelte. Er bekam Mangelerscheinungen, so dass er unter Aufsicht von Ärzten in der Heilanstalt Bethel bei Bielefeld behandelt werden musste. Zum Glück konnte er nach ein paar Wochen und einer abschließenden Rückenmarkpunktion wieder gesundet in die Arme der Eltern übergeben werden. Nach diesem für alle Beteiligten überaus schmerzhaften Erlebnis verliefen die nächsten Jahre für den jungen Erdenbewohner problemlos.
Nicht ganz zwei Jahre nach der Geburt meines Bruders erblickte ich, wieder ein Junge (nicht abwertend gemeint!), das Licht der Welt. Die neugewonnenen Erfahrungen meiner jungen Eltern nutzend, entwickelte ich mich der Zeit entsprechend normal. Natürlich benötigte mein Bruder, gerade aus Bethel entlassen, immer noch etwas mehr Zuwendung als ich. Aber ich bekam noch genug von Allem ab, um neben meinem Bruder existieren zu können. Ein Wonneproppen war ich zwar nicht, lernte aber, auch mit Hilfe von Maisbrot, meine mir vererbten Fähigkeiten zu entwickeln und auszubauen. Ich war dünn, ruhig und relativ clever, was wollte ich mehr. Darauf konnte ich aufbauen und das tat ich auch!
In unserer Küche stand ein Sofa. Auf dem Sofa lagen eine gefaltete Decke und zwei Kissen. Aber was das Beste war, das Sofa stand unter einem großen zweiflügeligen Fenster, aus dem hinaus man einen Rundumblick auf die Straße hatte, die an dem Haus, in dem wir wohnten, vorbeiführte. Das Sofa war also nicht nur als bequeme Kuschel- und Leseecke gefragt, sondern ebenfalls als Aussichtspunkt.
Familie
Mein Vorteil in diesem Fall war, dass ich etwas jünger war als mein Bruder und noch nicht in den Kindergarten ging. So hatte ich ausgiebig Zeit, mich ständig auf dem Sofa breit zu machen und meine vielen Bilderbücher zu betrachten. Aufgaben im Haushalt kamen erst später hinzu. Wenn dann mein Bruder vom Kindergarten nach Hause kam und sofort einen Blick in die Küche warf, hatte ich den besten Platz auf dem Sofa schon in Beschlag genommen. Auch konnte ich es mir nicht verkneifen, hämisch in seine Richtung zu grinsen.
Ich hörte noch, dass Mama auf dem Weg die Treppe hinunter rief:
„Streitet euch nicht! Ich muss in den Keller, ihr werdet euch schon einig werden!“
Sie wusste natürlich um den täglichen Kampf um einen Platz auf dem Sofa Bescheid.
Doch ich kannte uns schon seit ein paar Jahren und Monaten und wusste, was da auf mich zukam, nämlich mein Bruder in der Verkörperung eines Kämpfers, der seinen schmächtigen Mitbewerber in die Schranken zu weisen wusste. Er war mit einem Satz auf dem Sofa, stand über mir, noch ehe ich meine Bilderbücher in Sicherheit bringen konnte und prügelte auf mich ein. Nicht, dass ich mich nicht zu wehren gewusst hätte, nein. Aber ich musste mich trickreich wehren und gleichzeitig die Bücher retten, die in dem Augenblick schon durch die Küche flogen. Das war zu viel des Guten! Ich wehrte mich jetzt mit Händen und Füßen. Auch Kratzen und Beißen gehörten zu meinen Waffen, die ich zielgerichtet einzusetzen wusste. Als die Angriffswelle meines Bruders merklich abebbte und etwas nachließ, entfernte ich mich blitzschnell aus seiner Reichweite, klaubte ein paar der Bilderbücher vom Boden auf und überließ ihm das Feld. Der Klügere gibt eben doch nach!Als ich an der Küchentür war und mich noch einmal umdrehte, zeigte mir der einstweilige Sieger den bösen Mittelfinger. Ich hätte es ihm nur zu gerne gleichgetan, jedoch war mir die Unversehrtheit meiner Bücher, die ich in meinen Händen hielt, lieber.
Ich verließ das Haus durch die Haustür, weil ich wusste, dass mein Bruder bestimmt, mit einem Kissen auf der Fensterbank, auf dem Sofa kniete und die Weidestraße im Auge hatte. Als ich in sein Blickfeld kam, prellte ich den Ball, den ich mit nach draußen genommen hatte, auf den Boden und fing ihn wieder auf. Das wiederholte ich mehrere Male und schielte zwischendurch immer wieder zum Fenster hoch. Und richtig, es kam, wie es kommen musste. Mein Bruder erkannte, dass ich mit seinem Ball spielte!
„Eh!“, rief er wütend von seinem bequemen Fensterplatz aus, „lass sofort meinen Ball los! Warte, wenn ich dich kriege!“
„Komm doch, hol ihn dir!“, rief ich zurück. „Wenn du kommst, dann lass ich ihn los!“
Schon war er vom Fenster verschwunden, und ich sah, wie er die Haustür aufstieß und wütend auf mich zukam.
Zum besseren Verständnis muss ich erklären, dass neben unserem Haus die sehr steile Lärchenstraße begann, die an ihrem unteren Ende einen neunzig Grad Winkel nach links in die Lärche, einem kleinen Waldgebiet, hinein vollzog oder geradeaus direkt in den Forellenbach führte.
Als mein Bruder gerade den Ball ergreifen wollte, ließ ich diesen los und gab ihm noch einen kleinen Schubs, so dass er begann, immer schneller die Lärchenstraße hinunterzurollen. Mein Bruder ließ wutentbrannt von mir ab und rannte seinem geliebten Ball hinterher. Er würde ihn sicherlich einholen und vor dem Sturz in den Bach retten können, denn mein Bruder war schnell. Aus diesem Grund (wegen seiner Schnelligkeit) machte ich auf der Stelle kehrt und rannte so schnell ich konnte die Weidestraße hoch.
Ziemlich weit oben in der Weidestraße versteckte ich mich hinter einem Mauervorsprung und beobachtete die Situation aus sicherer Entfernung. Nach ein paar Minuten erschien mein Bruder mit seinem Ball in den Händen wieder in meinem Blickfeld, aber zum Glück weit genug entfernt. Er hielt Ausschau nach mir. Ich ließ mich natürlich nicht blicken, und das würde ich auch für den Rest des Tages so halten. Nur ja keine Konflikte herausfordern.
Zum Abendessen würde ich wieder zu Hause sein, dann im Schutz meiner Eltern. Ein klein wenig fühlte ich mich jetzt als Sieger.
So vergingen die Jahre! Ich bekam reichlich Beulen und blaue Flecken ab, lernte dadurch aber für mein Leben, wenn mir das auch noch nicht vollends bewusst war.
Dann kam der Tag, an dem meine Mutter mein Spiel mit dem Lastwagen und Bagger im Garten störte. Sie stellte sich vor mich hin und sagte geheimnisvoll:
„Sag mal, was hältst du davon, wenn du noch ein Geschwisterchen bekommst?“
Familie komplett
„Was“, ging es mir sofort durch den Kopf, „noch mehr Kämpfe und Einschränkungen?“
Aber das dachte ich nur, denn ich kannte auch den Spruch „Geteiltes Leid ist halbes Leid“.
Was nun auf mich zukommen würde, entzog sich meiner damaligen Vorstellungskraft. Was mir jedoch sofort in den Sinn kam, war folgendes: Jetzt war ich nicht mehr das zweite Kind von Zweien, sondern das mittlere Kind vonDreien. Ich konnte also jetzt Erfahrungen aus allen Richtungen sammeln, mein Erfahrungshorizont erweiterte sich dadurch beträchtlich.
Meine kämpferische, praktische Natur hatte ich bis zu dem Zeitpunkt schon genügend trainieren können. Ab jetzt wurde ich unbewusst in Fürsorge, Geduld und Liebe geschult. Ich nahm diesen eher musischen Gedanken gerne auf. Er entsprach meiner eigentlichen Natur am ehesten. Meinen so oft beanspruchten Platz auf dem Sofa vor dem Küchenfenster gab ich ebenfalls kampflos auf. Ich saß ab sofort lieber neben dem Körbchen, in dem meine kleine Schwester lag und mich anlachte. Endlich hatte ich genügend Gelegenheiten, mein lange erworbenes Wissen aus Bilderbüchern weiterzugeben.
Schwester im Kinderwagen
Ich konnte meiner Schwester immer wieder die Geschichten von Swimmy, Frederik und der kleinen Raupe Nimmersatt erzählen und ihr die Bilder zu zeigen. Meine Mutter war sehr dankbar über meinen unerwarteten Eifer, hatte sie doch jetzt Zeit für andere Dinge.
Kindergarten
Schon sehr früh in meinem Leben hatte ich mich auf ein Ziel versteift. Ich glaube, ich konnte dieses Ziel zu der damaligen Zeit noch nicht in Worte fassen, weil ich mich schlichtweg noch nicht ausreichend artikulieren konnte. In heutige Sprache gefasst lautet es in etwa folgendermaßen:
„Ich werde niemals in diesen Kindergarten gehen. Da kriegen mich keine zehn Pferde hin!“
Stuckenbrock
Und das habe ich bis zum Geht-nicht-mehr durchgezogen. warum meine Eltern es trotzdem geschafft haben, mich großzuziehen, weiß ich nicht mehr so genau. Es hängt auf jeden Fall mit meiner konsequenten Zielverfolgung zusammen.
„Hier stehe ich, ich kann nicht anders!“
Dieser berühmte Ausspruch des Martin Luther vor dem Reichstag zu Worms begleitet mich mein Leben lang. Er ist mir Stütze und Zielsetzung zugleich geworden!
Bachstraße
Schon beim Abbiegen von der Valdorfer Straße in die Dammstraße war mir bewusst, da vorne wohnt das Grauen. Auf der rechten Straßenseite befand sich das Kolonialwarengeschäft Stuckenbrock, dessen bunte Schaufensterauslage noch recht einladend aussah. Daran schlossen sich die Firma Schlüter (Öle und Schmierstoffe) und ein freies, verwildertes Grundstück an.
Aber daran anschließend duckte sich unter einen Bestand von großen, ausladenden Eichen das dunkle Mauerwerk des Kindergartens. Die komplette linke Seite der Dammstraße bis zum Kindergarten wurde flankiert vom Lauf des Forellenbaches. Dieser lag hier allerdings hinter einem Gitter und so tief unten, dass die meisten Kinder sich vor der Tiefe fürchteten. Auch ich traute mich nur, dem gurgelnden Treiben und den Wildenten im Bach zuzuschauen, wenn ich mich krampfhaft an dem Schutzgitter festklammern konnte.
Aber gegenüber dem Bach, auf der anderen Straßenseite, begann für mich eine andere Welt. Eine Welt, die ganz und gar nicht meinen Vorstellungen von Kinderglück und vorsorglichem Behütetsein entsprach.
Meine Mutter musste mich beim ersten Besuch an diesem Ort, dem Kindergarten in der Dammstraße Nr. 5, geradezu über die Schwelle schleifen. Der Eingang bestand aus einem dicken, eisernen Staketenzaun mit Tor, flankiert von zwei wuchtigen Eckpfeilern. Selbst die einzige Stufe dort hinein bestand aus einem hohen Steinquader, der viel zu hoch war, um von kleinen Kindern mühelos überwunden werden zu können.
Danach führte der Weg links herum, unter nicht gerade einladend ausschauenden, vier dunklen Fenstern entlang zu dem sogenannten Spielgelände. Auf diesem Spielgelände war die kindliche Fantasie in all ihren Facetten gefordert, denn das Gelände selbst und die paar Spielgeräte machten nicht viel her. Zum Glück hatte ich Fantasie genug, wie mir immer wieder von den Erwachsenen bestätigt wurde, mochte sie aber nicht an die, an diesem Ort sich auftuende Ödnis vergeuden!
Kindergarten in der Bachstraße
Rechts herum und noch einmal rechts herum, dann war der eigentliche Eingang erreicht. Der Haupteingang gleich hinter dem Tor, dort führten ein paar steinerne Stufen hinauf, wurde nie benutzt. Warum, das erschloss sich meinem kindlichen Gemüt nicht. Der benutzbare Eingang hingegen war ein dunkles Loch. Unter einem überkragenden, gemauerten Regendach befand sich eine riesige, doppelflügelige Holztür, die immer nur zur Hälfte geöffnet war. Eine freundliche Einladung für Ankommende war sie nicht gerade!
Hier wurden wir von einer älteren Frau in dunkler Kleidung empfangen - anthrazitfarbenes Kleid, darüber eine dunkelblaue Schürze und eine dunkelgraue Haube auf dem Kopf. Die Lippen zu einem Strich zusammengepresst, schaute sie mich von oben herab aus ihren fuchsigen Augen an. Sie stellte sich mit dem Namen Auguste vor. Ich zerrte am Mantel meiner Mutter, wollte nur weg hier.
„Na, der Junge hat wohl einen Dickkopf“, schnarrte die unsympathische Stimme der Frau. „Der Junge ist wohl noch nicht reif für eine gediegene frühkindliche Erziehung!“
„Nein, nein“, versuchte meine Mutter zu beschwichtigen, „wir sind nur heute sehr früh aufgestanden, damit auch alles klappt mit dem Kindergarten. Und die Nacht davor war auch mit sehr wenig Schlaf verbunden, für beide Teile. Mein Sohn scheint noch etwas verschlafen zu sein.“
Tante Auguste zischelte durch ihre zusammengepressten Lippen:
„Tse, tse, tse, klappt wohl gar nichts“, meinte sie. „Auf den Rippen hat er auch nichts, ob aus dem mal was wird?!“
„Da machen Sie sich man keine Sorgen“, versuchte meine Mutter endlich Partei für mich zu ergreifen. „Auf´m Kasten hat er jedenfalls was, das werden Sie schon sehen!“
Mit diesen Worten schob sie mich in Richtung Kindergartenfrau und wollte sich schon verabschieden. Da hatte sie jedoch die Rechnung ohne mich gemacht! Ich krallte mich mit beiden Händen, so kräftig ich konnte, in ihrem Mantel fest – und trat doch tatsächlich mit den Füßen aus. Das schien für die Tante zu viel des Guten zu sein, denn sie hob beide Hände abwehrend gegen uns und schimpfte:
„Den nehmen Sie mal erst wieder mit nach Hause. Der macht mir sonst noch die anderen Kinder renitent. Nein, nein, nein, Sie können ja in ein paar Tagen wiederkommen, wenn Ihr Gör stubenrein ist!“
Mit diesen für mich unsäglichen Worten verzog sich Tante Auguste in ihr dunkles Loch und ließ meine Mutter und mich unverrichteter Dinge zurück. Ich hatte den Eignungstest wohl nicht bestanden!
Zum Glück für mich war meine Mutter dermaßen perplex, dass sie keinen Widerspruch erhob, mit mir auf der Stelle kehrt machte und dem Ausgang zustrebte. Erleichtert nahm ich ihre Hand und hüpfte neben ihr her.
Zu Hause war alles, für kurze Zeit, wie bisher. Mein Bruder ging manchmal zum Kindergarten, wenn auch nicht regelmäßig. Gemeinsam spielten wir oft mit unseren Lego-Steinen und mit unseren Wiking-Autos. Die meiste Zeit waren wir jedoch an der frischen Luft unterwegs. Die „Lärche“ und der Forellenbach mit den anschließenden Flutmulden hinter unserem Haus waren die besten Spielplätze, die man sich für Kinder wünschen konnte.
Aber auch ganz allein hatte ich keine Probleme, mich zu beschäftigen. Im Moment lag ich in einem Liegestuhl unter dem Apfelbaum (Cox-Orange) hinten im Garten und blinzelte mit zusammengekniffenen Augen durch die von der Sonne beschienenen Blätter. Dabei hing ich meinen Gedanken nach. Was hatte die Kindergartentante damit gemeint, als sie gesagt hatte „Der hat ja nichts auf den Rippen und ist wohl noch nicht stubenrein!“ Die hatte ´se ja wohl nicht alle! War ich ein Hund? Selbst Waldi, der Hund unserer Vermieter, wäre dann schon weiter als ich gewesen. Und was meinte sie mit „… ist noch nicht reif für eine gediegene frühkindliche Erziehung“?Ich richtete mich ruckartig im Liegestuhl auf und knurrte laut wie ein Hund.
„Na, hast du geträumt?“, hörte ich eine Stimme vom Kellereingang her. Tante Wilma stand dort und schaute zu mir herüber.
„Nein, nein“, rechtfertigte ich mich, „ich denke nur über den Kindergarten nach.“
„So, so, da solltest du besser hingehen“, meinte sie. „Da kannst du noch was lernen und starrst nicht dauernd auf meine leckeren Äpfel.“
Mit diesen Worten drehte sie sich um und war im Keller verschwunden. War auch besser so, …!
„Wie bitte“, dachte ich, „jetzt spricht Tante Wilma schon genauso wie die Kindergartentante. Ich glaube, es geht los! Müssen denn alle Kinder immer nur das Gleiche machen, um schlau und groß zu werden?“
In was für eine Welt war ich da nur hineingeboren worden – vier Jahre nach dem Ende des großen Weltkrieges?! Mein Vater hatte mir oft davon erzählt. Bei all dem Elend, was meine Eltern erlitten hatten, war es kein Wunder, dass das Aufziehen von Kindern mit einigen Schwierigkeiten verbunden war. Nahrung war immer genügend da, aber auch alles für die Gesundheit? So ein Cox-Orange-Apfel wäre jetzt nicht schlecht!
Gerade in dem Moment rief mich meine Mutter ins Haus zum Mittagessen. Es gab Suppe, in die ich das Hasenbrot eintauchte, das mein Vater gestern Abend von der Arbeit mit nach Hause gebracht hatte. Ich fand es toll, wie die fettige Suppe von dem trockenen Brot aufgesogen wurde. Dann steckte ich mir einen Brocken in den Mund und drückte ihn langsam mit dem Gaumen und der Zunge zusammen, so dass das Fett wieder herausquoll und mir den Rachen hinunterlief. Das waren Momente, in denen ich meine Eltern über alles liebhatte!
„Mein Junge, wir müssen reden!“Meine Mutter schaute mir über ihren Tellerrand hinweg direkt in die Augen. Das konnte nichts Gutes bedeuten, so ernst war sie selten. Stress war angesagt, oder …?
„Du musst in den Kindergarten!“Ich verschluckte mich an dem zuletzt in den Mund geschobenen Brocken Brot und der heißen Suppe und musste husten. Meine Mutter langte über den Tisch und klopfte mir auf den Rücken.
Als ich wieder einigermaßen bei mir war, schrie ich:
„Ich will aber nicht! Ich – gehe – da – nicht – hin!!!“
Meine Mutter blieb ruhig und versuchte, mir die Situation zu erklären.
„Alle Kinder in deinem Alter gehen in den Kindergarten. Dort können sie mit anderen Kindern spielen und lernen eine Menge neue Dinge. Zur gleichen Zeit kann ich bei Sassenberg im Laden aushelfen und etwas Geld dazu verdienen. Dein Bruder und du habt euch doch schon lange einen neuen Roller und ein Dreirad gewünscht. All das könnten wir dann kaufen.“
Weidestraße 9
Je länger meine Mutter redete, desto mehr verrauchte mein Zorn. Die Aussicht auf die langersehnten neuen Fahrzeuge ließ meine Wut auf die Kindergartentante etwas weniger werden. Aber – nannte man das nun „gediegene frühkindliche Erziehung“? Ist das nicht eher Erpressung?!
Das Leben ist verrückt!
So kam es, dass ich dort saß, auf der oberen Mauer des Kindergartenspielplatzes und den anderen Kindern beim Spielen zuschaute.
Hier war wirklich Fantasie gefragt, dachte ich und sah, wie die meisten meiner Leidensgenossen im Sandkasten saßen und Sandburgen bauten. Ein paar kletterten auf den bunten Eisengerüsten herum und versuchten, sich nicht an den Roststellen zu verletzen. Sollte es an irgendeiner Stelle auf dem Spielgelände einmal laut werden, so erschallte vom Eingang her eine noch lautere Stimme wie ein Peitschenknall, dazu ein herrischer Fingerzeig – und schon lief wieder alles im Rahmen.
Die obere Mauer war die Grenze des Kindergartens zum Kleinbahngelände hin. Dahinter verlief ein weiteres kleines Bachbett, wie auf der unteren Seite, nur schmaler. Von Zeit zu Zeit ratterte eine Straßenbahn mit ohrenbetäubendem Lärm so dicht hinter meinem Rücken her, dass mein ganzer Körper vibrierte. Es war zwar erschreckend, aber mir gefiel das furchterregende Geräusch. Ein wirkliches Gefühl für Angst und Zerstörung bekam ich bei einem Starkregenschauer zu spüren. Wir Kinder standen unter der Obhut der Tanten unter dem Regendach und warteten auf das Ende des Gusses. Wenn es besonders stark regnete, stieg der obere Bachlauf an und schwappte sogar über seine Einfassung auf die Bahngeleise hinab. Auch der untere Forellenbach stimmte ein infernalisches Rauschen und Gurgeln an. Die wilden Enten, die sonst dort immer ihrer Tagesbeschäftigung nachgingen, hatten sich längst in ihre Verstecke verzogen. In diesen Momenten stellte ich mir vor, dass die beiden Bäche über ihre Ufer traten und sich zu einem wilden Strom vereinigten, das Spielgelände überfluteten und, bestenfalls, das ganze Kindergartengelände samt Haus hinfort spülten und mit sich nahmen, bis alles in den schäumenden Fluten der Weser verschwunden war und nie wieder auftauchte.
Doch meine Wünsche erfüllten sich leider nicht immer, auch nicht in diesem Fall. Der Regenschauer zog vorüber, wir durften danach ausnahmsweise mal inne Mötke spielen, - es geschahen noch Zeichen und Wunder - und der Kindergarten stand noch.
Meine anhaltende Traurigkeit und die anhaltende Lethargie wurden zum Glück von den Kindergartentanten falsch interpretiert.
„Der Junge ist noch nicht reif!“, war ihre eindeutige Aussage, und ich durfte zu Hause bleiben. Vorerst, wie es hieß.
Zu Hause blühte ich auf und überraschte meine Eltern mit Fähigkeiten, die man einem unterernährten und nicht stubenreinen Jungen niemals zugetraut hätte. Meine Eltern waren davon überzeugt, und ich sowieso, dass der Kindergarten für mich nicht die richtige Erziehungsstätte war. Ich blieb also zu Hause, und meine Mutter konnte trotzdem halbtags arbeiten gehen, weil Tante Wilma ein Auge auf mich warf - und ich ein guter Junge war!
Bei Oma geparkt
Wenn man noch sehr jung war, beaufsichtigt werden muss und nicht in den Kindergarten gehen wollte, konnte es einem passieren, dass man zum wiederholten Male bei Oma geparkt wurde. So erging es mir heute. Nicht, dass ich mich dagegen gesträubt hätte, nein. Bei meiner Oma war ich morgens, wenn die anderen Kinder im Kindergarten waren, das einzige Kind und wurde, so gut es eben in der Nachkriegszeit ging, umsorgt und sogar verhätschelt.
Brüder vor Omas Haustür
Brüder vor Omas Haustür
Auch heute nutzte ich die Gunst der Stunde. Ich saß draußen auf der Bank vor der Haustür und hörte, wie Oma die Stufen der Kellertreppe hinunterstieg. Auf jeder zweiten Stufe musste sie kurz rasten und schnaufte laut durch. Ich konnte mir bildhaft vorstellen, wie sie die Hände in die Seiten stemmte und angestrengt nach Luft schnappte.
“Dieses verdammte Asthma”, stöhnte sie.
Als von Oma nichts mehr zu hören war, sprang ich auf, schlich leise durch die offen stehende Haustür den Flur entlang und in die Küche hinein. Dort stieg ich auf einen Stuhl und schaute aus dem Fenster in den Garten hinunter. Und richtig, dort hinten stand sie gebückt zwischen den Büschen und machte sich an den Stibberken (Stachelbeeren) zu schaffen.
Also war die Luft rein und ich konnte mein Vorhaben in die Tat umsetzen. Ich wollte nämlich unbedingt meinen Jieper nach Süßem befriedigen. Und das ging so: eine große Tasse, einen Löffel, fünf Teelöffel Zucker, genügend Kondensmilch und alles umrühren. Anschließend setzte ich mich nach draußen auf die Bank und ließ es mir schmecken. Bevor Oma wieder aus dem Garten ins Haus kam, stellte ich die leere Tasse in das Spülbecken und beschäftigte mich wieder draußen. Ich spielte Rundlauf. Nachdem ich auf die Holzbank zwischen den Stufen der beiden Hauseingänge gesprungen war, rannte ich die Stufen hinunter und sprang erneut auf die Holzbank. So ging es eine ganze Zeit weiter, bis ich erschöpft war und mich auf der Bank ausruhen musste.
Doch dann geschah es! Beim letzten Sprung auf die Bank war ich anscheinend unachtsam, stieß mit der linken Schuhspitze an die Kante der Bank, rutschte ab und schürfte mir das linke Schienbein auf. Mist, tat das weh! Ich musste wohl doch etwas zu laut geklagt haben, denn sofort stand Oma in der Haustür. Als sie mein aufgeschürftes Schienbein und das Blut sah, drehte sie um und kam kurz darauf mit Verbandszeug wieder.
„Nun mach man nicht so´n Geschrei und geh man auf die Bank sitzen“, sagte sie, nahm einen Waschlappen, den sie mitgebracht hatte und wischte vorsichtig das meiste Blut ab. Anschließend nahm sie das größte Pflaster aus der Verbandtasche und klebte es auf die Wunde.
„Aua, Oma!“, stöhnte ich. „Das Pflaster ist zu hännig (klein), da guckt ja noch alles nebenher!“
„Nun nöhl mal nich so rum! Es ist besser, wenn noch etwas Luft drankommt!“
Mit diesen Worten drückte sie noch einmal kräftig ihre Handfläche auf das Pflaster. Ich musste mir einen lauten Schmerzensschrei verkneifen.
„Das kommt davon, wenn man zu viel Zucker in sich reinschlingt. Der Körper weiß nicht, wohin mit der überschüssigen Energie, und dann passiert so etwas! Ruh dich noch ein wenig aus und komm dann rein zum Mittagessen. Opa müsste auch gleich da sein. Er kommt heute etwas eher nach Hause.“
Ich sagte keinen Mucks mehr. Oma hatte anscheinend wegen der schmutzigen Tasse in der Spüle meine Zuckerschleckerei entdeckt und die richtigen Schlüsse daraus gezogen.
Opa und Oma Hünefeld
Mama sagte ja auch immer: „Süßes macht die Kinder hibbelig (nervös, zappelig)! Der Zucker, den unser Körper braucht, ist schon in der Nahrung enthalten!“
Als Opa den Nagelbrink hoch kam, blieb er kurz vor der Bank, auf der ich noch saß, stehen und meinte:
„Na, mein Junge, was kuckste so vanienig (schlecht gelaunt)? Ist dir ´ne Laus über die Leber gelaufen?“
Als er jedoch mein Knie sah, tätschelte er tröstend meinen Kopf.
„Lass uns man erst was zur Stärkung essen! Ich glaube, es gibt Schillegassen (Graupensuppe), komm!“
Schillegassen waren überhaupt nicht mein Leibgericht, da wäre mir Erbsensuppe schon lieber gewesen. Davon hatte ich sechs Teller auf einmal leergemacht.
In der Küche setzte ich mich an den Küchentisch und wollte gerade anfangen zu essen, da rief Oma:
„Disse Stuhl hört unser Opa! Setzt dich auf den anderen Stuhl, dann können wir anfangen!“
Gesagt, getan! Ich setzte mich auf den Stuhl neben Opa und löffelte mit spitzen Zähnen die Schillegassen in mich hinein.
„Nun sei man nich so´n Knötterpott (unzufriedener Mensch)! Iss man schön auf, dann bleibst du nich so´n Spinnewipp (Dünner)“, meinte Opa. Er hatte wohl bemerkt, dass mir die Suppe nicht schmeckte.
„Nachher gibt es noch Kompott (Nachtisch).“
Schweigend aßen wir unser Mittagessen. Opa machte einen erschöpften Eindruck. Ich wusste, dass er auf der Weserhütte arbeitete, wo Bagger gebaut wurden; in Kriegszeiten waren es Panzer gewesen.
Endlich waren alle Teller leer, und Opa sagte:
„So, Oma, tu mich den Kompott (… gib mir bitte den Nachtisch)! Ich bin etwas in Brass (Eile)!“
Oma und Opa Hünefeld
Oma räumte die Teller ab und holte eine Überraschung auf den Tisch. Zum Nachtisch gab es nämlich Pudding mit Bibberken (Blaubeeren).Dadurch hatte ich mich etwas mit dem Essen versöhnt. Doch ich hatte die Rechnung ohne Opa gemacht. Anscheinend aß er Bibberken genauso gerne wie ich, oder noch viel lieber, denn er sagte:
„Du siehst so ömmelig (schlecht) aus und bist so stickum (still), du kannst bestimmt nicht mehr! Wenn du mir deine Bibberken gibst, gebe ich dir dafür ´nen Groschen (zehn Pfennige)!“
Er hatte seine Hand schon an meinem Schüsselchen mit den Blaubeeren und zog es zu sich heran. Mit der anderen Hand kramte er in seiner Hosentasche, fand schließlich, was er suchte und schnippte mir einen Groschen über den Tisch. Was sollte ich machen? Ein Groschen war schließlich viel Geld für ein Zissemänken (kleiner Wicht) wie mich. Mir blieb nichts anderes übrig, als zuzuschauen, wie Opa meinen leckeren Pudding mit Bibberken verspeiste.
Als Opa mit dem Essen fertig war und sich wieder verabschiedet hatte, er wollte sich die Kunst des Zigarrenmachens anschauen, war ich vollends klödderig zugange (nicht gut)!
„Oma“, stöhnte ich, „mir ist nicht gut. Ich glaube, ich muss mal!“
„Dann aber schnell!“, rief Oma. „Heb deinen Pöter (Po) und nichts wie ab innen Keller.“
Ach ja, die Toilette, besser der Donnerbalken, befand sich ja ganz hinten im Keller beim Ausgang. Widerwillig öffnete ich die Tür zur Kellertreppe und schielte hinunter in die Dunkelheit.
„Mach dir Licht an!“, rief Oma mir hinterher. „Der Schalter ist gleich um die Ecke!“
Welche Ecke? Links, rechts, oben, unten? Für einen kleinen Jungen, der diesen Weg nicht jeden Tag einschlug, konnte das überall sein! Nach einigem Tasten in die Dunkelheit hinein, hatte ich den Schalter endlich gefunden. Nur, das Lämpchen, das dann aufflammte, ließ nicht viele Konturen erahnen. Jetzt wurde es Zeit, „der Mutterboden“ drückte. Ich stieg Stufe um Stufe die Holztreppe hinunter, immer in der Erwartung, durch die Stufen hindurch von einer knöchernen Hand gepackt zu werden. Unter einer dusteren Kellertreppe konnten nur Dämonen wohnen! Endlich unten angekommen, rannte ich auf einen quadratischen Lichtfleck zu, das Fenster in der Außentür. Daneben war die Toilettentür, die ich im letzten Moment aufriss. Deckel auf – Hosen runter – Hemd unter die Achseln geklemmt und sich der Erleichterung hingeben, das war eins.
Ich konnte mir ein leises Stöhnen nicht verkneifen. Doch als ich an mir hinuntersah, war es kein leises Stöhnen mehr, vielmehr ein Aufschrei des Schreckens. Ich hatte ganz vergessen, dass ich mich nicht auf einer modernen Toilette mit Wasserspülung, sondern auf einem Plumpsklosett befand. Ich saß also auf einem viel zu großen Loch, das in Holzbretter geschnitten war und über einem noch größeren Loch schwebte, dessen Tiefe für mich nicht einsehbar war. Nach erledigtem Geschäft rutschte ich schleunigst nach vorne vom Loch runter und drehte mich um. Was ich dort im Schummerlicht sah, ließ mir die Haare zu Berge stehen. Unter den Brettern erahnte ich einen großen, ummauerten Raum, aus dem es erbärmlich stank. Selbst die Wände waren mit Kot beschmiert, und weiße, madenartige Tierchen krabbelten langsam an ihnen empor.Nur schnell weg, dachte ich! Halt, ich musste mir ja noch den Po abputzen. Doch womit? Dann entdeckte ich an einem Nagel hängend einen gebogenen Draht, auf den Schnipsel von Zeitungspapier aufgezogen waren. Besser als nichts! Drei, vier Schnipsel dienten mir der Säuberung meines Gesäßes. Ich entsorgte sie ebenfalls in dem stinkenden Loch und knallte den Deckel darauf. Hemd runter – Hosen hoch – Tür auf und nichts wie weg. Den Weg die Kellertreppe hoch zog ich gar nicht erst in Betracht, da hatte ich keine Lusten (keine Lust) zu, sondern verließ den Keller gleich durch die nahe Kellertür und nahm den Weg außen rum.
Plumpsklosett im Keller
Als ich zur Haustür kam, hatte ich das erste Mal an diesem Tag Glück. Mama stand dort und unterhielt sich mit Oma.
„Da bist ja“, sagte Oma, „aber wieso kommst du den Garten hoch?“
„Ach“, seufzte ich erleichtert, „ich hatte was gehört und wusste gleich, dass Mama mich abholt.“
Ich hoffte, dass die kleine Flunkerei nicht so schlimm war.
„Tschüss, Oma, bis zum nächsten Mal!“, rief ich noch und war schon ein Stück die Straße lang.
Mama schüttelte den Kopf.„Na, der hat es aber eilig.“
Oma meinte:
„Er ist eben gern zu Hause!“
An der Weser 1951
Milch und Brot
Von Zeit zu Zeit verlangt der Körper nach Nahrung, das macht sich durch ein Hungergefühl bemerkbar. Dann ist es bald notwendig, etwas zu essen und zu trinken. Durch die Nahrung bekommt der Körper wieder Energie - und kann erneut Nahrung besorgen. In meinem speziellen Fall handelte es sich um Milch und Brot. Die Beschaffung dieser Nahrungsmittel gehörte oft zu meinen Aufgaben.
Auto von Milchmann Schröder
Der Weg zum Milchmann war weit, vor allen Dingen, für einen kleinen Kerl wie mich. Hätte ich zu Hause aufgepasst und auf die Glocke des Milchwagens geachtet, was auch meine Aufgabe war, dann bräuchte ich jetzt nicht mit der Milchkanne in der Hand und dem Milchgeld in Papier eingewickelt den weiten Weg Geschäft des Milchmannes zurücklegen.
Aus der Weidestraße kommend, konnte ich das Geschäft fast sehen. Es lag am unteren Ende der Valdorfer Straße, nicht ganz in der Stadt. Das war auch der Grund, warum meine Eltern mich ohne Bedenken ganz allein losschickten.
Milchkanne
Bis zum Ende unserer Straße war es ein Klacks. Auf der Valdorfer Straße war ich in weniger als fünf Minuten beim Tischler Jürdens und dem Malergeschäft Siekmann vorbei. Spätestens hier taten mir die Finger weh, so fest umklammerte ich den Bügel der leeren Milchkanne und hielt das Geld in der geschlossenen Hand.
Wo die Mittelstraße abzweigte, wurde ich unweigerlich von der anderen Straßenseite angezogen. Hier gab es, tief unten in einem Innenhof liegend, einen kleinen Schweineauslauf, in dem es immer etwas zu sehen gab. Auch dieses Mal, als ich vorsichtig die Straße überquert hatte, schaute mich von unten herauf eine riesige Muttersau mit ihren intelligent dreinschauenden Äuglein an. Ich war geneigt, mich ihr zu öffnen und Konversation mit ihr zu betreiben, besann mich aber glücklicherweise meiner Aufgabe, einen Liter Milch vom Milchmann zu besorgen.
Gerade in dem Moment sah ich aus den Augenwinkeln, wie sich am rechten Mauerrand des Auslaufes etwas bewegte. Neugierig geworden ging ich wieder näher heran und sah doch tatsächlich, wie eine Rattenfamilie dem nahen Schweinestall zustrebte. Vorneweg trippelte die Rattenmutter, gefolgt von fünf winzigen Rattenkindern, die sich mit ihren Schnäuzchen am Schwanz des jeweiligen Vordermannes festhielten, um nicht verloren zu gehen. Diese Prozession hielt mich eine geraume Weile in ihrem Bann gefesselt. Ich musste mich geradezu davon losreißen, um meine Aufgabe nicht zu vergessen. Ich glaube, ich hatte noch gerufen:
„Macht´s gut, ihr Kleinen!“
Vorsichtig überquerte ich erneut die Valdorfer Straße und legte den Weg zum Milchmann, vorbei an der Einmündung der Königsstraße, dem Zigarrengeschäft Stemmer und dem Gärtner von Beeren, in kurzer Zeit zurück. Beim Frisörgeschäft musste ich erneut die Straßenseite wechseln. Dann ging es beim Schuhmachergeschäft Fette direkt die Stufen hinunter in das Milchgeschäft
Natürlich wurde ich freundlich empfangen und begrüßt. Die Verkäuferin kannte mich schon. Ich war schon öfter hier.
„Hallo, wie immer?“, lachte sie mich fragend an. Als ich nickte, fuhr sie fort: „Na, dann gib mir mal deine Kanne rüber!“
Sie ging mit der Kanne zu einem riesigen Milchbehälter und füllte sie mit ein, zwei Hebelbewegungen mit einem Liter Milch. Ich gab ihr das eingewickelte Geld, bedankte mich und verließ das Geschäft.
„Pass aber auf“, rief sie mir noch hinterher, „dass du nichts verschüttest!“
„Jedes Mal die gleiche Leier! Ich doch nicht!“, dachte ich und machte mich auf den Rückweg.
Dieses Mal musste ich die Valdorfer Straße nur einmal beim Frisör überqueren. Den Besuch beim Schweineauslauf ersparte ich mir. Oder – vielleicht war die Mäusefamilie noch unterwegs? Nein, nein, ich setzte meinen Weg die Straße hinauf nach Hause fort Als ich die Einmündung zu unserer Straße erreicht hatte, ging es nicht mehr bergauf, sondern sogar etwas bergab. Ich sah mich schon fast zu Hause, ging etwas schneller, wurde dabei etwas übermütig und begann, die volle Milchkanne im Takt meiner Schritte zu schwenken. Ob ich aus dem Takt gekommen war, oder was sonst, ich wusste es nicht mehr. Jedenfalls ließ ich die Kanne einmal um einhundertsechzig Grad vertikal kreisen, um sie dann etwas zu ruckartig anzuhalten. Natürlich ging das nicht ohne Probleme vonstatten. Der Deckel hob sich etwas und entließ einen gehörigen Schwall der kostbaren Milch auf die Straße. Ich konnte meine Füße gerade noch in Sicherheit bringen, sonst hätte ich meine Sandalen auch noch versaut. Milch ist nun mal fetthaltig, die schmiert! Schwer atmend verweilte ich kurze Zeit, bis die in der Kanne schwappende Milch und ich mich etwas beruhigt hatten und ging dann die letzten Schritte wie auf Eiern nach Hause. Nur nicht noch mehr Milch verschütten!
Natürlich bemerkte meine Mutter die fehlende Menge Milch und sah mich fragend an.
„Komisch“, sagte sie, „du hast ja gar keinen Milchbart. Hat dir die Verkäuferin zu wenig Milch abgefüllt oder ist ein Liter heutzutage kein Liter mehr?“
„Nein, nein, Mama, ich habe nicht genascht!“, versuchte ich zu erklären. „Aber ich musste doch die Stufen hoch … und da waren noch die kleinen Mäuse. Die waren so süß! … das Schwein war riesig .. und beim Frisör war nicht viel los …!“
„Ja, ja, du und deine Ausreden“, sagte sie. „Aber es ist ja noch genügend da, dass wir einen Kuchen backen können und auch noch Haferflocken mit Milch und Kakao essen können!“
„Au ja!“, jubelte ich und fiel Mama um den Hals.
Sie musste mich aber doch noch ermahnen:
„Pass aber das nächste Mal auf, dass du den Milchwagen vor der Tür erwischst! Ich glaube, das ist für dich etwas einfacher!“
Der Mensch lebt nicht nur von Milch allein.Nein, das heißt anders: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein!Richtig, das ist der Spruch, den ich gesucht habe. Brot, Brot zu kaufen gehörte nämlich ebenfalls zu einer der Aufgaben, die ich auferlegt bekommen hatte. Ich musste alle paar Tage zum Laden gehen und Brot kaufen. Das gehörte definitiv zu meinen Lieblingsaufgaben, denn der Weg war nicht so weit wie zum Milchmann, und Brot konnte nicht überschwappen – oder doch?
Na ja, im wahrsten Sinne des Wortes nicht überschwappen. Aber ein ganzes Brot heil nach Hause zu bringen, gehörte anscheinend auch nicht zu meinen alltäglichen Kunststücken – oder wie soll ich sagen?
Nun denn! Mama drückte mir eines Tages das abgezählte Geld für einen Leib Graubrot in die Hand, um Brot kaufen zu gehen, lecker. Ich begab mich auf den kurzen Weg zum Laden. Meistens kauften wir unser Brot nicht beim Bäcker gegenüber, sondern in dem Geschäft, in dem meine Mama ab und zu einmal aushalf.
Der Kauf war schnell getan, das Brot in Papier eingewickelt, und ich begab mich wieder auf den kurzen Heimweg. Aber wie das Schicksal es jedes Mal wollte, bekam ich schon am Anfang der Weidestraße ein starkes Hungergefühl. Und wenn nicht zufällig aus dem Einwickelpapier ein großes Stück des knusprigen, stark duftenden Brotes herausschaute, dann wäre ich gar nicht erst in Versuchung geraten. So jedenfalls machten sich der Daumen und der Zeigefinger meiner Hand selbstständig, bohrten sich für mich kaum merklich in die Kruste des Brotes und brachen ein mundgerechtes Stück davon ab. Als der Brocken sich wie von selbst in meinen Mund verirrte, bildete sich dort ein unaufhaltsamer Speichelfluss, und mein Kaureflex setzte sich in Gang. Danach war kein Halten mehr! Brocken für Brocken fanden wie von selbst ihren Weg in meinen Mund und weiter in meinen nun nicht mehr knurrenden Magen.
Erst, als ich vor unserer Haustüre stand, bemerkte ich, dass ich kein Hungergefühl mehr verspürte und auch die anderen Reflexe nachgelassen hatten. Allerdings hatte auch das Volumen des Brotes um ein beträchtliches Maß abgenommen.
Mamas einziger Kommentar war:
„Na, für heute bist du dann ja wohl satt!“
Hausschlachtung
Die Hausschlachtung war in der Zeit nach dem großen Krieg ein notwendiges Übel (aus meiner kindlichen Sicht und wenn man es sich leisten konnte), Nahrung zu erwerben. Sie war ein probates Mittel, seine Familie zu ernähren, wenn man denn in diesen schweren Nachkriegszeiten ein Schwein hatte beschaffen können. Onkel Alfred kam gebürtig von einem Bauernhof in Hohenrode, einem kleinen Dorf bei Rinteln an der Weser, deshalb schien die Beschaffung für ihn möglich gewesen zu sein.Dass die komplette Verwandlung von einem lebenden Tier zur verzehrfertigen Pingelwurst in unserem Keller passieren würde, hatte ich mir in meiner noch kindlichen, naiven Fantasie nicht vorstellen können und wollen. Jedoch hat man als kleiner Junge in meinem zarten Alter noch keinen Einfluss auf derartige Entwicklungen!
Modelleisenbahn Märklin 1954
Modelleisenbahn Märklin 1954
Ich spielte wie so oft, wenn ich alleine war, mein Bruder war im Kindergarten, in unserem Kinderzimmer mit der elektrischen Eisenbahn. Unser Papa hatte auf einem großen Brett von einem mal zwei Metern eine wunderbare Landschaft erschaffen, in der unsere Märklin – Modelleisenbahn ihre Bahnen zog. Ihre ich nicht sagen, das wäre nicht richtig gewesen. Neben einem großen Oval gab es eine Acht und eine Hochstrecke. Diese drei Strecken waren mit einer Kreuzung und mehreren Weichen verbunden. Daneben bestand die Landschaft aus einem Berg mit einem Tunnel hindurch. Man entdeckte bei näherem Hinschauen eine Gärtnerei, einen Bahnhof und natürlich das Haus, in dem wir wohnten.
Gärtnerei
Wohnhaus der Familie
Es machte mir immer wieder Spaß, die Weichen und Signale zu bedienen, die Waggons umzuspannen und zu beladen und dann mit der Rangierlok den Berg hinauf zu schnaufen. Oftmals drehten die großen Eisenräder auf den Schienen durch und ich musste mit der großen Tenderlok von hinten schieben. Auch bei den vielen Strecken, die ich mit der Diesellok und den Passagieranhängern fuhr, wurde ich nie müde. Da musste schon einiges passieren, bevor ich den Zug in den Bahnhof einfahren ließ und den Trafo auf Stopp stellte.
Bahnhof
Und etwas Ähnliches geschah genau in diesem Moment, ich verspürte einen derartigen Harndrang, der einen Toilettengang unaufschiebbar machte. Ich schaltete die Anlage also aus und ging die Treppe hinunter, da die Toilette sich im Keller unseres Hauses befand, im Gegensatz zu dem Plumpsklo bei meiner Großmutter hatte diese eine moderne Wasserspülung. Als ich gerade die Kellertür aufdrücken wollte, da fiel mir ein, dass heute der Tag der Hausschlachtung war. Ich sollte also besser nicht den Weg die Kellertreppe hinunter und an dem wie immer auf einer Leiter aufgehängten toten Schwein vorbei nehmen. Es war bestimmt auch schon aufgeschnitten, und diesen Anblick wollte ich mir dieses Mal ersparen. Ich drehte also um, verließ den Flur durch die Haustür und lief die Rampe neben dem Haus hinunter in den Hof.
Endlich, da war die Kellertür. Jetzt musste ich schon etwas nötiger. Ich drückte erleichtert auf den Türgriff, - aber die Tür war abgeschlossen. Was sollte das denn? Ich sprang hoch und erhaschte einen Blick durch das kleine viereckige Fenster in den Kellergang hinein. Doch außer ein schemenhaftes Etwas war nichts zu erkennen. Auch durch das Waschküchenfenster daneben sah ich nur wabernde, dunstige Schwaden.
„Die machen bestimmt Pause“, dachte ich. „Gerade jetzt, wo ich so nötig muss!“
Es ging nicht anders! Ich lief so schnell ich konnte in den hinteren Teil des Gartens. Hinter den Kaninchenställen knöpfte ich meine Lederhose auf, ließ meine Unterhose runter und pinkelte an die Böschung. Das war eine Erleichterung! Der Strahl wollte gar nicht mehr aufhören.
Bei der Hausschlachtung vor einem Jahr war es für mich nicht ohne Schrecken abgelaufen. Ich hatte mich, ohne näher darüber nachzudenken, die dunkle Kellertreppe hinunter geschlichen und auf den Weg zur Toilette begeben. Dabei stand ich plötzlich ohne Vorwarnung vor einem riesigen, auf eine Holzleiter ausgestreckten Klumpen Fleisch. Aufgeschnitten und mit abgetrenntem Kopf und Füßen erinnerte es nur wenig an ein Schwein, das vor einigen Stunden noch quicklebendig war. Ich stand wie in Schockstarre da und atmete hektisch den warmen, fettigen Schwaden ein, der von der Waschküche zu mir herüberwaberte. Ich fing an zu zittern und wollte laut nach Mama schreien, da erinnerte mich mein Körper an mein allzu menschliches Bedürfnis. Die Toilette war in Reichweite. Ich riss mich von dem schrecklichen Anblick los und stürmte in den Toilettenraum. Ich konnte mich im Nachhinein nicht mehr daran erinnern, wie ich auf die Toilettentasse gekommen war. Jedenfalls brachte mich ein anderer Geruch als Brühschwaden wieder in die Wirklichkeit zurück.Hoffentlich behielt ich von diesem traumatisierenden Erlebnis keine psychischen Schäden zurück!
Ich zog meine Hosen wieder an und schlenderte erneut in Richtung Kellertür. Jetzt sollte die Pause wohl vorbei sein. Und richtig, emsiges Werkeln und Rufen machte mich schon von Weitem darauf aufmerksam, dass Tante Wilma und Onkel Alfred mit dem Schlachter zusammen bei der Arbeit waren. Ich betrat durch die jetzt offen stehende Tür den Kellergang und wäre beinahe in einer fettigen Wasserlache ausgerutscht.
„Kannst du nicht aufpassen?“, hörte ich Onkel Alfred aus dem Dunst heraus fragen. „Siehst du denn nicht, was hier los ist?“
„Ja, doch, aber ich muss zur Toilette“, stöhnte ich.
„Muss das unbedingt jetzt sein?“, fragte er unwirsch.
„Wenn nicht jetzt, wann dann?“, wollte ich erst fragen, stöhnte aber nur noch lauter: „Ja, unbedingt, es geht nicht mehr anders!“
Was Onkel Alfred dann grummelte, verstand ich nicht mehr, denn ich war schon in der Toilette verschwunden.
Als ich mein Geschäft erledigt und mich wieder angezogen hatte, öffnete ich die Toilettentür einen winzigen Spalt breit und lugte in den Kellergang. Als die Luft rein war, schob ich mich vorsichtig hinaus und wollte mich durch die Kellertür verdrücken.
"Halt!", rief Onkel Alfred hinter mir her. "Wenn du schon mal hier bist, kannst du mir auch gleich beim Rühren helfen!“
„Okay“, dachte ich, „Rühren ist ja nicht so schlimm, das schaffst du schon.“
Als Onkel Alfred mir in der Waschküche eine riesige Holzkelle in die Hand drückte, da wurde mir ganz anders zu Mute. Vor mir auf einem Schemel stand ein großer Bottich, in dem sich eine rote, zähe Flüssigkeit befand. Als ich hineinschaute, wollte ich die Holzkelle sofort wegschmeißen und davonrennen.
„Nun mal langsam mit den jungen Pferden!“, rief Onkel Alfred und hielt mich am Arm fest.„Das ist Blutwurst! Die esst ihr doch auch alle so gerne mit Senf. Du musst jetzt rühren, rühren und rühren, damit sich nichts am Boden absetzt, dann schmeckt sie nicht mehr!“
„Ja, aber…“, wollte ich protestieren.
„Nichts da!“ Onkel Alfred ließ nicht locker und erklärte: „Ich bin gleich wieder da, dann wirst du erlöst.“
Was blieb mir anderes übrig? Ich rührte, rührte und rührte, bis mir die Arme lahm zu werden drohten.
Nach einer gefühlten Ewigkeit kam Onkel Alfred zurück und meinte:





























