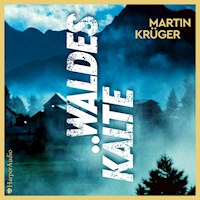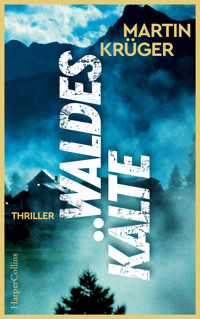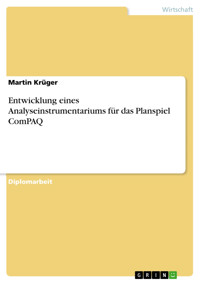9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Valeria Ravelli
- Sprache: Deutsch
In den Walliser Alpen wird eine grausam zugerichtete Leiche gefunden. Da sich der Tote als ehemaliger deutscher BKA-Beamter erweist, schaltet sich Interpol ein und schickt ihre beste Ermittlerin: Valeria Ravelli. In der eisigen Abgeschiedenheit der Berge stößt sie bei ihren Nachforschungen auf eine Mauer aus Schweigen. Ein mächtiges Areal der Wälder rund um das Dorf Steinberg ist abgeschottet und dient als privates Winterquartier für eine Gruppe schwerreicher Geschäftsleute. Gemeinsam mit einem neuen Kollegen folgt Valeria den weit verzweigten Spuren eines wahnhaften Mörders, dessen Taten zurück in die Vergangenheit reichen. Doch was sie nicht ahnt: Sie selbst ist längst in sein Visier geraten.
»Auf blutrünstige Details kann Martin Krüger verzichten, denn bei ihm funktioniert der Horror über das Ungewisse und die Vorstellungswelten der Lesenden.« Kulturnews, über den vorhergehenden Roman des Autors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Copyright © 2022 by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von wilhelm typo grafisch Coverabbildung von Christian Scheidegger, Nico J / Shutterstock E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749905072
www.harpercollins.de
1
Das Gesicht des Toten war eine Maske aus Schmerz.
Zuerst hielt der Mann die Leiche für ein Trugbild, dachte, dass ihn seine Augen getäuscht hätten. Das ist sicher nur eine alte abgestorbene Wurzel, die aus dem morastigen Höhlenboden herausragt, ging ihm durch den Kopf, mehr nicht …
Aber es war anders.
Mein Gott, was ist das?
Ausgerechnet hier?
Als er näher trat, entdeckte er die Hand, die unnatürlich abgeknickt an der Seite des Toten hervorragte. Sein Unterarm war offensichtlich gebrochen. Was immer dieser Fremde erleiden musste, es war schrecklich gewesen, das war ihm anzusehen, an den weit aufgerissenen Augen, an dem schmerzverzerrten Mund, der zu einem ewig währenden Schrei aufklaffte …
Eine Leiche, dachte der Mann. Hier. Mitten im Nirgendwo. Das konnte nicht sein, das durfte nicht sein. Er hob die Hand, die in dem dicken Handschuh steckte, und schob sich eine fettige Haarsträhne zur Seite, die wie ein Fächer vor seinem Gesicht hing. Lass ihn liegen. Kehr um und geh. Vergiss ihn. Das ist nicht deine Sache, also lass ihn ruhen. Hier oben würde der bald mit aller Kraft und Kälte hereinbrechende Winter schnell dafür sorgen, dass bis ins nächste Frühjahr niemand mehr auch nur einen Fuß in die Nähe dieses seltsamen Toten setzte.
Doch obwohl er von der schmutzig braunen, vertrockneten Leiche abgestoßen war, trat er vor, beugte sich tiefer. Er schob ein paar Blätter zur Seite und starrte auf die verrottenden Fetzen von Kleidung, die an der Leiche hingen. Er blickte auf die Finger, dann auf den Boden und hinüber zur schroffen Felswand. Worte standen dort, vielleicht auch nur sinnlose Buchstaben, die er las, aber nicht verstehen konnte – bis auf eines, das deutlich hervorstach. Man könnte den Toten verscharren, ging ihm ein flüchtiger Gedanke durch den Kopf, vergraben oder gleich hierlassen. Hier würde ihn ja doch niemand finden. Dem Ort bliebe der ganze Trubel erspart.
Denn wenn es stimmte, was er dort geschrieben hatte – seine letzten Worte vor dem Tod –, dann stand ihnen allen eine ganze Menge Unheil bevor.
Der Mann zögerte kurz, dann wandte er sich ab. Als er sich von der Leiche entfernte, war es ihm, als folgten die Augen des Toten jedem seiner Schritte.
2
Es war kalt und roch nach Pulver, Metall und frischer Farbe. Die Stellen, an denen man den in die Jahre gekommenen grauen Beton der Schießbahn weiß angestrichen hatte, schimmerten wie bleiche Knochen. Die langen Reihen von Leuchtstoffröhren summten leise.
Valeria Ravelli sicherte die Walther P 99 und steckte sie zurück ins Holster. Die Übungsscheibe kam zurück und zeigte ihr acht Treffer, drei ins Schwarze, aber keiner, der weit abwich. Die Stellen, wo die Neun-Millimeter-Projektile das Material perforiert hatten, fühlten sich noch immer heiß unter ihren Fingern an.
Nicht schlecht. Aber auch nicht besser.
Valeria blickte auf. Sie war nicht länger allein. Die Uhr, die nah bei den massiven Zugangstüren der Schießanlage aufgehängt war, zeigte kurz nach Mitternacht. Eine Uhrzeit für all jene, die das Alleinsein liebten. Es gab nicht besonders viele, die wussten, dass sie gerne zu dieser Stunde herkam.
»Ich dachte mir, ich würde Sie hier finden, Ravelli.« Konrad Tanners raue Stimme klang, als hätte er eine ganze Nacht in der Kälte verbracht – und vielleicht war es auch wirklich so.
Als er näher trat, wehte eine Böe kalter Luft aus der Tür, die er hatte offen stehen lassen. Dahinter klaffte Dunkelheit. Sie waren allein, und alles war still, so tief unter der Erde.
»Spionieren Sie mir nach?« Valeria betrachtete den Leiter von Einheit 11 genauer. Da war ein dunkler Ausdruck, ein harter Zug um seinen schmalen Mund, etwas, das manch anderer vielleicht als verbraucht oder müde bezeichnen würde, aber Valeria wusste es besser. Er hatte zu viel gesehen, zu viele Dinge, die niemand sehen sollte, und diese Dinge hatten ihre Spuren hinterlassen. Auf seiner Seele, seinem Gesicht, tief in seinen Augen. Er ist schon lange kein junger Mann mehr, dachte sie, aber er kann immer noch wie ein Löwe kämpfen.
»Ich spioniere nicht mehr«, erwiderte Tanner und lächelte flüchtig, doch würde niemand dieses Lächeln als herzlich bezeichnen. Er trug einen Aktenordner mit sich, in dunkles Leder geschlagen, durch den jahrelangen Gebrauch abgegriffen. Das Geräusch, als die Schlösser aufschnappten, ertönte laut in der Stille, die sie umgab. »Was wissen Sie über Steinberg?«, fragte er und nahm ein Blatt heraus, aber Valeria konnte nicht erkennen, was darauf stand.
»Nie gehört. Ist das ein Name?«
Wieder dieses seltsame Lächeln. »Ein Ort. Ziemlich abgelegen. Aber damit kennen Sie sich doch aus, nicht wahr?«
»Falls Sie auf Eigerstal anspielen, Tanner, dann war ich offiziell nie dort. Und das wissen Sie auch.«
»Ja, das tue ich. Aber in Steinberg, dort ist es etwas anders. Ich denke, es wird Ihnen gefallen.«
Valeria knüllte die papierne Zielscheibe zusammen und warf sie in einen der herumstehenden Abfallkörbe. »Ich denke nicht, dass wir wirklich Zeit dafür haben. Sie haben meinen Bericht gelesen und wissen …«
»Aber es fällt doch genau in Ihr Fachgebiet, Ravelli«, unterbrach er sie.
»Ach ja?«
»Mord. Die grausame Variante.« Er streckte ihr das Blatt entgegen. Es war eine Fotografie, viel zu dunkel belichtet, doch was man erkennen konnte, genügte schon.
»Sieht ganz danach aus«, erwiderte sie. »Dieser Tote … Was hat man mit ihm gemacht?«
»Eine ganze Menge bösartiger Dinge. Aber das ist jetzt noch nicht wichtig, das kommt später. Viel wichtiger ist im Augenblick, wer dieser Mann ist. Und da kommen wir ins Spiel.«
»Ja?«
»Steinberg liegt, wie ich bereits sagte, sehr, sehr abgelegen. Eine Enklave mitten in den Walliser Alpen. Abgeschieden, fern von jedem touristisch attraktiven Skigebiet. Die Berge sind zu unvorhersehbar, die Hänge zu steil, und die Lawinen gehen in jedem Jahr häufiger ab. Es gibt keine Attraktionen, keine Hotels, nichts, was anziehend wirken würde – von den Vorlieben einiger Extremsportler abgesehen, die gerne Kopf und Kragen riskieren.«
»Und natürlich all diejenigen, die sich gerade nach dieser Abgeschiedenheit sehnen.«
»Wie Sie selbst, Ravelli?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, mir ist die Stadt lieber, Tanner.«
»Ich fürchte, Sie werden Zürich eine Weile hinter sich lassen müssen. Tun Sie es für mich, weil ich Sie darum bitte.«
»Da steckt natürlich mehr dahinter.« Valeria konnte es Tanner an den Augen ablesen. Dieser Ausdruck, den sie dort erblickte, sie kannte ihn gut.
»Jemand hat mich um Hilfe gebeten.«
»Was Sie nicht sagen.« Ein süffisantes Lächeln schlich sich auf Valerias Lippen. »Eine Frau. Es ist immer eine Frau, wenn Sie so anfangen.«
»Eine alte Bekannte«, erwiderte Tanner. »Wir … nun, wir verstehen uns gut. Und ich schulde ihr einen Gefallen. Wahrscheinlich mehr als nur einen.«
»Das klingt nun so gar nicht nach Ihnen«, meinte Valeria. »Tanner, der Mann, der all seine Schulden ganz genau durchgezählt und aufgelistet hat. Klingt, als müssten Sie demnächst noch einen neuen Eintrag auf diese Schuldenliste setzen. Also gut, erzählen Sie mehr.«
»Nicht hier, Ravelli. Das ist nicht der richtige Ort. Und auch nicht die richtige Zeit. Kommen Sie morgen früh in mein Büro.«
Valeria wusste, dass sie nichts mehr aus ihm herausbekommen würde. »Wie Sie meinen.« Sie nickte knapp und wandte sich zum Gehen.
»Ravelli?«, sagte Tanner, als sie schon bei der Tür war.
»Ja?«
»Sie sollten sich darauf einstellen, so schnell wie möglich aufzubrechen.«
Der Blick, den sie ihm erwiderte, war kühl und distanziert. »Sie bitten mich also darum, dieser Sache höchste Priorität einzuräumen? Schön. Dieser Ort ist ebenso gut wie jeder andere. Mich hält hier nichts.«
Sie ging, und die schwere Tür der Schießanlage fiel mit einem schweren Knall ins Schloss.
»Ich fürchte«, sagte Tanner leise in die Leere hinein, »genau das könnte zu einem Problem werden.«
3
Ein alter, alleinstehender Mann, der wusste, wann sein Ende gekommen war, ging hinauf in die Wälder. Starb er im Winter, wurde sein Körper unter den Massen aus Schnee begraben, die ihn erst im nächsten Frühjahr wieder freigaben, bleiche Knochen, die nur noch fern über das, was er einst gewesen war, erzählten. Starb er im Herbst, so ging er in eine der Höhlen, die das Gestein, das dem Dorf seinen Namen gab, seit Jahrtausenden durchlöchert hatten. Vielleicht fand man dann im Frühling seine Überreste, vielleicht blieb er auch für immer verschwunden. Vielleicht zerrten die Wölfe seine Knochen zurück ans Tageslicht, vielleicht vergruben sie sie, und sie würden erst eines fernen Tages wieder an die Oberfläche gelangen. So hielten es die Alten in den hochgelegenen Dörfern, wenn die Kälte hereinbrach. Steinberg ist auf ihren Knochen gebaut, die für immer in den kargen Höhen ruhen.
Valeria blickte auf den Bildschirm, auf jene Worte, die sie dort las. Das blau gefärbte Licht ihres Notebooks schimmerte im spärlich eingerichteten Wohnzimmer ihrer Wohnung im Züricher Norden und verlieh den weiß gestrichenen Wänden einen sanften Ton von frisch gefallenem Schnee. Sagen, dachte sie, alte Geschichten … mehr Schauermärchen als Wahrheit.
Es gab nicht besonders viel, das sie über Steinberg hatte entdecken können, als sie im Internet nach dem Dorf gesucht hatte – und in den internen Systemen der Polizei noch viel weniger. Ein kleiner Fleck des Nichts auf der Landkarte, unbedeutend, vollkommen unauffällig.
Sie fuhr sich durch das dunkle Haar, streckte sich und trat zum Fenster. In der Ferne schimmerte die Limmat, die sich in der Nacht kühl und gemächlich durch ihr Flussbett wälzte. Das letzte Mal, als du so überstürzt aufgebrochen bist, warst du eine ganze Weile fort, verschollen in deiner eigenen Vergangenheit … aber dieses Mal wird es nicht so sein. Dieses Mal nicht. Valeria dachte an die Leiche auf der schlecht ausgeleuchteten Fotografie, die Tanner ihr gezeigt hatte. Der Unterarm des Mannes war gebrochen und in einem unnatürlichen Winkel vom Körper abgeknickt, sein Gesicht verzerrt von Schmerz. Der Ausdruck in seinen Augen … Dieser Mensch hatte etwas erlebt, das über einen gewöhnlichen Tod hinausging. Er hatte eine Geschichte zu erzählen, das spürte sie instinktiv. Und du willst, ob du es dir nun eingestehst oder auch nicht, diese Geschichte erfahren. Du willst dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Tanner wusste, dass er dich damit locken kann.
Valeria klappte das Notebook zu. Als sie sich kurz vor zwei hinlegte und kurz darauf einschlief, geisterte ein alter Mann durch ihre Träume, der sie immer tiefer in eine Höhle führte. In der Hand hielt er eine Fackel, deren Licht tanzende Schatten auf das schroffe Schiefergestein warf.
Wohin bringst du mich, wollte sie ihn fragen, doch er antwortete ihr nicht. Immer tiefer ging es in die Höhle. Sie waren nicht allein, begriff sie … Es waren nicht nur die Schatten im Licht der Fackel, die ihr folgten.
Du hättest nicht herkommen sollen, flüsterten Stimmen aus der Dunkelheit. Aber wir heißen dich dennoch willkommen.
Der Mann machte mit einem Mal Halt, so abrupt, dass Valeria beinahe in ihn hineingelaufen wäre. Irgendwo in der Tiefe der Höhle erklang ein Geräusch, als würde dort etwas atmen.
Der Alte fuhr zu ihr herum, und Valeria erschrak. Seine Augen waren bleich wie frisch gefallener Schnee, und der Griff seiner Finger, mit denen er sie packte, war kalt wie Eis.
Wir warten auf dich. Schon lange Zeit.
Diese Stimme war direkt in ihrem Kopf. Sie versuchte sich dem Griff des Mannes zu entziehen, doch als sie an ihrem Arm herabblickte, bemerkte Valeria, wie die Kälte ihren Körper durchdrang und ihre Haut zu Eiskristallen erstarrte, bleich und durchscheinend.
Sie riss sich los, und der Alte lachte, während sie spürte, wie die Kälte sie peinigte, das Eis, das ihren Arm umfangen hatte, ihr Fleisch zerriss …
Schmerzen. Und sie fiel. Fiel in eine bodenlose Dunkelheit, suchte nach Halt …
Fiel.
Und fiel.
»Nein!«
Valeria holte keuchend Luft, schrak auf und strampelte die Decke von sich. Instinktiv tastete sie nach ihrem Arm, erwartete, dort nur totes, in Eis erstarrtes Fleisch vorzufinden, aber alles, was sie bemerkte, war das Zittern ihrer Hand. Dicht hinter ihrer Stirn schmerzte es. Schweiß stand auf ihrer Haut. Sie fühlte sich, als hätte sie kaum mehr als eine Stunde geschlafen, doch als Valeria langsam erwachend zu den Fenstern hinüberblickte, lag über den Dächern von Zürich ein feiner Morgennebel im blaukalten Licht der aufgehenden Sonne.
Atme, sagte sie sich. Ganz ruhig. Das war nur ein Albtraum.
Nach einer kurzen heißen Dusche belebte ein doppelter Espresso ihre Sinne wieder. Dann brach Valeria auf: Es war an der Zeit, mehr über Tanners ungewöhnlichen Auftrag herauszufinden.
4
Tanner erwartete Valeria in seinem Büro im vierten Stock des schlichten mehrstöckigen Gebäudes am Ende einer kurzen, ebenso schlichten Straße voller Lagerhallen und heruntergekommener Geschäftsgebäude. Der Beton war über die Jahre schmutzig und grau geworden, Wasserflecken zogen sich unter den Fenstern über die gesamte Fassade. Aus einem der Fallrohre tropfte es. Den ganzen Morgen fiel Regen, und der Himmel war ein einziges tiefes graues Wolkendickicht.
»Der Aufzug funktioniert nicht«, sagte sie zu ihm, nachdem sie eingetreten war.
»Bitte schließen Sie die Tür.« Tanner blickte nicht auf.
Der abgenutzte Ledersessel quietschte leise, als sie Platz nahm. In der Ecke des Raums stand eine Standuhr aus Eiche, die mit kunstvoll geschnitzten Intarsien verziert war. Vermutlich das einzige Objekt, das er mit in dieses Büro gebracht hatte. Leise schlug die Uhr achtmal, dann blickte Tanner auf und legte den Füllfederhalter beiseite, mit dem er einige Unterschriften gesetzt hatte.
»Sie sehen müde aus«, sagte er mit rauer Stimme. Er wirkte, als hätte er gerade vor Kurzem erst von etwas erfahren, das ihm mehr zusetzte, als er sich selbst eingestehen wollte.
»Gut möglich. Meine Nächte sind nicht mehr so erholsam wie früher.« Valeria blickte kurz zu dem betongrauen Himmel hinaus, zu dem Nebel, der sich gegen die Fenster drängte. »Sie wollten mir Details mitteilen?«
Tanner legte eine Reihe von Fotografien auf den Tisch, die jene männliche Leiche, die sie am Tag zuvor gesehen hatte, noch detaillierter zeigten. »Gefunden wurde dieser Tote vor drei Tagen. Es gibt in den Wäldern oberhalb von Steinberg einige Höhlen, die durch Verwerfungen im Fels während der letzten Eiszeit entstanden sind. Stabile Strukturen, die sich bis tief unter den Ort ziehen. Der Finder ist ein Pilzsammler aus dem Ort. Was er in dieser Höhle zu suchen hatte, ist mir nicht bekannt, aber nach eigener Aussage hat er sofort nach dem Fund die Polizei benachrichtigt.«
Natürlich hat er das, dachte Valeria. »Diese Leiche ist mumifiziert. Der liegt dort schon seit … wenn ich schätzen müsste, über einem Jahr?«
»Seit vergangenem Herbst«, erwiderte Tanner und nickte. »Das deckt sich mit unseren Einschätzungen. Aber natürlich wird sich noch ein Fachmann den Toten ansehen – und mit dem werden Sie sich dann unterhalten. Ich habe dafür gesorgt, dass jemand mit der entsprechenden Expertise vor Ort sein wird.«
»Gibt es Anhaltspunkte zu seiner Identität?«
Tanner zögerte einen Augenblick. »Auf die Höhlenwände hat er etwas gekritzelt, mit einem Stück Holzkohle, das er wohl auf dem Höhlenboden gefunden hatte, vermutlich ein Überrest eines Lagerfeuers. Man hat weder Identitätskarte noch Führerausweis gefunden, nur noch ein Stück verwittertes, unleserliches Papier in seinen zerlöcherten Taschen, aus dem nicht mal die beste Forensik der Welt noch etwas herausholen könnte …«
»Was hat er geschrieben?«
»Buchstaben. Immer wieder die gleichen. E, L und T, hin und wieder auch kleine Kreise. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll.«
»Und das Papier?«
»Notizzettel, nehme ich an. Vielleicht auch ein Parkticket. Aber es gibt kein Fahrzeug, das schon länger unbewegt herumsteht – jedenfalls haben die Polizisten vor Ort noch keines gefunden. Vielleicht ist es irgendetwas vollkommen anderes, wer weiß das schon?«
Valeria seufzte. »Ich verstehe nicht, warum bei diesem Fall ausgerechnet Interpol hinzugezogen werden muss.«
»Sie wissen noch nicht alles, Ravelli. Ein Stück weiter oben in der Hierarchie sitzt eine gute Freundin meiner Person … Sie hat diese Bilder auch gesehen. Und sie hat den Toten erkannt.«
Valeria hob die Augenbrauen. »Was Sie nicht sagen. Woran?«
Tanner tippte auf die Aufnahme, die den Oberkörper des Toten aus der Nähe zeigte. »Er hat da ein Tattoo auf der Brust. Sehen Sie? Das ist kein Dreck oder Wundmal … nicht alles zumindest.«
Valeria erkannte es. Man hätte es leicht angesichts des fortgeschrittenen Verwesungszustandes übersehen können, doch hatte sich die Farbe tief in die ledrige Hautstruktur eingeprägt. »Und daran hat sie ihn …«
»Es gibt hier eine gewisse Dringlichkeit … und eine besondere Vertraulichkeit, was dieses Detail angeht. Dieses Tattoo war beliebt bei Angehörigen der légion étrangère.«
»Die Fremdenlegion«, sagte Valeria. »Ich verstehe.«
»Der Mann war Fremdenlegionär. Ein Deutscher. Und später arbeitete er als Ermittler beim BKA. Das deutsche Bundeskriminalamt.«
»Was Sie nicht sagen.«
»Er ist vor einigen Jahren ausgestiegen. Meine gute Freundin, deren Name hier nichts zur Sache beiträgt, sagte, dass es einen Zeitpunkt in seinem Leben gab, an dem er anfing, sich … nun, nennen wir es … zurückzuziehen. Sich zu verschließen. Vor ihr. Vor allen anderen. Es muss mit etwas zusammenhängen, an dem er gearbeitet hatte. Und dann – etwa zwei Jahre nachdem er von der Bildfläche verschwunden ist – tauchte er plötzlich wieder auf. Er hat sich verändert, sagte man … aber er hat auch ein Ziel verfolgt. Da war wieder dieses Feuer, so beschrieb es meine gute Bekannte, die ihn damals noch ein einziges Mal gesehen hat. Er verfolgte eine Spur. Was genau es war, sagte er ihr nicht. Er wirkte, so formulierte sie es, besessen, vielleicht schon wahnhaft.«
»Was ist dann passiert?«
»Er ist wieder verschwunden. In seiner Wohnung in Freiburg fand man damals ein Chaos vor, Verwüstungen, Spuren eines Kampfes. Das nächste Mal, dass man ihn wiedersah …« Tanner deutete auf die Leiche auf den Aufnahmen. »Meine Bekannte ist sich sicher. Das ist er. Das ist unser vermisster Ex-Fremdenlegionär, der frühere BKA-Beamte.«
»In einer Höhle in Steinberg, am wortwörtlichen Arsch der Welt. Mitten im Hochgebirge.« Valeria musterte das Tattoo auf der Fotografie. »Also stellt sich uns jetzt die Frage: Was suchte er dort? Wie kam er in diese Höhle?«
»Richtig. Und ich muss wiederholen: Vertraulichkeit, Ravelli.«
»Hm«, machte sie nur.
»Ich kann mich auf Sie verlassen, nicht wahr?«, verlangte Tanner zu wissen.
»Aber klar. Was die Vertraulichkeit angeht … und was dieses Rätsel angeht. Wenn es denn eines gibt, werde ich es bestimmt lösen. Vielleicht hatte der Mann auch einfach nur genug, und er hat sich einen wirklich abgeschiedenen Ort zum Sterben ausgesucht.«
»Es gibt keine abgeschiedenen Orte zum Sterben. Nicht mehr. Irgendwann werden sie alle gefunden.«
»Das ist sicher«, erwiderte Valeria. »Spesen?«
»Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Mir ist diese Sache wichtig. Was immer es kostet.«
Valeria musterte Tanner eingehend. Wer immer diese gute Bekannte war, von der er sprach, ihr schien dieser Tote am Herzen gelegen zu haben. Und sie besaß Einfluss, daran bestand kein Zweifel. »Diese Frau … Von welcher Hierarchie weiter oben sprechen wir hier genau?«
»Sehr weit, Ravelli. Und sie legt Wert darauf, bei der ganzen Sache nicht namentlich genannt zu werden.«
»Na schön. Soll mir recht sein. Also soll ich Steinberg einen Besuch abstatten und die letzten Stunden, Tage und Wochen unseres Ex-Legionärs nachrecherchieren?«
»Der Mann hat natürlich einen Namen. Thomas Gress.« Tanner zögerte. »Und nein, ich bin mir nicht sicher, ob Sie direkt dorthin aufbrechen sollten.«
»Wie meinen Sie das?«
»Ich wurde angewiesen, dass Sie sich zwar dieser Sache annehmen sollen, aber eben nicht allein.«
Valeria starrte ihn an. »Gerade in einer Sache wie dieser, die auf Geheimhaltung angelegt ist …«
»Deswegen will man, dass jemand dabei ist, auf den man sich zu einhundert Prozent verlassen kann.«
»Man? Das ist also eine Anweisung Ihrer Hierarchie-Freundin, Tanner. Entweder traut sie mir nicht oder Ihnen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht?« Valeria versuchte, jegliche Verärgerung aus ihrer Stimme zu verbannen, doch gelang es ihr nicht vollkommen.
»Ich sagte ihr, dass ich meine beste Mitarbeiterin einsetzen würde.«
Ein flüchtiges, ironisches Lächeln huschte über Valerias Lippen. »Das schmeichelt mir jetzt aber.«
»Es genügte ihr aber nicht. Also entsendet sie noch jemanden, der bei dieser Angelegenheit helfen soll.«
»Helfen? Oder mir über die Schulter schauen und Aufpasser spielen?«
»Beides, vermutlich.« Tanner lehnte sich zurück, das Leder seines Bürostuhls knarzte leise, und er legte die Fingerspitzen aneinander. »Sie müssen sich mit ihm abstimmen. Daher sagte ich, es ist vielleicht nicht sinnvoll, sofort aufzubrechen. Ich überlasse Ihnen die weitere Abstimmung … und die Maßnahmen, die vor Ort zu treffen sind.«
»Und wer genau soll mir über die Schulter blicken?«
Tanner sah aus, als bedauerte er seine nächsten Worte bereits jetzt. »Er ist kein Unbekannter. Es ist Colin Bain.«
»Bain?«, wiederholte sie irritiert. »Der Neue?«
»Ja, Ravelli. Und ich weiß, dass Sie ihn nicht ausstehen können.«
Valeria musste lachen. »Das beruht wohl auf Gegenseitigkeit.«
»Reden Sie mit ihm.«
Sie nickte widerstrebend. Bain war ein Neuzugang bei der Einheit, ein ehemaliger Metropolitan-Police-Ermittler, der seine alte Wirkungsstätte hinter sich gelassen hatte und in die Schweiz gezogen war. »Wann treffe ich ihn?«
»Um zehn.«
Tanner sah aus, als betrachtete er ihr Gespräch für beendet, daher stand sie auf. Gegen die hohen Fenster schlug mittlerweile Regen, der ein leises Prasseln erzeugte.
»Und eine Sache noch, Ravelli. Wir wissen nicht, wer oder was Gress so zugerichtet hat, und ich kann nicht sagen, was Sie und Bain dort unten erwartet. Aber eines weiß ich: Hier wird nicht mit offenen Karten gespielt. Weder was Gress’ Vergangenheit betrifft, noch was Bains Hinzuziehung in diese Angelegenheit angeht. Also passen Sie auf sich auf.«
»Natürlich. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß«, sagte Valeria.
Sie ging hinaus, und aus den betongrauen Wolken schüttete es, als sie das in die Jahre gekommene Gebäude verließ. Bevor sie Bain gegenübertrat, würde sie erst mal Kaffee brauchen. Starken Kaffee.
5
»Ravelli. Da sind Sie ja.«
Colin Bain kam gegen zehn in ihr Büro, als würde es ihm gehören. Sein Blick streifte das Regal, wo sie ein Bild von Mark Harrington und seiner Tochter aufgestellt hatte. Dann betrachtete er flüchtig das Stück Schiefergestein, das sie aus Eigerstal mitgebracht hatte – eine letzte Erinnerung an den Ort, zu dem sie nie mehr zurückkehren wollte.
»Bain«, sagte sie, speicherte den Bericht, an dem sie gerade geschrieben hatte, und sah zu ihm auf. Colin Bain war groß und blond, und von dem grauen Mantel, den er trug, tropfte Wasser auf den Laminatboden in Eichenholzoptik. »Sie sind nass.«
Er wandte sich dem Kleiderständer neben der Tür zu. »Darf ich?«
»Sicher.«
Unter dem Mantel kam ein teurer marineblauer Anzug zum Vorschein. Maßangefertigt, dachte sie. Natürlich, was auch sonst? Sie hatte sich ein wenig umgehört, was ihn anging, und in allen Geschichten war man sich einig: Bain liebte sich selbst mehr als alles andere.
Er musterte sie aus blassgrünen Augen, als er ihr gegenüber Platz nahm, während von ihm ein Hauch eines herben Aftershaves ausging, der sich mit dem feuchten Geruch des Regens vermischte.
»Sie wurden also informiert«, sagte er leise. »Thomas Gress. Zu Tode gefoltert, wie es scheint. Todeszeitpunkt wahrscheinlich vor etwa etwas weniger als einem Jahr.«
Sie hielt seinem taxierenden Blick stand. »Ich wurde vor allem darüber informiert, dass mir jemand bei der Ermittlung über die Schulter blicken wird. Und ich frage mich, was das ganze Theater soll.«
Bain lächelte, doch erreichte das Lächeln nicht seine Augen, die nach wie vor abwägend und kühl dreinblickten. »Dieser Jemand bin dann wohl ich. Und ich würde es nicht so drastisch formulieren … eine Zusammenarbeit, das trifft es doch besser.« In sein Deutsch hatte sich kaum ein Hauch eines britischen Akzents eingeschlichen, und er wählte seine Worte sehr sorgfältig. »Eine Zusammenarbeit, von der alle profitieren können.«
»Inwiefern?«
Bain nestelte an seinem Hemdkragen herum. »Es ist ein Fall, der jemandem ganz besonders am Herzen liegt, der möglichst schnell aufgeklärt werden sollte. Diskret. Geschickt. Sie wurden nicht zufällig damit beauftragt.«
»Nein?«
»Sie sind Tanners beste Ermittlerin.«
»Jetzt schmeicheln Sie mir aber«, wiederholte Valeria dieselben Worte, die sie schon gegenüber Tanner benutzt hatte, und hob eine Augenbraue.
Bain warf einen Blick auf den dichten Regen, der vom Wind beinahe waagrecht gegen das Fensterglas geweht wurde. Die Schlieren verzerrten die umliegenden Gebäude zu schemenhaften Abbildern wie die eines mittelmäßig talentierten Aquarellmalers. »Der Herbst ist da. Noch bleibt Zeit. Aber wenn der Winter hereinbricht, sollten wir wieder aus Steinberg verschwunden sein. Bis dahin … Wer weiß schon, was dort noch alles zu finden ist?«
»Wie meinen Sie das?«
»Gress war einer Sache auf der Spur. Und wenn wir zu Ende bringen, was er begonnen hat … Wie ich schon sagte, jemandem liegt diese Sache besonders am Herzen.«
»Also sind Sie darauf aus, sich einen Namen zu machen?«
»Würde ich sagen, ich würde es ausschließlich aus Gründen der Gerechtigkeit machen, würden Sie mir glauben?«
»Nein«, erwiderte Valeria. »Aber das klingt jedenfalls ehrlich.« Sie beugte sich vor. »Wieso glauben Sie, dass Gress an etwas dran war? An einer Sache, wegen der er womöglich ermordet wurde?«
»Ich glaube es nicht nur … Ich weiß es.« Bain musterte sie aus seinen durchdringenden grünen Augen. »Ravelli, ich weiß, Sie trauen mir nicht. Aber bei dieser Sache, da fürchte ich, wird es Ihnen nicht anders gehen als mir. Wenn Sie sehen, was ich gesehen habe, dann werden Sie glauben.«
»Dafür muss ich was sehen?«
Bain schwieg einen Augenblick, und nur das Geräusch des Regens, der gegen die Glasscheibe prasselte, unterbrach die Stille. »Ich habe es erst vor einer Woche entdeckt. Gress hat etwas hinterlassen. Eine Art Versteck. In einem kleinen Örtchen im Schwarzwald. Nicht weit von seiner alten Wohnung … die vor Jahren verwüstet aufgefunden wurde.«
»Wie sind Sie auf dieses Versteck gekommen? Und was haben Sie dort gefunden?«
Bain schüttelte langsam den Kopf. »Das ist etwas, das Sie selbst sehen sollten. Wir können heute noch los, wenn es passt. Ich möchte, dass Sie es sich ganz unvoreingenommen ansehen.«
Valeria blickte in den Regen hinaus, dann zu Bain. Etwas an seinen Worten klang unglaubwürdig, aber zugleich auch seltsam interessant. »Das sind, na ja, zwei Stunden Autofahrt? Es ist doch ein wunderschöner Tag mit wunderschönem Wetter«, erwiderte sie sarkastisch. »Also gut. Kommen Sie.«
»Jetzt? Sofort?«
»Klar. Was kann man schon gegen einen kleinen Ausflug unter Kollegen sagen?«
6
Das Tiefdruckgebiet reichte bis zur deutschen Grenze und in den Schwarzwald hinein, und als Bains Geländewagen, ein Jeep Cherokee, durch Tannen- und Fichtenwälder auf kleinen Straßen in die Höhe kletterte, war der Regen nur kaum merklich schwächer geworden. In dichten Schlieren lief das Wasser über die Windschutzscheibe, während die Scheibenwischer auf Hochtouren arbeiteten. Bain fuhr kaum mehr als fünfzig, und einzig die Lichter des alle paar Minuten entgegenkommenden Verkehrs verrieten ihnen, dass sie nicht gänzlich allein inmitten dieser Wälder waren. Böiger Ostwind kam auf und ließ die Tannenwipfel schwanken. Laub trieb über die asphaltierte Straße.
»Ich sagte ja schon, Gress hat sich ein gutes Versteck ausgesucht.«
Valeria warf Bain einen Blick von der Seite zu. Er hatte das Lenkrad fest umfasst und fokussierte sich vollkommen auf die Straße.
Sie wusste nicht besonders viel über ihn: Er war sechsunddreißig und stammte aus Northumberland, nahe der schottischen Grenze. In England hatte er sich einen Namen gemacht, die Liste der von ihm aufgeklärten Verbrechen war lang … doch die Liste der Beschwerden, die sich gegen ihn angehäuft hatten, war ebenso lang. Ein Exzentriker, jemand, der mit dem Kopf durch die Wand wollte, sich nur schwer beugen oder unterordnen konnte. Vielleicht einer der Gründe, wieso er seiner Heimat den Rücken gekehrt hatte, sie wusste es nicht.
»Sie überlegen gerade, was Sie eigentlich über mich wissen und ob es eine gute Idee war, mich zu begleiten. Sie überlegen, ob es vielleicht nicht nur Zeitverschwendung ist und was von mir zu halten ist«, sagte er nun in die Stille hinein.
»Sie können ja auch noch Gedanken lesen.«
»Ich versichere Ihnen, das ist es nicht. Keine Zeitverschwendung. Was meine Gesellschaft angeht, nun, das müssen Sie selbst beurteilen.«
Valeria sah in den Regen hinaus. Durch die Glasscheiben des Jeeps drang Kälte, und sie hatte das Gefühl, mit jedem Meter, den sie zurücklegten, fiel die Temperatur weiter. »Wissen Sie, was passiert ist, als ich das letzte Mal zu einem Ort zurückkehrte, den ich eigentlich nie wieder in meinem Leben aufsuchen wollte?«
»Nein«, erwiderte er. »Sagen Sie es mir?«
»Ich habe jemanden verloren, den ich für einen Freund gehalten habe. Aber am Ende … hat er sich als etwas ganz anderes herausgestellt.« Valeria bemerkte, dass sie die Hand zur Faust geballt hatte. »Was soll das hier, Bain? Spielen wir mit offenen Karten. Warum wurden wir beide auf diesen Fall angesetzt?«
Er warf ihr einen kurzen Blick zu. »Weil Tanner Ihre Fähigkeiten wertschätzt. Und weil ich jemanden brauche, der etwas von seiner Arbeit versteht.«
»Sie haben sich allein auf seine Empfehlung verlassen?«
Bain sah aus, als wollte er etwas antworten, entschied sich dann jedoch dagegen. »Natürlich nicht«, fuhr Valeria fort. »Sie haben sich über mich informiert. Sie wissen, wer ich bin.«
»Ich weiß, wer Sie sind«, bestätigte Bain. »Und ich weiß, woher Sie kommen. Ich weiß, was Sie durchgemacht haben. Und dass es Sie besser werden ließ … als Ermittlerin. Als Mensch. Und ich weiß …« Er bremste den Jeep und bog auf eine schmale Straße ein, die sie nach einigen Hundert Metern an den Rand eines kleinen Dorfes führte. »… dass ich Sie brauchen werde. Wegen Ihrer Erfahrung. Wegen Ihres Instinkts.« Er parkte am Dorfrand und deutete durch die Windschutzscheibe hinaus. »Dieses Haus dort«, sagte er und wies auf ein kleines graues Gebäude mit Spitzdach, auf dem Moos wucherte. »Es hat einen Keller. Dort habe ich Gress’ Versteck gefunden.«
»Wie?«
»Es stammt aus Familienbesitz. Das Haus gehörte seinem Großvater, Gress hat es geerbt. Es war all die Jahre unbewohnt.«
Bain stieg aus und stapfte durch den Regen, der den Boden zu einem schlammigen Morast hatte anschwellen lassen. Valeria folgte ihm unter das Vordach des heruntergekommenen Hauses, wo der Putz von den Wänden bröckelte und das Wasser in großen Sturzbächen vom Dach floss. Bain schloss die Tür auf, dann holte er eine Taschenlampe aus seinem Mantel und richtete den Lichtkegel ins Innere. Es war staubig, schmutzig, und Spinnweben hingen in den Ecken. Der Geruch war ein Gemisch aus Morast, tief in die Wände eingedrungener Feuchtigkeit und schwarzem Schimmel. Bain wandte sich einer Kellertreppe zu, die in die Tiefe führte. Die Metallstufen knarrten leise, als Valeria ihm folgte und hinabstieg.
Der Keller bestand aus zwei Räumen, im einen rostete eine alte Heizungsanlage vor sich hin, der andere war voller Gerümpel – ein altes Paar Ski lehnte an der Wand, daneben ein Plastiktannenbaum, der mit Spinnweben überwuchert war. Auf dem Boden lag ein zerbrochener Spiegel, Glassplitter überall verteilt. An der rückwärtigen Wand war ein Regal beiseitegeschoben worden, dahinter klaffte ein weiterer Durchgang, der tiefer in den Keller führte.
»Niemand hat vor mir diesen versteckten Raum gefunden«, sagte Bain, und in der Dunkelheit dieses Kellers klangen seine Worte seltsam dumpf und erstickt. »Oder wollte ihn finden. Bis ich mir die Zeit genommen und genauer nachgesehen habe.« Er tastete an der Wand zum Boden entlang. Licht flammte auf. Ein akkubetriebener Bauscheinwerfer stand neben der Tür. Bain drehte sich zu ihr um. »Den hab ich hier aufgestellt. Bitte. Das ist es.«
Der versteckte Raum hinter dem beiseitegeschobenen Regal war im Gegensatz zum Rest des Hauses in etwas besserem Zustand. Regale aus verzinktem Blech und Schränke aus hellem Spanholz ragten an den Wänden entlang bis unter die Decke. Ein kleiner Schreibtisch stand dazwischen, und in all den Schränken standen Aktenordner – auf dem Schreibtisch befanden sich eine Karte und ein Computerbildschirm. »Kabel, aber kein Computer, der an den Monitor angeschlossen ist«, sagte Bain. »Der war schon verschwunden, als ich diesen Raum gefunden habe. Entweder hat ihn Gress mitgenommen … oder jemand war vor mir hier.«
»Was hat Gress hier getan?«
»Er hat Nachforschungen betrieben«, sagte Bain und deutete auf die Ordner. »Er verfolgte wohl die Spuren von drei jungen, vermissten Personen. Seit mehreren Jahren schon, vermutlich schon bevor er beim BKA ausgestiegen ist. Danach hat er für sich selbst weitergemacht, und nach allem, was ich in diesen Aktenordnern gesehen habe, war er besessen davon.« Er zog einen der Ordner hervor und schlug ihn auf. »Die Erste. Rebecca Mineau. Verschwunden vor etwas über vier Jahren, nachdem sie allein zu einer großen Rucksackreise durch Europa aufgebrochen ist … letzter Aufenthaltsort, so Gress, östliches Frankreich, nahe der Schweizer Grenze.«
»Haben Sie die alle schon durchgesehen?« Valeria schätzte die Aktenordner auf etwas über dreißig Stück.
»Ja. Und alle beschäftigen sich mit den drei Verschwundenen. Drei Frauen, alle noch unter dreißig Jahre alt. Alleinstehend … und alle ohne noch lebende Familienangehörige. Eine ist Vollwaise seit ihrer Geburt, die beiden anderen haben ihre Eltern mit jeweils zehn und dreizehn Jahren verloren.« Er entnahm einem der Ordner ein Blatt Papier, auf dem in dünner Handschrift zwei Sätze geschrieben standen.
»Wie viele Monster braucht es, um eine vollkommen zerstörte Existenz zu erschaffen?«, las Valeria die Worte laut vor. »Die Antwort lautet: wie viele auch immer dafür benötigt werden.« Sie blickte zu Bain auf, der ihre Reaktion abzuwarten schien. »Das hat Gress geschrieben, nicht wahr?«
»Ja, das hat er.« Bain nickte.
»Düstere Worte.« Einen Augenblick lauschte sie dem Gluckern des Regens, das in einem Fallrohr in der Wand entstand. »Düstere Worte für einen düsteren Tag.«
»Von wem, schätzen Sie, könnte er hier sprechen? Von welchen Monstern und von welcher zerstörten Existenz?«
»Das ist schwer zu sagen. Aber ich fürchte, die Antwort auf diese Frage hängt mit allem zusammen – und am Ende wohl auch mit seinem Tod durch die Hand seines Mörders.«
»Gut möglich«, erwiderte Valeria. »Die zerstörte Existenz … Was ist, wenn Gress von sich selbst sprach? Sein Leben am Ende … Es scheint nicht besonders angenehm gewesen zu sein. All das hier … Er hat sich versteckt. War er auf der Flucht? Hatte er Angst? Wurde er verfolgt? Oder geht dieser Satz auf etwas zurück, das weiter in seiner Vergangenheit liegt … auf etwas, das ihm während seiner Zeit beim BKA begegnet ist, oder sogar noch früher, bei der Legion?«
»Ravelli …« Bain schien sich mit jeder Minute, die er in diesem modrig riechenden Keller verbringen musste, unwohler zu fühlen. »Was halten Sie davon, wenn wir diese Akten mitnehmen und von hier verschwinden?«
»Liebend gerne, aber können wir uns denn sicher sein, dass wir auch nichts übersehen haben? Was ist, wenn er hier noch mehr versteckt hat?«
»Ich habe mich in diesem alten Haus lange und gründlich umgesehen«, sagte Bain, »lange und gründlich genug, würde ich meinen. Außer dem, was sich in diesem Raum befindet, ist nichts Relevantes mehr hier.«
»Na schön. Dann packen wir es ein.«
»Ich hatte gehofft, Sie würden das sagen.«
»Und hoffen wir, dass uns niemand aufhält.«
»Hier?« Bain lachte leise. »Unwahrscheinlich.«
In einer Ecke des Kellerraums standen große Kunststoffkisten, in die sie die Aktenordner stapelten. Dann trugen sie sie hinaus zu Bains Wagen. Valeria warf einen Blick zurück. Das heruntergekommene Haus duckte sich in den Nebel, der aus den umliegenden Wäldern aufzog. In den umliegenden Gebäuden, von denen keines näher als etwa fünfzig Meter lag, herrschte nur Dunkelheit hinter den Fenstern, und doch konnte sie sich nicht des Gefühls erwehren, dass jemand sie beobachtete. Es war eine unangenehme Empfindung – ihr war es, als hätte sie mit dem Mitnehmen von Gress’ alten Unterlagen so etwas wie einen Pakt geschlossen, ein unsichtbares Versprechen, das zu beenden, was er begonnen hatte, koste es, was es wolle.
Wer auch immer Gress getötet hat, er weiß davon. Er beobachtet dich, und er will dich aufhalten.
»Ravelli?« Bain hatte bemerkt, dass sie in Richtung der Wälder blickte, als erwartete sie, dort jemanden zu entdecken.
»Schon gut«, erwiderte sie. »Ich dachte bloß, ich hätte jemanden gesehen. Aber das war nichts, nur ein Nebelfetzen.«
Das Innere des Jeeps war warm und eine willkommene Abwechslung nach der alles durchdringenden Kühle und Feuchtigkeit. Als sie das Dorf verließen, warf Valeria immer wieder Blicke in den Seitenspiegel. Autos, distanziert hinter ihnen, doch soweit sie erkennen konnte, folgte ihnen niemand.
Da war nichts, versuchte sie sich zu beruhigen. Wer sollte Gress’ altes geerbtes Elternhaus im Blick behalten wollen? Doch im selben Augenblick begriff sie, dass die Antwort auf diese Frage auf der Hand lag: wer auch immer ihn getötet hatte.
»Wir sollten uns aufteilen«, sagte Bain in die Stille hinein. »Wir müssen diesen Fall von zwei Seiten angehen, davon bin ich überzeugt. Wir haben die Akten, wir haben seine Nachforschungen … und wir haben Steinberg, Gress’ Leiche, und die Frage, was auch immer er dort getrieben hat.«
»Also geht jemand von uns nach Steinberg und der andere …«
»Der andere verfolgt die Fälle der Verschwundenen. Ja. So sollten wir es angehen.« Sie beide schwiegen, und nur der Regen, der auf das Autodach prasselte, war zu hören.
Valeria warf Bain einen Blick zu. »Und? Haben Sie sich bereits entschieden?«
»Die Wahl überlasse ich Ihnen, Ravelli.«
»Ganz der Gentleman. Steinberg ist es dann.«
Bain nickte knapp. »Einverstanden. Ich folge Gress’ Ermittlungen zu den Verschwundenen. Aber was immer Sie in Steinberg herausfinden …«
»Wir bleiben in Kontakt.«
»Ich meinte eher: Gress wurde an diesem Ort getötet, vergessen wir das nicht. Also bleiben Sie besser vorsichtig.« Bains Stimme war sehr ernst.
»Sie sind schon der Zweite, der mich bittet, aufzupassen. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet und wie all das zusammenhängt. Aber was immer es ist, wir treten ihm entgegen. Ich bin mir der Gefahren bewusst, aber ich weiß auch, was geschieht, wenn ich scheitere … Also gehe ich trotzdem, auch wenn ich vielleicht manchmal lieber nichts tun würde. Meine Entscheidung, Bain.«
»Gut.« Er nickte knapp. »Wann brechen Sie auf?«
»Morgen. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich zuvor erledigen will.« Valeria strich sich das dunkelbraune Haar zurück. »Aber dann …« Der Gedanke, jene Höhle aufzusuchen, wo Gress den Tod gefunden hatte, behagte ihr schon jetzt nicht. Es war ein Gefühl, als wäre sie vollkommen durchgefroren und keine Wärme war in Sicht, eine Kälte wie aus der Tiefe eines Grabes.
»Das Foto mit dem Mann mit dem jungen Mädchen, das Sie dort bei sich im Büro aufgestellt haben …« Bain zögerte. »Ich will nicht neugierig erscheinen, aber …«
»Aber Sie sind es dennoch.« Valeria lächelte flüchtig, um ihren Worten die Schärfe zu nehmen. »Mark Harrington. Ein guter Freund und seine kleine Tochter. Mir ist klar, worauf Sie anspielen. Jemand, der Gress so zurichtet, so brutal tötet, schreckt vor nichts zurück. Aber ich hinterlasse niemanden. Ich habe keine Kinder, keine Familie. Niemanden, den man in Gefahr bringen könnte, niemand, der allein zurückbleibt, sollte ich bei dieser Sache sterben.« Sie schwieg für einen Moment. »Nicht mehr.«
TEIL EINS:
Ein Mann des Krieges
7
Die Straße schraubte sich in engen, nicht enden wollenden Serpentinen in die Höhe. Die Wolken waren in ein tiefes Grau-Blau gehüllt, wie die Farbe eines alten Blutergusses. Hoch türmten sie sich hinter den schneebedeckten Gipfeln der Viertausender, die den Horizont überragten wie ein schroffer, eisiger Rahmen, der alles begrenzte.
Und die Wälder: Nadelgehölz, dicht und grün wie ein Dschungel, der sich zu beiden Seiten der Straße auftürmte, undurchdringlich und alles Licht schluckend. Valeria drehte am Stellknopf des Radios, doch in jedem Sender, den sie empfangen konnte, liefen die gleichen Nachrichten und Wetterberichte. Schneefall wurde angekündigt, ein kurzer, kalter Herbst, der bald in den Winter übergehen würde.
Es war erst ein Uhr mittags am nächsten Tag, und doch musste sie bereits die Scheinwerfer des Dienstwagens einschalten, den sie sich für die Fahrt nach Steinberg geliehen hatte. Der BMW X3 wankte unter einer heftigen Windböe, die ihn von Osten her erfasste. Valerias Blick ging zum Straßenrand, und mit einem jähen Schrecken stieg sie auf die Bremse.
Dort, mitten im nebligen Schatten des Unterholzes, stand jemand.
»Verfluchte Scheiße«, stieß sie hervor. Die Gestalt war klein, kaum größer als ein Kind, und der rote Kapuzenmantel, den sie trug, stach deutlich aus dem Grünbraun des Waldes hervor. Das Gesicht dagegen lag im Schatten. Valeria starrte hinüber, und die Gestalt starrte zurück. Nach einigen Augenblicken wirbelte sie herum und verschwand zwischen den Baumstämmen im Nebel.
Ein Kind? Ein Kleinwüchsiger?
Valeria blickte auf jene Stelle am Waldrand, doch bewegten sich dort nur die tief hängenden Äste der Blautannen im Wind – kein Funken Rot war mehr zu sehen.
Hast du dir das gerade nur eingebildet?
Nein. Ganz bestimmt nicht.
Sie nahm den Fuß von der Bremse, das Automatikgetriebe ließ den Wagen anfahren. Im Rückspiegel trieb dichter Nebel über die schmale Straße und verhüllte jene Stelle am Waldrand. Sie beobachtete alles im Rückspiegel, bis eine Biegung ihr die Sicht nahm.
»Okay«, sagte sie leise zu sich selbst. »Das war … nur ein Kind.«
Aber wieso sollte sich ein Kind bei diesem Wetter allein in den Wäldern herumtreiben, Kilometer von Steinberg entfernt? Das Navi an der Mittelkonsole zeigte ihr an, dass sie noch etwa zwanzig Kilometer zurücklegen musste, etwa vierzig Minuten auf dieser Straße.
Sonst gab es nichts in der Umgebung, zumindest nichts, das auf dem Navi angezeigt wurde. Valeria dachte an die Höhlen, die das Felsgestein hier oben durchzogen, sie dachte an die Sage von den Alten, die sich zum Sterben in die Isolation zurückzogen, und ein Schauer kroch ihr den Rücken hinab.
Im Kofferraum hatte sie Fotokopien der wichtigsten Auszüge aus Gress’ Aktenordnern liegen, die sie und Bain am vergangenen Tag angefertigt hatten; daneben einen Koffer mit genügend warmen Sachen für zwei Wochen. Auf dem Beifahrersitz stand eine Thermoskanne mit Kaffee. Ihre Pistole hatte sie im Handschuhfach verstaut, zwei weitere Magazine im Koffer hinten.
Bain hatte ihr erklärt, dass er zunächst dem Vermisstenfall Rebecca Mineau nachgehen wollte, die Einundzwanzigjährige, die während ihrer Selbstfindungsreise durch Europa verschwunden war. Gress hatte ihre Spur nachverfolgt, bis zu jenem Dorf an der französischen Grenze … und dort, im Jura, wollte Bain nach ihrem Verbleib suchen. Ob Gress selbst dort gewesen war, wussten sie nicht.
Valerias Handy meldete sich mit einem schwachen Brummen. Es war Bain.
»Sind Sie schon in Steinberg angekommen?«, fragte er sie.
»Nein. Halbe Stunde noch in etwa. Hier ist es verregnet, neblig und kalt … Die Straße ist teilweise überspült. Kann nur vor mich hinschleichen. Und Sie?«
»Ich bin vor etwa zwei Stunden angekommen. Strahlender Sonnenschein. Fünfundzwanzig Grad, ein herrlicher Spätsommertag, wer hätte das gedacht?«
»Ich kann Sie nur beglückwünschen, Bain«, sagte Valeria. »Badehose eingepackt?«
Er lachte. »Aber sicher.«
»Gibt es schon etwas Neues zu Mineau oder Gress?«
»Nun, ich versuche, nicht direkt mit der Tür ins Haus zu fallen und auch nicht mit einem großen Schild herumzulaufen, auf dem in Rot Ja, ich bin Bulle steht. Lassen Sie mich erst mal ankommen und dann das Ganze auf meine Art angehen.«
»Irgendwann müssen Sie anfangen, nachzufragen. Und dann werden alle im Ort wissen, nach wem Sie suchen, da können Sie sich noch so viel Mühe geben.«
Bain seufzte leise. »Ich fürchte, Sie haben recht.«
»Ich gebe Ihnen einen Tipp«, sagte Valeria. »Nähern Sie sich den Einheimischen so unauffällig wie möglich. Seien Sie der etwas neugierige, historisch interessierte Tourist, der sich ein wenig die Zeit mit der Dorfgeschichte vertreiben will … oder versuchen Sie eine andere Story. Meine Güte, Bain, Sie sind Engländer. Vielleicht sollten Sie sich einfach als Uniprofessor ausgeben, der zur Schweiz-Französischen Geschichte forscht. Ziehen Sie sich eine Fliege an und ein Tweedjackett.«
»Es gibt Grenzen, Ravelli.«
Valeria musste das Lenkrad festhalten, als erneut eine Windböe an ihrem Geländewagen rüttelte. Mit einem lauten Krachen kippte eine vertrocknete Kiefer um und schlug mit einem Prasseln auf die Straße hinter ihr. Das Holz splitterte in alle Richtungen.
»Verflucht.«
»Was ist los?«
»Da ist gerade ein Baum auf die Straße gefallen. Etwa zehn Meter hinter mir. Wär ich nur etwas langsamer gewesen …«
»Ist alles okay?« Er klang ernstlich besorgt.
»Ja, mir geht’s gut.« Nach einigen Metern hatte der dichte Nebel die umgestürzte Kiefer verschluckt. Sie mochte sich gar nicht ausmalen, was geschehen würde, wenn jemand hinter ihr zu schnell fuhr und den Baum übersah. »Ich sollte eigentlich anhalten und jemanden informieren …« Aus dem Lautsprecher drang ein abgehacktes Störgeräusch. Ein Blick auf ihr Smartphone verriet ihr, dass der Empfang schwächer wurde.
»Hören Sie … noch?«, drang Bains Stimme aus den Lautsprechern.
»Schwach.«
»Wenn Sie Steinberg erreicht haben, sollte es besser werden. Halten Sie nicht an, informieren Sie den Räumdienst erst, wenn Sie angekommen sind.«
»Machen Sie sich Sorgen um mich, Bain?«, fragte Valeria spöttisch. »Dass ich allein mitten im Wald auf dieser Straße warten muss?«
»Ich weiß nicht, sollte ich? Es macht Ihnen sicher nichts aus, im Wald ausgesetzt zu sein.«
Seine Worte, wenngleich im Scherz gemeint, lösten bei ihr ein unangenehmes Grummeln in der Magengegend aus. »Das ist nicht lustig«, erwiderte sie und konnte hören, wie Bain mit den Zähnen knirschte.
»Nun … ich muss um Entschuldigung bitten. Das war unüberlegt von mir.«
»Wissen Sie, ich kauere nicht verängstigt in der Ecke, nur weil jemand diese Sache von vor über einundzwanzig Jahren erwähnt. Wenn es etwas gibt, das uns Menschen auszeichnet, dann ist es doch unsere Fähigkeit zu vergessen, nicht wahr?« Valeria lenkte den Wagen eine enge Serpentine hinauf. Graue Granitblöcke ragten am Wegesrand auf, daneben ein verwittertes Holzkreuz. Sie konnte die Inschrift nicht lesen, aber den steilen Abgrund dahinter ausmachen, wo für einen unvorsichtigen Fahrer nichts als viele Meter tiefer Fall und schroffe Felsen warteten.
»Ravelli, ich wollte nur …«
»Und ich sagte, es ist schon gut. Wechseln wir das Thema.«
»Na schön. Wissen Sie schon, wo Sie unterkommen?«
»Nein. Es gibt ein paar privat geführte Pensionen … Da werde ich schon was finden.«
»Und wenn nicht, in einem Schlafsack soll es ja auch ganz kuschlig sein. In der Luft im Hochgebirge ist der Schlaf ohnehin ganz entspannt, das sagt man doch.«
Valeria antwortete nicht. In Wahrheit schlief sie in den letzten Wochen schlecht und träumte von seltsamen dunklen Dingen, von Stimmen, die nach ihr riefen, und tastenden Schemen im Nebel.
Schemen, die aus der Kälte nach dir greifen. Das hat natürlich mit all dem zu tun, was du in Eigerstal erlebt hast. Nichts davon war leicht, nichts davon wird dich schnell loslassen, auch wenn du es dir nicht eingestehen willst, auch wenn dir lieber wäre, dass es anders wäre. »Das ist etwas, mit dem ich allein zurechtkommen muss«, sagte sie leise.
»Wie bitte?«
Der Nebel trieb in dichten Schwaden über die Straße, und Valeria bremste ab. »Nichts. Es ist unheimlich hier«, sagte sie. »Ich kann kaum mehr als zwanzig Meter weit blicken. Es ist alles so still.«
»Ravelli, was …«
Das war alles, was sie von Bain hörte, ehe die Verbindung abbrach. Kein Empfang mehr. Verflucht.
Die Wälder ragten zu beiden Seiten der Straße auf, als wollten sie den schmalen Streifen aus Asphalt fressen, ihn verschlingen und nie wieder freigeben. Der Wind trieb Laub in dichten Wolken vorüber, bunte Böen, die durch das Licht ihrer Scheinwerfer tanzten. Wieder eine langgestreckte Kurve, die kaum enden wollte.
Was hatte Tanner gesagt? Jemand war vor Ort, ein Rechtsmediziner, der die Leiche bereits obduziert hatte. Die zuständige Polizei hatte den Fundort abgesperrt, und die Suche nach möglichen Spuren dauerte noch immer an … Valeria warf einen Blick auf das schmale Notizbuch, das neben ihr auf dem Beifahrersitz lag. Sie würde Kontakt mit den Kollegen aufnehmen, sobald sie angekommen war und eine Unterkunft gefunden hatte. Nur die Ruhe, sagte sie sich. Gress ist seit Monaten tot, er wird einen weiteren Tag oder wenigstens einige Stunden warten können.
Die Lichter des BMW strichen über ein Schild am rechten Straßenrand zwischen niedrigen, dunklen Sträuchern, die mit dicken schwarzen Beeren behangen waren. STEINBERG stand dort, in seltsam verschnörkelten Buchstaben, daneben die stilisierte Darstellung eines hohen Nadelbaums vor einem schroffen Bergmassiv.
Valeria fand, die Zeichnung des Bergs ähnelte auf beunruhigende Weise einem Gesicht mit weit aufgerissenen Augen, die dem Neuankömmling entgegenstarrten, ihn jedoch nicht willkommen hießen.
Sie war angekommen.
8
Die Reifen des BMW rumpelten über unebene Pflastersteine am Dorfeingang. Dicht dahinter war Holz meterhoch gegen die Wand eines windschiefen Schuppens gestapelt. Der Garten davor war verwildert und mit dornigem Unkraut überwachsen. Ein paar Einfamilienhäuser schlossen sich an, doch leuchtete kein Licht hinter den Fenstern. In den Einfahrten standen ältere Pkw und ein paar Pick-ups, auch ein Schneemobil war darunter, halb von einer Schutzplane verdeckt.
Auf dem Dorfplatz stand ein stillgelegter Brunnen, der von zwei aus Granit gehauenen Figuren gekrönt war: ein Steinbock und ein Mädchen standen nebeneinander auf einem Sockel und blickten auf etwas in der Ferne. Da war ein Postschild, welches gelb aus dem Nebel hervorragte. Ein altes Hotel, dessen Fenster mit Holzbrettern vernagelt waren, ein Zu verkaufen-Schild davor. In weiterer Entfernung sah Valeria ein eindrucksvolles Herrenhaus auf einer Anhöhe mit vernagelten Fenstern und verwitterter Fassade.
Sie bremste, als sie vor einem im Chalet-Stil gehaltenen, zweistöckigen Haus ein Schild entdeckte, das freie Zimmer verkündete, und bog auf einen Parkplatz daneben, wo zwei weitere Fahrzeuge standen. Als sie ausstieg, legte sich der feuchtkalte Nebel auf ihre Kleidung. Auf dem Dachfirst des Hotels krächzte eine Krähe und flatterte mit breiten Schwingen in die Luft.
Valeria öffnete die Tür der Pension. Warme Luft schlug ihr entgegen, dazu Licht, das buttergelb aus dem Inneren fiel und die Wassertropfen im Nebel schimmern ließ.
»Bitte schließen Sie die Tür«, erklang eine leise Stimme.
Valeria entdeckte einen Mann, der auf der untersten Stufe einer Treppe stand und ihr entgegenblickte. Seine schwarzen Haare wurden an den Schläfen bereits grau, in den Händen trug er einen Stapel weißer Handtücher. An seinem Ringfinger schimmerte ein silberner Ring, wie sie bemerkte, und auf dem Empfangstresen neben ihm stand eine ebenso silberne Glocke. Er trat hinter den Tresen und legte die Handtücher in einen Korb.
»Suchen Sie eine Unterkunft? Sie haben Glück. Wir haben noch ein Zimmer, oben unter dem Dach. Viele nennen es das beste im Haus.«
Valeria fragte sich, was in diesem Zusammenhang viele bedeutete. »Dann würde ich es gerne mieten. Für eine Woche, erst mal, aber vielleicht verlängere ich auch.«
»So?« Er holte ein Formular hervor, das er ihr mitsamt einem Kugelschreiber über den Empfangstresen schob. »Dann wollen Sie also eine Weile hierbleiben?«
»Eine kleine Auszeit, ja. So habe ich mir das vorgestellt«, erwiderte Valeria.
»Wenn Sie Abgeschiedenheit suchen, etwas Stille, dann sind Sie hier tatsächlich richtig.«
»Klingt fantastisch.« Sie füllte das Formular aus, der Kugelschreiber kratzte über das Papier. Irgendwo aus einem Hinterzimmer spielte ein Radio leise Musik.
»Es kommen nicht viele zu dieser Jahreszeit her. Nicht genau hierher, zumindest.«
Valeria warf ihm einen Blick zu. »Hierher?«
»Wir sind doch etwas abgelegen, Frau …« Sie sah, wie er auf das Blatt blickte, das noch immer vor ihr lag, und dort über Kopf den Namen entzifferte. »Ravelli. Und jetzt, wo die Tage kürzer und die Nächte kälter werden, beehren uns nur noch wenige Touristen mit ihrer Anwesenheit.«
Das sagt er, aber so hat er es nicht gemeint. Das spürte Valeria. »Bitte«, sagte sie und reichte ihm das Meldeformular.
»Ich danke«, erwiderte er. »Oh, da fällt mir ein, ich habe mich gar nicht vorgestellt: Mein Name ist Ulrich Ziegler.« Er nahm einen messingfarbenen Schlüssel vom Haken. »Ich zeig Ihnen das Dachgeschosszimmer.«