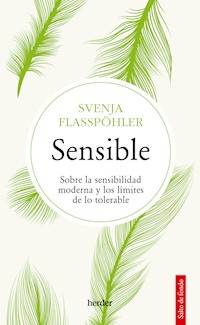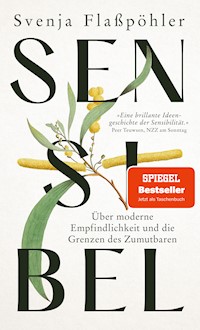13,99 €
Mehr erfahren.
Über die Tyrannei der Selbstoptimierung
Für uns Menschen von heute ist Arbeit nicht mehr nur Mühsal. Wir tun unsere Arbeit gern, verstehen uns gar als Genussarbeiter. Das Genießen im engeren Sinn hingegen, der Müßiggang, gelingt uns immer seltener und wird regelrecht zur Anstrengung. Warum aber sind wir als moderne Leistungsträger hyperaktiv bis zum Burnout und halten das Nichtstun kaum mehr aus? Genießen nur, wenn wir arbeiten, oder höchstens noch beim Sport? Die Philosophin Svenja Flaßpöhler geht den kulturellen und psychischen Ursachen von Arbeitssucht, Körperkult und Versagensangst auf den Grund und fragt nach dem prekären Verhältnis von Freiheit und Zwang in der heutigen Gesellschaft. Ihre eindringliche Analyse zeigt: Nur wenn wir inmitten des Optimierungswahns nicht ausschließlich tun, sondern auch lassen, sind wir imstande, wirklich zu genießen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Ähnliche
Für meinen Vater
Inhaltsverzeichnis
Genussarbeit
Das Genießen der Mühsal, die Mühsal des Genießens
Arbeit ist für uns heute nicht mehr nur Mühsal. Wir, die wir unsere Arbeit gern tun und uns in ihr verausgaben auch über das erforderliche Maß hinaus, sind keine Pflichtarbeiter im herkömmlichen Sinne mehr, sondern Genussarbeiter. Diese Wortschöpfung bringt eine Entwicklung auf den Punkt, die sich verstärkt seit einigen Jahrzehnten, im Grunde aber schon seit zwei Jahrhunderten, nämlich seit Beginn des bürgerlichen Zeitalters vollzieht. Seitdem der Mensch körperlich ruinöse Arbeit von Maschinen erledigen lässt, Zugang zu Bildung hat, seine Tätigkeit neigungsorientiert wählen kann und sich vornehmlich durch Leistung definiert, birgt die Arbeit ein Glücksversprechen, das andere Quellen der Lust in immer stärkerem Maße verdrängt. Sex? – Keinen Kopf dafür. – Ausruhen? Mal nichts vorhaben? – Tödlich. – Feiern, hin und wieder über die Stränge schlagen? – Kindisch.
Für uns Genussarbeiter ist der Genuss Arbeit und die Arbeit umgekehrt Genuss. In unserer Arbeit gehen wir auf wie eine Knospe im Frühling. Jede neue Herausforderung lässt uns wachsen, überborden vor Energie, so wie ein Blümlein sich begierig zur Sonne reckt, damit es gedeiht, verlangen wir unentwegt nach neuen Möglichkeiten, um das eigene Können unter Beweis zu stellen. Als Genussarbeiter und Genussarbeiterinnen lieben wir unsere Arbeit, wir brauchen die Anerkennung, die wir durch sie erfahren oder doch zumindest zu erfahren hoffen , denn das Gefühl, tatsächlich ausreichend Anerkennung zu erfahren, stellt sich fast nie und wenn, dann nur flüchtig ein. Und so arbeiten und arbeiten wir, sind ehrgeizig und hochmotiviert, und verlieren dabei nicht selten jedes Maß.
Der Überschwänglichkeit in der Arbeit entspricht die Enthaltsamkeit im Genuss. Dort Distanzlosigkeit, hier vorsichtige Distanznahme; dort Gier, hier Abstinenz. Unsere sexuelle Energie sublimieren wir größtenteils oder sogar ganz in Arbeit. Mit größter Leidenschaft widmen wir uns unseren Projekten, geben uns unserer Arbeit hin wie einer großen, neuen Liebe, für die wir alles zu tun bereit sind.
Sublimation meint Verwandlung, Veredelung des Triebs. Doch häufig hat unser Tätigsein selbst triebhaften Charakter: dann ist es nicht ekstatisch, sondern exzessiv. Zwanghaft lebt der Workaholic seine Lust in der Arbeit aus, er muss arbeiten und kann überhaupt nicht mehr aufhören, denn wenn seine Dauererregung einmal nachlässt, überkommt ihn unweigerlich eine diffuse Angst. Jegliche Form der Muße ist für den exzessiven Genussarbeiter Mühsal. Während am Schreibtisch jedes Gefühl für die Zeit verloren geht und Überstunden kaum als solche empfunden werden, tickt die Uhr, sobald es still wird und nichts mehr zu tun ist, unüberhörbar laut. Unverplante Zeit, gar Langeweile ist für ihn kaum auszuhalten, er muss sich regelrecht anstrengen, um nicht sofort in zwangsneurotische Betriebsamkeit zu verfallen (E-Mails beantworten, Joggen und Aufräumen etwa sind beliebte Ersatzhandlungen), als würde ihn, wenn er auch nur einmal lockerließe, sofort der Teufel holen. Ein solcher Aktionismus, den wir in unserer Leistungsgesellschaft nur allzu leicht mit Leidenschaft und Vitalität verwechseln, ist in Wahrheit häufig nichts anderes als ein verzweifelter Kampf gegen die Depression. Selbst nachts kann der Genussarbeiter nicht mehr abschalten, muss unentwegt Gedanken wälzen, bis irgendwann, wenn die Kraft nicht mehr ausreicht, sich vollkommene Apathie einstellt.
Menschen bilden Süchte aus, um sich zu betäuben, um einen Schmerz, der tief in ihrem Inneren nagt, nicht spüren zu müssen. Die Arbeitssucht ist neben der Sportsucht die einzige gesellschaftlich anerkannte, ja sogar geforderte und geförderte Sucht. Drogenabhängige, Alkoholiker, Kettenraucher, sie alle gelten als randständig, bemitleidenswert, suizidal; Arbeitssüchtige hingegen lenken Firmen und Staatsgeschicke, werden bedient, bewundert, idealisiert.
In seiner Schrift Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus legt der Soziologe Max Weber die tiefe Genussfeindlichkeit der erstarkenden Wachstumsgesellschaft eindrücklich dar. Askese und Fleiß im Dienste Gottes respektive der Akkumulation: Das war das protestantisch geprägte Arbeitsethos des frühen Industriekapitalismus. Lebendig ist dieses Ethos nach wie vor, allerdings mit bedeutsamen Verschiebungen. Erstens: An die Stelle gottgefälliger Strebsamkeit ist heute nackter Ehrgeiz getreten, ein unerbittlicher Kampf um Anerkennung, der keine Grenzen mehr kennt. Wer lediglich fleißig ist und erledigt, was verlangt wird; wer Zeit mit der Familie verbringen will und am Sonntag prinzipiell nicht arbeitet, auch wenn eine Deadline drängt, gilt als unmotiviert und häufig auch als unbrauchbar. Einigermaßen sicher im Sattel beziehungsweise auf Chefposten sitzen nur die, deren Arbeitseifer unendlich ist, die in vorauseilendem Gehorsam auch am Wochenende arbeiten, spätabends noch E-Mails schreiben, jede Aufstiegsmöglichkeit beim Schopfe packen, die sich selbst überschreiten und bisweilen auch überschätzen.
Zweitens: Anders als Weber leben wir heute in Zeiten des globalisierten Schnäppchenkapitalismus, der die Gier respektive den Geiz (beide Wörter haben denselben Wortstamm), für den gläubigen Christen eine Todsünde, als lustvolle Grenzüberschreitung anpreist (Geiz ist geil!). Mit protestantischer Sparsamkeit hat der Geiz-Konsum nur scheinbar zu tun, geht es doch letztlich nicht darum, das Geld bei sich zu behalten, sondern möglichst viel für möglichst wenig zu bekommen. Der Schnäppchenkapitalismus ist ein Verschwendungskapitalismus. Wachsam studieren wir Sonderangebote, verfolgen Auktionen bei eBay, damit uns kein heruntergesetzter Fernseher, keine preisgünstige Couch entgeht. Dass Genuss heute Arbeit ist, hat also auch mit diesem Volkssport des gegenseitigen Wegschnappens zu tun, der die Massen selbst nachts die Discounter stürmen lässt.
Drittens haben wir heute probate Mittel und Wege gefunden, dem leiblichen Genuss, den der protestantische Asket sich naturgemäß versagt, den Stachel der Schuld zu ziehen. Genuss ohne Reue, so lautet das Motto des Wellness-Zeitalters. Alkoholfreies Bier, fettreduzierter Käse, virtueller Sex: »Alles ist erlaubt, man kann alles genießen«, schreibt der Philosoph und Kulturkritiker Slavoj Žižek, »unter der Bedingung, daß es seiner Substanz beraubt ist, die es gefährlich macht.« Der Wellness-Genuss ist schuldfrei, weil er sich nicht über gesellschaftliche Leistungsanforderungen erhebt, sondern den Körper gerade umgekehrt leistungsstark macht, ja im Grunde sogar selbst Arbeit ist. Es wird geschwitzt und gepeelt, trainiert und gefastet, meditiert und der Darm durchgespült, um den Körper fit zu machen und auch noch den letzten Dreck aus ihm herauszuschwemmen. Ob Fitness, Diät oder Wellness-Kloster: Die Wohlfühlarbeit reinigt den Körper, anstatt ihn zu beschmutzen, durch sie erspart man sich die Verschuldung, die ein zweckfreies Genießen unweigerlich mit sich bringt.
Hervorgegangen ist der Wellness-Kult bezeichnenderweise aus einer protestantischen Freikirche. So sehen die Siebenten-Tags-Adventisten den menschlichen Körper als »Tempel des Heiligen Geistes«, wie es in den Korintherbriefen heißt, und den Adventisten zugehörig fühlte sich einst auch ein Arzt namens John Harvey Kellogg. Im Battle Creek Sanatorium, das Kellogg leitete, aß man ausschließlich vegetarisch, nahm Heilbäder und ertüchtigte sich beim Sport. Alkohol, Tabak und Kaffee waren selbstredend untersagt. Und als John Harvey gemeinsam mit seinem Bruder Will Keith die erste knusprige Frühstücksflocke erfand, waren die Patienten im Battle Creek Sanatorium so glücklich über die neue Verbindung von Genuss und Vernunft, dass sie sich das neue Produkt auch nach ihrer Entlassung noch zusenden ließen. Ein neuer Industriezweig war geboren, der des gesundheitsbewussten Genießens, das den Körper stärkt, anstatt ihm zu schaden.
Das Genießen passt sich also dem Leistungsgedanken an; und umgekehrt ist auch die Leistung, sprich: die Arbeit, längst nicht mehr das Gegenteil des Genusses. Arbeit, das war in früheren Zeiten eine Plage, die Strafe Gottes für den Sündenfall, bis zum körperlichen Ruin mühte sich der Mensch ab mit Acker und Vieh, und wie froh war er, wenn er abends Pferdegeschirr und Sense an den Haken hängen konnte. Heute hingegen ist Arbeit – zumindest für die Mittel- und Oberschicht der westlichen Welt – keine Strafe im alttestamentarischen Sinne mehr, sondern eher ein Labsal. Vorbei die Zeiten körperlicher Qual, der Pflüge und Pferdekarren. Heute sitzt man auf ergodynamischen Stühlen vor schicken Macs, neben sich eine Latte macchiato, und gibt sich, scheinbar mühelos, dem Rausch der Arbeit hin. Der Genussarbeiter fühlt die Anstrengung nicht oder nur kaum, seine körperliche Aktivität beschränkt sich weitestgehend auf das Bewegen der Fingerspitzen auf der Tastatur und die Fokussierung der Pupillen, ansonsten ist nur sein Hirn tätig. Beiläufig nimmt er hier eine Information auf, reagiert dort auf einen Reiz, klickt sich durch Webseiten, folgt diesem oder jenem Link, während er Ideen und Projekte verwirklicht, manchmal sogar seine eigenen.
Seitdem der Mensch sich aus der göttlich verfügten Ordnung und der selbst verschuldeten Unmündigkeit befreit hat, muss er sich nicht mehr knechten lassen oder Schlosser werden, nur weil der Vater Schlosser war. Er kann sich seine Tätigkeit aussuchen, sich mit Leib und Seele in sie einbringen, sich mit ihr identifizieren, was naturgemäß zur Folge hat, dass die Ansprüche an die eigene Leistung sehr hoch sind: Wenn das Werk unvollkommen ist, ist es sein Schöpfer, seine Schöpferin auch; erst wenn das Werk perfekt ist, hat die arme Seele Ruh. Aber was ist schon perfekt? Lässt sich nicht immer noch ein bisschen feilen? Verschönern? Optimieren?
Die Lust an der Überschreitung, die kennzeichnend fürs Genießen ist, lebt der Genussarbeiter vor allem in seiner Arbeit aus. Nicht mehr nur die Verbotsüberschreitung, die ›süße Sünde‹, sondern insbesondere die Selbstüberschreitung im Beruf ist es, die ihm Lustgewinn bringt. Yes, you can!, ruft sich der Genussarbeiter unentwegt selbst zu – allein, wenn dieser motivierende Zuruf zu einem abstrakten Leistungsimperativ wird, verliert der Genussarbeiter schnell jedes Gefühl für die eigene Schmerzgrenze. »Das entgrenzte Können ist das positive Modalverb der Leistungsgesellschaft«, wie der Philosoph Byung-Chul Han in seinem Buch Müdigkeitsgesellschaft schreibt. Die andere Seite der Selbstüberschreitung ist die Selbstausbeutung, die übertriebene Verausgabung in der Arbeit, die mit der Gefahr lähmender Erschöpfungsmüdigkeit unauflöslich verbunden ist.
Ein Genuss, der nichts mit Arbeit zu tun hat, macht zwanghaften Genussarbeitern Angst. Sie fürchten sich vor der ›unnützen‹ Zweckfreiheit, die sie als Leere empfinden, als ein Ungehaltensein im doppelten Wortsinne: Ohne ihre Arbeit fühlen sie sich in ihrem Sein gefährdet, sie werden unruhig und agieren latent aggressiv – manchmal gegen sich selbst, manchmal gegen andere. Zeit mit kleinen Kindern zu verbringen etwa hält der exzessive Genussarbeiter in der Regel nicht lange aus. Auf dem Spielplatz wird eifrig ins Smartphone getippt, und beim Holzklötzchenbauen schweifen die Gedanken immer wieder ab zu diesem oder jenem wichtigen Projekt, das dringend vorangetrieben werden muss, Elternzeit hin oder her. Spielen um des Spielens willen, Stunde und Tag vergessen, ja, überhaupt keinen Begriff von Zeit zu haben, noch nicht einmal Sprache, das alles gemahnt an einen Daseinszustand, in den man nicht zurückfallen will, nicht zurückfallen darf. Das kindliche Sein ist ein mythisches: zeitlos, geheimnisumwoben, fremdbestimmt – bestimmt durch Mächte, deren Verfügungsgewalt alles umfasst. Das kindliche Dasein ist ein schicksalsergebenes Dasein, es ist eingebettet in die elterlich-göttliche Gewalt, die des Kindes innere Ruhe, seine Selbstvergessenheit im Spiel erst ermöglicht: Nur wer auf den Halt vertraut, kann sich dem Spiel hingeben. Doch genau das – Vertrauen zu haben – ist Genussarbeitern kaum möglich. Es gibt nichts, worauf sie sich verlassen wollen beziehungsweise können, sie fühlen sich austauschbar, ersetzbar, und sie sind es auch. Sich in der Arbeit zu verlieren wie in einem lustvollen Spiel und zwischendurch müßigzugehen ist in der beschleunigten Wachstums- und Wettkampfgesellschaft nicht gefragt; was zählt, sind Leistung, Effizienz und Flexibilität. Der moderne Genussarbeiter ist, ausgerüstet mit Smartphone oder Blackberry, immer erreichbar und einsatzbereit und muss doch ständig fürchten, dass jemand anderes noch erreichbarer und einsatzbereiter ist als er selbst, weshalb er die Verbindung zur Arbeit selbst im Urlaub hält. Die Verfügbarkeit des flexiblen Genussarbeiters, sein Ehrgeiz und seine Elastizität sind das Fundament der modernen Wachstumsgesellschaft: »Der flexible Mensch«, schreibt der Soziologe Richard Sennett, ist »driftend«, er treibt durch den globalen Kapitalismus wie ein Stück Holz im (Geld-)Fluss.
Das Urvertrauen des Kindes ähnelt in vielerlei Hinsicht dem Gottvertrauen des vormodernen Menschen: So wie das Kind sich auf seine Eltern verlässt und genau daraus seine Kraft zieht, hat dieser einst auf Gott vertraut. Es war der Glaube an einen Vater im Himmel, der den Rahmen für die eigene Existenz bereitstellte, ein Rahmen, der einengte, aber auch Sicherheit versprach. Seit der Aufklärung aber will der Mensch sich nicht mehr bestimmen lassen und sich in sein göttlich verfügtes Schicksal ergeben. Seine Existenz ist nicht länger fixiert durch Herkunft und Stand, sondern, dem Ideal der Französischen Revolution zufolge, frei. Diese Freiheit ist, unbezweifelbar, eine der größten Errungenschaften der Geschichte: Jeder Mensch kann sich (zumindest idealerweise) je nach seinen Fähigkeiten entwickeln und entfalten und einen frei gewählten Beruf ausüben. Er kann – wenn er sich nur gehörig anstrengt – die soziale Leiter hinaufklettern und ist, wie es heißt, ›seines eigenen Glückes Schmied‹. Die dialektische Kehrseite der Freiheit aber ist die Möglichkeit des Scheiterns. Wo die Chance zum Aufstieg ist, lauert immer auch die Gefahr des Abstiegs. In dieser Spannung zwischen Glück und Unglück, zwischen Erfolg und Ruin, zwischen Grandiositätsgefühl und Depression bewegt sich der Genussarbeiter von heute, ob bewusst oder unbewusst, ständig: Ohne Pause ist er unter Strom, greift ehrgeizig nach den Sternen – denn jedes Nachlassen, Ablassen, Auslassen und Loslassen birgt sogleich das Risiko des Falls.
Die Dialektik der Aufklärung haben wir längst noch nicht verarbeitet. Gerade einmal gut zweihundert Jahre ist es her, dass der Mensch ohne göttliche Bevormundung, die gleichzeitig metaphysische Geborgenheit bedeutete, leben muss, leben darf. Der vormoderne Mensch hatte Rituale, an die er sich halten konnte, religiöse Rituale, die ihn zur Ruhe kommen ließen wie etwa das Gebet oder der arbeitsfreie Sonntag. Der moderne Mensch hingegen muss vor sich selbst rechtfertigen, wann und ob er sich eine Pause gönnt; er muss damit zurechtkommen, dass sein Platz in der Gesellschaft keineswegs gesichert ist; und er muss akzeptieren, dass seine Existenz nicht mehr gehalten wird durch ein göttlich verbürgtes Danach. Der Tod bedeutet das unwiederbringliche Ende, weshalb wir uns, um ihn zu verdrängen, mehr denn je in hektische Betriebsamkeit flüchten. Die Hyperaktivität des Genussarbeiters, seine Arbeits- und Beschäftigungssucht, ist immer auch ein Ausdruck von Todesangst; genauso wie sein Fitness- und Wellness-Wahn, dessen Ziel es ist, den Körper jung zu halten, um ihn so lange wie möglich vor dem unabänderlichen Verfall zu bewahren.
Das Menschenbild der Aufklärung war ein materialistisches. Nicht die (undurchdringliche, metaphysische) Seele, der Körper war der neue Schlüssel zur Wahrheit, seine Mechanismen, seine Funktionsweisen zu verstehen, das hieß, den Menschen zu verstehen und ihn gegebenenfalls reparieren zu können wie eine Maschine. Heute spitzt sich diese Verwissenschaftlichung zu in den Neurowissenschaften, die jede menschliche Regung auf Neuronenströme im Hirn zurückführen möchte, auf Ströme, die sich abbilden und messen lassen und die wieder zum Fließen gebracht werden müssen, wenn sie einmal stocken. Die Begeisterung, die diese Wissenschaftsdisziplin derzeit ausübt, ist unübersehbar: Kaum ein Phänomen findet sich noch, das wir nicht mit den Erkenntnissen der Hirnforschung zu erklären versuchen, und auch die Muße ist längst in den Kernspintomographen geschoben worden, wie Ulrich Schnabel in seinem Buch Muße. Über das Glück des Nichtstuns darlegt. Doch auch wenn es richtig sein mag, dass wir unser »Betriebssystem«, wie Schnabel das Arbeitsgedächtnis nennt, nicht überfordern dürfen und ihm Pausen gönnen müssen, darf nicht übersehen werden, dass die Neurowissenschaft sich dem Leistungsgedanken, der unsere Gesellschaft beherrscht, zutiefst verschrieben hat.
Das offensichtlichste Beispiel hierfür ist das sogenannte Hirndoping oder fachsprachlich ausgedrückt: das Neuroenhancement. Unter Enhancement versteht man einen korrigierenden Eingriff in den menschlichen Körper, der nicht aufgrund einer medizinisch indizierten Krankheit, sondern allein zum Zweck der Optimierung erfolgt. Neben schönheitschirurgischen Maßnahmen, auf die wir in diesem Buch ebenfalls zu sprechen kommen werden, fällt auch die Verabreichung leistungssteigernder Medikamente wie Ritalin oder Modafinil unter den Begriff des Enhancement. Entwickelt wurden diese Medikamente für die Behandlung von Depressionen, Aufmerksamkeitsstörungen und exzessiver Schläfrigkeit, doch weil sie auch geeignet sind, um Prüfungsängste und Konzentrationsschwächen einzudämmen, werden sie immer häufiger verabreicht, um Erschöpfte schnell wieder arbeitsfähig zu machen. Wer arbeitet, soll sich nicht quälen, sich nicht herumplagen mit körperlichen Schwächen und psychischen Blockaden. Das Genießen der Arbeit wird damit zum Programm.
Im Lichte der Neurowissenschaften erscheint der (arbeitende) Mensch als entgrenzte Lustmaschine: als ein System, das funktioniert, solange man es schmerzfrei hält. Allein: Wenn der Schmerz nur noch als Störung, als ein Fehler im System begriffen wird und Körpergrenzen lediglich dazu da sind, um überschritten zu werden, verliert der Mensch einen wesentlichen Bezugspunkt seiner Existenz. Nur wenn ich mich selbst als begrenzt erlebe, habe ich überhaupt ein Selbst; sobald ich diese Grenzen medikamentös auflöse, verschwimme ich mit meiner Umwelt und mit den Anforderungen, die sie an mich stellt. Ein spannungsvolles Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Ich und Wir kann es nur geben, wenn der Mensch Kontur behält, wenn er seine Grenzen kennt und anerkennt und, vor dem Hintergrund einer (psychischen oder somatischen) Schmerzerfahrung, sein eigenes Leben wie auch gesellschaftliche Verhältnisse hinterfragt. Schmerz gibt Anlass zum Denken; wer ihn eindämmt, um möglichst schnell wieder arbeiten zu können, beugt sich dem Leistungsdiktat.
Wenn wir verstehen wollen, warum wir uns heute bis zur völligen Erschöpfung in der Arbeit verausgaben, und wenn wir begreifen möchten, weshalb das Genießen immer mehr Menschen außerordentlich schwerfällt, dürfen wir es nicht dabei belassen, den menschlichen Körper als radikal entkontextualisierten in den Blick zu nehmen. Wir haben nicht einfach nur ein Hirn, sondern wir haben auch eine Geschichte, eine individuelle Biographie, die sich in unseren Körpern, in unseren Gefühlen und Ängsten materialisiert und die auch unser Verhältnis zur Arbeit und zum Genuss maßgeblich beeinflusst. Und nicht nur unsere Vergangenheit ist höchst spezifisch, wir leben auch in einer ganz bestimmten Gesellschaft: einer Gesellschaft, die uns – bei aller Freiheit, die sie uns gewährt – einem überaus strengen Leistungsimperativ unterwirft. Diese individuellen und kulturellen Implikationen sieht – im Unterschied zur Neurowissenschaft – die Psychoanalyse Sigmund Freuds, auf die sich dieses Buch deshalb maßgeblich stützt: Bereits am Beginn des vergangenen Jahrhunderts bemerkte Freud die zunehmende »kulturelle Nervosität«, die verursacht wird durch gesellschaftlich geforderten Triebverzicht; und dass Depressionen und Angstzustände ihre Ursache nicht einfach in fehlerhaften Neuronenströmen haben, sondern auf komplexe, individuelle Verdrängungsmechanismen zurückgehen, ist die grundlegende Einsicht der psychoanalytischen Theorie. »[I]ch weiß nichts, was mir für das psychologische Verständnis der Angst gleichgültiger sein könnte, als die Kenntnis des Nervenwegs, auf dem ihre Erregungen ablaufen«, so Freud in seiner Vorlesung über die Angst.
Aus Sicht Freuds ist der Mensch kein in sich schlüssiges, autonomes, transparentes System, das, wenn alles ›normal‹ ist, funktioniert und sich im Falle einer Dysfunktion pharmazeutisch-technisch korrigieren lässt. Vielmehr ist der Mensch von Beginn an ein Mängelwesen: Er ist angewiesen auf Andere, deren Liebe und Anerkennung er begehrt und die er braucht, um zu (über-)leben. Dass wir uns nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch in der Arbeit bisweilen bis zum Kollaps erschöpfen, hat fundamental mit diesem Begehren zu tun: Wir wollen anerkannt sein. Durch den Anderen, den wir lieben; durch das Werk, in dem wir uns spiegeln; von der Gesellschaft, für die wir arbeiten. Alles, was wir tun, ist auf einen Anderen bezogen. Und wer dessen Anerkennung nicht bekommt, kennt in seinem Ehrgeiz keine Grenze, in der Hoffnung, durch vermehrte Anstrengung doch noch Wertschätzung zu erfahren.
Es ist diese konstitutive Abhängigkeit vom Anderen, die uns in Bewegung hält und uns manchmal auch in tiefe Verzweiflung stürzt. Denn können wir uns seiner Anerkennung überhaupt jemals vollkommen sicher sein? Tatsächlich beruht der menschliche Zweifel wie auch der menschliche Wille – unsere Lebensenergie, unsere Neugierde, unser sexuelles Begehren, unser Ehrgeiz, unsere Schöpferkraft – wesentlich auf dieser Unsicherheit, die wir nie ganz überwinden können: Wir sind nun einmal keine selbstgenügsamen, fröhlich durch die Welt rollenden, vierarmigen und vierbeinigen Kugelmenschen, wie sie in Platons Gastmahl beschrieben werden, sondern Verlangende. So wie die Kugelmenschen, nachdem sie von Zeus in zwei Teile geschnitten wurden, sich nach ihrer verlorenen Hälfte sehnen, sehnen wir uns nach Anerkennung. Um es mit dem französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan zu sagen: Wir begehren das Begehren des Anderen.
Doch auch wenn dieses Begehren nie restlos gestillt werden kann und wir notgedrungen (oder auch zum Glück, denn sonst hätten wir keinerlei Antrieb mehr) mit einer gewissen Grundspannung leben müssen: Dass wir heute in einem Burnout-Zeitalter leben, zeigt deutlich, wie übertrieben wir uns für den Anderen verausgaben, wie fundamental gestört also die gesellschaftlichen Anerkennungsverhältnisse sind. Weil es in der Wettbewerbsgesellschaft primär um Erfolg geht und die Arbeit häufig lediglich ein Mittel zum Zweck darstellt, ist sie sinnentleert, hohl, und vermag kein tiefes Selbstwertgefühl zu vermitteln. Darüber hinaus ist das Verhältnis von Verausgabung und Wertschätzung vollends aus dem Lot geraten. Wir erleben zur Zeit, so meint der Medizinsoziologe Johannes Siegrist, eine schwere ›Gratifikationskrise‹. Aus ideellen oder auch strategischen Gründen erschöpfen wir uns in schlecht oder gar nicht entlohnten Projekten, machen unbezahlte Praktika, Fortbildungen, Umschulungen, stets hoffend, damit in die Zukunft zu investieren und früher oder später die angemessene Anerkennung zu erfahren. Wird die Hoffnung enttäuscht, so stellt Siegrist zusammen mit dem schwedischen Stressforscher Töres Theorell fest, kann das »dramatische Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden haben«.
Die lebenswichtige Struktur wechselseitiger Anerkennung hat Freud (wie vor ihm Hegel und Marx) gesehen und sie zum Fundament seiner Theorie erklärt: Anstatt den Menschen als Maschine zu verstehen, nimmt Freud ihn als begehrenden in den Blick – als ein Wesen, das erst in seiner Beziehung zu einem Anderen, dessen Anerkennung er sich erhofft, seine Produktivität, sein erotisches Verlangen entwickelt.
Die andere Seite der menschlichen Unvollkommenheit und Abhängigkeit, auch diese sieht Freud wie kein Zweiter, ist die Todesangst. Es ist dies die Angst vor der eigenen Ohnmacht, vor dem Ausgeliefertsein an einen Anderen, vor dem Nichts, dessen Kälte den Menschen immer dann anhaucht, wenn er die Anerkennung, nach der er sich sehnt, nicht bekommt. Die Neurowissenschaften interessieren sich für diese Angst nicht in ihrer existenziellen Dimension; sie wollen sie lediglich möglichst schnell zum Verschwinden bringen. Aber die Angst verschwindet nicht, sie wird höchstens eingedämmt; und sie verschwindet auch nicht, indem man ihr durch Hyperaktivität zu entfliehen versucht. Vielmehr führt dieser Aktivismus, je weiter man ihn treibt, geradewegs ins Nichts hinein, in die vollständige psychische Lähmung, die Angstlähmung, das körperliche und seelische ›Ausgebranntsein‹, den Burn-out, wie man die Depression heute euphemisierend nennt.
Die alles entscheidende Frage lautet demnach: Woran liegt es, dass wir heute so angestrengt um Anerkennung kämpfen? Findet dieser Kampf seine Ursache womöglich auch und insbesondere in der Arbeit selbst, da diese, als entfremdete, uns nicht das eigene Sein spiegelt? An welchem Punkt schlägt der Kampf um Anerkennung in eine Sucht nach Anerkennung um? Inwiefern ist der Workaholic vergleichbar mit einem Pornodarsteller, der den Sex nicht um des Sexes willen, sondern einzig und allein für die Kamera vollzieht? Existiert womöglich ein säkularisiertes, abstraktes ›göttliches Auge‹, von dem wir uns unausgesetzt beobachtet fühlen und dem zu Gefallen wir alles unternehmen? Was ist das für ein imaginärer Anderer, dessen Blick wir auf uns fühlen? Ein liebender, der uns loszulassen erlaubt? Oder ein tyrannischer, dem wir nicht genügen können? Weshalb verausgabt sich der Workaholic bis zum Exzess? Inwiefern ähnelt er einem Asketen, der, wie es bei Paulus heißt, seinen Leib zerschlägt, um das göttliche Kleinod zu erwerben? Und: Dient der Wellness-Genuss wirklich nur dem eigenen Wohlbefinden? Oder ist er nicht doch zutiefst verschaltet mit einem emotionalen Weichspül-Kapitalismus, dessen Seele das »flüssig sein« (Wolfgang Ullmann), das flexible Floaten im globalen Raum ist?
Der Mensch ist kein unabhängiges Wesen, er existiert nur in Beziehungen; er hat immer ein Gegenüber (ob real oder imaginär, ob konkret oder abstrakt), dessen Anerkennung er sich wünscht und zu dem er sich in ein Verhältnis setzt. Dass diese Struktur auch und insbesondere für das Denken gilt, haben die antiken Denker erkannt: Der Denkakt ist, wie es in Platons Gastmahl heißt, eine geistige Zeugung, zu der naturgemäß immer zwei gehören. Entsprechend hatte Sokrates auf seinen Wandelgängen stets einen Gesprächspartner, sein Philosophieren war im wahrsten Sinne ein dialektisches, eine Kunst der Unterredung, der Gesprächsführung, des zweisamen Müßiggangs. Das Wort ›Genussarbeit‹ beginnt vor diesem Hintergrund zu schillern, ja bekommt einen ganz anderen Sinn: Als dialektische ist sie nicht exzessiv, sondern sinnlich, nicht rein geistig, sondern immer auch körperlich und mit Lust und Muße verknüpft. Zudem, und auch das ist entscheidend, liegt das Gelingen dialektischer Denkarbeit nie nur in der eigenen Hand, sondern immer auch in der Macht des Anderen. Dieser Andere kann ein menschlicher Anderer sein; es kann sich aber auch um Eros handeln, um den großen Dämon der Liebe, der das Denken inspiriert, es befruchtet – und zwar in aller Regel genau dann, wenn man loslässt, träumt und nicht verkrampft nach einer Lösung sucht.
Dieses Buch beleuchtet die Genussarbeit in ihrer tiefen Ambivalenz. Sind wir dabei, die marxistische Utopie unentfremdeter Arbeit zu realisieren, nur weil wir unsere Laptops und Blackberrys mit ins Bett nehmen? Oder verwechseln wir womöglich eine lustvolle Verwirklichung durch Arbeit mit einem zwanghaften Nicht-loslassen-Können? In welchem Verhältnis steht der Genuss zum Denken? Warum brauchte Heidegger die Askese der Berghütte, um in eine intime Beziehung zum Gedanken zu treten, während Sokrates bei Speis und Trank über den Eros philosophierte? Und weshalb scheinen wir heute der Erotik des Denkens, ja der Erotik schlechthin ferner zu sein denn je? Was für einen Bezug haben wir zur Sexualität in einer Gesellschaft, die einerseits Triebverzicht fordert, andererseits aber jede auch nur denkbare Überschreitung als lustvollen Kick anpreist? Täuscht die gegenwärtige, viel beschworene Pornographisierung der Gesellschaft womöglich nur darüber hinweg, dass wir im Grunde immer prüder und asketischer werden? Leben wir tatsächlich in einer enttabuisierten, durch und durch schamlosen Zeit, wie immer wieder behauptet wird? Oder weisen exhibitionistische Talkshows und auch Slogans wie Geiz ist geil eher darauf hin, dass wir uns womöglich gar schuldiger fühlen denn je? Welche Folgen hat die Säkularisierung für unser Genussverhalten? Und welche der technisch-medizinische Fortschritt? Bedeutet die Tatsache, dass wir über den eigenen Körper verfügen, ihn nach Belieben trainieren, verschönern, modifizieren, seine natürlichen Grenzen überschreiten können, wirklich einen Zugewinn an Freiheit? Oder ist die Elastizität des Körpers, seine Form-, Bieg-und Veränderbarkeit, nur ein Auswuchs ebenjener Flexibilität, die heute allenthalben gefordert ist?
Diesen und anderen Fragen widmet sich dieses Buch, das der gezwungenen Freiheit, dem freien Zwang unserer heutigen Leistungsgesellschaft auf den Grund zu gehen versucht. Einerseits sind wir so frei wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit; andererseits aber werden wir mit immer absurderen Leistungsanforderungen konfrontiert, die wir fatalerweise mit unserem eigenen Begehren identifizieren. Was wir wollen und was wir müssen, ist in Zeiten zunehmender Selbstverantwortung und Selbstausbeutung kaum noch unterscheidbar.
Zeigen möchte ich, dass wir gerade heute, in einer Zeit unausgesetzten Tuns und neurotischer Selbstoptimierung, wieder lernen sollten zu lassen. Das Lassen in seinen unterschiedlichen Formen ist die Freiheit des »Nicht-zu« (Byung Chul-Han), die Zweckfreiheit, die keiner Verwertungslogik gehorcht. Nur wenn wir nicht jede Herausforderung reflexhaft annehmen, nicht jede Möglichkeit zwanghaft nutzen, nur weil es sich um eine Möglichkeit handelt, sind wir wirklich frei. Es ist dies die Freiheit des Auslassens, des Einlassens und Seinlassens, die Freiheit des Nicht(s)tuns, des Ablassens, Gelassenseins und Loslassens. Erst wenn wir bereit sind, der Aktivität die Passivität an die Seite zu stellen, können wir die Gesellschaft, in der wir leben, und auch uns selbst verwandeln. An die Stelle von Entsagung und Exzessivität träte ein Genuss, der uns zum Funkeln bringt.
Das genießende Arbeitstier
Über den Menschen und seine Abgründe
Wir Menschen schauen mitunter neidvoll auf die Tiere. Wie wunderbar im Gleichgewicht die sind! Essen und jagen nur, um satt zu werden, kennen keine Haltungsschäden, keine Süchte und sind, wenn sie kein natürliches Bedürfnis quält, vollkommen entspannt. Wir hingegen: völlig aus dem Lot geraten. Wir arbeiten zu viel, genießen zu wenig, und wenn wir genießen, schlagen wir nicht selten über die Stränge und fühlen uns hinterher schuldig. Aber wem gegenüber eigentlich? Und wieso? Weshalb ist Genuss Sünde? Warum haben wir im Gegensatz zu den Tieren ein so gespaltenes, kompliziertes, ja zwanghaftes Verhältnis zu den eigenen Lüsten?
Um diese Fragen zu beantworten, lohnt sich zunächst ein Blick in unsere Kulturgeschichte. Wer genießt, darin sind sich die großen Erzählungen des Abendlandes einig, macht sich schuldig. Schuldig an Gott und schuldig an der Gesellschaft, denn der Genuss dient weder dem Allmächtigen noch der Moral, sondern einzig und allein der Lust. In der Schöpfungsgeschichte bringt das Naschen vom Baum der Erkenntnis tiefe Scham und die Vertreibung aus dem Paradies mit sich. Der verbotene Genuss ist der Grund dafür, dass der Mann sich im Schweiße seines Angesichts bei der Arbeit quälen muss, während die Frau unter Schmerzen gebärt. Der Mensch, ein Erbsünder, so lehrt uns die Bibel. Doch auch aufgeklärte Philosophen mahnen seit jeher, dass man den Lüsten keinen freien Lauf lassen sollte. Georg Wilhelm Friedrich Hegel etwa behauptete, dass nur, wer seine Begierde »hemmt« und die Früchte der Natur unter Mühen bearbeitet, anstatt sie sofort zu verschlingen, seine Triebhaftigkeit überwinden und so zu wahrer, nachhaltiger Befriedigung durch das von ihm gestaltete Werk gelangen kann. Ein Mensch hingegen, dessen Lust sich in Verzehr und Vernichtung erschöpft, versinkt im Genuss, einem höchst flüchtigen Vergnügen, denn aus dem Genuss geht nichts hervor. Ja, die Gefahr ist groß, dass man dem einen Genuss sogleich den nächsten folgen lässt, dass man sich verliert in einer Endlosschleife des Genießens, weil die ersehnte Befriedigung sich nicht einstellen will. Und Hegel war, was die Missbilligung des Genießens angeht, noch vergleichsweise gnädig. Am vernichtendsten nämlich urteilte der große Aufklärer und Pflichtethiker Immanuel Kant über den Genuss. »Daß aber eines Menschen Existenz an sich einen Wert habe, welcher bloß lebt […] um zu genießen […]: das wird sich die Vernunft nie überreden lassen«, ist in seiner Kritik der Urteilskraft zu lesen. »Nur durch das, was er tut ohne Rücksicht auf Genuß, in voller Freiheit und unabhängig von dem, was ihm die Natur auch leidend verschaffen könnte, gibt er seinem Dasein als der Existenz einer Person einen absoluten Wert.« Weil er sein Tun nicht auf eine Pflicht, sondern auf seine Neigung gründet, verspielt der Genießende für Kant seinen »Wert«: Er ist abhängig von seiner Natur, von seinen Trieben und daher kein vollwertiges, verlässliches Mitglied der Gesellschaft.
Das klingt hart, und wir werden noch erfahren, warum der »Alleszermalmer« – so wurde Kant des Öfteren im Zuge der Philosophiegeschichte genannt – auf fatale Weise irrt: Ein Mensch, der alle Neigungen zurückbannt, um einzig und allein der Pflicht zu dienen, ist eine Maschine, die so lange arbeitet, bis sie zusammenklappt. Nichtsdestotrotz hat selbst der gestrenge Kant in einem Punkt durchaus recht: Wer immer nur genießt, ist zu wertvoller Kulturarbeit kaum fähig. Nur weil wir unsere Lüste kontrollieren und uns in Triebverzicht beziehungsweise -aufschub üben, gehen wir höflich miteinander um und morgens ins Büro. Würden wir unsere Begierden nach Lust und Laune ausleben, gäbe es keine Kultur, keine Moral, keine Zivilisation. Maschinen, Straßen, Supermärkte, Computer, Mathematik, Biologie, Physik, Philosophie, Diplomatie, Tische, Stühle, Bänke, Brot und Butter, Kinos, Jonathan Franzens Roman Freiheit oder die amerikanische Kultserie The Sopranos, keine einzige zivilisatorische Errungenschaft würde existieren, wenn der Mensch nicht seit jeher von unmittelbarer Triebbefriedigung abgesehen und sich stattdessen Tätigkeiten wie Bauen, Konstruieren, Forschen, Denken, Backen, Schreiben und Entwerfen, kurz: der Arbeit, zugewandt hätte. Die Fähigkeit zu Entsagung und Triebaufschub macht den Menschen tatsächlich überhaupt erst zum Menschen, das heißt zu einem denkenden, schöpfenden und, last but not least, sittlichen Wesen: Anders als das Tier koitiert der Homo sapiens nicht an jeder Straßenecke, anstatt auf Bäumen schläft er in von ihm gebauten Häusern, sein Essen bereitet er erst zu, bevor er es verspeist, und zur Begrüßung riecht er nicht am Anus seines Gegenübers, sondern schüttelt ihm die Hand. Ja, alles Animalische ist dem Menschen zutiefst zuwider, er verachtet jedes instinktgeleitete Handeln, in der Politik genauso wie im Alltag, und wenn unter den Achseln eines Artgenossen das Deo oder im Bad die Zitrusfrische fehlt, rümpft er die Nase. Was der Mensch schätzt, ist das Erhabene, Saubere, Rationale, ganz gemäß der Position seines Kopfes, den er nicht wie das Tier auf der Höhe seiner Geschlechtsteile trägt, sondern, dank seines aufrechten Ganges, weit, weit oben.
»Heiliger aber als sie [die Tiere] ein Wesen noch fehlte, das hohen Sinnes fähiger sei und die übrigen könne beherrschen. Und es wurde der Mensch. Mag sein, daß der Meister der Dinge, Er, der Ursprung der besseren Welt, ihn aus göttlichem Samen Schuf, mag sein, daß Erde, die jüngst erst getrennt von dem hohen Äther, den Samen vom ursprungsverwandten Himmel behalten, Erde, die dann des Iapetus Sohn, vermengt mit des Regens Wassern, geformt nach dem Bild der alles lenkenden Götter. Während die übrigen Wesen gebeugt zur Erde hin sehen, Gab er dem Menschen ein aufrecht Gesicht und hieß ihn den Himmel Schauen, aufwärts den Blick empor zu den Sternen erheben.«
So heißt es in Ovids Metamorphosen. Der ›stolze‹ Mensch lässt seinen Blick in metaphysische Ferne schweifen, er ist fähig zu Lustverzicht und abstrahierendem Denken. Während das gebeugte Tier an diesem oder jenem Apfel schnuppert und schleckt, überblickt er die Gattung der Kernobstgewächse; und anstatt die Frucht sofort zu verspeisen, wenn sie ihn lockt, dreht und wendet er sie in der Hand, untersucht sie, vergleicht, systematisiert und katalogisiert die verschiedenen Arten.
Doch gerade dies, dass dem Menschen ein wie auch immer geartetes ›natürliches‹ Triebleben schon immer verwehrt ist und er sich ständig zügeln, kontrollieren und zu Kulturarbeit motivieren muss, ist der Grund dafür, dass er sich in sogenannten schwachen Momenten kopfüber, ja mitunter nachgerade halsbrecherisch ins Reich der Nahsinne stürzt. Von der angestrengt zurückgehaltenen Lust überwältigt, wühlt er sein ansonsten so erhabenes Haupt zwischen Brüste und Beine, schnuppert gierig an Geschlechtsteilen und Achselhöhlen, schleckt und tastet und koitiert und trinkt und isst ganze Nächte hindurch.
Tatsächlich ist der Genuss nur die andere Seite des ständigen Triebverzichts: Je strenger der Verzicht, desto ekstatischer das Genießen. Die Pflicht zur Entsagung, die das Genießen angeblich nur zu unterdrücken versucht, bringt es in Wahrheit selbst hervor. »Ich wüßte nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht sagte: ›Du sollst nicht begehren!‹«, so heißt es bereits in den Römerbriefen des Apostels Paulus. »Nachdem aber die Sünde durch das Gesetz einen Anlaß empfangen hatte, hat sie in mir jedwede Begierde geweckt; denn ohne Gesetz wäre die Sünde tot.« Der Mensch genießt, weil er anders als das Tier von einem ›Gesetz‹, von einem Verbot beherrscht wird, das ihm die ungezügelte Sinneslust seit jeher verwehrt und sie deshalb allererst reizvoll erscheinen lässt. Auch Adam und Eva mussten erst schamhaft ihre Geschlechtsteile voreinander verbergen, um sich als geschlechtliche Wesen wahrzunehmen und sexuell zu begehren; im schuldlosen Paradieszustand waren sie so ungeschlechtlich wie Badegäste am FKK-Strand. Ohne Gesetz gäbe es keine Sünde. Nur weil wir seit jeher von einer Grenze durchzogen sind, die das Erlaubte vom Verbotenen, das Sittsame vom Verdorbenen, das Vernünftige vom Unvernünftigen trennt, können wir genießerische Wollust empfinden: nämlich in jenem Augenblick, in dem wir die Grenze überschreiten.
»Aber im Augenblick des Überschreitens empfinden wir die Angst, ohne die es das Verbot nicht gäbe: das ist die Erfahrung der Sünde«, schreibt der französische Philosoph Georges Bataille. »Die Erfahrung führt zur vollendeten Überschreitung, zur geglückten Überschreitung, die, indem sie das Verbot aufrechterhält, es aufrechterhält, um es zu genieʃsen.« Wer genießt, macht sich schuldig, weil er ein Verbot überschreitet. Doch gerade diese Schuld erzeugt eine in höchstem Maße erregende Angst-Lust, ein ekstatisches Gefühl des Aufbegehrens gegen eine Untersagung, die gleichwohl wirkmächtig bleibt – denn sie ist es ja, die das Genießen überhaupt erst ermöglicht und deshalb, wie Bataille sagt, ›aufrechterhalten‹ werden muss. »Ah!«, lässt der Romancier und Pornograph Marquis de Sade, der Meister der Überschreitung, einen seiner lüsternen Libertins stöhnen, »wenn ihr nur wüßtet, was es heißt, zu Füßen einer Madonna zu vögeln … im Innern eines Beichtstuhls oder auf dem Rande eines Altars, wie es mir Tag für Tag vergönnt war! Nein, nichts auf Erden ist so köstlich, wie das Vorhandensein dieser Zügel, deren einziger Dreh und Sinn darin geht, uns die Lust an der Übertretung zu verschaffen.« Und an anderer Stelle heißt es: »Wenn diese törichten Gesetzgeber doch nur wüßten, wie beflissen sie unsere Gefühle befördern, indem sie sich das Recht anmaßen, dem Menschen Satzungen aufzuerlegen: sich keinen Deut um Gesetze zu scheren, sie samt und sonders zu brechen, mein Freund, dies ist die wahre Kunst, Wollust zu empfinden. Erlerne diese Kunst und zerreiße alle Zügel.«
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die Lust des Menschen sich vom animalischen Instinkt fundamental unterscheidet: Wo Tiere lediglich eine Naturnotwendigkeit verspüren, reizt den Menschen die Überschreitung einer kulturellen Grenze. Der menschliche Trieb ist nicht einfach natürlich, sondern er empfängt seine Intensität vom Verbot, das er genießend bricht und damit gleichzeitig bestätigt. Dieses Verbot, dieser Zwang zum Triebverzicht ist verantwortlich dafür, dass uns unsere Lüste entgleiten, dass wir exzessiv sind, obwohl wir doch eigentlich maßhalten wollen; und je strenger wir uns beschränken, desto größer wird sogar die Gefahr des Exzesses.
Heute, zweihundert Jahre nach der Aufklärung und vierzig Jahre nach der sexuellen Revolution, haben sich die kulturellen Verbote natürlich tiefgreifend verändert – verschwunden aber sind sie keineswegs. Der moderne, aufgeklärte Mensch muss nicht mehr aus Glaubensgründen fasten, freitags auf Fleisch verzichten und mit dem Sex bis zur Ehe warten; dennoch sind wir in unserer heutigen Hochleistungsgesellschaft ganz offensichtlich weit davon entfernt, wieder schuldlos wie die Tiere zu werden und uns ohne Gewissensbisse dem Nichtstun hinzugeben. Unsere Gesellschaft, in der mehr denn je Schlankheit, Sportlichkeit, Gesundheit, Produktivität und Effektivität gefragt sind, verlangt uns ganz im Gegenteil ein immer höheres Maß an Triebverzicht ab. Dieser Triebverzicht ist nicht mehr an die göttliche Untersagung gebunden, sondern an strengste individuelle Selbstkontrolle, die durch die Angebote der heutigen Überflussgesellschaft zusätzlich herausgefordert – beziehungsweise konterkariert – wird. Inmitten von All-you-can-eat-Angeboten, Shopping per Mausklick und frei verfügbarer Internetpornographie muss der Mensch seine Lüste umso strenger zügeln; und umso gefährdeter ist er gleichzeitig, in die Sucht abzugleiten. Denn wie soll er damit umgehen, dass ein und dieselbe Gesellschaft ihm den Genuss verbietet und aufdrängt? »Sucht steht für die Unmöglichkeit einer vollständigen Selbstkontrolle«, schreibt der französische Soziologe Alain Ehrenberg in seinem Buch Das erschöpfte Selbst. Der Süchtige »steht in einem ›unmöglichen‹ Verhältnis zum Gesetz. Die Freiheit der Sitten, also das Verschwinden der Polarität erlaubt – verboten … bewirk[t], dass alles konkret möglich wird.« Unsere Konsumleistungsgesellschaft fördert zwanghaftes Genießen, weil sie einerseits auf strengstem Verzicht beruht, andererseits aber durch ihre ständigen Reize die Lust an der Überschreitung provoziert. Was sie verbietet, preist sie gleichzeitig an.
Diese prekäre Dialektik von ständiger Verlockung und notwendiger Selbstkontrolle, von Freiheit und Zwang, von Lust und Untersagung führt dazu, dass jenes Genießen, das Sade und Bataille in ihren Werken beschreiben, heute immer häufiger in quälender Zwanghaftigkeit stattfindet. Das Verbot, das aufrechterhalten wird, ›um es zu genießen‹, wie Bataille schrieb, ist kein Quell der Lust, sondern ein Quell der Unlust, weil seine von ihm selbst erzwungene Überschreitung einzig und allein tiefe Scham mit sich bringt. »Nein, nein, nein, nein, nein, ich darf die Schokolade nicht essen!«, sagt die essgestörte Frau still zu sich selbst, vor ihr auf dem Tisch eine 400-Gramm-Tafel Vollmilchschokolade. »Hinterher werde ich mich dick fühlen und hässlich und schlecht und schuldig. Nein, nein, nein!« Aber dann, in einem Anflug von Gier, greift ihre Hand doch danach, Sünde, Sünde, Sünde!, ruft das Gewissen, aber das macht die Lust nur umso hemmungsloser: Das Papier wird aufgerissen und die Schokolade in Windeseile, um es mit Hegel zu sagen, ›negiert‹. Auch die esssüchtige Frau stürzt sich kopfüber in ein Genießen, wenn man so will – aber in kein lustbringendes, sondern in ein hilfloses, selbstzerstörerisches, zwanghaftes Genießen, das seine Ursache im Über-Ich, dem psychischen Repräsentanten des kulturellen Gesetzes, findet. »Nichts zwingt jemanden zu genießen, außer dem Über-Ich«, schreibt der Psychoanalytiker Jacques Lacan. »Das Über-Ich, das ist der Imperativ des Genießens – Genieße!«
Dass genau dieser Imperativ im Zentrum der heutigen Konsumkultur steht, ist natürlich bezeichnend. Genieße! ruft man uns allenthalben zu. Morgens sollen wir den duftenden Kaffee genießen, tagsüber die Arbeit und abends den Sport. Wir sollen uns lächelnd in Schaufenstern betrachten (Du darfst!) und uns selbst wichtig nehmen (Unterm Strich zähl ich!). Wir sollen uns etwas gönnen. Neue Schuhe zum Beispiel, ein neues Haus oder ein Wellness-Wochenende. Wir sollen erregt sein. Lieber geiles Bier als gepflegtes Pils trinken. Pornos gucken. Wir sollen mit dem Finger zärtlich über virtuelle Oberflächen streichen. Wir sollen Flatrates haben. Online sein. Ununterbrochen kommunizieren. Wir sollen mit schnellen Autos durch staubige Kurven fahren. Wir sollen Schnäppchen jagen. All-inclusive-Angebote nutzen. Zum Shoppen nach London jetten. Wir sollen die Vorteile eines Darlehens genießen. Wir sollen in Aktien investieren und auf den Bankrott eines Staates wetten. Wir sollen Schmerz vermeiden und Lust maximieren. Der Mensch im Kapitalismus genießt bis zur absoluten Erschöpfung. Der Lust am ›Weniger‹ frönt er genauso wie der Lust am ›Mehr‹, Diätvorschläge fordern zum kollektiven Hungern, All-you-can-eat-Angebote zum kollektiven Überfressen auf, und während die einen für einen billigen Flachbildschirm sogar nachts die Discounter stürmen, erfüllt es die anderen, 42 Kilometer lang über Großstadtasphalt zu hetzen.
Diese Exzessivität des Genießens ist kein Zeichen von zunehmender Freiheit, sondern vielmehr das Symptom eines extremen Triebverzichts: Genuss, so haben wir oben gesehen, kann es schließlich nur geben vor dem Hintergrund von Entsagung, und je größer diese ist, desto zwanghafter das Genießen. Die Schizophrenie der heutigen Gesellschaft ist somit offensichtlich: Das uns von überall her der Imperativ Genieʃse! entgegenhallt – und wir ihm gehorchen –, zeigt, wie verklemmt, wie prüde, wie asketisch diese Kultur im Kern ist.
Eindrücklich offenbart sich die gegenwärtige Lustfeindlichkeit auch in einer derzeit höchst beliebten Form des Genießens, das die Grenze brav akzeptiert, anstatt sie zu überschreiten. »In der Kultur westlicher Gesellschaften hat etwa Mitte der neunziger Jahre etwas stattgefunden, das man – mit einem Wort von Karl Marx – als einen Wechsel der Beleuchtung beschreiben möchte«, so der österreichische Philosoph Robert Pfaller. »Objekte und Praktiken wie Alkoholtrinken, Rauchen, Fleisch essen, schwarzer Humor, Sexualität, die bis dahin glamourös, elegant und großartig lustvoll erschienen, werden seither plötzlich als ekelig, gefährlich oder politisch fragwürdig wahrgenommen.« Aus der ekstatischen Wollust scheint in der Tat immer mehr eine gesellschaftskonforme ›Wohllust‹ zu werden: Die heutige Genusskultur ist eine Wellness-Kultur, in welcher der Geschlechtsakt höchstens noch der Entspannung dient, das Rauchen verboten und das Maßhalten unentwegt angeraten wird. Der Wellness-Genuss ist kein transgressiver, überschreitender Genuss, sondern ein zutiefst affirmativer: Genossen – sofern von Genuss überhaupt noch die Rede sein kann – wird das Gesunde, Reine, Biologische, Gute, Ungefährliche, das dem Leistungsimperativ keineswegs zuwiderläuft, sondern ihm zuarbeitet.
Besuchen wir, um der Logik des vernünftigen Genießens auf den Grund zu gehen, den berühmten Seefahrer Odysseus auf seinem schwankenden Kahn – jenen rationalen Genießer, der sich lieber fesseln lässt, anstatt der süßen Verlockung nachzugeben. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor?
Odysseus in der Sauna
Wie aus der Wollust die Wohllust wurde
Ein Mann auf hoher See, aufrecht steht er am Mast, starr, unbeweglich. Unter ihm sitzt, auf harten Bänken und mit verstopften Ohren, sein ruderndes Gefolge. Der Mann ist gefesselt. Auf sein Geheiß hin haben ihn die Ruderer mit starken Seilen an den Mast geschnürt. Doch plötzlich windet er sich, schreit, bittet, man möge ihn befreien! Die tauben Gefährten sehen seinen weit aufgerissenen Mund, seine verzweifelten Augen, doch anstatt seinem Flehen nachzugeben, schlingen sie die Seile nur noch fester um seinen Leib. Der Mann daraufhin reckt, so weit es ihm möglich ist, Kopf und Oberkörper nach vorne, er bemerkt die schneidenden Fesseln nicht, sondern hört nur den süßen Gesang zweier vogelähnlicher Frauen, die, umringt von Gebeinen und getrockneter Haut, auf einem begrünten Eiland sitzen:
»Hierher, Odysseus, Ruhm aller Welt, du Stolz der Achaier! Treibe dein Schiff ans Land, denn du musst unsere Stimmen erst hören! Keiner noch fuhr hier vorbei auf dunklen Schiffen, bevor er Stimmen aus unserem Munde vernommen, die süß sind wie Honig.«
Doch Odysseus, so der Name des Mannes, lenkt sein Schiff nicht an Land. Dank einer Warnung der Göttin Kirke wusste er rechtzeitig, dass die Sirenen ihn locken würden; und auch wusste er, dass er, wenn er ihrem Lockruf nachgäbe, sterben würde wie all die anderen Seeleute, auf deren Knochen die todbringenden Wesen sitzen. Und so folgt er Kirkes klugem Rat, den Gefährten mit Wachs die Ohren zu verstopfen und sich anschließend von ihnen an den Mast binden zu lassen – zumal ihm auf diese Weise die bezaubernden Lieder der Sirenen durchaus nicht entgehen. Nur die Ruderer werden ihres Gehörs beraubt, damit sie taub sind für die Verführungskraft der Sirenen und ihren Herrn kühlen Kopfes vor sich selbst schützen können; Odysseus dagegen kann den Gesang genießen, ohne sich von ihm auf tödliche Weise hinreißen zu lassen.
Odysseus, wie er am Mast steht, gefesselt, entsagend und doch genießend – er ist Sinnbild für einen Genuss, der sich durch strengste Selbstkontrolle und rationalen Verzicht auszeichnet. Odysseus überlässt sich nicht kopflos dem tödlichen Zauber des Sirenengesangs, sondern er bewahrt gesunden Abstand zum Objekt des Begehrens und damit die absolute Herrschaft über sich selbst. »Der gefesselt Hörende«, schreiben die Philosophen Max Horkheimer und Theodor Adorno in ihrer Dialektik der Aufklärung, »will zu den Sirenen wie irgendein anderer. Nur eben hat er Veranstaltung getroffen, daß er als Verfallener ihnen nicht verfällt.«
Indem Odysseus seine Triebe im wahrsten Sinne des Wortes zügelt und sich damit als stabiles, über jede Verführbarkeit erhabenes Selbstbewusstsein behaupten kann, nimmt er vorweg, was wir im 21. Jahrhundert längst bis ins Letzte perfektioniert haben: nämlich einen vernünftigen, gesundheitsbewussten Genuss, der an die Stelle des genussvollen, ekstatischen Selbstverlusts umgekehrt die Erhaltung und Instandsetzung des Selbst setzt. Im Wohlfühlgenuss wollen wir uns nicht verlieren, sondern wir wollen uns wiederfinden, wir wollen unsere Grenzen nicht auflösen, sondern diese durch eine noch reinere Haut, einen noch strafferen Po und eine noch größere Zurückhaltung beim Trinken und Essen umso präziser markieren. »Das Buffet, das wir kaum noch anrühren, der verschmähte Rest auf dem Teller, das Rumoren eines nicht ganz gefüllten Magens – das sind zweifellos zivilisatorische Errungenschaften«, stellt der Publizist Tobias Kniebe im Frühjahr 2008 im Magazin der Süddeutschen Zeitung fest. Eine zivilisatorische Errungenschaft sind diese Formen der Wohlstandsaskese insofern, als sie von einem hohen Maß an Kultiviertheit und Selbstbeherrschung zeugen. Der Wohlstandsasket schnallt den Gürtel nicht enger, weil er muss, sondern weil er sich gefällt in der freiwilligen Geste der Entsagung. Den Trieb unter Kontrolle zu haben bedeutet Autonomie nicht nur gegenüber den eigenen dunklen Mächten, sondern auch gegenüber der Überflussgesellschaft, die uns ein Gratishäppchen nach dem anderen feilbietet. Der Berliner Kulturwissenschaftler Thomas Macho schreibt: »Wer mit permanenter Fülle konfrontiert wird, sehnt sich nach Leere: nach einer Erlösung vom Zwang, alle Genussangebote akzeptieren zu müssen. Wer unaufhaltsam versorgt wird, beginnt nach Entzug zu streben. Daher ist es keineswegs verwunderlich, daß sich – gewissermaßen als Reaktion auf stets besetzte Supermarktregale – ein Typus alternativer Sinnstiftung etabliert hat: etwa in Gestalt pseudoasketischer Lebensweisheiten, die Verzicht und Enthaltsamkeit predigen. Jedem zeitgenössischen Kochrezept korrespondiert ein Diätvorschlag; jeder Metzgerei ein Reformhaus; jeder Werbung für ein neues Nahrungsmittel ein Medikament gegen ›Völlegefühle‹ oder Gastritis.«
Während weltweit Millionen von Menschen hungern und ums nackte Überleben kämpfen, haben wir das Luxusproblem ständiger Nahrungsmittelüberverfügbarkeit, die den Verzicht notwendig und durchaus auch attraktiv macht. Wer einen letzten Rest auf dem Teller lässt, wer lieber weniger als mehr isst, zeigt damit seine Souveränität, seine Selbstbestimmtheit, seine Diszipliniertheit und nicht zuletzt auch seine Schichtzugehörigkeit an. Mit den All-you-can-eat-Essern, denen der Spätkapitalismus durch Flatrate-Angebote unaufhörlich das Maul stopft, hat der gesundheitsbewusste Wellness-Genießer nichts zu tun. Gierig sind die anderen, die aus den unteren Lagen der Gesellschaft, die Colatrinker, Pornogucker und Fastfood-Konsumierer. Und um sich von ihnen abzugrenzen, übt der gehobene Mittelschichtler sich in vornehmer Entsagung. Dass allerdings ein solches Verhalten zugleich auch seelische Verarmung bedeutet oder zumindest bedeuten kann, daran lassen die Philosophen Horkheimer und Adorno keinen Zweifel. Odysseus, so schreiben sie, stellt ein Selbst vor, »das immerzu sich bezwingt und darüber sein Leben versäumt […] Er […] kann nie das Ganze haben, er muß immer warten können, Geduld haben, verzichten, er darf nicht vom Lotos essen und nicht von den Rindern des heiligen Hyperion«.
Doch greifen wir nicht vor. Denn zunächst einmal ist nicht von der Hand zu weisen, dass Genuss in gewisser Hinsicht durchaus die Fähigkeit zur Entsagung und Selbstkontrolle voraussetzt. Hätte Odysseus sich nicht an den Mast binden lassen, er wäre verloren gewesen. Der lebensgefährlichen Versuchung standhalten konnte er nur, indem er seinen Leib bezähmte. In der Tat ist unkontrollierter Genuss gefährlich nah an der Sucht, weshalb es unter Umständen sogar lebensnotwendig ist, auf manche Annehmlichkeit zu verzichten – so verlockend sie auch erscheinen mag. Wir entscheiden uns, das wusste bereits der antike Philosoph Epikur, »nicht schlichtweg für jede Lust, sondern es gibt Fälle, wo wir auf viele Annehmlichkeiten verzichten, sofern sich weiterhin aus ihnen ein Übermaß von Unannehmlichkeiten ergibt«.
Darüber hinaus ist der Ungezügelte unfähig, das Objekt seines Begehrens in seiner ganzen Schönheit zu erkennen. Man denke nur an den überhasteten Geschlechtsakt, bei dem sich Liebende im Grunde keines Blickes würdigen. Nur wenn der Genießer seine Triebhaftigkeit überwindet, verwandelt sich das Objekt seines Begehrens von einem natürlichen Ding, das lediglich Bedürfnisse befriedigt, zu einem bewunderungswürdigen Kunstwerk. Der Genießer hat es sorgsam arrangiert und zunächst in all seinen feinen Einzelheiten betrachtet, bevor er es sich langsam, nach Manier eines Connaisseurs, einverleibt. Wer genießen will, muss sich Zeit nehmen, um eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, er muss eine Situation zu inszenieren wissen, in der das begehrte Objekt – sei es ein Teller Pasta oder ein anderer Körper – seinen ganzen Reiz entfalten kann. »Die Verwandlung in ein Artefakt, die Metamorphose in ein Kunstwerk, ist es, was … eine Intensität entstehen läßt, die sich nicht der Natur, sondern allein kunstvoller Inszenierung und Dramatisierung verdankt«, scheibt Nikolaus Lagier in seinem Buch Die Kunst des Begehrens. Homers Odysseus verhält sich in dieser Hinsicht geradezu vorbildlich. Anstatt sich den Sirenen einfach hinzugeben, dramatisiert er die Begegnung mit ihnen und hält, damit einhergehend, einen ehrerbietenden Abstand ein. Insofern ist Odysseus tatsächlich der kultivierte Genießer par excellence, ja, der gefesselte Held gemahnt gar an einen Konzertgänger, der den Sopranistinnen auf der Bühne gern nah sein würde, aber, da er die Grenze nicht überschreiten darf, wie gebannt auf seinem Platz verbleibt und genau dadurch Intensität, Spannung entstehen lässt. »Der Gefesselte«, so Max Horkheimer und Theodor Adorno, »wohnt einem Konzert bei, reglos lauschend wie später die Konzertbesucher, und sein begeisterter Ruf nach Befreiung verhallt schon als Applaus.«
1. Auflage
Copyright © 2011 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Bildnachweis: AKG Images, Berlin: Bild 1 (Erich Lessing), Bild 2, Bild 3 (N.N.); Bayerische Staatsbibliothek, München: Bild 4 (Rar. 747).
Typografie und Satz: DVA/Brigitte Müller
Gesetzt aus der Baskerville
eISBN 978-3-641-06179-1
www.dva.de
www.randomhouse.de
Leseprobe