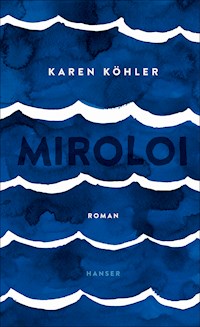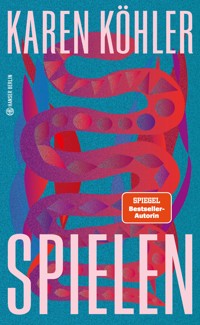Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es gibt diesen Moment, in dem das eigene Universum zerbricht und weit und breit kein neues in Sicht ist: Eine junge Frau sitzt mittellos und nahezu dehydriert vor einer Tankstelle im Death Valley. Als plötzlich ein Indianer vor ihr steht und ihr das Leben retten will, glaubt sie zu phantasieren. Doch das Universum setzt sich nach seinen eigenen Regeln wieder zusammen. Schon bald teilen sich die beiden einen Doppelwhopper, gehen gemeinsam ins Casino und stranden schließlich in einem dieser schäbigen Motels, die es eigentlich nur im Film gibt. Karen Köhlers Erzählungen sind getragen von einer fröhlichen Melancholie und einer dramatischen Leichtigkeit. Ihre Figuren sind wahre Meisterinnen im Überleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
KAREN KÖHLER
ERZÄHLUNGEN
CARL HANSER VERLAG
ISBN 978-3-446-24684-3
© Carl Hanser Verlag München 2014
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Karen Köhler, www.karenina-illustration.de
Satz im Verlag
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
INHALT
Il Comandante
Cowboy und Indianer
Polarkreis
Name. Tier. Beruf.
Wir haben Raketen geangelt
Familienportraits
Starcode Red
Wild ist scheu
Findling
MEINEM RUDEL
»I TRIED TO DROWN MY SORROWS,
BUT THE BASTARDS LEARNED HOW TO SWIM.«
FRIDA KAHLO
JETZT. ALSO SAMSTAG. SAMSTAG, DER 2. JUNI.
Keiner da. Das ist gut. Ich ziehe mir die Perücke vom Kopf, nehme gleich alle Steine aus der Schale und befülle die Perücke damit, steige auf die runde Holzbühne, hocke mich vor den Altar und lege den Perückensteinbeutel vor mich hin. Nicht nur ein Stein, sondern ein ganzes Nest der Schwere. Hole mein Telefon raus und fotografiere das Nest mit einer Polaroid-App. Ich klicke: Nachrichten. Klicke: Cesar. Klicke auf das kleine Fotosymbol. Lade das Bild und schreibe: I even did my hair for you. I hope they serve Banana Split in heaven. Klicke: Senden. Mache dann Musik an. Interpret: Buena Vista Social Club. Volle Lautstärke Hasta Siempre Comandante.
DER MONTAG DAVOR
Ich liege auf der 14A, Zimmer 11 und habe das Bett am Fenster. Die Diplompsychologin hat sich auf den Stuhl zwischen Bettkante und Fensterbank gesetzt und schaut mich aufmunternd an. Es ist ihr dritter Versuch in sieben Wochen. Jederzeit könne ich mich bei ihr melden. Dafür sei sie ja schließlich da. Ich brauche mich nicht für meine Schwäche zu schämen. Hinter ihr schieben sich wilde Wolken durch Fensterrahmen. Ich könne jetzt gleich einen Termin mit ihr vereinbaren. Sie habe Verständnis für meine Situation und Erfahrung mit Patienten wie mir. Sie könne sich meine Gefühle und Ängste gut vorstellen. Ein Playboy-Hase fliegt auf den Diplompsychologinnenkopf zu. Jetzt hat sie vier Ohren. Sie wisse, dass gerade in meiner Situation oft Überforderungen im Umgang mit der Krankheit auftreten und dass sowas auch eine Partnerschaft belasten könne. Ich blicke weiter aus dem Fenster. Die Hasennase kommt als Schlange wieder aus ihrem Ohr heraus. Ich solle mich nicht scheuen, den kostenlosen Patientendienst in Anspruch zu nehmen und mich bei ihr melden, wenn ich Hilfe benötige.
»Danke. Ich habe kein Interesse«, sage ich. Dann geht die Tür auf und der Arzt kommt zur Visite. Oberarzt Doktor Kehlmann schäkert, sie verschwindet. Endlich. Eine Maus fliegt vorbei.
»Wie geht es uns heute?«, fragt Dr. Kehlmann.
Die Maus wird zu einem Dackel.
»Na gut. Dann wollen wir uns das mal ansehen.«
Kehlmann schlägt die Bettdecke von meinem Bauch und zieht sich Einweggummihandschue an. Ich hebe das T-Shirt. Wir gucken auf den Beutel. Mitten in meinem Bauch ist neuerdings ein Loch. Über dem Loch klebt die Platte,an der Platte ist eine Öffnung mit einem Verschluss, und daran hängt der Beutel. In dem Beutel ist meine Scheiße. Das ganze heißt Stoma. Künstlicher Darmausgang. Den habe ich seit vier Tagen. Seit 29 Tagen habe ich eine Glatze, genauer gesagt habe ich mittlerweile gar keine Haare mehr am Körper. Seit zwei Tagen hat sich Tom nicht mehr gemeldet. Ich bin 33 Jahre alt und habe Krebs. Wiesollsunsdennheuteschongehen.
»Kommen Sie mit dem Stoma zurecht?« Ich nicke. Kehlmann entfernt den Beutel, in dem sich mein Frühstück befindet, eine Pampe aus Tee und Apfel. Ein Geruch, an den ich mich noch immer nicht gewöhnt habe, breitet sich aus. Kehlmann betupft und säubert mit der freien Hand die Öffnung. »Ahh. Das sieht doch wunderbar aus, das ist sehr gut verheilt«, sagt er, während er den kleinen roten Mund in meinem Bauch begutachtet. Ein Stückchen Dünndarm schaut da heraus, vernäht zu einer Öffnung. Mich ekelt dieser Schlund.
»Vertragen Sie den Kleber von der Platte?«
»Glaub schon.«
»Kein Juckreiz?«
»Nö.«
»Das ist gut. Unsere Stoma-Therapeutin wird Ihnen zeigen, wie Sie in den nächsten Monaten selbständig alles wechseln können.«
»Das hat sie schon.«
»Achso. Ja. Wenn Sie entlassen werden, kommt sie zu Ihnen nach Hause und versorgt Sie mit Utensilien.«
Doktor Kehlmann geht zum Waschbecken und entleert den Beutel. Ich stelle mir vor, wie die Stoma-Therapeutin bei Tom und mir zu Hause auf dem Sofa sitzt und uns wie ein Staubsaugervertreter Beutel und Platten andreht.
»Das wird schon. Übung macht den Meister. In ein paar Monaten sind Sie ein Profi. Den werden Sie gar nicht mehr loswerden wollen …« Kehlmann klickt gekonnt den Beutel an den Verschluss.
Ich will darin kein Profi werden. Ich will meinen alten Bauch zurück. Ohne Loch. Ich will meine Wimpern zurück, meine Augenbrauen und meine langen Haare. Ich will, dass Tom neben mir liegt und ich mich einrolle.
Kehlmann schiebt meine Hose herunter und wechselt den Verband der Narbe, die einmal quer über meinen Unterbauch verläuft und aus der ein Schlauch herausführt, der in einem weiteren Beutel mit Wundsekreten endet.
»Ich bin ein Beuteltier.«
Kehlmann lacht und untersucht die Wunde. Darunter: Mein stillgelegter Restdickdarm. Jetzt funktionslos und hoffentlich auch karzinomfrei.
»Das sieht auch sehr gut aus. Wir entfernen bald die Drainage.«
Er blättert in der mitgebrachten Kartei, macht Notizen und sagt, man habe jetzt den Befund von den Lymphknoten. Diagnose pT3pN2. Das bedeute, dass man über weitere Therapien nachdenken müsse, er werde mit mir noch für diese Woche einen Termin vereinbaren, damit wir alles genau besprechen können. Zunächst wolle er sich aber auf der Tumorkonferenz mit seinen Kollegen beraten. Die Schwester werde mir den Termin mitteilen. Wahrscheinlich sei der Mittwoch. Das sei alles kein Grund, den Kopf …
Weitere Therapien, was für Therapien, wie kann das sein, dass da nach sechs Wochen Chemo jetzt noch was befallen ist, ich dachte, ich bin jetzt fertig, was kommt denn da noch, pT3pN2, warte mal, N2 bedeutet mehr als drei benachbarte Lymphknoten, das ist doch schlecht, oder nicht, ist auch mein Blut befallen, wird das wieder, warum sagt er denn nichts, was ist mit der Leber und der Bauchspeicheldrüse, was sagt er, FOLFOX, wieso FOX, wohin frisst sich das noch, was heißt denn weitere Therapien, wieso denn Plural, danach noch mal FU5, ambulant oder stationär, dafür bekomme ich einen Port über dem Herzen, was ist das, ein Port, ein Hafen, warte …
Doch bevor ich etwas sagen kann, ist er verschwunden, und ein Pferd galoppiert durch den Himmel.
DIENSTAG
Die Klinik heißt wie ein griechischer Gott. Ein hässliches, schmales, braunes Gebäude, dass gar nicht erst den Anspruch hat, gut auszusehen. Unverschämt und vollverglast steht es in der Stadtlandschaft herum. 21 Stockwerke hoch. Ich starre auf den braunen Klopper und versuche, mein Zimmerfenster auszumachen. Zum ersten Mal seit Wochen habe ich das Gebäude verlassen. Habe gestern eine neue Zimmernachbarin bekommen, die jede Menge Besuch am Start hat. Ehemann, Eltern, Schwester, Kinder, Freunde. Der Strom reißt da gar nicht ab. Deshalb bin ich jetzt hier unten am See. Obwohl, See … Teich. Besser: Tümpel. Sieben Enten und ein Fischreiher sonnen sich darin. Rhododendron blüht. Bäume rauschen. Einige davon entladen ihre weißen Flusen in die Luft. Denke: Baumwolle.
Ich setze mich auf eine Bank am Ufer. Dann wische ich übers Glas. Entriegeln. Gebe den Code ein. Klicke auf Telefon. Anrufliste. Tom. Es tutet. Wieder nur die Mailbox. Ich versuche, zuversichtlich zu klingen.
Der Hubschrauberlandeplatz liegt bedrohlich auf einer Erhöhung neben dem See. Jederzeit kann hier was landen, ein Unfallopfer mit schwachem Puls oder eine Kühltasche mit den Organen eines Toten.
Der Fischreiher hebt unvermittelt ab. Ich lege auf.
Langsam schleppe ich mich wieder zum Haupteingang. Eine Hochschwangere watschelt mir mit dem werdenden Vater entgegen. Die Geburtsstation, das Storchennest, ist gleich nebenan im kleineren, schöneren Gebäudekomplex. Ich lächle über ihren Bauch und muss Praline denken. Sie sieht mich mitleidsvoll an, er schaut weg, beide gehen grußlos vorbei. Ich weiß selber, wie ich aussehe. Blass. Froschig. Krank. Mein Kopftuch ist schweißnass, als ich endlich vorm Haupteingang stehe, mein T-Shirt unter Toms Pullover klebt an der Haut. Unter beiden Beuteln laufen kleine Bäche.
Im Raucherpavillon sehe ich einen Krebspatienten. Unsere Blicke treffen sich. In seinem liegt Übermut, in meinem Unverständnis. Ich drehe mich ins Gebäude, und biege, weil ich Durst habe, in das Krankenhauscafé ab, das den genialen Namen Café Bistro trägt. Ein Kundenfänger steht vorm Eingang. Schnitzel sind heute im Angebot.
Als die Bedienung an meinen Tisch kommt, bitte ich um ein Glas Leitungswasser.
»Mehr nicht?« Sie schaut mich an.
»Ich bezahle es meinetwegen auch«, sage ich.
»Schon gut«, sagt sie, »aber dass mir das nicht zur Gewohnheit wird.«
Ich schüttele den Kopf.
Das Krankenhaus-Café könnte sich auch in einem Hotel an der Ostsee befinden, das in den 90ern zuletzt renoviert wurde. Vor einer halbrunden Fensterfront stehen sechs Tische, Holzlaminat und Stahlbeine, mit jeweils vier dazu passenden Stühlen. Um eine Säule in der Mitte des Raumes wurden mehrere Zweierensembles gruppiert. Die bleiben immer am längsten frei. Zuerst füllen sich die Fensterplätze. Auf allen Tischen stehen Ständer mit der Speise- und Eiskarte und weiße Vasen, in denen kleine Kunststraußgebinde stecken, die vergeblich versuchen, Frühling zu verbreiten. Außer mir sitzen noch fünf weitere Gäste im Café.
Die Bedienung balanciert zwei Kuchenteller mit einer Hand, stellt mir im Vorbeigehen das Wasserglas auf den Tisch und flötet ein Bittesehr.
Dann sehe ich ihn: Ein älterer Mann kurvt im Rollstuhl herein. Eine Wollmütze thront auf seinem Kopf, unter der sich seine schwarzen Locken beulen, seine Augen verdeckt eine große Designer-Sonnenbrille. Er rollert ungeübt, aber zielstrebig auf einen Fenstertisch zu, ein Lächeln findet den Weg durch seinen grauen Rauschevollbart. Was lächelt der, er ist in einem Krankenhaus, warum hat der so gute Laune. Er überstrahlt alles, was ich in den letzten Wochen hier gesehen habe, ach Quatsch, er überstrahlt auch vieles außerhalb dieses Krankenhauses. Kann mich gar nicht sattsehen. Der kann doch gar nicht krank sein.
»Hello, my friend«, ruft ihm der Café Bistro-Chef zu.
»Buenos dias, amigo«, sagt er, schiebt umständlich einen Stuhl zur Seite und platziert sich aufwendig am Fensterplatz des Tisches. Rückwärts Einparken in siebenundzwanzig Zügen.
»What can you offer me today?« Seine Stimme ist wie ein Instrument, laut und tief.
»Fish and Pommes mit Salad?«, stümpert der Bistro-Chef.
»Pescado y patatas fritas, muy bien, Dankeschön«, sagt er und legt sein Smartphone auf den Tisch. An den Fingern der linken Hand stecken mehrere Goldringe, an seinen Ohrläppchen glitzern Steine.Er trägt etwas um den Hals, das wie ein Union Jack aussieht. Eine Wolldecke liegt über seinen Beinen, die in irgendeiner Jogginghose stecken, in seinem Schoß liegt ein Hipbag. Obenrum: Ein ausgewaschenes helles T-Shirt und darüber eine dunkelblaue Jacke. Er sieht in meine Richtung.
Nicht, dass hier vorher viel geredet wurde. Jetzt aber, jetzt schauen alle auf den Popstarparadiesvogelpatientenopa. Und er schaut mich mit seinen Popstarsonnenbrillenparadiesvogelaugen an. Ich versuche ein Lächeln.
Das war unsere erste Begegnung.
MITTWOCH
Doktor Kehlmann redet nicht lang herum. In vier von sechzehn Lymphknoten wurden bösartige Tumorzellen gefunden, was bedeute, dass das Karzinom bereits gestreut habe und nun weitere Therapien mit Zytostatika anstünden. Man wolle ganz sichergehen, dass alle eventuell im Körper befindlichen Krebszellen abgetötet würden. Dazu sei auch ein stärkeres Medikament notwendig. Es wird eine ambulante Behandlung mit FOLFOX vorgeschlagen, und anschließend, nach einer Pause von drei Wochen, nochmals mit FU5, das ich ja bereits gut vertragen habe. Ambulant bedeute, dass man mir nun einen Port einpflanzen werde, das sei eine Art Andockstation, die über dem Herzen an eine Vene operiert würde, in die dann die Chemotherapien der nächsten Monate laufen werden. Die wöchentliche Dosis könne ich mir in einer Praxis in der Nähe abholen, das Medikament werde mit einer kleinen Pumpe an einem Gürtel um den Bauch getragen, ein Schlauch führe dann über eine Kanüle zum Port, von wo es dann kontinuierlich in den Körper gelange. Die Operation sei nächste Woche, der genaue Termin werde mir mitgeteilt. Der Port habe den enormen Vorteil, dass ich während der nächsten Monate ein weitgehend selbständiges Leben führen könne. In einem halben, dreiviertel Jahr sei ich damit spätestens durch. Wenn alles gut ginge, also bei günstiger Entwicklung der Heilung, würde danach der künstliche Darmausgang wieder entfernt und eine Rückoperation des Darms durchgeführt werden.
Alles ist wie in Watte, als ich im Fahrstuhl nach unten fahre. Und weil ich mich verdrückt habe, fahre ich nach ganz unten. Ins UG. Das merke ich aber erst, als ich ausgestiegen bin und der Fahrstuhl wieder weg ist. Vor mir tut sich ein schmuddeliger Gang auf. Ein Schild weist links den Weg zum Bettenlager. O ja. Da will ich hin. Unbedingt. Ich bin so müde. Ich folge den Schildern, bis ich in einem großen Raum voller leerer Krankenhausbetten stehe, die nicht bezogen sind. Ich überlege, in welchen wohl Leute gestorben sein könnten und lege mich in eines, von dem ich glaube, dass es unbestorben ist.
Ich stehe am Fenster eines hohen Turms und aus meinem Bauch kommt ein Schlauch, den ich aus dem Fenster lasse. Unten steht Tom. Er versucht, an dem dünnen Schlauch zu mir hochzuklettern, aber der Schlauch wächst, wird länger und länger und Tom landet immer wieder auf dem Boden, während ich oben stehe und vor Schmerzen schreie. Ich denke noch im Traum, dass das ein gefundenes Fressen für die Diplompsychologin wäre, dann weckt mich ein Pfleger. »Was machen Sie denn hier? Hier können Sie nicht schlafen.« Ich sammle mich zusammen und verschwinde.
Mein Blick wandert zwischen den sechs Fahrstühlen hin und her, von denen keiner kommen will, und bleibt an dem Wort Kapelle hängen. Das Schild zeigt nach rechts und ich folge ihm, weil ich nicht glauben kann, dass hier unten irgendwo eine Kapelle sein soll.
Aber doch: Gottesdienst nächsten Sonntag um 10:15 Uhr.
Ein Gästebuch liegt auf einem Pult am Eingang des Vorraums. An den Wänden hängen christliche Symbole. Ein Gang führt weiter in eine rechtsdrehende Schnecke und mündet in einen runden Raum, der das Herz der Kapelle bildet. Die Atmosphäre ist klar und freundlich. Es gibt eine runde Holzbühne mit einem Altar darauf, die von einem Oberlicht beleuchtet wird. An der gegenüberliegenden Raumseite sind Stühle im Halbkreis angeordnet. Ich setze mich und lausche. Eine Lüftung rauscht. Vor mir steht ein kleines Tischchen mit einer Schale darauf, in der Steine liegen. Hinter dem Altar sind Seile von der Decke zum Boden gespannt, an denen Goldquadrate befestigt sind, die in unterschiedlichen Winkeln zueinander das Licht reflektieren. Das sieht sehr schön aus. Ich zähle die Seile. 14. An jedem Seil sind 21 Goldplättchen. Macht 294. Ist das eine christliche Zahl? Ich will ein Foto machen und sehe, dass ich eine Nachricht von Tom erhalten habe.
Gib mir Zeit. Tom
Ich stehe auf und fotografiere wirr herum. Kerze. Klick. Altar. Klick. Decke. Klick. Orgel. Klick. Der Raum Klickklickklick. Pfingstrosen. Bibel. Klickklick. Ein Relief an der Wand zeigt einen Kranken, der am Boden liegt und einen Gesunden, der ihm aufhilft. Nur sieht es eben so aus, als würde der Gesunde den Kranken runterdrücken. Klick.
Neben der Schale mit den Steinen auf dem Tisch liegen Gebrauchsanweisungszettel.
Einladung zur Begegnung mit Gott.
Haben Sie Kummer? Sorgen? Ist Ihr Herz schwer?
Nehmen Sie sich einen Stein aus der Schale, lassen Sie ihren Schmerz und Ihre Angst, alles, was Sie beschwert, aus sich heraus und in den Stein hineinfließen. Gott trägt Ihre Last gern für Sie. Er kann Ihnen dabei helfen, leichter zu werden. Legen Sie Ihren »Stein der Schwere« in die Schale auf den Altar. Beim nächsten Gottesdienst wird für jeden in der Schale liegenden Stein eine Fürbitte gesprochen werden.
Haben Sie einen Wunsch? Nehmen Sie sich einen der Zettel, einen Augenblick Zeit und schreiben Sie Ihren Wunsch auf. Gottes Ohren sind offen. Auch für Sie.
Ich glaube ja nicht an so was, also dass das irgendwas bringt, nehme aber trotzdem Stein, Zettel und Stift und setze mich auf die Holzbühne.
Ich packe meinen Beutel in den Stein. Meine Scheiße. Meine Angst. Den ganzen Krebs. Ich packe Toms Unsicherheit in den Stein. Meine Trauer. Meine verlorenen Wimpern. Ich presse und drücke alles Schlechte in den Stein. Dann schreibe ich LIEBE auf den Zettel, falte ihn zweimal und denke, dass das blöd war, dass ich mir lieber Gesundheit hätte wünschen sollen. Ich trete an den Altar, lege Zettel und Stein in die Schale, und betrachte danach die aufgeschlagene Seite in der Bibel. Johannes 21.1 Die Erscheinung des Auferstandenen am See.
See, denke ich.
Natürlich sitzt er da. Er sitzt da am Ufer, in der Sonne, mit dem Kopf im Nacken und weit geöffnetem Mund. Der Paradiesvogelpopstarsonnenbrillenopa im Rollstuhl. Sieht aus, als schicke er einen stummen Schrei in den Himmel. Diesmal trägt er eine Art Kapitänsmütze, ansonsten ist die Verkleidung wie gestern. Nur ist der Union Jack ein Sternenbanner, wie ich jetzt erkennen kann.
»Hello«, sagt er, als ich an ihm vorbeigehen will.
»Hello«, sage ich und bleibe stehen.
»Hola, beautiful Donna, come va? It is such a nice day, si? Why don’t you take a piccolo Pause? Would you like to sit on the bench?«
Warum nicht.
»Why not«, sage ich.
»Hablas Espanol?«
»Nö«, sage ich. »I don’t speak Spanisch. But a little Italian. Posso parlare un po italiano.«
»Italiano, muy bien. Boungiorno.«
»You want me to push you?«, frage ich und will schon hinter seinen Rollstuhl greifen, um ihn anzuschieben, aber er legt den Kopf schräg und fragt, ob ich verrückt sei, dann arbeitet er sich an den Rädern des Rollstuhls ab, bugsiert sich neben die Bank und macht wieder diesen stummen Sonnenschrei. Er sagt: »Ohhh it’s so good, the sun.«
»What are you doing?«
»I am drinking the sunlinght.«
»What?«
»Try it. This is good, Baby.«
Mir ist alles egal, ich reiße meinen Schnabel auf, und, tatsächlich, es fühlt sich gut an, wie die Sonne meinen Mund von innen wärmt. Aber noch viel besser fühlt es sich an, etwas Komisches zu tun. Etwas Seltsames. Etwas, was nicht alle machen. Etwas, das diese Krankheitseinöde verläßt.
»Good, ehm?«
»Gnhm.«
»Baby, can you feel it?«
»I can feel Kiefernstarre«, sage ich nach einer Weile.
»Yeah.«
Wir fangen an zu lachen, es schüttelt uns, wir können gar nicht mehr aufhören, immer heftiger werden die Salven, wir krümmen uns, meine Bauchmuskeln tun weh und die Narbe schmerzt, und trotzdem reißen wir immer wieder unsere Münder auf, um Sonne zu trinken, bis bei mir Tränen laufen und mein Lachen in ein Weinen übergeht.
Als es vorbei ist, hängt Rotze aus meiner Nase und ist in meinem ganzen Gesicht verteilt. Er gibt mir ein Taschentuch. Das nicht ausreicht. Und noch eines.
»Why are you so sad, Baby?«
Warum ich traurig bin. Sehr witzig.
»I have cancer.« Idiot.
»Yeah, I can see that.« True.
»I might die«, versuche ich. Aber er lacht nur sein Donnergrollenlachen.
»You will die for sure, Baby. We all will… My name ist Cesar, and I am happy to have met you before you died.«
Eine Stunde später schiebe ich meinen neuen Freund zu Musik aus seinem Smartphone, Love’s Theme von Barry White, zurück zum Haupteingang. Inzwischen weiß ich, dass er Sohn einer Kolumbianerin und eines Amerikaners ist und in Kuba geboren wurde, weshalb ich ihn Comandante nenne. Ich weiß auch, dass er in New York und in San Francisco gelebt hat. Dass er zweimal verheiratet war, und dass seine zweite Frau vor vier Jahren gestorben ist. Der Comandante ist 72 Jahre alt und wird seit zwei Wochen hier im Krankenhaus behandelt, dies ist sein erster Krankenhausaufenthalt überhaupt. Sein Bett ist auf Station 12, Zimmer 5. Wir haben Handynummern ausgetauscht. Jetzt wollen wir Eis essen.
Ich kutschiere ihn zu seinem Fenstertisch, der gerade frei wird, sage, ich käme gleich wieder und zeige in Richtung der Toiletten. Auf dem Klo knie ich mich vor die Schüssel, schraube den Verschluss vom Beutel auf und lasse den Inhalt ablaufen, ist nicht viel drin, aber ich will sichergehen.
Als ich wieder am Tisch ankomme, stehen da zwei Banana-Split-Eisvariationen bereit und Cesar hat schon den Löffel in der Hand.
»My favourite!«, sagt er und fällt über das Eis her.
DONNERSTAG
Habe den ganzen Vormittag geschlafen, war von gestern sehr erschöpft. Eigentlich soll ich noch gar nicht so viel sitzen, geschweige denn Rollstühle herumschieben.
»Sie haben das Mittagessen ja gar nicht angerührt«, siezt mich meine Lieblingsschwester. »Das ist jetzt der dritte Tag ohne Mittagessen und Abendbrot. Von Tee und einem Apfel am Tag werden Sie nicht wieder fit.«
»Ich weiß«, sage ich, »an apple a day keeps Kehlmann away.« Sie lacht.
»Aber wenn das so weitergeht, muss ich es melden.« Sie zwinkert mir zu. »Was ist denn los?«
»Habe keinen Appetit«, sage ich. Sie setzt sich auf meine Bettkante.
»Was gab es denn heute?«, fragt sie.
»Weiß nicht, hab nicht reingeschaut.«
Meine Lieblingsschwester ist meine Lieblingsschwester, weil sie daraufhin den Plastikdeckel vom Teller anhebt, die Mundwinkel nach unten zieht und meint: »Nix verpasst, würd ich sagen.« Dann räumt sie das Tablett weg und kommt mit einem Schokoriegel wieder.
»Du brauchst Kraft. Iss das hier wenigstens.«
Ich nicke und packe den Riegel aus, sie winkt mir zu und schließt leise die Tür. Ich beiße ab, obwohl mir Essen seit kurzem zuwider ist. Davon beult sich der Beutel so aus, man sieht alles, kann genau erraten, was es war, eine bunte Pampe, manchmal auch noch mit Luft vermischt. Dafür furze ich jetzt nicht mehr.
Ich kann verstehen, wenn Tom mich nicht mehr will. Stelle mir vor, dass er heimlich ausgezogen ist, dass er mit Sack und Pack aus der Wohnung raus ist, weil er es nicht mehr aushält mit mir. Weil ich jetzt hässlich, krank und bedürftig geworden bin. Ich stelle mir vor, wie er seinem besten Freund sagt, dass das nicht mehr geht mit uns. Runterschlucken. So. Schokoriegel ist im Bauch, bald im Beutel.
Dingding. Nachricht vom Comandante.
Ready for Nachtisch? Cesar
Si, Comandante. I need a coffee. Meet you in 10 minutes @ café-bistro?
Yeah, Baby.
Als ich zehn Minuten später pünktlich im Krankenhaus-Café stehe, sitzt Cesar schon an seinem Fensterplatz. Wie macht er das nur. Alle anderen Tische sind belegt. Wie stellt er es an, dass er immer am selben Platz landet.
»Hello, my sweetheart«, sagt er und hebt zur Begrüßung seine Kapitänsmütze.
»Captain, my Captain«, sage ich und setze mich ihm gegenüber.
Der Bistro-Chef bringt ein Banana-Split-Eis und stellt es vor Cesar ab, der sich die Hände reibt. Das gibt’s doch nicht. Der haut jeden Tag so nen Becher weg, oder wie.
»Por favor, Señor Cesar.«
»Gracias.«
»De nada. Und für die Dame?«
»Ich nehme einen Espresso.«
»Kommt sofort.«
»How are you today, sweetheart?«
»Okayisch. And you?«
»I am happy«, sagt der Comandante und lächelt in seinen Bart.
Dingding. Nachricht von Tom.
»Fucking hell, I love this shit«, Cesar löffelt Sahne in sich rein.
Ich komme am Samstag. Wie geht es dir? Tom
Wie es mir geht, passt nicht in eine Kurznachricht.
Cesar guckt mich an.
»Bad news?«
»No. Good news.«
»Why are you sad then?«
»Soo. Der Espresso für die Dame.«
»Danke.«
»Gracias.«
»Bittesehr.«
»I am not sad, I am mad with my boyfriend.«
»Why?«
»He did not show up for a while. «
Und dann will der Comandante alles wissen, wie mein Freund heißt, was er macht, seit wann wir ein Paar sind, wie lange wir schon zusammenwohnen. Ich erzähle, dass er sich fünf Tage nicht hat blicken lassen, und dass ich eine Scheißangst habe, dass er mich verlässt wegen dem Krebs und dem Beutel, und dass ich jetzt hässlich bin und denke, er suche sich genau in diesem Augenblick eine andere, gesunde, beutellose, schöne und bessere Freundin. Und der Comandante sagt, dass das sicher auch für Tom alles nicht einfach sei, und fragt, ob ich Fotos von uns habe. Klar hab ich welche, in meinem Telefon stapeln sie sich. Tausendfach. Ich zeige ihm welche aus dem Urlaub im letzten Jahr. Da waren wir auf Kreta. Tom in einer Taverne mit Ouzoglas vor sich. Tom beim Lesen. Eine Verpackung von griechischem Zucker. Meine Füße im Meer. Tom und ich auf einer Fähre, meine Haare wehen, wir sind glücklich. Ich im Bikini auf einem Felsen. Eine Blüte. Ich mit einem Eis am Stil. Tom neben einem Esel.
»He’s coming on saturday«, sage ich.
»Tell him, you are happy to see him soon. Just do it.«
Aye, aye, Captain. Ich tippe artig freue mich darauf, dich zu sehen ein und klicke Senden.
»Man! You are a very pretty woman.«
»Not anymore.«
»Your hair will grow back.«
»Don’t know. I’m going to get more chemical treatment.«
»You will be alright.«
Aber ich weiß nicht, ob ich alright sein werde.
»Look at me«, sage ich, und ziehe mein Kopftuch ab, und es ist mir jetzt scheißegal, dass wir in einem Restaurant sind und Cesar gerade einen Eisbecher vor sich hat, ich hebe auch noch meinen Pullover an und zeige den Beutel. Und dann will ich von Cesar wissen, ob er sich vorstellen kann, mit einer Frau Liebe zu machen, die keine Haare am Leib und so einen Beutel am Bauch hat.
Er schweigt. Ich trinke meinen Espresso aus.
»You see«, sage ich.
»Wait«, sagt er und winkt dem Chef. »Zahlen, bitte.« Als er das erledigt hat, parkt er aus.
»Vamos! Pronto, pronto!« Cesar rollt durch die Eingangshalle am Informationsstand vorbei, rollt weiter, am Briefkasten und an den Automaten vorbei, er passiert den Kiosk, biegt dahinter links ab, direkt zum Friseurladen mit den Perücken. Schwupps ist er im Laden drin.
»No! Cesar, no!«
»Just try one.«
»Cesar, Scheiße, ich will keine Perücke, das kratzt, it’s itchy, und look, they are all very, very ugly. Das sind Omaperücken. You understand. Grandmastyle.«
»Guten Tag, kann ich Ihnen behilflich sein?«, fragt die Verkäuferin.
»Wir suchen eine Haare«, sagt Cesar »but schöne Haare, not Omafrisur for this Lady.«
Die Verkäuferin hebt eine Augenbraue, dann sieht sie mich an und fragt: »Welche Länge darfs denn sein?«
»Halblang«, sage ich, und der Comandante lächelt.
Wir haben uns für einen dunkelbraunen Bob mit Pony entschieden. Das sieht zwar nach Perücke aus, ist es ja aber auch. Der Comandante meint, ich sähe aus wie Uma Thurman in Pulp Fiction. Wir sitzen draußen im Schatten einer Pappel auf einer Bank unten am See, ich mit neuen Haaren, und suchen etwas Schickes zum Anziehen für mein Date mit Tom am Samstag. Wir schauen beide in unsere Telefone und klicken uns durch Kleider und Schuhe. Cesar schlägt mir aus Spaß eine Art pinkfarbene Leberwurst vor.
»That’ll do.« Wir kichern.