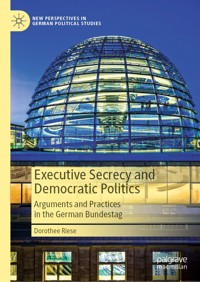33,23 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über eine außergewöhnliche Jugend am Fuße der Karpaten
Die Geschichte einer Kindheit als soziales Experiment: Anfang der 1990er Jahre wandert die fast sechsjährige Judith mit ihren Eltern von Deutschland nach Rumänien aus. Ihr Ziel ist ein abgelegenes Dorf in Transsilvanien am Rande der Karpaten. Judith soll in einer ursprünglichen, vom Kapitalismus freien Gemeinschaft aufwachsen. Mit wachem Blick erkundet sie den Ort, seine Menschen, Geschichte und Sprache. Bald wird sie zur Wahlenkelin der alten Siebenbürger Sächsin Lizitanti. Und sie lernt Irina kennen, die mit ihrer Ziege im Milchauto mitfährt. Irina ist eine Romni. Judith möchte das auch sein, Irina aber lehnt das kategorisch ab. Bald stellt der Widerspruch zwischen mitgebrachter Utopie und vorgefundener Realität die Familie vor immer größere Probleme.
»Ist Fremdsein eine unüberwindbare Grenze – auch wenn man den Alltag miteinander teilt? Mit Dorothee Riese betritt eine Autorin die literarische Bühne, der es gelingt, mit den Mitteln der Sprache das, was hinter der Sprache liegt, spürbar zu machen.« Jenny Erpenbeck
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autor:innen und Bücher:
www.berlinverlag.de
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2024
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Anthony Thomas / Getty Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitate
Teil 1
Am Transformator begann das Dorf
1.
2.
3.
4.
5.
Teil 2
Judith kannte die Flüsse des Landes
1.
2.
3.
4.
5.
Literaturverweis
Dank
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
»Was siehst du,
Wenn du mich anschaust?«
Charles Smith: Identität
»Weißt du noch, wir liefen zusammen
durchs Dorf und sagten
allen Gänsen und Hühnern
Guten Tag.«
Ioana
»Die Mutter aber rannte
über Felder und Berge
und suchte nach ihrem Sohn,
dem Schäfer,
sie weinte aus den Augen
und fragte alle, die sie traf:
›Wer hat ihn gesehen,
meinen Schmalschultrigen,
meinen Rabenhaarigen,
meinen Ährenbärtigen,
meinen Milchschaumhäutigen,
meinen Brombeeräugigen.‹«
nach der Volksballade Miorița
Teil 1
Am Transformator begann das Dorf
Der große Strommast hieß im Dorf Transformator. Am Transformator endeten zwei Landstraßen. Die Straße von Ședref, wo der Bürgermeister und der Waldinspektor ihre Geschäfte machten, denn das war allgemein bekannt, dass sie es waren, die die Eichen fällten, und die Straße vom Marktflecken Rota, wohin die Dörfler freitags fuhren, um Ferkel und Lackschuhe zu kaufen. Am Transformator begann das Dorf.
Judith stand zu Hause im Hof und schnitt Blumen. Über dem Hof lag schwarz der Wald. Silva hieß der Wald auf Latein, und das war die Sprache der Römer. Der Wald war sehr groß, und daher lag das Dorf im Land hinter den Wäldern, in Transsilvania. In den Adern der Bewohner von hinter dem Wald floss Trajans Blut, Römerblut. Hier floss davon mehr als sonst wo, weil hier das Herz war. Darum hatte das Dorf im Kommunismus einen neuen Namen bekommen: Sarmizegetusa. Die Deutschen von hier nannten sich Sachsen und sagten zum Dorf Waldlichten. Valihta, das war nicht melodiös, das war ein hässliches Sprachgemisch. So etwas musste man abschaffen, deshalb war es richtig, dass das Dorf nicht mehr Valihta hieß, dass am Eingangsschild Sarmizegetusa und Waldlichten stand.
Sarmizegetusa, so hieß die Hauptstadt des glücklichen Landes Dacia felix. Dort trafen sich Römer und Daker im Jahr 106 zum Kampf. Deshalb sprachen hier alle Rumänisch, eine Sprache, die fließt. Sie fließt wie ein Bergbach, flink und geschmeidig, sie fließt wie ein reißender Strom, gewaltig und stark. Solch ein Satz, dafür hatte die Lehrerin Judith über die Zöpfe gestrichen und gesagt: »Unsere kleine Rumänerin.«
Judith schnitt die Trikolore. Blaue, gelbe, rote Blumen. Aus dem Daumen lief Blut. Sie leckte daran. Das Blut floss wie ein Bergbach, floss in Strömen. Judith drehte sich um den Daumen, sang die Hymne: »Auferstanden, du Rumäne«, und fiel um.
Über Judith stand ihre Mutter und sagte: »Blutet ja schon gar nicht mehr, ich hol ein Pflaster.«
Judith schrie: »Du bist ja Deutsche, du hast ja gar kein Römerblut.« Und sie rannte ins Dorf, bis zum Transformator und vom Transformator noch weiter. Irina war vor dem Diensthaus und spielte mit dem Kettenhund. Judith zerrte Irina an den Haaren zu sich. Sie sagte: »Jetzt machen wir Blutsfreundschaft wie Huck Finn.« Sie nahm das Messer, und Irina rannte vom Hof bis zum Transformator und rannte um den Transformator herum. Judith rannte hinterher und rief dabei: »Du feige Rumänerin. Ich hab ein echtes Schweizer Taschenmesser.«
Irina lag endlich unter ihr. So gehörte es sich für das Mädchen mit der Ziege. Judith schnitt ihr vorsichtig in den Finger und drückte ihren Daumen auf die Wunde. An dem Strommast stand etwas in roten Buchstaben. Judith las Irina die drei Wörter vor: »Pericol de moarte.«
Kurt hatte einmal gesagt, dass man verbrennt, wenn man den Transformator berührt.
1.
Auf der Ladefläche des Milchautos fuhr es sich gut. Judith schaukelte auf einer Milchkanne. In der anderen Ecke hockte ein Mädchen mit einer Ziege. Es hatte eine Ziege und Judith hatte keine. Sie rief dem Mädchen zu: »Ich hab auch eine Ziege, aber meine Ziege ist groß, und meine Ziege ist tot.«
Judiths Ziege war nämlich gestorben, weil das Zicklein nicht aus ihr hatte herauskommen wollen.
Das Mädchen hörte es nicht; es tat so, als ob es nichts hörte. Guckte aus den Haaren heraus, aber tat so, als ob es nicht guckte. Jetzt kämmte es der Ziege wieder mit den Fingern den Bart. Küsste die Ziegennase. Das Milchauto rumpelte über große Steine. Judith lachte, weil sie fast bis zu den Pappelzweigen hochhüpfte. Aber das Mädchen lachte nicht. Es hatte Angst vor der wilden Fahrt, legte sich auf die Ziege, als ob die ihm gehörte. Es hätte beim Hochhüpfen fast die Ziegennase abgebissen.
Das Mädchen hatte Haare, das waren nicht irgendwelche Haare, die waren so dicht, dass Judith sein Gesicht nicht sehen konnte. Judith hatte geflochtene Zöpfe, weil es im Sommer zu heiß war, um nicht Zöpfe zu tragen. Sie wollte das Mädchen loswerden, aber die Pappeln hörten nicht auf. Das Mädchen streckte die Zunge heraus. Judith schubste eine Milchkanne an, sie rollte über die Ladefläche und stieß an die anderen Kannen. Es war ein tolles Scheppern und Klirren. Sie hasste die Haarige dort auf immer und ewig, weil die sogar eine rosa Zunge hatte, die so spitz war, dass sie bestimmt bis zur Nase ging. Judith erreichte mit ihrer Zunge die Nasenspitze nicht und konnte auch nicht mit den Ohren wackeln. Die leeren Milchkannen rollten durcheinander. Judith rollte hinterher, sodass sie mit dem Kopf in den Bauch der Ziege stieß. Sie mochte den Geruch des Körpers der Ziege. Auch dem Mädchen war sie jetzt ganz nah, und das war so verdutzt, Judith plötzlich zwischen den Beinen der Ziege zu sehen, dass es sich gar nicht mehr bewegte.
Sie zischte dem Mädchen das gruselige Wort Sarmizegetusa ins Ohr. Das Mädchen roch auch nach Ziegenmilch. Es zeigte auf eine Burg mit Türmen, unter der Häuser herumstanden. Aber das war ein Trick. Judith sah nur kurz auf, aber schon griff das Mädchen nach ihren Zöpfen rechts und links. Es ließ die Finger über ihre Zöpfe gleiten. Das Mädchen sagte etwas und lächelte. Judith wollte ihm mit dem Kopf in den Bauch stoßen. Das Mädchen zuckte zusammen und versteckte sich hinter einer Milchkanne. Als ob Judith das nicht gesehen hätte. Jetzt würde sie dem Mädchen zeigen, wie gut sie fangen konnte. Sie krallte sich in den Haaren des Mädchens fest. Der Strick der Ziege war ans Handgelenk des Mädchens gebunden. Die Ziege sprang von der Ladefläche herunter und riss das Mädchen mit. Vielleicht war es tot. Schade, dass Judith nicht herunterkonnte, dann hätte sie ihm die Haare abgeschnitten.
Der Milchautofahrer hielt an einem großen Strommast. Nach diesem Mädchen und seiner Ziege fragte er nicht. Er rieb Zeigefinger und Daumen aneinander.
»Geld«, sagte ihre Mutter.
»Der hat uns doch mitgenommen«, sagte Kurt.
»Oder vielleicht Kuchen?«, sagte die Mutter.
Warum denn Kuchen?, dachte Judith.
»Selbst gebacken«, sagte die Mutter.
Der Fahrer schleuderte den Apfelkuchen durch die Luft und schrie, sodass alle Kühe stehen blieben und zu pinkeln anfingen.
Judith musste auch pinkeln, sie hockte sich an den Strommast, aber bei den Kühen brauste es lauter. Sie konnte keinen so großen See machen, der die Fliegen fortschwemmte. Da stupste sie ein Ziegenbart von hinten an. Das Mädchen mit der Ziege! Judith holte ein großes Taschentuch aus Kurts Hosentasche und hielt es dem Mädchen hin, weil es eine blutige Nase hatte. Das Mädchen wischte sich damit quer über das Gesicht. Die Mutter streckte die Hand aus und streichelte dem Mädchen über die Haare. Dann öffnete sie noch einmal die Dose und gab ihm das letzte Stück Apfelkuchen. Das war übertrieben. Judith hatte auch Hunger. Aber die mit der Ziege aß den Apfelkuchen auf, ohne nachzufragen, ob Judith auch etwas wollte. Sie hatte das Taschentuch abgegeben, das Mädchen aber gab nichts ab.
*
Die alte Frau saß auf der Bank vor dem Haus und strickte. Vor ihr pickten Hühner. So eine alte Frau hatte Judith noch nie gesehen. Die Eltern passten nicht auf, sie fingen gleich an zu reden. Die alte Frau aber stand auf, sodass sie riesig wurde. Die Hühner rannten auseinander. Der Hahn blieb stehen, flatterte mit den Flügeln, rannte einem der Hühner hinterher und hieb ihm mit dem Schnabel in den Hals. Unter dem Strohhut der alten Frau war es ganz schwarz. Sie schwang ihren Krückstock durch die Luft, dessen Spitze scharf war, und er sauste nieder. Judith wollte schon ihre Zöpfe nehmen und davonlaufen, als ein schreckliches Donnern voller R und T hervorbrach: »Und wer ist die Verrotzte dort?«
Das Mädchen mit der Ziege stand hinter ihnen. Die Ziege riss es fast um. Judith war einverstanden, das war Rotz, kein Blut.
»Das ist unser guter Engel«, sagte Kurt.
»Sie hat uns den Weg gezeigt«, sagte die Mutter.
»Du Teufel«, zischte die alte Frau. Sie legte die Stricknadeln aus den Händen, und das Wollknäuel rollte ihr auf die Pflastersteine. Judith drehte sich zu dem Mädchen um, das ein paar Schritte hinter ihnen stand. Sie hoffte, dass es sich hinter der Ziege verstecken würde, um sich in Sicherheit zu bringen. Das Mädchen aber machte die Augen an den Winterschuhen fest und sah dabei fast genauso grimmig drein wie die Alte. Die bückte sich, streckte die Hand aus und griff nach Judiths Kopf mit ihren Knochenfingern.
»Ich bin Lizitanti«, sagte sie.
Das weiße Wollknäuel rollte über die Steine, die moosig waren zwischen dem Gänsekot. Lizitanti hatte breite Beine, und sie trug, obwohl es Sommer war, eine wollweiße Strumpfhose. Ihre Schuhe waren klobig, die waren schon auf dem Mist gewesen. Lizitanti war sehr schwarz, sie trug einen schwarzen Rock, eine schwarze Schürze und unter dem Hut auch ein schwarzes Kopftuch. Aber die Ärmel ihrer Bluse waren weiß.
Lizitanti hatte hellblaue Augen, die sahen alles. Und sie sprach auch so eine Sprache. Das war Deutsch, aber es pikste, rollte und stach. Sie sah streng zu Judiths Füßen: »Warum hast du deine Schuhe nicht an?«
Kurt wollte erklären, dass Kinder keine Schuhe brauchten, aber die Mutter zwickte ihn in die Hand.
»Der Herr Vater hat auch nackte Füße«, sagte die alte Frau langsam, ihre Augen wanderten von den Füßen zu Kurts Kopf.
»Ich bin Kurt«, sagte er und begann davon zu reden, wie heilsam es sei, barfuß zu laufen. Die Mutter zwickte wieder, aber zu spät.
Die senkrechte Falte zwischen Lizitantis Augen wurde ein finsterer Graben. Sie erzählte von ihren Zehen, die im Winter in Russland fast abgefallen waren. »Wollen Sie das sehen?«, fragte sie. »Meine Niere ist krank. Ein ordentlicher Mensch soll nicht ohne Schuhe gehen.«
Die Mutter wollte sie beruhigen. Ihr Mann habe unbedingt neue Schuhe mitnehmen wollen und da sofort Blasen bekommen. Da habe die Kleine natürlich auch die Schuhe ausgezogen.
Lizitanti machte aus den Augen Schlitze, weil sie der Mutter nicht glaubte, und auch Judith glaubte ihr nicht. Das mit dem Mann kam schon hin, nur klein war hier niemand, außer dem Mädchen da vielleicht. Aber Judith verstand, dass Lizitanti richtig wütend werden könnte, wenn sie wüsste, dass Kurt immer barfuß lief.
Zu Hause in Bad Rosau waren die Kinder nicht mehr zum Spielen gekommen, weil er barfuß gegangen war und Judith schon allein durch den Ort hatte laufen dürfen. Bei der Brotzeit im Kindergarten hatten die Tischnachbarinnen laut geschmatzt, ihre Zähne gezeigt und geflüstert, wenn Judith ihre Apfelsinenstücke aß: »Blut.« In der Arche, dem Mitgliederbioladen, bei dem ihre Mutter gearbeitet hatte, gab es diese Apfelsinen mit rotem Fleisch, die sehr saftig waren. Kurt hatte ihr erklärt, dass es nicht die Kinder seien, die Judith nicht mochten. Die Eltern seien es, meinte er, die etwas dagegen hätten, wenn jemand, statt mit dem Auto zu fahren, barfuß ging. Aber Judith könne stolz auf ihren Vater sein, weil er für die Freiheit barfuß gehe. Judith war wirklich stolz, auch wenn sie sich fragte, was Freiheit mit nackten Füßen zu tun hatte. Die Tiere im Zoo hatten ja auch nichts an und waren trotzdem unfrei. Auf jeden Fall wollte sie es den Kindern und ihren Eltern zeigen. Sie schmatzte jetzt so laut, dass selbst die Kinder am Nachbartisch kicherten, und ließ sich den roten Saft der Blutorangen das Kinn hinunterlaufen. Nur die Puppe musste zu Hause bleiben, weil die es nicht vertrug, wenn die Kinder sie auslachten, nur weil sie keinen glatten Plastikbabykopf hatte, sondern richtige Haare zum Kämmen. Ihre Mutter hatte aber gesagt, dass Kurt sich ruhig mal Schuhe anziehen könnte, das sei doch nicht so schlimm. Sie wolle nicht, dass Judith immer das Außenseiterkind sein müsse.
Auch Lizitanti war nicht dafür, dass Kurt barfuß lief. Und Lizitanti hatte den Schlüssel für die Nummer 26. Sar-mi-ze-ge-tu-sa, Nummer 26. Judith hatte sich alles Wichtige gemerkt.
Sie hatte einen Einfall: »Die hat unsere Schuhe geklaut.« Sie zeigte auf das Mädchen mit der Ziege, das immer noch hinter ihnen auf seine Schuhe schaute. Zum Glück verstand es ja ihre Sprache nicht.
Das gefiel Lizitanti. Sie kam mit ihrem Gesicht herunter. Es war so nah, dass Judith sich im Schatten der breiten Krempe des Strohhuts verstecken konnte. Lizitanti krümmte zwei Finger und streichelte Judith damit über die Wange, die Finger waren kühl, was bei der Hitze angenehm war.
»Aber –«, sagte die Mutter und kam nicht weiter, denn Lizitanti warf ihr Aber mit einer schroffen Handbewegung weg, klopfte mit dem Stock auf den Boden und flüsterte scharf: »Fuga!«
Das Mädchen schaute durch die Haare, rührte sich aber immer noch nicht. Da wurde Lizitanti fuchsteufelswild. Dreimal hieb sie den Stock auf den Boden, und dann rollte ein ganzes Gewitter über Judiths Kopf hinweg, sodass sie sich die Ohren zuhalten wollte, aber sich nicht traute, weil das bei so einer donnernden Frau gefährlich war.
Jetzt rannte das Mädchen los und zog an der Ziege, die noch einen Moment stehen blieb und dieser Lizitanti ins Gesicht starrte.
Judith wollte dem Mädchen hinterher, aber ihr Hosenträger hing fest am Krückstock der Alten. Sie sagte, wieder sanft: »Was ein braves Mädchen.«
Lizitanti nahm ihr Wollknäuel und hieb den Stock auf das Kopfsteinpflaster. Ein letztes Mal sah sie auf Kurts Füße, der den Schlüssel für die Nummer 26 nehmen wollte, und sagte: »Den bekommt die Frau.«
*
Judith ging mit ihren Eltern zur Nummer 26. Auf der Straße liefen Menschen mit Eimern. Kurt lächelte die Frauen an, die auf den Köpfen geblümte Tücher mit Knoten unterm Kinn trugen. Manchmal war der Knoten auch hinten. Kurt konnte mit Frauen besonders gut sprechen. Er ging an die Eimer heran und sah hinein.
»Milch«, sagte er.
Die Frauen sahen flüchtig zu seinem zerzausten Bart und zu Judith, die neugierig war, der die Zöpfe in den Milcheimer hingen. Sie sagten »Sara« mit scharfem S und gingen schnell weiter. Kurt sah jetzt auch auf die Milcheimer, weil es Abend war und er hungrig wurde.
Die Häuser am Rand der Straße waren rostrot, sandgelb, himmelblau, bleistiftgrau und hatten lackgrüne Fensterläden, die geschlossen waren. Zur Straße hin bildeten die Häuser mit ihren Hoftoren eine Mauer, wie bei einer Burg. Davor standen zu spät heimgekommene Kühe und muhten, damit ihnen jemand den Weg wies oder weil sie vielleicht noch nicht in den Stall wollten. Die Nummer 26 war rosa mit grauen Flecken vom abblätternden Putz.
»Unser Zuhause«, sagte die Mutter.
Während die Eltern versuchten, das Schloss vom großen Hoftor zu öffnen, kam ein Junge daher, der ein rotes Eimerchen trug. Er sah aufmerksam auf den Boden und hielt den Eimer weit ab von seinen Beinen, damit die Milch nicht überschwappte. Der Junge trug eine Pudelmütze, obwohl es immer noch warm war.
Judith sagte: »Sara«, mit sehr scharfem S, und: »Können wir deine Milch kaufen?« Sie sagte es höflich und zupfte an ihren Zöpfen.
Der Junge sah zu Judith, die jetzt direkt vor ihm stand, und antwortete nicht. Er sah sie so neugierig an, dass er nicht bemerkte, wie sie den Finger in die warme Milch tauchte. Die Milch war schaumig und so weiß, dass sie leuchtete. Sie schmeckte süß und ergoss sich mit einem Schwall in den Staub. Der Eimer rollte die Straße hinab. Der Junge bekam dicke Augen vor Schreck und rannte weg.
Judith hob den Eimer auf. Im Naturschwimmbad hatte es einen gelben Eimer gegeben. Damit hatte sie immer Wasser für ihre Ziege geholt. Die hatte die Aufgabe gehabt, das Gras rund ums Schwimmbecken kurz zu halten, aber jetzt lag die Ziege in ihrem Grab unter dem Kirschbaum, der noch wachsen musste. Judith hatte ihn selbst mit einem Kirschkern gepflanzt. Die Ziege hatte die Badegäste gestört, weil es im Schwimmbad nach ihr roch. Als die Ziege starb, schrieb die Zeitung vom Ende der Ziege. Kurt las es Judith vor. Da stand, dass man den Rosauern keine Ziege in einem Schwimmbad hätte zumuten dürfen, da Bad Rosau ein Luftkurort sei. Judith wollte nicht mehr in den Kindergarten gehen, wo die Erzieherin sagte, wie leid es ihr tue, dass die Ziege nicht mehr lebte. Ihre Mutter schimpfte mit Kurt, weil er Judith aus der Zeitung vorgelesen hatte und das nichts für die Ohren von Kindern sei, aber Judith fand es vollkommen richtig, sie musste alles wissen, was die Leute über ihre Ziege sagten. Da stand auch: Jetzt müssen nur noch die Bauwagen weg. Das sollte heißen, die Bauwagen neben dem Schwimmteich. Einer war von Judith, in dem lebten auch ihre Eltern, und einer war der Stallwagen, da wohnte die Ziege, wenn es im Winter zu kalt wurde. Jetzt waren sogar die Freunde von der Umweltpartei gekommen: um mit den Eltern über die Bauwagen zu sprechen, wie sie sagten.
Judith fiel eine Birne auf den Kopf. Eine schrumpelige, viel zu kleine Birne. Eine Kuh kratzte sich die Flanke am Birnbaum. Sie ging einfach so auf den Hof durch die kleine Tür im hohen Tor.
Judith lief hinter dem Kuhschwanz her und rief: »Die kommt hier einfach rein!«
»Die wohnt vielleicht hier, eine Kuh ist ein freies Tier!«, rief Kurt aus dem Haus.
»Gibt die uns jetzt ihre Milch?« Judith wollte gern den roten Eimer benutzen.
»Das ist ein Stier«, sagte Kurt leise.
»Macht nichts«, sagte Judith.
Irgendwann wurde es dunkel. Aus dem Tier gähnte es brüllend. Vom Nachbarhof bellte ein Hund zurück. Im Dorf wurde es laut. Es waren wohl richtig große Hunde, die nicht bellten, sondern heulten, die heulen mussten, weil die Nacht hier finster war.
Judith sah sich im Hof um, der von allen Seiten von Mauern umgeben war. An der Rückseite hatte das Haus ein Vordach, unter dem ein langer Tisch stand. »Eine Tafel für viele«, hatte Kurt dazu gesagt, und Judith hatte die Vorfreude in seiner Stimme gehört. Eine Treppe führte ins Haus, hinter der Treppe stand ein Lehmherd ohne Ofenrohr. Judith öffnete die Ofentür, Asche fiel ihr entgegen.
Die Eltern entschieden, nicht draußen zu schlafen. Im Haus sah man nichts mehr, weil der Strom nicht funktionierte. Deswegen legten sie ihre Isomatten unters Fenster. Judith auch, denn das einzige Bett, das im Zimmer stand, roch nach Mäusepisse.
Im Hof graste der Stier unter einem dürren Pflaumen- oder Mirabellenbaum. Judith musste an ihre tote Ziege denken. Weil sie sehr geweint hatte, hatten sie die Ziege selbst begraben, als es dunkel war. Gut, dass niemand in Bad Rosau wusste, dass die Ziege dort mit dem gelben Eimer unter der Erde lag und nur noch ein Gerippe war. Denn in Bad Rosau war es verboten, Ziegen und gelbe Eimer beim Naturschwimmbad zu begraben.
»Hier hast du jetzt einen Stier«, versuchte Kurt sie zu trösten.
»Der gehört jemand anders«, sagte ihre Mutter streng.
»Der Stier ist ein freies Tier«, sagte Kurt noch einmal. »Er wohnt hier, und wir sind seine Gäste.« Aber dass ausgerechnet ein Stier so frei war, war ihm doch nicht so recht, das wusste Judith.
Vom Hoftor her quietschte etwas. Judith ging nachsehen, was los war. Ein Mann mit Schnurrbart und Peitsche mit langen Troddeln schritt um das Haus. Judith musste näher treten, um ihn anzuschauen. Vielleicht war er ein Räuberhauptmann. Er beugte sich zu ihr, und weit unter dem Schnurrbart öffnete sich ein Mund und lachte so, dass Judith anfing, den Schnurrbart zu mögen. Der Räuberhauptmann drückte ihr seine Peitsche in die Hand, und sie trieben den Stier aus dem Hof. Hinter ihnen lief hurtig eine kleine Frau, die vom Kopftuch einen großen Knoten unterm Kinn sitzen hatte und das eine Bein beim Gehen hinterherzog. Vielleicht war sie die Räubersfrau. Vielleicht waren ihr die Zehen in Gefangenschaft abgefallen, wie bei Lizitanti. Die kleine Frau tauschte den roten Plastikeimer auf dem großen Tisch unter dem Vordach gegen eine Kanne aus Blech mit Henkel. Die Eltern, die nun auch rausgekommen waren, riefen: »Sara!«
In der Kanne stand schaumige Milch.
Judith lag zwischen den hohen Rücken der Eltern. Beide schliefen sie schon, aber sie schlief nicht, obwohl die beiden ihr sogar zusammen das Abendlied gesungen hatten. Es musste den Eltern gefallen auf diesem Holzfußboden, sie gingen sonst nie alle gleichzeitig ins Bett. Nur bei Gewitter, da durfte Judith länger aufbleiben und ihren Kopf auf den Schoß der Mutter legen. Wenn die Eltern hier so friedlich waren, war sie damit einverstanden, hier zu bleiben. Sie überlegte, ob sie Kurt in den Rücken zwicken sollte, damit er ihr noch etwas erzählte. Meistens sagte er, dass er dafür zu müde sei, und klappte die Augen zu, aber vielleicht würde er wenigstens heute von dem Mädchen mit den großen Stiefeln erzählen, das mit seinem Regenschirm durchs Gewitter flog. Doch war da körperwarmer Milchschaum, der sich über Judiths Augen ergoss, sie versuchte, den umgestürzten Eimer zu finden, aber der Eimer schwamm einfach davon.
*
Judith und ihren Eltern gefiel das Teilen. In Bad Rosau hatte jeder alles für sich haben wollen. Hier in Rumänien teilten alle. Sie saß auf einem Hocker am Kopfende des Tischs unterm Vordach. Auf den langen Bänken saßen rechts ihre Mutter und links Kurt. Wenn der Tisch eine Wippe wäre, würde er jetzt kippen.
»Unser Tisch für viele«, sagte Kurt immer wieder.
Judith stützte das Kinn auf der Platte ab und spähte über die meterlange Rennbahn für Weinbergschnecken. Sie aßen zu Abend. Sie sangen: »Brot, Brot, danke für das Brot, lasst uns bei dem Essen andere nicht vergessen.« Judith dachte, dass sie die Schnecken im Einmachglas nicht vergessen durfte. Die hatte sie seit gestern nicht gefüttert.
Hinter ihrer Mutter hing das grässliche Tuch. Es hieß Hungertuch, weil die Menschen, die darauf abgebildet waren, Durst und Hunger litten. Wenn Judith die Gefesselten anschaute, die mit Stricken an Balken gebunden waren und dabei mit Ruten geschlagen wurden, musste sie die Augen schließen. Kurt hatte gesagt, dass man das Folter nenne, wenn Gefesselte geschlagen würden, aber sie würden bald freigelassen werden, weil Jesus sie zu sich rufe. Im Gesicht und am Oberkörper hatte Jesus tiefe Falten, und um sich herum hatte er Leute versammelt, die Kurt Mühselige und Beladene nannte. Judith wusste aber, dass sie eigentlich aus Amerika waren. Die Menschen hatten schon keinen Hunger mehr. Weil jetzt Maiskolben an dürren Pflanzen wuchsen.
In Rumänien gab es auch Mais. Aber die Menschen hätten trotzdem Hunger, hatte ihre Mutter gesagt. Viele Menschen ritten ohne Sattel auf Pferden und Eseln mit roten Troddeln. Vielleicht wohnten sie sogar in Tipis. Zum Brot gab es Butter, die schwitzte, bröckelte und ranzig schmeckte. Die Rumänen konnten keine anständige Butter machen. Zur Butter gab es frisches Brot und Schnittlauch aus dem Garten.
Jemand schlug ans Tor. Die Mutter ging hin und öffnete. Sie kam zurück und holte das Brot. Judith sah um die Ecke, da war eine Frau am Tor, sie hatte einen dicken Zopf, der hing aus dem Kopftuch heraus. Im Gesicht der Frau war kein Lächeln. Die Zähne leuchteten so weiß, dass Judith kaum sah, wie schief die Frau stand, damit das Baby auf ihrer Hüfte sitzen konnte. Und an der Hosentasche der Frau hielt sich ein Mädchen fest, es war das mit der Ziege. Die Frau schob das Brot unter den Pullover. Judith folgte den beiden ein paar Schritte, aber da streckte das Mädchen ihr diese lange rosa Zunge raus. Die war so spitz, die konnte sicher zustechen, und die Frau machte ein Geräusch, »KSCH«, als ob sie eine Katze verscheuchen wollte. Judith wagte keinen Schritt mehr vorwärts.
Die Eltern saßen am Tisch. Sie hatten die Zunge nicht gesehen und nicht das »KSCH« gehört. Judith sagte nichts, aber Kurt machte Falten wie Jesus. Er ärgerte sich darüber, dass die Mutter das letzte Brot hergegeben hatte, weil heute Freitag war und es im Dorfladen nur dienstags Brot gab. Nach Rota, wo der Bahnhof und der Markt waren, mussten sie trampen oder den Bus nehmen, der auch nur einmal pro Woche fuhr.
Ihre Mutter aber sagte zu ihm: »Wir sind hier für die Stille, nicht für das Brot.«
*
Die Eltern legten im Hof einen Steinkreis an, Judith schnitzte Muster in einen Stock. Der sollte in die Mitte des Kreises, ein Zeiger für die Sonnenuhr.
»Zwölf Uhr, haargenau«, sagte Kurt, als er den Stock befestigte, der seinen Schatten fast auf den größten Stein der Sonnenuhr warf. Da fingen von der Kirchenburg her die Glocken an zu läuten, und die Eltern stellten sich im Steinkreis auf und sangen ein Lied für den Frieden. Es ging darum, dass der Friede für die ganze Welt da sein sollte, und dazu breiteten die Eltern ihre Arme aus. Das machten sie, damit auch Judith mitsingen konnte. Sie aber musste rücklings auf allen vieren über diese Steine balancieren, die heute eine Straße waren. Als sie versuchte, die Hände zu lösen und wieder aufzusetzen, fiel sie auf die spitzen Kanten und hätte vor Schmerz laut aufgeschrien, doch genau in diesem Moment quietschte das Hoftor, und es war Lizitanti. Sie trug den schweren Schlüsselbund von der Kirchenburg in der Hand.
»Ich müsste nicht so viel beten, wenn sie nicht alle gefahren wären. Aber sie sind gefahren«, sagte sie, als sie dann auf dem dreibeinigen Hocker am langen Tisch saß. Judith füllte ihr Brunnenwasser in eine geblümte Tasse. Lizitanti klagte, und sie schlug dabei mit dem Schlüsselbund auf den Tisch. Sie rollte wieder das R, und es war ein Donnern, dass Judith ganz still saß und horchte, und sie verstand, dass Lizitanti hoffte, wenigstens sie, die Eltern und Judith, würden in Sarmizegetusa bleiben.
Judith sagte: »Wir fahren nie.« Sie merkte, wie sie für Lizitanti das I in die Länge zog und sogar versuchte, mit dem R zu donnern. Davon wurden Lizitantis Augen sanft und hell.
Die alte Frau hielt drei Finger in die Luft und meinte damit ihre Töchter. Sie erklärte, dass die drei ihre Adoptivtöchter gewesen seien, sie habe die mutterlosen Mädchen des Dorfes eingesammelt, weil sie nach der Verschleppung in den russischen Wald zu alt gewesen sei. Doch, einmal sei sie noch schwanger geworden und habe das Kind auch ausgetragen, aber der Arzt war ins Wirtshaus gegangen, die Hebammen versuchten es mit Zangen, aber die hatten nicht geholfen. »Das Kind haben sie blau aus mir herausgeschnitten«, sagte sie.
Die Mutter bekam rote Augen, als Lizitanti das sagte, und da kroch Judith unter den Tisch. Sie setzte sich auf Lizitantis Füße. Und als die Alte wieder sagte: »Sie sind gefahren«, und dabei wahrscheinlich ihre Finger hob, da war ihre Stimme schon ein bisschen weicher. Mit den drei Fingern meinte sie die Adoptivtöchter, sie meinte vielleicht aber auch die Nachbarn, die Frauen und Kinder, die weggezogen waren. Und sie erzählte vom Dorf, wie es gewesen war, als die Männer vor den Höfen ihre Hüte lupften, wenn sie vorbeiging, und die jungen Leute sich zum Maientanz an der Linde im Kirchhof trafen, sie erzählte von den Brüdern, denn früher hießen die Nachbarn Brüder und die Nachbarinnen Schwestern und halfen sich gegenseitig dabei, Feuer zu löschen und Gräber für die Toten auszuheben.
»An meinem Rock ging immer das kleine Mädchen«, sagte Lizitanti. Die ersten beiden Adoptivtöchter waren nach der Revolution sofort nach Deutschland abgereist. Die Revolution, das hatte Kurt Judith erklärt, war kurz nach Judiths Geburt passiert, da hätten welche den Mann, der die 26, die Kirchenburg, aber auch Lizitantis Haus, ja ganz Sarmizegetusa abreißen und die Dörfler in Hochhäuser umziehen lassen wollte, umgebracht. Judith hätte viel lieber gewusst, wo dieses kleine Mädchen von Lizitantis Rock war, aber die Eltern fragten nicht nach, das musste die jüngste Tochter sein, von der Lizitanti gar nicht erzählte.
»Ich bin die Letzte, die sich noch um die Blumen kümmert und die Glocken läutet, jeden Mittag, jeden Abend. Die Leute aus Șlam, sie ziehen durchs Dorf und setzen sich in unsere Häuser, das ist wie nach dem Krieg.«
Da öffnete Lizitanti den doppelten Knoten ihres Kopftuchs und lupfte es, so wie früher die Brüder ihre Hüte. Für einen Augenblick sah Judith weiße Flechtzöpfe, weich und dünn um den Kopf gebunden. Sie hätte fast ihre Hand ausgestreckt, um deren Windungen zu zählen, zog dann aber doch rechtzeitig den Finger zurück.
Lizitanti sagte: »Komm mit, Kind, ich zeige dir meine Hühner.«
Aber Judith hielt sich fest an der Hand von Kurt.
*
Es kam ein Mann mit einer Sense auf dem Rücken, der hatte einen runden Kopf. Er hieß Nea Gheorghe und sagte, dass er der Nachbar sei. Judith fand, dass Rundkopf besser zu ihm passte, aber das behielt sie für sich.
Die Sense hatte in der Mitte einen Holzgriff, an dem ein Bündel hing. Er zeigte Judith, was da drin war: ein Taschentuch, ein Stein, etwas Brot, eine Mundharmonika und ein Heftchen. In das Heftchen hatte der Rundkopf grüne Schlingpflanzen mit Glockenblüten gemalt, auf jede Seite. Der Stein war ein Schleifstein, damit schliff er die Sense und schnitt dann die Wiese bis zur letzten Spitze.