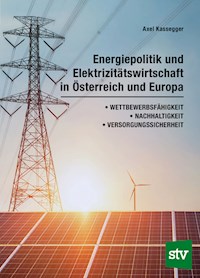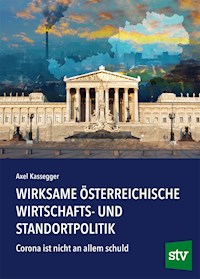
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stocker, L
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"Corona ist an allem schuld!" Das soll die Begründung sein für strauchelnde Volkswirtschaften und staatliche Hilflosigkeit. Doch die Ereignisse der letzten eineinhalb Jahre mit ständig abwechselnden Lockerungen und neuen Lockdowns haben gezeigt: Bei dieser allzu einfachen Erklärung handelt es sich um einen Trugschluss. Die Corona-Maßnahmen und ihre Auswirkungen haben vielmehr nur offenbart, was an strukturellen Schwächen und wirtschaftspolitischen Fehlentwicklungen bereits lange unter der Oberfläche schwelte und durch die planlose, nachhaltig schädliche Krisenpolitik nicht nur der österreichischen Bundesregierung nun an die Oberfläche gelangt. Der Autor, freiheitlicher Wirtschaftssprecher im Nationalrat, analysiert die zahlreichen Problemfelder der österreichischen Wirtschafts- und Standortpolitik und schlägt effektive Lösungen vor. Von Föderalismus bis EU-Versagen, von Globalisierung bis Sozialstaats- und Bankenreform: Beispiellose Zeiten erfordern ganz neues Denken – für Österreich und ganz Europa! Axel Kassegger macht den Anfang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Axel Kassegger
WIRKSAME ÖSTERREICHISCHEWIRTSCHAFTS- UNDSTANDORTPOLITIK
CORONA IST NICHT AN ALLEM SCHULD
Leopold Stocker VerlagGraz – Stuttgart
Umschlaggestaltung: Werbeagentur Rypka GmbH, 8143 Dobl/Graz, www.rypka.atUmschlagabb. Vorderseite: istockphotos.com/Orietta Gaspari, istockphotos.com/TomasSereda
Wir haben uns bemüht, bei den hier verwendeten Bildern die Rechteinhaber ausfindig zu machen. Falls es dessen ungeachtet Bildrechte geben sollte, die wir nicht recherchieren konnten, bitten wir um Nachricht an den Verlag. Berechtigte Ansprüche werden im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter https://www.dnb.de abrufbar.
Hinweis
Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
Leopold Stocker Verlag GmbH
Hofgasse 5 / Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.stocker-verlag.com
ISBN 978-3-7020-1918-1
eISBN 978-3-7020-2024-8
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten. © Copyright by Leopold Stocker Verlag, Graz 2021
Layout: Werbeagentur Rypka GmbH, 8143 Dobl/Graz, www.rypka.at
INHALT
EINLEITUNG
CORONA IST AN ALLEM SCHULD – EIN IRRGLAUBE
Corona als Ausrede für strukturelles Versagen
Die großen Herausforderungen vor Corona wie nach Corona
Herausforderungen auf drei Ebenen
Globale Herausforderungen
Herausforderungen auf europäischer Ebene – die EU
Hausgemachte österreichische Herausforderungen
Der Zustand Österreichs als Wirtschaftsstandort vor Corona
Zwei Jahrzehnte mangelhafte Standortpolitik bis 2019
16 besorgniserregende Problemfelder
DIE CORONA-KRISE 2020/21
Anamnese der Verbreitung und der Maßnahmen in Österreich
Politik der türkis-grünen Bundesregierung in der Krise
Grottenschlechtes Krisenmanagement
Die „12-Sünden-Tafel“ der türkis-grünen Bundesregierung
Falsche Beurteilung des Problems – Außerachtlassung der Verhältnismäßigkeit
Politik der Angst und der Schuldzuweisungen
Politik für die Eigenen und die Freunde
Entscheidungen auf Basis untauglicher Kennzahlen
Planlose Gießkannen-Politik und vollkommen chaotische Umsetzung
Beschädigung des Rechtsstaates – Ermächtigungsgesetze und gesetzeswidrige Verordnungen
Propaganda und Kauf der Medien
Verächtlichmachung anderer Meinungen
Angriff auf das Versammlungsrecht, Vereine und Privatleben
Angriff auf die Physis und Psyche der Menschen
Nachhaltige Schädigung unserer Kinder
Nachhaltige Schädigung der Wirtschaft
Die ökonomische Situation zu Ostern 2021
Österreich wirtschaftlich schwer angeschlagen
Andere Länder stehen deutlich besser da
Der große Gewinner China
Die gesellschaftliche Situation zu Ostern 2021
Eigenverantwortung oder Unmündigkeit
Die Freiheit der Gesellschaft schwer angeschlagen
SELBSTVERSTÄNDNIS WIRKSAMER WIRTSCHAFTS- UND STANDORTPOLITIK
Dimensionen und Fragen
Wirtschaftspolitik und Freiheit
Das ausgewogene Viereck wirksamer Wirtschaftspolitik
Staat und Wirtschaft
EIN STARKER, ABER SCHLANKER RECHTSSTAAT
Eigeninitiative statt Regulierung
Möglichkeiten statt Umverteilung
Keine Privatisierung wichtiger Standortinfrastruktur
Wirtschaftswachstum schafft Arbeitsplätze und Wohlstand
Grundsätze in der Umsetzung
Ökonomisches Prinzip
Komplexitätsreduktion
Einhaltung des Kongruenzprinzips
Wirtschaftspolitik in der Krise
DIE 16 HANDLUNGSFELDER ZUR NACHHALTIGEN GESUNDUNG
Mäßige Position bei internationaler Wettbewerbsfähigkeit
Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos
Die 16 Handlungsfelder und Ziele im Überblick
1. Leistungsgerechtigkeit – Leistung muss sich wieder lohnen
Arbeitslosengeld – Notstandshilfe – Mindestsicherung
Leistungsanreize für Mitarbeiter in Unternehmen schaffen
Leistungsanreize für alle durch Steuersenkungen
Verringerung struktureller Wettbewerbsnachteile für kleinstrukturierte Unternehmen
Steuerliches Familienentlastungsmodell
2. Starker, verlässlicher, schlanker und sparsamer Staat
Rolle des Staates und makroökonomische Ziele
Sofortige Öffnung und mittelfristige Nachhaltigkeitsziele
Ausgabenseitige Strukturreformen als Gebot der Stunde
3. Entlastung des Faktors Arbeit
Zu hohe Kosten des Faktors Arbeit
Möglichkeiten der Senkung von Lohnnebenkosten
4. Bildung, Wissenschaft, Innovation und Forschung stärken
Investitionen in Bildung sind Investitionen in Arbeitsplätze
Sanierung und Optimierung des österreichischen Bildungssystems
Notwendigkeiten für Wissenschaft und Forschung
Potential nach oben im Innovationsbereich
Wirksame Forschungs- und Innovationspolitik
Wirksame Technologie- und Digitalisierungspolitik
5. Rechtssicherheit schaffen – Gesetze wieder lesbar machen
Vertrauensverlust und Komplexitätsauswüchse
Vertrauen schaffen – Komplexität reduzieren
Schwere Schädigung des Rechtsstaates 2020 und 2021
6. Föderalismus richtig gemacht – nahe am Bürger
Demokratie – Selbstbestimmung – Verantwortung
Gemeinden und Länder stärken
7. Das Förderungswesen minimieren und optimieren
Österreich, das Land der überbordenden Förderungen
Voraussetzungen für ein wirksames Förderungsregime
Grundproblem – keine funktionierende Transparenzdatenbank
Grundproblem – System der Töpfe
Grundproblem – privates Förderungswesen nicht entwickelt
Ziel – Reduktion der Förderungen auf EU-Schnitt
8. Neukodifizierung der Gewerbeordnung
Bestehende Gewerbeordnung ist strukturelle Bremse
Wirtschaftskammer als Bremser der Liberalisierung
Komplette Neukodifizierung der Gewerbeordnung als Gebot der Stunde
9. Radikale Reform des Kammerwesens
Trennung Arbeitgeber – Arbeitnehmer überwinden
Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft
Reduktion der Zwangsbeiträge
Dringende Reformen in der Arbeiterkammer
Dringende Reformen in der Wirtschaftskammer
10. Klares Bekenntnis zum Industriestandort Österreich und Europa
Österreichs mittelständische Produktionsunternehmen
Industriepolitische Maßnahmen und Ziele
11. Unverzüglich Unternehmen entlasten und Wachstumsimpulse setzen
Sofortige Steuer- und Abgabenentlastungen
Finanzierung erleichtern und stärken
Wachstumsimpulse setzen
Besondere Entlastung und Förderung von KMU und EPU
Österreichs Tourismuswirtschaft und Gastronomie wiederbeleben
Abbau der überbordenden Bürokratie
12. Wirksame Arbeitsmarktpolitik beginnen
Explodierende Arbeitslosenzahlen durch Dauerlockdowns
Vollbeschäftigung für österreichische Staatsbürger
Miteinander statt Vorschreiben und Abstrafen
Ausgewogene Arbeitsmarktgesetze und Arbeitnehmerschutz
Betriebliche Lehrlingsausbildung unterstützen und ausbauen
13. Energie- und Klimapolitik im Interesse der Umwelt und des Standorts
Energie- und Klimapolitik in der Kompetenz der EU
Österreichische Energie- und Klimapolitik
Energie- und Klimapolitik im Interesse des Standorts
14. Migrations- und Asylpolitik im Interesse der Menschen Österreichs
Ökonomische Betrachtung
Gesellschaftspolitische Betrachtung
15. Rückkehr zu einem finanzierbaren Sozialstaat
Den Sozialstaat für unsere Kinder sichern
Besorgniserregende Zahlen, Daten, Fakten
Baustellen im Sozialsystem
Nachhaltige Sicherung unseres Pensionssystems
16. Fehlentwicklung Europäische Union korrigieren
Gebrochene EU-Versprechen
EU – das Projekt Euro
EU – die riskante Schuldenpolitik der EZB
EU-Migrationspolitik
EU-Politik im Windschatten der Corona-Krise
EU-Erweiterungspläne
EU – Zentralstaat oder Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
ÖSTERREICH IN DER WELT DER GLOBALISIERUNG
Grenzen nationaler Wirtschafts- und Standortpolitik
Soziale Marktwirtschaft und Wachstum oder Gegenmodelle
Globalisierung und Freihandel richtig gemacht
Chancen und Gefahren in der Zukunft
ÜBER DEN AUTOR
EINLEITUNG
Dieses Buch war in seinen wesentlichen Grundzügen bereits im Herbst 2019 fertiggestellt und sollte auf die Fehlentwicklungen der österreichischen Wirtschaftsund Standortpolitik in den zwei Jahrzehnten zuvor eingehen und Lösungsvorschläge zur Verbesserung darlegen. Doch dann kam Anfang 2020 ein Virus namens SARS-CoV-2 aus China zu uns nach Europa und verbreitete sich über die ganze Welt. Die dadurch ausgelöste Krankheit erhielt den Namen „COVID-19“ bzw. umgangssprachlich „Corona“, und nichts blieb mehr so, wie es einmal war. Es war daher angezeigt, auf dieses „Corona-Virus“ einzugehen, weniger auf das Virus selbst als vielmehr auf den Umgang der türkis-grünen österreichischen Bundesregierung und so ziemlich aller Regierungen auf der ganzen Welt mit dieser neuen Situation.
Das Buch geht daher ausführlich auf die Ereignisse seit dem März 2020 ein, insbesondere die Reaktionen ebendieser türkis-grünen österreichischen Bundesregierung auf das „Corona-Virus“. Sehr rasch war dabei klar, dass die Analyse der Vorgehensweise der Bundesregierung weit über eine rein wirtschaftspolitische Betrachtung hinausgehen musste, wollte sie nicht stückhaft und unvollständig bleiben.
Dabei wird das Argument der politischen Verantwortlichen, dass ausschließlich die „Corona-Krise“ an der schlechten wirtschaftlichen Situation, der schlechten Verfassung der Republik als Wirtschaftsstandort schuld sei, entkräftet. Der Wirtschaftsstandort Österreich war durch jahrzehntelange mangelhafte Standortpolitik bereits vor der „Corona-Krise“ in einem besorgniserregenden Zustand. In Kapitel 1 wird dieser anhand von 16 Problemfeldern umrissen. Corona wurde nicht als Chance genutzt, keines der Probleme wurde angegangen, alle 16 Problemfelder bestehen nach wie vor und sind durch die Politik in der Krise teilweise massiv verschlimmert worden.
In einem ausführlichen Kapitel 2 wird die Politik der türkis-grünen Bundesregierung im Zeitraum vom März 2020 bis zum Redaktionsschluss dieses Buches Ende März 2021 untersucht und deren grottenschlechtes Krisenmanagement anhand einer „12-Sünden-Tafel“ im Detail kommentiert. Eine „Koste es, was es wolle“-Politik ohne wirkliche Zielvorgaben, ohne Controlling der Effekte und Wirksamkeit von schuldenfinanzierten Milliarden-Unterstützungsmaßnahmen, mit schwerwiegenden, unverhältnismäßigen Eingriffen in Grund- und Freiheitsrechte ist keine Strategie. Ende März 2021 war unsere Republik sowohl ökonomisch als auch gesellschaftlich schwer angeschlagen.
Unter Berücksichtigung der dramatischen Schwächungen des Standortes und der Gesellschaft durch die Regierungsmaßnahmen in den Jahren 2020 und 2021 sind diese 16 vordringlichsten Problemfelder als unverzüglich umzusetzende Handlungsfelder zur raschen wirtschaftlichen Gesundung aus der Krise in Kapitel 4 definiert, dazu werden konkrete Maßnahmen empfohlen.
Davor wird in Kapitel 3 das „kulturelle“ Selbstverständnis, das Fundament wirksamer Wirtschafts- und Standortpolitik betrachtet, die Rolle des Staates reflektiert und die Bedeutung von Eigeninitiative, Selbstbestimmtheit, Leistungsorientierung und Wirtschaftswachstum für die Schaffung von Arbeitsplätzen betont und klargestellt, dass prioritärer Adressat und Begünstigter aller Maßnahmen die Solidargemeinschaft österreichischer Staatsbürger sein muss.
Ein abschließendes Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Rolle Österreichs in einer Welt fortschreitender Globalisierung, nimmt Stellung zum Modell der „sozialen Marktwirtschaft“ und zum Freihandel und skizziert Chancen und Risiken zukünftiger Entwicklungen für die Menschen in Österreich.
Ende März 2021 schweben gefährliche Geier über dem Standort Österreich, der Geier der Verarmung vieler durch Insolvenzwellen, der Geier der Vernichtung von Vermögen durch einen Verfall der Währung Euro, der Geier der Wegnahme von Eigentum durch Umverteilungsregime, der Geier der Rechnungslegung für die unverantwortliche Schuldenpolitik der letzten Jahre bei einem Anstieg des Zinsniveaus, der Geier der Zerstörung unseres hochentwickelten Gesundheits- und Sozialsystems durch „notwendige Sparpakete“, der Geier der weiteren Beschädigung unseres Bildungs- und Wissenschaftssystems durch „notwendige Sparpakete“.
Dennoch gilt es nicht depressiv zu werden, sondern Wege aus der Krise zu finden, Wege einer möglichst raschen Gesundung zu gehen. Die Lage ist sehr ernst, aber nicht hoffnungslos. Es muss im rein wirtschafts- und standortpolitischen Bereich die Krise endlich als Chance gesehen werden und die 16 Problemfelder, die bereits vor der Corona-Krise da waren, als Handlungsfelder unverzüglich, ohne Verzögerung „abgearbeitet“ werden. Und noch viel dringender muss im allgemein gesellschaftspolitischen Bereich ein selbstbewusster Umgang mit dem Virus gefunden werden, der es ermöglicht, den Menschen ihre über die Jahrhunderte erkämpften Grund- und Freiheitsrechte wieder zurückzugeben, und zwar nicht in Gestalt „neuer Normalitäten“, sondern so, wie sie vor dem Frühjahr 2020 bestanden haben und gelebt wurden.
Es sei explizit darauf hingewiesen, dass die Inhalte dieses Buches meine Meinung als Bürger, Unternehmer und Politiker widerspiegeln und nicht die „Parteilinie“ der Freiheitlichen Partei Österreichs, wiewohl ich annehme, dass beim weitaus überwiegenden Teil des Buches inhaltliche Deckungsgleichheit herrscht.
Graz, im März 2021
CORONA IST AN ALLEM SCHULD – EIN IRRGLAUBE
CORONA ALS AUSREDE FÜR STRUKTURELLES VERSAGEN
Dieses erste Kapitel beschäftigt sich ausschließlich mit den nicht gemachten Hausaufgaben der Wirtschafts- und Standortpolitik in Österreich und dem daraus resultierenden schlechten Zustand des Landes sowie der maßgeblichen grundsätzlichen strukturellen Fehlentwicklungen, die zu ebendiesem Status geführt haben.
Dabei ist selbstverständlich zu berücksichtigen, dass die Republik Österreich mit ihren Bürgern und ihrer Wirtschaft kein eigener Planet im Weltenraum ist, sondern sich in einem europäischen und globalen Umfeld befindet und sich die Grenzen zu diesem in den letzten Jahrzehnten immer mehr aufgelöst haben. Dies äußert sich zum einen in einer intensiveren internationalen wirtschaftlichen Verschränkung unter dem Regime globaler Handelsregelungen und zum anderen in einer stärker werdenden Gestaltungsmacht supranationaler Gremien und Organisationen.
Dennoch liegt nach wie vor ein beträchtlicher Anteil dieser Gestaltungsmacht bei den nationalstaatlichen Regierungen als Exekutivorgane mit demokratischem Mandat ihrer Staatsbürger.
In diesem ersten Kapitel wird der Corona-Schock des März 2020 zunächst bewusst ausgeblendet und werden die strukturellen Fehler österreichischer Wirtschafts- und Standortpolitik sowie deren daraus resultierende negative Ergebnisse und Zustände im Vergleich zu anderen Ländern untersucht. Dies mit dem methodischen Ziel, die Ausrede, dass der Corona-Schock an allem schuld sei, als solche evident zu machen.
Der Corona-Schock 2020 hat die Situation natürlich dramatisch verschärft, aber wir haben auch bereits vorher unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Es darf keinesfalls der Fehler gemacht werden, für den desaströsen Zustand zu Ostern 2021 ausschließlich Corona verantwortlich zu machen.
Der katastrophale Zustand, in dem sich unser Land zu Ostern 2021 in vielen Bereichen befindet, ist eine giftige Mischung aus:
•Den vielfältigen strukturellen Schwächen und Fehlentwicklungen, die bereits vor der Corona-Krise bestanden haben.
•Dem dilettantischen, auf Angstmacherei beruhenden Vorgehen der Bundesregierung, welches unserer gesamten Gesellschaft und daraus resultierend auch unserer Wirtschaft nachhaltigen, langfristig wirkenden Schaden zufügt.
•Dem Unvermögen der türkis-grünen Bundesregierung, die Corona-Krise als Chance für nachhaltige strukturelle Reformen zu sehen.
Auf das mangelhafte Management der Corona-Krise durch die türkis-grüne österreichische Bundesregierung wird im nachfolgenden Kapitel 2 ausführlich eingegangen werden.
Wirksame Wirtschafts- und Standortpolitik hat aber immer stattzufinden, in der Krise herrschen nur besonders erschwerte Bedingungen. Mehr noch, wirksame Wirtschafts- und Standortpolitik erhöht selbstverständlich die Resilienz des Systems, erhöht die Robustheit in Krisenzeiten.
In diesem ersten Kapitel wird die Wirtschafts- und Standortpolitik der Bundesregierungen vor dem Corona-Schock 2020 analysiert. Dies ist nur unter Berücksichtigung der globalen und europäischen Herausforderungen, die neben den nationalen Herausforderungen das Umfeld bestimmen, möglich und sinnvoll.
Die Gestaltungsmöglichkeiten von nationalstaatlichen Regierungen hinsichtlich der großen Herausforderungen auf globaler und europäischer Ebene sind natürlich eingeschränkt. Hinsichtlich der Methodik für die Lösung dieser Herausforderungen stehen zwei grundsätzlich unterschiedliche Vorgehensweisen bzw. Modelle zur Verfügung:
Einerseits die Methode der Lösung der Herausforderungen durch institutionalisierte supranationale Organisationen. Dies bedingt jedoch die Abgabe der dafür erforderlichen Kompetenzen und Ressourcen durch die Nationalstaaten an diese Organisationen. Ein Modell, für das in letzter Zeit zunehmend der Begriff des „Multilateralismus“ verwendet wird.
Andererseits die Methode der Lösung der Herausforderungen durch bilaterale, trilaterale und auch multilaterale Zusammenarbeit, jedoch in Form problem- und anlassbezogener Kooperation zwischen weiterhin hinsichtlich der Ressourcen und Kompetenzen weitestgehend souveränen und eigenbestimmten Nationalstaaten.
Die Republik Österreich stand bereits 2019 vor großen Herausforderungen. Diese sind mit der „Corona-Krise“ nicht verschwunden, sie bestehen weiter. Mehr noch, durch die Corona-Krise ist das Erfordernis, sich diesen Herausforderungen zu stellen und die sich daraus ergebenden Aufgaben zu lösen, noch deutlich größer geworden.
Nachfolgend gehe ich kurz auf die globalen und europäischen Herausforderungen ein, um mich danach ausführlich den österreichischen Herausforderungen und dem strukturellen Versagen österreichischer Bundesregierungen im Bereich der Wirtschafts- und Standortpolitik in den Jahren vor Corona zu widmen.
Dieses Versagen führte im Ergebnis dazu, dass Österreich im internationalen Vergleich bereits vor Corona, also Ende des Jahres 2019, in vielen wesentlichen Bereichen den Anschluss an Spitzenländer längst verloren hatte.
DIE GROSSEN HERAUSFORDERUNGEN VOR CORONA WIE NACH CORONA
Herausforderungen auf drei Ebenen
Ausgehend von der Selbstverständlichkeit, dass der Mensch im Mittelpunkt aller Politik stehen muss, ist es Aufgabe wirksamer Wirtschafts- und Standortpolitik, ihren Beitrag insoweit zu leisten, als dadurch die materiellen Grundlagen geschaffen werden müssen, die es den in unserer Solidargemeinschaft „Republik Österreich“ lebenden Menschen ermöglicht, ein Leben
•in sozialem Frieden und sozialer Sicherheit
•in Wohlstand
•in Freiheit und weitestmöglicher Selbstbestimmung
•in einer funktionierenden Demokratie mit einer funktionierenden Gewaltentrennung zwischen Legislative, Judikative und Exekutive
•in einer sauberen und gesunden Umwelt
zu führen.
Damit wird erst das nachhaltige Funktionieren einer Solidargemeinschaft mit Rechten und Pflichten ermöglicht.
Österreichische, nationalstaatliche Wirtschafts- und Standortpolitik sieht sich dabei mit großen Herausforderungen konfrontiert, die sich vielschichtig auf mindestens drei Ebenen ergeben.
Hier sind zum Ersten die großen globalen Herausforderungen unserer Zeit zu nennen, die es durch internationale, aber vor allem auch nationalstaatliche Politik zu bewältigen gilt. Neben der derzeit alles überlagernden Herausforderung durch COVID-19 sind dies unsere Umwelt betreffende Fragen, der Klimawandel, der Umgang mit unseren Ressourcen. Das ist weiters die zunehmende Globalisierung aller Märkte, welche heute von Gütern und Kapital bis zu Dienstleistungen und Arbeit reicht. Das ist aber auch das weltweite Altern der Bevölkerung, und das sind vor allem die stark steigenden weltweiten Migrationsbewegungen. Der gegenwärtige internationale politische Rahmen erleichtert deren Bewältigung nicht und zeigt vielfach Signale einer völligen Überforderung.
Die Meisterung dieser Herausforderungen wird zum Zweiten erschwert durch eine Europäische Union, die in einem besorgniserregenden Zustand ist. Dies ist das Ergebnis einer viel zu überhasteten Integration und des Glaubens, durch Vorgabe von Integrationsschritten ökonomische Reformen in den neuen Mitgliedstaaten bewirken zu können. Wie der Euro gezeigt hat, ist das Gegenteil der Fall und die ausgelösten finanziellen, ökonomischen und politischen Spannungen dieses Versuches sind mitverantwortlich für wachsende Desintegrationserscheinungen.
Zum Dritten sind wir mit der Tatsache konfrontiert, dass durch verfehlte nationale Wirtschaftspolitik der letzten 15 Jahre Österreich, das zu Beginn dieses Jahrtausends noch als das „bessere Deutschland“ gefeiert wurde, bestenfalls zum Mittelmaß abgesunken ist. Trotz Rekordsteuern und Abgaben können die hohen Staatsausgaben nicht finanziert werden, was zu Rekordhöhen bei den Staatschulden führt. Dies ist das Ergebnis eines totalen Reformstaus und des fehlenden Muts zu echten strukturellen Verbesserungen auf allen Ebenen. Der unkontrollierte Zuzug von Wirtschaftsmigranten und deren rasche Integration, allerdings überproportional leider nur in das Sozialsystem, hat die Lage weiter verschlechtert.
Wirksame Wirtschafts- und Standortpolitik stellt sich diesen vielschichtigen Herausforderungen. Wirksame Wirtschafts- und Standortpolitik will Österreich im globalen und europäischen Umfeld besser positionieren und wieder zu einem Vorbild für andere Länder machen.
Nachfolgend werden im Sinne einer IST-Analyse die wirtschaftspolitischen Herausforderungen auf der globalen Ebene, auf der supranationalen europäischen Ebene und der „hausgemachten“ österreichischen Ebene eingehend dargestellt. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Darstellung des Abstiegs Österreichs in den letzten 15 Jahren gelegt. Diese Analyse zeigt, dass sich unser Land bereits vor dem Corona-Schock im März 2020 in einem Zustand befand, der als absolut unzufriedenstellend bis besorgniserregend zu bezeichnen ist.
Globale Herausforderungen
Hier sind die großen globalen Herausforderungen unserer Zeit zu nennen, die es durch internationale, aber auch nationale Wirtschaftspolitik zu bewältigen gilt.
•Das sind alle unsere Umwelt betreffende Fragen, der Klimawandel, der Umgang mit unseren Ressourcen.
•Das ist das sehr starke Bevölkerungswachstum in bestimmten Regionen der Welt.
•Das ist die zunehmende Globalisierung aller Märkte.
•Das ist das weltweite Altern der Bevölkerung.
•Das sind die stark steigenden weltweiten Migrationsbewegungen, für uns von Interesse vornehmlich jene aus sehr armen, kulturfremden Ländern nach Europa.
•Das sind die enorm gewachsenen Möglichkeiten der Datenerhebung, Datenerfassung, Datenspeicherung und Datenverknüpfung, die rasanten Weiterentwicklungen im Bereich der Artificial Intelligence (AI), welche große Chancen bieten, jedoch in „falschen Händen“ gewaltige Werkzeuge zur Kontrolle, Freiheitsbeschränkung und Unterdrückung jedes Individuums sein können.
•Das ist der Riese China, der nach Jahrhunderten der Isolation seit rund 30 Jahren zu einem weltweit agierenden wirtschaftlichen und zunehmend auch militärischen Faktor wird.
•Das sind die USA als nach wie vor einziges weltweites Imperium.
•Das ist Russland als rohstoffreichstes, flächengrößtes und militärisch hochgerüstetes Land.
•Das ist die „Vernetzung“ der Welt durch eine sehr starke Zunahme von globalen Rohstoff-, Waren-, Dienstleistungs- und Menschenströmen.
•Das ist die „Verkleinerung“ der Welt und die dramatische Erhöhung von Geschwindigkeiten durch die Möglichkeiten der Kommunikation und Digitalisierung.
•Das ist die „Zentralisierung“ der Welt durch die Schaffung einer weltweiten virtuellen Vernetzung des Banken- und Finanzsektors.
•Das ist die fortschreitende „Konzentration“ der weltweiten Eigentümerstrukturen auf immer weniger und immer größere Strukturen und die damit einhergehende Zurückdrängung kleiner und mittelständischer Strukturen.
•Das ist der stetige Bedeutungsverlust der Realwirtschaft im Vergleich zur virtuellen Banken- und Finanzwirtschaft.
•Das ist die durch die fünf letztgenannten Entwicklungen bedingte dramatisch höhere Störanfälligkeit der gesamten Welt gegenüber weltweiten Krisen.
All diese globalen Faktoren und Herausforderungen sind für das kleine europäische Land Österreich als Wirtschaftsstandort von erheblicher Relevanz.
Welche Institutionen und Organisationen sollen diese globalen Herausforderungen lösen? Das vielfach von Befürwortern der Machtvergrößerung supranationaler Organisationen (wie etwa UNO, WHO, Weltbank, IWF, Europäische Union, EZB etc.) unter dem Schlagwort „Stärkung des Multilateralismus“ vorgebrachte Argument, globale Herausforderungen könnten nur von globalen Organisationen bewältigt werden, ist meines Erachtens nicht richtig.
Die Forderung nach „Stärkung des Multilateralismus“ bedingt natürlich automatisch die Forderung nach Übernahme von mehr Aufgabenbereichen durch supranationale Organisationen, die Forderung nach mehr Kompetenzen und Macht und die dafür notwendige Ausstattung mit mehr Ressourcen und Geldmitteln, am besten durch Einhebung eigener Steuern und Abgaben.
Das hieße selbstverständlich automatisch eine entsprechende Verringerung der Macht, der Aufgabenbereiche, der Ressourcen und Geldmittel bei den Nationalstaaten, deren Regierungen und deren Bevölkerung. Das hieße selbstverständlich auch eine noch weitere Entfernung der meist wenigen, demokratisch oft nicht legitimierten Entscheidungsträger von den Menschen. Die Demokratie bewegt sich immer weiter vom Bürger weg.
Das ist bereits aus demokratiepolitischen Gründen abzulehnen. Es bedarf einer differenzierten Betrachtungsweise und differenzierter Lösungsansätze, wobei grundsätzlich dem verantwortungsvollen, kooperativen Zusammenwirken selbstbestimmter Staaten der Vorzug gegenüber dem Machtausbau supranationaler Organisationen zu geben ist.
Die Corona-Krise 2020 hat in vielerlei Hinsicht gezeigt, dass supranationale und multilaterale Organisationen de facto noch weniger als nationalstaatliche Regierungen in der Lage sind, eine Politik zu machen, die nahe an den Bedürfnissen der Menschen ist und deren Probleme, Ängste und Sorgen nicht nur ernst nimmt, sondern auch abbaut. Das klingt nicht nur logisch, es ist es auch – New York und Brüssel sind weiter weg von St. Anna am Aigen als Graz und Wien.
Es stellt sich insbesondere die Frage, ob die Europäische Union in ihrer derzeitigen Form überhaupt in der Lage ist, im globalen Wettbewerb die Interessen des Kontinents Europa und seiner Staaten bestmöglich zu vertreten.
Herausforderungen auf europäischer Ebene – die EU
Meines Erachtens ist die Europäische Union des Jahres 2021 nicht einmal im Ansatz in der Lage, die drei größten europäischen Probleme und Herausforderungen zu lösen:
•die überbordende Migration nach Europa aus kulturfremden Regionen mit einer drohenden, vielfach bereits stattfindenden Verdrängung der „christlichabendländischen“ Kultur
•die Sicherstellung ausreichender Arbeitsplätze am europäischen Arbeitsmarkt und damit die Erhaltung eines gewissen Wohlstandes in Europa
•den Ausbau bzw. die Erhaltung europäischer Wettbewerbsfähigkeit und die Vertretung europäischer Interessen im globalen Umfeld.
Die EU verliert sich stattdessen in der Überregulierung von Details, dem Versagen im Umgang mit dem Corona-Virus, der massiven Ausweitung und Vergemeinschaftung enormer Schulden und der Beschäftigung mit wenig nutzenschaffenden Pseudothemenbereichen.
Die Briten waren jedenfalls nicht der Meinung, dass die Europäische Union in der Lage ist, diese großen europäischen Probleme zu lösen bzw. diese Herausforderungen zu meistern, und sind 2020 aus der EU ausgetreten. Diese Entscheidung legt genau genommen das völlige Scheitern der EU in der derzeitigen Form offen. Wer nun glaubt, dass die Verantwortlichen in den Regierungen der Länder Europas und die Verantwortlichen im EU-Apparat diese eindeutige Warnung erkennen und eine Kurskorrektur einleiten würden, der irrt. Nichts davon findet statt, der Irrweg wird mit gleicher Intensität weiterverfolgt. Dem Thema EU ist in diesem Buch unten ein eigenes Kapitel gewidmet.
Hausgemachte österreichische Herausforderungen
Zu Beginn dieses Jahrtausends wurde Österreich hinsichtlich der Attraktivität des Standortes und in Bezug auf seine allgemeine Wirtschaftspolitik, und dies durchaus zu Recht, von vielen Experten noch als das „bessere Deutschland“ bezeichnet.
In einem wirtschaftlich offenen Europa der Europäischen Union mit ihren vier Grundfreiheiten ist das Vorhandensein komparativer Standortvorteile gegenüber anderen Ländern der EU von ganz elementarer Bedeutung. Umso mehr, wenn es sich dabei um Vorteile gegenüber dem mit großem Abstand wichtigsten Handelspartner, nämlich Deutschland, handelt.
Gelingt dies, so wie in den Jahren 2000–2006 und auch in den Jahren 2017–2019 (jeweils mit Regierungsbeteiligung der FPÖ), hat die Politik vieles richtig gemacht. Gelingt dies nicht, so wie in den übrigen Jahren seit 2007, hat die Politik vieles falsch gemacht.
Österreichs Wirtschaftspolitik und der Abstieg in den letzten Jahren seit 2007 muss anhand eines Vergleiches mit Ländern dargestellt werden, mit denen wir uns messen sollten und müssen. Demnach müssen wir uns mit Deutschland und unserem nicht in der EU befindlichen Nachbarland Schweiz und weniger, ohne diesen Ländern zu nahe treten zu wollen, mit Ländern wie Griechenland oder Portugal vergleichen.
Österreichs Abstieg in den Vergleichsfeldern Entwicklung der Staatsschulden, Entwicklung der Steuer- und Abgabenquote, Entwicklung der Arbeitslosenzahlen, Entwicklung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung der Innovationsfähigkeit ist dabei (im negativen Sinn) beachtlich und besorgniserregend.
Wesentlich ist, dass diese Entwicklungen „hausgemacht“ und von den jeweiligen österreichischen Bundesregierungen zu verantworten sind, dass das Land als Wirtschaftsstandort sich bereits Ende 2019, also vor der Corona-Krise, in einem Zustand befunden hat, der absolut unzufriedenstellend war, und bereits damals dringender Handlungsbedarf für grundlegende wirtschafts- und standortpolitische Reformen bestand.
DER ZUSTAND ÖSTERREICHS ALS WIRTSCHAFTSSTANDORT VOR CORONA
Zwei Jahrzehnte mangelhafte Standortpolitik bis 2019
Österreich ging leider in den letzten beiden Jahrzehnten wirtschafts- und standortpolitisch die meiste Zeit den falschen Weg. Es wurde über die Jahre ein Staat geschaffen, der in seinen Kernaufgaben schwach ist, diese nur völlig unzureichend erfüllt, in manchen Bereichen sogar gänzlich versagt. Andererseits wurde über die Jahre auch ein „Moloch-Staat geschaffen, der sich überall dort einmischt, wo er eigentlich nicht tätig sein sollte, und höchst ineffektiv und ineffizient agiert.
Wirksame Wirtschafts- und Standortpolitik heißt auch, diese Entwicklung zu stoppen und umzukehren. Dabei kann in der Betrachtung des Zeithorizonts von 2000 bis 2019 grob zwischen drei „Phasen“ unterschieden werden:
Erstens der Phase der ÖVP/FPÖ-Regierungen zwischen 2000 und 2006, wo es Österreich gelang, den großen Bruder Deutschland in vielen Bereichen zu überholen und in manchen Bereichen zum „besseren Deutschland“1 zu werden.
Zweitens der Phase der SPÖ/ÖVP-Regierungen zwischen 2006 und 2017, in der Österreich kontinuierlich zurückfiel2 und von vielen Ländern, mit denen wir uns vergleichen sollten, überholt wurde. Dies vor allem deshalb, weil diese Länder Maßnahmen gesetzt hatten, die in einem „rot-schwarzen“ Dauerstillstand in Österreich eben nicht gesetzt wurden.
Drittens der Phase der ÖVP/FPÖ-Regierung zwischen 2017 und 2019 mit einer sehr guten Entwicklung hinsichtlich der volkswirtschaftlichen Zahlen. Diese gute Entwicklung ist einerseits durch manch vernünftige wirtschaftspolitische Initiative begünstigt worden. Andererseits muss man doch sagen, dass wohl eher die sehr gute allgemeine Wirtschaftsentwicklung in diesen beiden Jahren der Hauptgrund für deutliche Senkungen etwa der Staatsschuldenquote war. Notwendige, tiefgreifende strukturelle Reformen sind auch dieser Regierung nicht gelungen, sodass sich der Wirtschaftsstandort Österreich Ende 2019, also bereits vor der „Corona-Krise“, in keinem guten Zustand befand.
Eine kurze Analyse der Entwicklung ausgewählter volkswirtschaftlicher Steuerungskennzahlen aus dem Zeitraum 2000 bis 2019 soll dies verdeutlichen. Neben den Zahlen für unsere Republik Österreich sind dabei insbesondere Vergleiche mit anderen Ländern, und zwar solchen, mit denen wir uns vergleichen sollten und müssen, von Interesse. Methodisch werden dabei die Entwicklungen bis zum Zeitpunkt vor dem Ausbruch der Corona-Krise, also im Wesentlichen die Entwicklungen relativ „normaler“ Wirtschaftsjahre bis Ende 2019, betrachtet.
Staatsausgaben und Staatseinnahmen – schlechte Budgetdisziplin
Quelle: Statistik Austria
Nachhaltig verantwortungsvolle Budgetpolitik heißt, dass die Staatsausgaben über einen bestimmten Zeithorizont betrachtet die Staatseinnahmen nicht übersteigen sollten. Kurzfristig höhere Staatsausgaben als Staatseinnahmen sind daher durchaus zulässig, die entscheidende Frage ist aber, wofür man diese kurzfristigen Ausgabenüberschüsse, also Budgetdefizite, in Kauf nimmt. Auch hier soll ein Vergleich mit Deutschland und der Schweiz die Beurteilung der Qualität der österreichischen Budgetpolitik erhellen.
Während es in Österreich erst in den Jahren 2018 und 2019 erstmalig seit über 60 Jahren gelungen ist, tatsächlich geringfügige Budgetüberschüsse zu erzielen, gelang dies Deutschland, die grundsätzlich gute Entwicklung der Wirtschaft nach der Finanzkrise 2012 offenbar besser nutzend, schon sehr viel früher. Deutschland gelang es bereits seit dem Jahr 2012 bis einschließlich 2019, Budgetüberschüsse zu machen. Auch der Schweiz gelang es bereits seit 2003, ihre Budgets ausgeglichen zu gestalten, wobei in diesen vergangenen 16 Jahren teilweise deutliche Budgetüberschüsse verzeichnet werden konnten.
Wenn man sich diese Vergleiche vor Augen führt, ist die Behauptung mancher ÖVP-Politiker, das Land könne sich jetzt die ausschließlich auf Schulden finanzierten Milliardensubventionen der Jahre 2020 und 2021 leisten, weil man in den Jahren zuvor „so gut gewirtschaftet hätte“, schlichtweg falsch.
Hohe Staatsverschuldung
Quelle: Statistik Austria, Staatsquoten 1995–2020
Betrugen Österreichs Staatschulden im Jahr 2000 noch 140,4 Mrd. Euro (65,9 % des BIP) und war damals die Erreichung der 60 %-Marke nach den Maastricht-Konvergenzkriterien noch möglich, konnte in der Zeit bis 2007 durch verantwortungsvolle Haushaltspolitik der Schuldenstand in Relation zum BIP sogar leicht gesenkt werden. Im Jahr 2007 betrugen die Staatschulden 183,8 Mrd. Euro oder 65,1 % des BIP. Unter den dann seit 2007 folgenden SPÖ/ÖVP-Regierungen explodierten die Staatsschulden geradezu und betrugen im Jahr 2016 fast 300 Mrd. Euro oder 83,7 % des BIP. Auch in den Jahren 2017 bis 2019 stiegen die Staatsausgaben. Durch die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung konnte die Staatsschuldenquote im Jahr 2017 allein durch die Tatsache, dass das Budgetdefizit kleiner als das Wirtschaftswachstum war, auf 78,5 % des BIP gesenkt werden. In den Jahren 2018 und 2019 konnten in Österreich erstmals seit über 60 Jahren Budgetüberschüsse erwirtschaftet werden, was bei gleichzeitig guten Wachstumsraten des BIP zu einer Senkung der Staatsschuldenquote auf 70,5 % des BIP zu Ende des Jahres 2019 führte. Das klingt aufs Erste betrachtet ganz gut, wenn man allerdings Vergleiche mit Ländern zieht, mit denen wir uns vergleichen sollten,3 schaut die Welt ganz anders aus.
Im Jahr 2003 hatte die Schweiz mit einer Staatsverschuldung von 47,9 % des BIP eine nur unwesentlich geringere Staatsverschuldung als Österreich mit rund 65 %. Im Gegensatz zu Österreich, das seine Staatsverschuldung ab 2007 deutlich vergrößerte, hat die Schweiz im Jahr 2003 eine Schuldenbremse im Verfassungsrang beschlossen und diese Politik in den letzten Jahren auch konsequent verfolgt. Daher hatte die Schweiz im Jahr 2018 eine Schuldenquote von nur mehr 28,0 % des BIP4.
Auch die Entwicklung in Deutschland ist seit 2010 deutlich besser als in Österreich. Ausgehend von einer Staatsverschuldung von 78,4 % des BIP im Jahr 2010 sank diese kontinuierlich über die Jahre und betrug im Jahr 2019 nur mehr erstaunliche 55,1 % des BIP. Dies auch deshalb, weil es Deutschland gelang, seit dem Jahr 2012 bis einschließlich 2019 Budgetüberschüsse zu machen.
Auch Schweden hatte im Jahr 1996 noch eine Staatsverschuldung von fast 70 % des BIP, schlug aber dann einen konsequenten Konsolidierungskurs ein und hat seit über 10 Jahren eine Staatsverschuldung von nur rund 40 % des BIP. Auch Dänemark verfolgte über die Jahre eine ähnliche Schuldenpolitik und hatte Ende des Jahres 2019 eine erstaunlich niedrige Staatsverschuldung von lediglich 29,4 % des BIP.
Abgabenquote – drückende Steuer- und Abgabenbelastung
Sieht man sich die sehr schlechte Entwicklung der Staatsschulden in Österreich an, so müsste man in einem nächsten Schritt prüfen, ob dann nicht wenigstens die Belastung der Bevölkerung mit Steuern und Abgaben vergleichsweise gering ist, der Staat gleichsam höhere Verschuldungen in Kauf nimmt, dafür die Bürger aber mit weniger Steuern und Abgaben belastet. Die Abgabenquote (auch Steuer- und Abgabenquote) gibt dabei den Anteil an Steuern und Sozialabgaben am BIP in Prozent an. Leider ist in Österreich das Gegenteil der Fall.
Quelle: eurostat pressemitteilung 160/2020 vom 29.10.2020
Die Abgabenquote (auch Steuer- und Abgabenquote) gibt den Anteil an Steuern und Sozialabgaben am BIP in Prozent an. Österreich hat im Jahr 2019 mit 43,1 % eine viel zu hohe Abgabenquote, die in Europa nur mehr von Dänemark, Frankreich, Schweden und Belgien übertroffen wird. Dänemark und Schweden haben allerdings signifikant geringere Staatschuldenquoten als Österreich. Belgien und Frankreich haben zusätzlich auch noch sehr hohe Staatsschuldenquoten, diese beiden Länder sind jedoch wirtschaftspolitisch alles andere als Vorbilder für Österreich.
In Absolutzahlen ausgedrückt heißt dies, dass der Staat über Steuern und Sozialversicherungsabgaben dem Steuerzahler bei einem BIP für 2019 von 397,58 Mrd. Euro den Betrag von 171,36 Mrd. Euro abnimmt. Das ist viel zu hoch und inakzeptabel. Deutschland hatte dazu im Vergleich 2019 eine Abgabenquote von 40,6 %. Das heißt, Deutschland hatte eine um 2,4 % niedrigere Abgabenquote.
Bei einem österreichischen BIP für 2019 von 397,58 Mrd. Euro entsprechen 1,4 % einem Betrag von 5,57 Mrd. Euro, den der Staat mehr über Sozialabgaben und Steuern einnimmt als in Deutschland. Da stellt sich die Frage: Wohin verdampfen diese 5,57 Mrd. Euro jedes Jahr in Österreich? Noch dramatischer fällt der Vergleich zu anderen erfolgreichen Industrienationen außerhalb der EU aus. Die Schweiz (27,4 %), die USA (26,7 %) und Japan (33,1 %) hatten 2019 eklatant niedrigere Abgabenquoten als Österreich.
Conclusio für die Zeit 2000 bis 2019
Betrachtet man die Kombination der beiden Kennzahlen Staatsverschuldung in % des BIP und Abgabenquote über den Zeitraum 2000–2019, so ist festzustellen, dass Österreich sich leider in den Kreis der Länder eingliedert, in denen es zu einer Erhöhung beider Werte über die Jahre gekommen ist. Nur Länder wie Frankreich und Italien haben hier ähnlich schlechte Entwicklungen, freilich in noch viel dramatischerem Ausmaß, aufzuweisen. Es ist zu befürchten oder besser gesagt fast davon auszugehen, dass genau diese Länder, insbesondere auch durch die zusätzlichen negativen Auswirkungen der dort ergriffenen Maßnahmen aus Anlass der Corona-Krise ab 2020, in den nächsten Jahren zu einem massiven Problem im Euro-Raum und damit der gesamten Europäischen Union werden.
Es lag also, mit wenigen Ausnahmen von 2000 bis 2005 und von 2017 bis 2019, schon vor der Corona-Krise in Österreich über die letzten zwei Jahrzehnte alles andere als eine wirksame, erfolgreiche Steuer-, Abgaben- und Haushaltspolitik der jeweiligen Bundesregierungen vor. Trotz einer sehr hoher Abgabenquote und damit riesigen Einnahmen für den Staat wurden dennoch teils erhebliche Budgetdefizite produziert. Der Staat kam und kommt also offensichtlich selbst mit dem vielen Geld, dass er den Steuerzahlern abnimmt, nicht aus und macht dennoch jedes Jahr neue Schulden.
16 besorgniserregende Problemfelder
Trotz einiger wirtschafts- und standortpolitischer Erfolge und guter Maßnahmen der nur knapp eineinhalb Jahre und damit für nachhaltige Reformen zu kurz im Amt befindlichen ÖVP/FPÖ-Regierung in den Jahren 2018/19 war Österreich als Ergebnis jahrelanger verfehlter Gesamtpolitik und des jahrelangen Versäumnisses, echte Strukturreformen anzugehen, als Wirtschaftsstandort im globalen Wettbewerb bereits vor der Corona-Krise in einem äußerst besorgniserregenden Zustand.
Folgende Aussagen über Österreich als Wirtschaftsstandort trafen bereits Ende 2019, also schon vor der Corona-Krise, zu:
1.Österreich ist ein Land, in dem Leistungsgerechtigkeit nicht mehr gegeben ist, sich Leistung nicht mehr lohnt, und das ein sehr leistungsfeindliches, ungerechtes, ineffizientes und viel zu kompliziertes Steuersystem hat,
2.ein Land, in dem sich „der Staat“ in zu viele Dinge ineffizient einmischt, mit daraus resultierenden viel zu hohen Staatsausgaben und einer viel zu hohen Steuer- und Abgabenquote, das trotzdem eine viel zu hohe Verschuldung hat,
3.ein Land, in dem der Faktor Arbeit viel zu teuer ist, so teuer wie fast nirgendwo auf der Welt,
4.ein Land, in dem sehr viel Geld für Bildung, Wissenschaft, Innovation und Forschung ausgegeben wird, wobei der messbare Erfolg in diesen Bereichen aber seit Jahren international hinterherhinkt,
5.ein Land mit komplizierten, oft unlesbaren Gesetzen und Verordnungen,
6.ein Land mit einem strukturell ineffizienten und teuren Föderalismus ohne klare Zuordnung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung,
7.ein Land mit einem völlig überdimensionierten, ineffektiven und ineffizienten Förderwesen,
8.ein Land mit einer die Freiheit der Erwerbsausübung hemmenden protektionistischen Gewerbeordnung aus dem vorigen Jahrhundert,
9.ein Land, in welchem durch gesetzliche Zwangsmitgliedschaft abgesicherte Kammern mit enormen Ressourcen ausgestattet ihren Einfluss bei praktisch allen standortrelevanten Themen ausüben,
10. ein Land ohne klare Industriepolitik, mit stetig sinkender Industriequote und zu schwach steigender Arbeitsproduktivität,
11. ein Land, in dem das Unternehmertum durch Steuern, Abgaben, Vorschriften und Bürokratie belastet statt entlastet wird und in dem zu wenig für die kleinstrukturierte Wirtschaft getan wird,
12. ein Land ohne effektive und effiziente Arbeitsmarktpolitik mit groben Mängeln in der Fachkräfteausbildung, das österreichische Staatsbürger am Arbeitsmarkt vorbei ausbildet und zu wenig schützt,
13. ein Land, das statt ausgewogener, standortsichernder Energiepolitik eine überzogene Klimapolitik betreibt,
14. ein Land mit einer völlig falschen Migrationspolitik zu Lasten des Standortes, des Arbeitsmarktes und der hier lebenden Bevölkerung,
15. ein Land, dessen hochentwickeltes Sozialsystem immer unfinanzierbarer wird,
16. ein Land, das in den Regimen der sich in vielen Bereichen völlig fehlentwickelnden Europäischen Union (EU) und der eine verantwortungslose Schuldenpolitik betreibenden Europäischen Zentralbank (EZB) gefangen ist.
Diese 16 besorgniserregenden Problemfelder ergeben in Summe einen veritablen Standortnachteil Österreichs. Sie sind das Ergebnis jahrelanger verfehlter Wirtschafts- und Standortpolitik und bestanden bereits Ende 2019, also vor der Corona-Krise im März 2020. Sie bilden in ihrer Summe das grundsätzliche, über die Jahre aufgebaute und verfestigte, strukturelle Problem des WirtschaftsstandortesÖsterreich im globalen Wettbewerb ab. Eine Lösung ist bisher noch nicht ernsthaft angedacht, geschweige denn umgesetzt worden.
Aufgrund des schlechten Managements der Corona-Krise durch die türkis-grüne Bundesregierung in den Jahren 2020/21 hat sich diese unbefriedigende Situation lediglich noch weiter verschärft, in vielen Bereichen dramatisch.
Nachfolgendes Kapitel 2 widmet sich daher der im März 2020 ausgebrochenen Corona-Krise. Dabei wird vor allem auf das amateurhafte und dilettantische Krisenmanagement der türkis-grünen österreichischen Bundesregierung sowie der Europäischen Union eingegangen. Die Möglichkeit, diese Krise als Chance zu sehen und grundsätzliche, strukturelle Problemfelder zu lösen, wurde dabei leider ganz und gar nicht genutzt.
Die Kapitel 3 und 4 behandeln anschließend mögliche und notwendige Wege zur raschen Gesundung nach der Krise und Festigung einer nachhaltig positiven Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Österreich im globalen Wettbewerb.
Das Fundament, das „strategische Selbstverständnis“ wirksamer Wirtschaftsund Standortpolitik, wird in Kapitel 3 erläutert. In Kapitel 4 wird jedes einzelne der 16 festgestellten strukturellen Problemfelder als unmittelbares Handlungsfeld zur raschen und nachhaltigen Gesundung verstanden, konkret zu ergreifende Maßnahmen werden entwickelt und vorgeschlagen.
1So etwa im Artikel des deutschen Magazins „Der Spiegel“ vom 18.06.2005 (https://www.stern.de/wirtschaft/job/oesterreich-das-bessere-deutschland-3298546.html).
2Vgl. dazu etwa „Agenda Austria“ vom 17.08.2017 (https://www.agenda-austria.at/warum-oesterreich-nicht-mehr-das-bessere-deutschland-ist/).
3Ich bin nicht der Meinung, dass wir uns bei Beurteilung des Ausmaßes einer akzeptablen Staatsverschuldung mit Ländern wie Italien, das bereits 2018 mit rund 135 % des BIP verschuldet war, Spanien und Frankreich, die bereits 2018 mit rund 100 % des BIP verschuldet waren, oder auch den USA, die ebenfalls Verschuldungen weit jenseits der 100 % des BIP ausweisen, vergleichen sollten. Vielmehr sollten wir uns, wenn schon nicht an der Schweiz, Dänemark oder Schweden, so doch zumindest an dem 60 %-Wert der Maastricht-Konvergenzkriterien orientieren.
4https://www.ibf-chur.ch/SWISS-MACRO-CHARTS-2018-19-20/staatsschulden-schweiz-1991-2018/ (20.02.2021).
DIE CORONA-KRISE 2020/21
ANAMNESE DER VERBREITUNG UND DER MASSNAHMEN IN ÖSTERREICH
Nachfolgend wird lediglich die Verbreitung des Virus und die entsprechenden Reaktionen der österreichischen Bundesregierung in Kurzform chronologisch aufgelistet. Eine kritische Würdigung der Maßnahmen der Regierung erfolgt im Detail weiter unten. An dieser Stelle genügen zunächst eine Richtigstellung und eine Feststellung. Erstens ist die Behauptung falsch, das Virus verursache Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise. Richtig ist die Feststellung, dass immer die Maßnahmen der Regierung ursächlich für entsprechende positive oder negative Effekte sind. Zweitens erkennt man bereits beim bloßen Durchlesen des chronologischen Ablaufs der Maßnahmen der Regierung eine offensichtliche Konzept-, Strategie- und Planlosigkeit.
Am 31. Dezember 2019 wurde das WHO-Länderbüro China über Fälle von Lungenentzündung unbekannter Ätiologie informiert, die in der Millionenmetropole Wuhan in der Provinz Hubei festgestellt wurden. Ein neuartiges Corona-Virus (SARS-CoV-2) wurde am 7. Januar 2020 von den chinesischen Behörden als das verursachende Virus identifiziert. Ursprünglicher Infektionsort war angeblich der Wuhaner Großhandelsmarkt für Fische und Meeresfrüchte, von wo sich das Virus binnen weniger Wochen erst in den Nachbarländern und dann nahezu über die ganze Welt ausbreitete5.
Im Dezember 2019 wurde in österreichischen Medien berichtet, dass in der chinesischen Millionenstadt Wuhan auffällig viele Fälle einer Krankheit auftraten, die vor allem die Atemwege in Mitleidenschaft zog. Als Ursache wurde rasch ein neues Virus aus der Familie der Coronaviren festgemacht. Später wurde es mit dem Namen SARS-CoV-2 versehen und die damit einhergehende Krankheit als COVID-19 bezeichnet.
Im Laufe des Monats Jänner 2020 traten erste Fälle der Krankheit außerhalb Chinas am asiatischen Kontinent auf. Ende Jänner wurde das Virus auch in den USA bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt konnte das Auftreten immer auf eine Verbindung nach China und Wuhan zurückgeführt werden.
Mitte Februar 2020 verzeichnete man den ersten Sterbefall auf europäischem Boden, der mit COVID-19 in Verbindung gebracht wurde – das Opfer war ein achtzigjähriger Chinese. Ende Februar 2020 begann sich das Virus auch in Europa zu verbreiten, besonders betroffen waren dabei in dieser ersten Phase Regionen in Norditalien.
Spätestens im Jänner 2020 mussten die politischen Entscheidungsträger erkennen, dass hier Handlungsbedarf besteht. Getan wurde aber nichts, so wurde diese wichtige Anfangsphase mehr oder weniger völlig „verschlafen“.
Am 12. März 2020 erklärte die WHO die nun auf mehreren Kontinenten auftretende Krankheit zur Pandemie. Erst jetzt begannen die Regierungen in Europa aufzuwachen und zu reagieren. Auch in Österreich waren die nächsten Tage und Wochen gekennzeichnet von hektisch entwickelten Vorgehensweisen und Maßnahmengesetzen, die sehr weitreichende Verordnungsermächtigungen für die Bundesregierung vorsahen.
Ab 10. März 2020 wurde Passagierflugzeugen aus Norditalien, Südkorea oder dem Iran die Landung in Österreich verboten. Ab dem 11. März wurde von Personen, die aus Risikogebieten außerhalb der EU kamen, ein ärztliches Attest verlangt, Personen mit Wohnsitz in Österreich hatten sich in 14-tägige Heimquarantäne zu begeben. Folgende Maßnahmen können als „1. Lockdown“ zusammengefasst werden: Am 11. März wurde die Schließung von Universitäten und Schulen ab dem 16. März angekündigt. Zwei Tage später erklärte die Bundesregierung, alle Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, hätten ebenfalls ab 16. März zu schließen, außerdem musste die Gastronomie dauerhaft schließen.
Am 16. März 2020 trat eine Verordnung in Kraft, welche das Betreten öffentlicher Orte verbot, somit ein allgemeines Ausgangsverbot darstellte6. Die Ministerinnen Tanner und Köstinger gaben am 15. März bekannt, dass Grundwehrdiener und Zivildiener, deren Dienst Ende März beendet gewesen wäre, ihren Dienst verlängern mussten, weiters wurden ca. 1400 Milizsoldaten mobilisiert. Für geöffnete Geschäfte wurde per 30. März 2020 eine Maskenpflicht eingeführt.
Ab 14. April 2020 kam es zu Lockerungen für kleinere Geschäfte und Baumärkte. Außerdem wurde die Maskenpflicht auf öffentliche Verkehrsmittel ausgedehnt. Ab dem 2. Mai 2020 durften Geschäfte mit mehr als 400 m2 Fläche sowie Friseure und Kosmetiksalons wieder aufsperren. Mitte Mai wurden auch die Schulen wieder geöffnet, ebenso öffneten am 15. Mai die Gastronomie, Fitnessstudios, Hotels und Freibäder. Seit 1. Mai galt eine Maskenpflicht für alle geschlossenen Räume des öffentlichen Bereichs.
Ab dem 15. Juni 2020 entfiel die Maskenpflicht für die Schulen, die Gastronomie (allerdings nur für die Gäste) und den Handel. Mit dem 1. Juli 2020 wurde auch die Maskenpflicht für das Personal in der Gastronomie wieder aufgehoben. Sportarten, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden konnte, wurden ebenfalls wieder erlaubt. Oberösterreich führte die Maskenpflicht am 9. Juli wieder ein. Bei einer Pressekonferenz am 21. Juli gab die Regierung die Einführung einer österreichweiten Maskenpflicht für Supermärkte, Postfilialen und Banken ab dem 24. Juli bekannt.
Am 4. September 2020 wurde die „Corona-Ampel“ „in Betrieb genommen“. Zehn Tage später wurde die Maskenpflicht unabhängig von der Ampelfarbe für Handel und Gastronomie wieder eingeführt. Schulen und Universitäten waren ab Semesterbeginn auf „gelb“ geschaltet, was das genau bedeutete, war nicht nachvollziehbar. Bis heute kann in Wahrheit niemand den Sinn, die Funktionsabläufe, die Parameter, die Konsequenzen der Zuweisung einer Farbe für Regionen und Bezirke dieser „Corona-Ampel“ erklären. Am 19. Oktober 2020 verkündete die Regierung, dass Zusammenkünfte im privaten Bereich auf sechs Personen und im Freien auf zwölf Personen zu reduzieren sind. Diese Regelung trat am 25. Oktober in Kraft.
Der „2. Lockdown“, umgangssprachlich als „Lockdown light“ bezeichnet, wurde am 31. Oktober 2020 von der Regierung angekündigt und begann am 3. November 2020. Es wurde eine Ausgangssperre von 20:00 bis 6:00 verhängt. Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Hotels und Gastronomie mussten schließen. Handel und Friseure blieben vorerst geöffnet. Die Schuloberstufen sowie die Universitäten wurden geschlossen und mussten auf Fernlehre umstellen. Am 14. November 2020 verkündete die Bundesregierung die Verschärfung des Lockdowns zu einem „harten Lockdown“, der vorerst bis 6. Dezember gültig sein sollte. Die verschärften Ausgangsregeln wurden nun auf den ganzen Tag ausgeweitet, körpernahe Dienstleister und Handel mussten ebenfalls schließen. Auch die Schulunterstufen wurden geschlossen und mussten auf „Fernunterricht“ umstellen.
Der „harte Lockdown“ wurde am 7. Dezember 2020 wieder gelockert und es galten erneut die Regelungen des „Lockdown light“, insbesondere durften Handel und Dienstleister wieder öffnen.
In den ersten beiden Dezemberwochen 2020 wurden in ganz Österreich Massentestungen durchgeführt. Die Sinnhaftigkeit solcher Massentestungen von überwiegend gesunden Menschen ist äußerst umstritten, darüber hinaus erwachsen daraus Gesamtkosten (Tests, Personal, Infrastruktur etc.) in dreistelliger Millionenhöhe. Obwohl das zugrundeliegende Modell der Harvard University eine Beteiligung von rund 75 % und mehrfache Testrunden als Voraussetzung vorsieht, um überhaupt epidemiologisch brauchbare Ergebnisse für weitere nutzbringende Maßnahmen zu erhalten, wagte es die Bundesregierung nicht, diese Testungen verpflichtend zu machen oder negative Folgen für allfällige Verweigerungen anzudrohen.
Übrig blieb eine freiwillige Beteiligung von rund 22,6 % der Bevölkerung. Rund 2 Millionen Menschen ließen sich testen, bei 4.200 von ihnen gab es ein positives Testergebnis, das entspricht rund 0,21 % der Getesteten. Ein positives Testergebnis sagt aber nichts über eine Erkrankung oder Ansteckungsgefahr aus, diese wurde nicht getestet. Nachdem von der Bundesregierung auch keine Wirkungsziele, keine Ergebnisziele, keine Ziele für allfällige Maßnahmen vorab festgelegt wurden, verbleiben am Ende dieser völlig sinnlosen Aktion Kosten in vielfacher Millionenhöhe und die sachlich völlig unsinnige, weil falsche Feststellung des Gesundheitsministers Anschober: „… 4.200 Menschen, die sonst, ohne es zu wissen, andere Menschen angesteckt hätten, seien aus dem Infektionsgeschehen geholt worden …“7.
Nach dem Massentestungs-Flop kündigte die Regierung am 18. Dezember 2020 den dritten „harten Lockdown“ an, der zunächst vom 26. Dezember 2020 bis zum 18. Jänner 2021 dauern sollte. Es galten wiederum landesweite Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr, das völlige Schließen des Handels, der Gastronomie, weiter Teile der Beherbergungsbetriebe und Dienstleistungsunternehmen, das Verbot jeder Art von Indoor-Sportausübung, 1-Meter-Abstandsregeln für Sport im Freien. Schulen, Universitäten, alle Kultureinrichtungen (Museen, Büchereien, Bibliotheken) sowie Freizeiteinrichtungen (Tierparks, Zoos, botanische Gärten) blieben weiterhin geschlossen. Darüber hinaus wurden wieder absurde, verwirrende, unlogische Kontaktregelungen für den privaten Bereich erlassen, jegliche Treffen mehrerer Personen in Vereinslokalen blieben weiterhin grundsätzlich verboten. Es wäre aber nicht Österreich, wenn es nicht für Seilbahnbetreiber in den Schigebieten eine Ausnahme gegeben hätte, diese durften unter Einhaltung von Mindestabständen und Maskenpflicht geöffnet bleiben. Für Alters-, Pflege- und Behindertenheime blieben die Besuchsbeschränkungen aufrecht, es gab jedoch nach wie vor keine Testverpflichtung für Besucher und Mitarbeiter dieser Institutionen!
Am 27. Dezember 2020 wurden unter medienwirksamer Beteiligung des Bundeskanzlers und des Gesundheitsministers die ersten Menschen in Österreich mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer geimpft. Das nachfolgende Desaster bei der Besorgung von Impfstoffen durch die EU passte ins Gesamtbild.
Der dritte „harte Lockdown“ wurde bis 8. Februar 2021 verlängert, zusätzlich wurde ab dem 25. Jänner 2021 das landesweit verpflichtende Tragen von FFP-2-Masken unter anderem in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Handel, bei Behörden, im Taxi vorgeschrieben. Kopfschütteln verursachte dabei die Tatsache, dass die entsprechende Verordnung diese Pflicht auch bereits genesenen und geimpften Personen auferlegte.
Obwohl die Infektionszahlen im Jänner 2021 konstant bzw. rückläufig waren, kam es am 8. Februar zu keiner Beendigung des nunmehr bereits 44 Tage dauernden „3. Lockdowns“. Neu auftretende Mutationen des Virus, die „Großbritannien-Mutation“ und die „Südafrika-Mutation“, wurden seitens der Bundesregierung als Argument für die Verlängerung des „Lockdowns“ mit bestimmten Lockerungen vorgebracht. Gastronomie, Tourismus, Theater und Konzerthäuser blieben weiter geschlossen. Der Handel, körpernahe Dienstleister, Tierparks, Zoos, Museen und Bibliotheken durften unter restriktiven Vorschriften (absurde, oft nicht durchführbare Abstandsregeln und Quadratmeterregeln – eine Person pro 20 m2, FFP-2-Maskenpflicht, verpflichtende Test bei Friseurbesuchen, Öffnung bis maximal 19.00 Uhr etc.) wieder öffnen. Die Ausgangsbeschränkungen galten von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr.
Besonders chaotische Regelungen