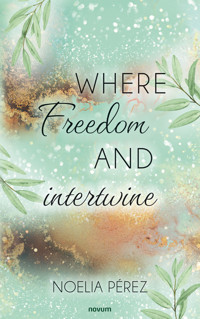15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Solea hatte eigentlich vor, nach ihrer Schulzeit sofort mit einem Studium zu starten. Als sie keinen Studienplatz bekommt, scheint dies ein Wink des Schicksals zu sein, der sie zu ihren Wurzeln nach Spanien zurückführt. Dort lernt sie den attraktiven, aber sehr verschlossenen Enrico kennen und versucht, seine dunklen Geheimnisse zu enthüllen. Dabei wird sie auch schmerzlich mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert, vor der sie zu flüchten versucht. Um diese Flucht zu beenden, muss sie sich allerdings auf einen Richtungswechsel ihres Lebens einlassen. "Wo Leben und Freiheit sich verweben" ist eine Geschichte über Ängste, Selbstzweifel und Rückschläge, aber auch über die Liebe und den Weg zu sich selbst. Ein Weg, den jeder nur selbst gehen kann, der sich aber wie kein anderer lohnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99130-518-7
ISBN e-book: 978-3-99130-519-4
Lektorat: Dr. Angelika Moser
Umschlaggestaltung: Acelya Soylu
Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Widmung
Meine Grosseltern väterlicherseits waren aus Spanien. Während der Zeit der Diktatur von Francisco Franco zogen sie in die Schweiz und bauten sich da ihre Familie auf. Allerdings erkrankte meine Grossmutter schwer an Asthma. Schweren Herzens beschlossen sie und ihr Mann, wieder zurück nach Spanien zu kehren, da das Klima dort in den Bergen und am Meer besser für die Gesundheit der beiden war. Ihre inzwischen erwachsenen Kinder blieben mit ihren eigenen Familien in der Schweiz. In den Ferien besuchten wir sie aber regelmässig. Meine Grossmutter war, aufgrund ihrer Erkrankung, immer auf Sauerstoff angewiesen. Da es damals noch keine tragbaren Asthmageräte gab, war sie, in meinen Augen, zuhause gefangen im Radius ihres Sauerstoffschlauchs. Als Kind fragte ich sie einmal unverblümt und ehrlich, ob ihr nicht langweilig werde so. Sie lachte und verneinte die Frage sofort. Sie habe viele Dinge um sich rum, die sie erfüllten und glücklich machten. Sie war eine begabte Malerin, kochte und backte gerne, bastelte und nähte viel. Und sie schrieb, hauptsächlich Gedichte. Damit füllte sie vor allem die Zeiten, in denen sie im Krankenhaus war. Obwohl sie unvorstellbar schwierige Jahre hinter sich und ein bewegtes Leben geführt hatte, verlor sie niemals den Lebenswillen. Ihre Augen strahlten immer pure Freude und Dankbarkeit aus, sie motivierte alle mit ihrer so positiven Lebenseinstellung. Sie fand die Kraft zum Leben stets in ihrer Familie und ihrem starken Glauben. Und in ihren Gedichten.
Ihre Gedichte hat sie in zwei Gedichtbücher drucken lassen für den Kreis ihrer Familie und ihrer engen Freunde. Ihr zweites Buch begann mit dem Satz:
„Escribir es sentirme viva“ – „Schreiben ist, mich lebendig fühlen.“
Was ich als Kind nie verstanden habe, kristallisierte sich für mich in der Jugend heraus. Nach dem Tod meiner Grossmutter erwischte ich mich, wie ich in schwierigen Situationen immer mehr geschrieben habe. Tagebücher, Gedichte, philosophische Texte, Sprüche und Geschichten. Alles geknüpft an meine Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse. Es half mir, Geschehenes zu verarbeiten und meine oft sehr wirren Gedanken zu sortieren und in eine Reihenfolge zu bringen. Immer mehr verstand ich ihre Aussage, dass sie sich beim Schreiben lebendig fühlte. Und auch wenn ich diese Zeilen mit Tränen in den Augen schreibe, so fühle ich mich von der Liebe meiner Grossmutter umarmt. Und von den Worten in ihren Gedichten, die auch Jahre nach ihrem Tod zu den Herzen derjenigen spricht, die bereit sind, sich dem zu öffnen. Sie hat im Schreiben einen Weg gefunden, uns immer nahe zu sein und in uns mit ihrer Liebe und Güte, ihrer Wärme und Lebensfreude weiterzuleben, die sie uns zeit ihres Lebens geschenkt hat.
Im Schreiben fühle ich mich nicht nur lebendig, sondern auch verbunden mit einem Menschen, mit dem ich eine Lebensphilosophie und eine Leidenschaft teile.
Ihr widme ich dieses Buch. In tiefster Dankbarkeit und Demut.
Und in ewiger Liebe.
Noelia Pérez
Das Ende einer Ära
Es war stressig, ja.
Während ich telefonierend versuchte, mit nur einer Hand mein Schulzeug aus meinem Spind zu holen und in meiner Tasche zu verstauen, redete meine beste Freundin von rechts ununterbrochen auf mich ein. Wie toll es doch sei, dass wir nun endlich unsere Matura bestanden haben und mit dem Studium beginnen können. Gleichzeitig redete meine Mutter über das Handy auf dem linken Ohr eindringlich auf mich ein, ich solle dies und jenes mit einpacken und pünktlich am Flughafen sein. Und dass ich ihr doch bitte noch meine Flugnummer schicken solle. In diesem Moment klingelten die Glocken zum Unterrichtsende durch die Gänge und die lärmenden Schüler rannten alle zu ihren Spinden. Ich wurde von einer Seite unsanft angerempelt, dabei glitten mir die Bücher aus der Hand. Ich fluchte ungehalten: „Verdammte Scheisse!“
Während mich meine Mutter am Telefon tadelte, lachte meine beste Freundin Ylenia schallend los. Dann wandte sie sich wieder ihrem Spind zu, den sie entspannt und in aller Ruhe ausräumte. Diese Ruhe konnte sie sich ja leisten, im Gegensatz zu mir. Sie hatte ihre Prüfungen mit Bestnoten bestanden und sich nicht nur für einen Studienplatz angemeldet, nein mehr noch, diesen sogar bestätigt bekommen. Ich fühlte mich plötzlich total eingeengt und hatte das Gefühl, unter Wasser zu sein und keine Luft mehr zu bekommen. In meinem Kopf war nur noch ein dumpfes Dröhnen und alles vor meinen Augen begann langsam zu verschwimmen.
„Stopp!“, rief ich in diesem Moment, ich hielt es einfach nicht mehr aus. Ich fühlte mich, als hätte ich einen Ballon in meiner Brust, der kurz vor dem Platzen war.
„Mama, ich ruf dich zurück!“, rief ich in das Handy, legte, ohne ihre Antwort abzuwarten, auf und warf es ganz nach hinten in den Spind. Ich stützte mich mit beiden Armen an den Spind und warf Ylenia mit hochgezogener Augenbraue einen langen, strengen Blick zu. Sie verstand sofort, dass gleich mein innerer Vulkan in die Luft gehen würde, wenn sie jetzt nicht sofort ihren Mund hielt. Mir war sowieso alles zu viel im Moment. Fast drei Monate hatte ich ununterbrochen für die Prüfungen gelernt, im Anschluss an diese sofort nach einem Studienplatz gesucht und zum Schluss noch eine letzte Universität in der Schweiz gefunden, die mich auf ihre Warteliste setzte. Alle anderen Universitäten hatten ihre Plätze schon belegt und nahmen mich auch nicht mehr auf ihre Wartelisten. Leider war es die Universität in Bern. Falls ich dort einen Platz bekommen sollte, werde ich entweder pendeln müssen oder mir in der Nähe eine Wohngemeinschaft oder eine Studentenunterkunft suchen. Eigentlich war meine erste Wahl die Uni in Zürich gewesen, aber die war begehrt und eine der ersten, die alle Plätze gefüllt hatte. Ich sollte mich aber nach der offiziellen An- und Abmeldefrist noch telefonisch bei der Universität melden, um nachzufragen, ob ich einen Platz bekäme oder eine derjenigen war, die von der Liste gestrichen wurden. Ich hatte mich schon vor einiger Zeit für ein Jurastudium entschieden. Es waren dessen Inhalte und die Fragen nach dem Recht und der Gerechtigkeit, die mich schon immer fasziniert hatten. Und trotzdem war ich nicht zu 100 % überzeugt von meiner Entscheidung. Und damit meine ich nicht die Wahl des Studiengangs, sondern überhaupt erst die Wahl dieser akademischen Laufbahn an sich. Noch gröber gesagt: ich war mir nicht sicher, ob ich schulisch und beruflich den richtigen Weg für mich eingeschlagen hatte. Gerade nach den Ereignissen in den letzten Monaten. Und ich stellte auch immer mehr in Frage, ob ich generell der Typ Mensch für ein Studium war. Aber jetzt blieb mir nichts anderes übrig, ich hatte mich aus eigenen Stücken dazu entschieden, das Gymnasium zu besuchen. Und nun, wo ich es bestanden hatte, musste ich doch einfach da anknüpfen. Das erwartete man ja von mir. Wie sähe das nur aus, wenn man die Matura bestanden hatte und sich im Anschluss gegen ein Studium entschied? Welches wären denn die Alternativen? Was wollte ich eigentlich? Und wenn ich mal alle Erwartungen von Aussen aus meinen Gedanken verbannen würde, wie würde mein Lebensweg dann aussehen?
Jemand klopfte mir auf die Schulter und ich wirbelte mit einem erschrockenen Schrei herum. Es war Ylenia, die mich nun besorgt musterte.
„Du bist gerade wieder total abgeschweift, nicht wahr?“
Ich schloss kurz die Augen und atmete tief ein. Dann nickte ich und sah meine beste Freundin an. Wir steckten immer noch mitten in der Masse an Schülern, die ihre kurze Pause nutzten, um bei den Spinden das Schulmaterial für die nächsten Stunden zu holen. Diese wirkten alle so motiviert und ehrgeizig in dem, was sie taten. Wenn sie nur wüssten …
„Stopp“, befahl mir Ylenia sanft. Einmal mehr staunte ich über ihre feinen Antennen und mitfühlende Art, mit der sie mich aus meinen Gedanken holte. Ich seufzte tief, löste meinen Blick von Ylenia und stiess mich von meinem Schrank ab. Dann hob ich die Bücher, die noch immer am Boden lagen, auf und stopfte sie in meine Tasche.
Genervt nahm ich das Geschichtsbuch und die letzten drei Deutschbücher aus meinem Fach. Mein Blick fiel auf das oberste Buch. Es war „Andorra“ vom Schriftsteller Max Frisch. Ein Drama, in dem unter anderem die Identitätsfrage thematisiert wurde. Identität, das war ein gutes Stichwort …
„Solea“, schrie Ylenia über den Lärm der Schüler hinweg.
„Was ist?“, fauchte ich sie an, und hatte im gleichen Moment ein schlechtes Gewissen, sie so angefahren zu haben. Sie meinte es ja nur gut. Aber ich war geladen, gereizt, unruhig und fühlte mich hier in den Schulgängen total unwohl. Ich wollte diese Schule so schnell wie möglich wieder verlassen. Eine leichte Übelkeit breitete sich in meinem Magen aus und ich schluckte. „Tut mir leid“, sagte ich an Ylenia gerichtet. „Hast du was gesagt?“
„Ja … ich habe dich gefragt, ob du jetzt endlich bei der Uni Bern angerufen hast? Gestern war doch Anmeldeschluss, heute müssten die fixen Studentenlisten stehen.“
Ich riss meine Augen auf. Alles, was zuvor noch brodelte in mir, wich einer eiskalten Starre, ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. Der Ballon in meiner Brust schrumpfte sofort, jegliche Luft und Spannung entwich ihm. Und wieder klatschten die Bücher auf den Boden. Mit zitternden Händen und pochendem Herzen holte ich mein Handy aus den Tiefen des Spindes und sah auf das Datum im Display, das mir höhnisch ins Auge sprang. Ich drehte mich um, liess meinen Kopf schwer gegen die weisse Fläche knallen, schloss die Augen und liess mich zu Boden gleiten.
„Was ist los?“, hörte ich von rechts. Die Flure leerten sich allmählich. Und in Ylenias Tonfall lag diese warme Empathie und Unvoreingenommenheit, die ich so sehr mochte an ihr. Sie setzte sich vor mich auf den Boden, legte mir eine Hand auf mein Knie und sah mich ruhig und fragend an. Ich blickte ihr in die wunderschönen rehbraunen Augen, die zu der Person gehörten, die in den letzten Jahren wie eine Schwester für mich geworden war. Wir hatten zusammen geweint und gelacht, gestritten und uns wieder versöhnt und uns gegenseitig alles erzählt und anvertraut. Die schrille Glocke, die die nächste Unterrichtslektion ankündigte, liess mich zusammenfahren. Ich schüttelte wie in Zeitlupe den Kopf. Nachdem auch das Echo der Schulglocke verstummt war, antwortete ich leise:
„Ich habe noch nicht angerufen. Ich habe Angst vor der Antwort. Und zwar vor beiden Antworten, die möglich sind.“ Ylenia sah mich mit gerunzelter Stirn an. „Wieso?“
„Einerseits weiss ich nicht, ob ich schon bereit bin für ein Studium. Andererseits … was soll ich ohne Studium und nur mit einer Maturität machen?“
Es war plötzlich so still in diesem Flur, in dem noch vor zwei Minuten die lernhungrigen Schüler herumtobten wie ein Haufen wild gewordener Hyänen. Ylenia stiess die Luft aus, die sie angehalten hatte. Wenigstens hatte sie noch welche, ich hatte gefühlt keine mehr.
„Ruf doch jetzt an. Ich bin bei dir. Irgendwann musst du es ja tun.“
Sie stand auf, griff in meinen Kasten, holte mein Handy heraus und setzte sich mit diesem neben mich. Sie reichte mir meines, während sie ihr eigenes Handy aus der Tasche fischte und für mich die Nummer der Universität von Bern googelte. Sie diktierte mir die Nummer und ich tippte sie in mein Handy ein, doch bevor ich den Anruf startete, sah ich Ylenia an. Sie nickte mir bestimmt und aufmunternd zu. Also holte ich tief Luft, drückte den grünen Knopf, hielt mir das Handy ans Ohr und wartete darauf, dass mich jemand am anderen Ende der Leitung endlich von meinen inneren Qualen erlösen würde.
„Universität Bern, was kann ich für Sie tun?“, trällerte eine fröhliche, hohe Frauenstimme.
„Hier ist Solea Moreno. Ich stehe noch auf der Warteliste für das Jurastudium, das im August beginnt. Können Sie mir sagen, wie es aussieht?“, leierte ich so schnell wie möglich runter.
„Solea Moreno, einen kleinen Moment bitte, ich schaue nach.“
In der Leitung war Musik zu hören.
„Am liebsten würde ich auflegen“, zischte ich Ylenia zu. Meine Nerven waren zum Zerreissen gespannt, ich zitterte am ganzen Körper. Dann klackte es in der Leitung und die Dame war wieder zurück am Apparat.
„Solea Moreno“, wiederholte sie, „leider konnten wir sie nicht aufnehmen für dieses Jahr, alle Plätze wurden belegt. Sollen wir Sie für das nächste Jahr einschreiben?“
Das Klopfen meines Herzens kam kurz aus dem Takt, ehe es weiter wie wild gegen meine Brust hämmerte. Wie ferngesteuert antwortete ich:
„Nein, danke. Meine erste Wahl wäre sowieso die Universität in Zürich gewesen. Nach Bern hätte ich pendeln müssen oder …“
Ich unterbrach mich selbst. Meine Probleme interessierte sie doch nicht, kein Grund also, dieser fremden Frau mein Herz auszuschütten.
„Ich probiere es dann nochmals in Zürich“, sagte ich schnell. „Danke für die Auskunft, auf Wiederhören.“
Ich legte auf, ohne verstanden zu haben, was die nette Frau der Administration noch sagte oder fragte. Ich lehnte meinen Kopf zurück an die Spinde und schloss die Augen. Ylenias Hand drückte sanft meine Schulter. Es tat gut, jetzt gerade nicht allein zu sein. Alle Anspannung wich aus mir. Alle Ängste und Unsicherheiten flossen gerade langsam davon. Wieso hatte ich mit dieser Absage einen kleinen Hüpfer der Freude tief im Inneren empfunden? Hatte ich innerlich heimlich ebenfalls auf ein „Nein“ gehofft?
„Was willst du jetzt tun?“, fragte Ylenia vorsichtig.
Ich raufte mir die Haare, warf dann meine Hände in die Luft und antwortete resigniert: „Meinen Eltern berichten, dann endlich in die Ferien fliegen und nächstes Jahr mit dem Studium beginnen. Was anderes bleibt mir im Moment nicht übrig, oder?“
Ich griff erneut nach meinem Handy und wählte wieder die Nummer meiner Mutter, die mit meinem Bruder und meinem Vater bereits nach Spanien in die Sommerferien geflogen war. Ich würde morgen nachfliegen und noch zwei Wochen Ferien mit ihnen zusammen verbringen.
„Solea, warum legst du einfach auf?“, fragte meine Mutter aufgebracht und ohne Begrüssung, ich erkannte auch den leicht gekränkten Unterton in ihrer Stimme.
„Ich habe den Platz für das Studium im September nicht bekommen“, brach ich ohne Begrüssung heraus, trocken und nüchtern, ohne jegliche Emotionen. Einen Moment lang herrschte Stille. Dann fragte meine Mutter:
„Wieso denn nicht?“
„Ich war auf der Warteliste in Bern. Ich schaffte es schlichtweg nicht, gleichzeitig meine Prüfungen zu managen und nach einem Studienplatz zu suchen. Es war mir, neben allem, was sonst noch gelaufen ist, einfach zu viel und zu stressig. Und als ich mich anmelden wollte, waren zu dem Zeitpunkt alle Plätze schon belegt. Die Uni in Bern hat mich als einzige noch auf die Warteliste gesetzt, heute habe ich nachgefragt, aber auch sie haben alle Plätze besetzt.“
Ich verstummte, bevor ich mich um Kopf und Kragen redete. Es brachte nichts, es gab keine Entschuldigung für diese Situation. Es war wieder einen Moment still in der Leitung. Plötzlich lachte meine Mutter.
„Das ist typisch du! Das heisst, du wirst ein Jahr Pause machen, bevor du nächstes Jahr beginnst zu studieren?“
„Habe ich eine andere Wahl?“, fragte ich zynisch mit einem bissigen Unterton.
„Nein“, sagte sie. „Überleg dir aber, was du in diesem Jahr machen wirst. Vielleicht einen Studentenjob, eine Weiterbildung, Kurse oder so, ah, und die Anmeldung fürs Studium, ja! Besser früher als zu spät. Na ja, aber Solea, wegen der Abflugzeiten …“, fuhr sie fort, doch ich unterbrach sie schnell.
„Ich weiss, ich schicke dir die Flugnummer noch per WhatsApp, bis dann!“, sagte ich schnell und legte auf wie schon beim ersten Mal. Ich schnaubte, stand auf und las ein zweites Mal meine Bücher vom Boden auf. Was für ein Bild. Ich identifizierte mich mit den Büchern. Tiefer und unsanfter als auf den hässlichen Linoleumboden im Untergeschoss der Schule konnte man wohl nicht fallen. Dann stopfte ich diese in meine Tasche, zerrte noch meine Sporttasche aus meinem Fach, entfernte das Schloss davor und machte mich ratlos und ausgelaugt auf dem Weg zum Ausgang. Ylenia holte mich rasch ein, legte mir einen Arm um die Schulter und flüsterte mir verschwörerisch ins Ohr:
„Ich würde das Jahr ausnützen.“
Ich hielt abrupt an. „Wie meinst du das jetzt, Ylenia?“
„Na ja, wir wissen beide, dass du im letzten Jahr über die Grenzen deiner Belastbarkeit hinausgeschossen bist. Und ganz ehrlich, Solea. Hast du in deinem Leben jemals gelebt? Hast du jemals gelebt, ohne an Schule zu denken? Hast du jemals gelebt, ohne an deine Zukunft zu denken?“
Ich sah betreten den Boden an. Wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, diesen grün einzufärben? Grün war eigentlich die Farbe, die für Ruhe, Sicherheit und Vertrauen stand, das ist mir aus dem Bildnerischen Gestalten noch geblieben, als wir uns mit dem Farbkreis und der Bedeutung verschiedener Farben beschäftigt hatten. Aber dieses Grün war richtig dunkel und schmutzig, überall waren braune und graue Streifen mit eingearbeitet. Sollte das Kunst sein? Wenn ja, betrachtete ich es definitiv mit einem anderen Auge als der Künstler selbst. Ylenia räusperte sich kräftig und holte mich damit zurück in den Moment. Sie kannte mich sehr gut und wusste, dass ich nicht selten aus der Realität abschweifte und mich in unlogische, nichts nützende, energieverschwendende Gedanken flüchtete. Ich blickte sie an. Sie ergriff meine Schultern und sah mich ganz bestimmt an. Mit fester, theatralischer Stimme trug sie vor:
„Solea, ich prophezeie dir, dass ein unvergessliches Jahr voller Leben und Marmeladenglasmomenten vor dir liegt. Sobald du durch die Türen dieser Schule treten wirst, wirst du als neuen Menschen geboren und ein neues Leben beginnen. Wer weiss, vielleicht landest du in einer Parallelwelt, so wie die Kinder in den Chroniken von Narnia von Clive Staples Lewis.“
Ich konnte nicht anders und prustete los.
„Übertreib mal nicht, okay?“
Ich setzte mich wieder in Bewegung, Ylenia kam sofort hinterher und rempelte mich spielerisch an.
„Solea, was ich damit sagen möchte: Lerne, das Leben zu geniessen, und entfalte deine Freiheiten.“
Ich stupste zurück und legte ihr dann einen Arm um die Schultern.
„Das werde ich versuchen“, versprach ich ihr und legte einen dankbaren Unterton in meine Stimme. Dann straffte ich die Schultern und stiess zum letzten Mal die schwere Eingangstüre dieses Schulhauses auf. Es ging sicher nicht in eine fantastische Parallelwelt wie Narnia, es ging hinaus auf die Strasse, in die brutale Realität. Ich würde meine Schulzeit nicht vermissen, ich war froh, dass sie zu Ende war. Und während ich hörte, wie die Türe im Hintergrund ins Schloss fiel, fühlte ich, wie ein Teil des Stresses hinter diesen geblieben war. Das liess Platz für ein ganz neues, komisches Gefühl. Ein Gefühl der Erleichterung, der Freude. Darüber, dass ich das Studium verpassen würde? Ich konnte es nicht einordnen. Doch ich beschloss, meinen Gedanken schnell ein Ende zu setzen. Ich würde nun erst mal die Ferien geniessen, mein studienfreies Jahr planen und mich für nächsten Sommer anmelden. Alles halb so wild, die Welt würde sich ja wie gewohnt weiterdrehen. Dass mir das Leben einen Strich durch die Rechnung machen würde und Ylenias Prophezeiung wahr werden könnte, konnte ich noch nicht ahnen, als ich mit ihr zusammen ein gewaltiges Lebenskapitel hinter mir liess.
Ein Jahr Leben
Am nächsten Morgen reiste ich wie vereinbart in die Ferien nach San Javier, eine Gemeinde in der autonomen Region Murcia im Südosten Spaniens. Am Flughafen von Alicante wartete ich erst mal ungeduldig auf meinen Koffer, der natürlich als einer der letzten auf dem Gepäckausgabeband auftauchen würde. Das waren vermutlich die Konsequenzen davon, dass ich immer überpünktlich und als eine der ersten meinen Koffer eincheckte. Während der Wartezeit liess ich meinen Blick umherschweifen. Im Dutyfree, durch das ich gekommen war, dominierten helle, wilde und lebensfrohe Farben. Rot und Gelb, die Farben der spanischen Flagge, waren omnipräsent in den Schlüsselanhängern und Magneten, in den Keksdosen und sogar den Plüschtieren, die verkauft wurden. Vor den Toiletten standen die Frauen Schlange, während es bei den Männern ein geschmeidiges Kommen und Gehen war. Auf den benachbarten Gepäckbändern drehten die Koffer aus Paris, Lissabon und Madrid ihre Runden. Als ich meinen Koffer auf dem Band von Zürich erblickte, hechtete ich hin und riss ihn vom Band. Doch dann stoppte ich mich selber.
„Nicht so hektisch“, flüsterte ich mir zu. Langsam und bewusst, einen Fuss bedächtig vor den anderen setzend lief ich zum Ausgang hin. Dann passierte ich endlich den Zoll, nein, ich hatte nichts anzumelden, grün also. Ich durchquerte die kleine Ankunftshalle des Flughafens und steuerte direkt auf den Ausgang zu. Draussen hielt ich inne. Mehrere Personengruppen warteten gemeinsam mit mir auf ihre Taxis oder diejenigen, die sie abholen würden, und unterhielten sich. Ihre Sprache, die auf mich einprasselte, schoss direkt so warm durch meine Venen wie das Wetter, das mich in diesem Moment in Südostspanien willkommen hiess. Mit dieser Wärme breitete sich ein Gefühl von Zugehörigkeit in mir aus. Es war schön, wieder hier zu sein. Jede Person, dessen Blick ich kreuzte, lächelte mich warm und willkommen an. Meine Mundwinkel zogen sich ebenfalls automatisch hoch und erwiderten die Gesten mit voller Ehrlichkeit. Ich entspannte mich allmählich etwas und sah hoch zum strahlend blauen Himmel, an dem nur vereinzelte süsse, kleine Wolken zu sehen waren. Ich schloss die Augen und genoss die Wärme der Sonne meiner Heimat auf meinem Gesicht. Jedes Mal, wenn ich in Spanien landete, kehrte ein Stück meiner Seele nach Hause. In Spanien konnte ich viel eher die Person sein, die ich war. Ich konnte hier die südländischen Charakterzüge, die ich von der Familie meines Vaters geerbt hatte, voll und ganz ausleben, ohne anzuecken oder mich erklären zu müssen. Als jemand laut meinen Namen rief, zuckte ich zusammen und schreckte aus meinem schon fast entspannten Zustand hoch. Ich sah mich suchend um und mein Blick blieb an dem silberfarbenen Mietauto hängen, das vor dem Flughafengebäude nur ein paar Meter von mir entfernt parkte. Davor stand meine Mutter in ihrem grellgelben, geblümten Sommerkleid und winkte mich aufgeregt zu sich. Ich setzte mich langsam in Bewegung, doch es konnte ihr gar nicht schnell genug gehen. Sie rannte auf mich zu und schlang ihre Arme um mich. Sie drückte mich fest an sich und verteilte Küsschen auf meiner Wange. Ich kniff die Augen zusammen und zog meine Nase kraus, doch ich liess sie gewähren. Zwei Wochen hatten wir uns nicht gesehen, nur gelegentlich telefoniert oder geschrieben. Ich wusste, wie wichtig dieser Moment für sie war, es fiel ihr noch immer schwer, sich von mir abzulösen und mir meine Freiheiten zu lassen. Nachdem sie mich losgelassen hatte, sah sie mich prüfend und mit einer leichten Besorgnis in ihrem Blick an.
„Mama, mir geht es gut, wirklich!“, versicherte ich ihr, da ich genau wusste, welche Frage sie gleich gestellt hätte.
„Ach, Solea, bist du sicher?“
„Ja“, erwiderte ich kräftig und sagte: „Das Studium kann ich auch nächstes Jahr beginnen. Klar, es ist ärgerlich und es nervt mich auch, nicht jetzt starten zu können, aber es ist kein Weltuntergang, oder?“
Ich merkte, wie ich langsam anfing, dieses Spiel zu geniessen. Nach aussen die Zerknirschte zu spielen, die so enttäuscht war, dass sie das Studium nicht beginnen konnte. Aber innerlich triumphierte ich mittlerweile, dass ich ein Jahr frei hatte. Ein Jahr frei bedeutete doch ein Jahr Leben. Ein Jahr Freiheit. Ein Jahr Spontanität. Bisher war mein gesamtes Leben durchgetaktet, jeder Tag vom Kindergarten bis zur Matura penibel durchgeplant. Zu Beginn war es noch meine Mutter, welche die Strukturen vorgab, doch irgendwann baute ich mir auch meine eigenen auf. Ich war es so gewohnt, es gab mir die nötige Sicherheit, die ich brauchte. Bis zu einem Punkt, an dem das ganze Konstrukt zusammenbrach und jegliche Planung nicht mehr funktionierte. Es war ein Lebensabschnitt, in dem ich ins Straucheln kam, dem Stress verfiel und fast zerbrach. Und ich spürte einen Teil in mir, der endlich aus diesem Käfig ausbrechen wollte. Aber ob meine Eltern dies ohne Wenn und Aber akzeptieren würden, wusste ich nicht. Eigentlich war ich volljährig und konnte tun und lassen, was ich wollte. Trotzdem fügte ich mich immer noch den ungeschriebenen Regeln meiner Eltern und meinen eigenen Erwartungen von Leistung und Bildung. Um nicht in Erklärungsnot zu kommen, wieso ich jetzt in der nächsten Zeit jegliche Planung über den Haufen werfen würde, verfolgte ich mein Muster weiter, verschränkte die Arme, blickte zu Boden und tat so, als wäre mir die ganze Situation unangenehm. Ich musste mich so zusammenreissen, um den nach Freiheit schreienden Vogel in meiner Brust keine Beachtung zu schenken und den Käfig schön geschlossen zu halten. Irgendwann würde mein Moment kommen, um auszubrechen. Das fühlte ich. Ich musste nur noch etwas Geduld haben. Eine Weile sah sie mich an, dann nickte sie.
„Da hast du wohl recht“, seufzte sie.
Ich zuckte mit den Schultern und lächelte.
„Papa und Alejandro wissen es wahrscheinlich auch schon, oder?“
Sie nickte. Eigentlich sollte mir doch klar sein, dass sie meinem Vater und meinem Bruder alles erzählen würde. In unserer Familie hatte man keine Geheimnisse. Alles, was man tat, musste man rechtfertigen oder erklären.
„Ich glaube, es wird Zeit für den Strand“, murmelte ich, als ich mein Gepäck in den Kofferraum des Autos hievte und meine Mutter den Motor startete. Ich setzte mich neben sie auf den Beifahrersitz und sie lenkte das Auto aus dem Flughafengelände raus, direkt auf die Autobahn nach San Javier.
Während der einen Stunde Fahrt zum kleinen Ferienhaus meiner Grosseltern sprachen wir nicht viel. Sobald wir von der Autobahn runterfuhren und auf die Strasse an der Strandpromenade einbogen, öffnete ich das Fenster auf meiner Seite und liess alle Gerüche und Geräusche auf mich einwirken. Der Duft nach Palmen und Sand, der Geruch nach dem hoch konzentrierten Salzwasser des Mar Menor, der warme Sommerwind. Die bellenden Hunde am Wasser, die spielenden Kinder, die quietschenden Bremsen der klappernden, alten Fahrräder, das Geschnatter und der Flügelschlag der Möwen. All das versetzte mich in eine Zeit zurück, als ich selber noch klein war und im Wasser noch mit Schwimmflügeln herumgeplanscht hatte. Damals hatte sich meine so durchgeplante Welt noch nicht um Schule und Studium gedreht. Als das Auto vor unserem Ferienhaus zum Stehen kam, sprang ich sofort raus und lief zu dem kleinen, weissen Tor unseres Ferienhauses. Während meine Mutter mein Gepäck auslud, lief ich direkt auf meinen Vater und meinen Bruder zu, die auf der Terrasse im Schatten auf ihren Liegestühlen gerade die Siesta genossen. Nachdem ich auch meinen Vater und meinen Bruder begrüsst hatte, betrat ich das kleine Haus. Es gehörte meinen Grosseltern väterlicherseits. Sie hatten allerdings noch ein zweites Haus in der spanischen Provinz Salamanca. Das war ihr Hauptwohnsitz, wo sie ihre Sommer verbrachten, die dort durch die Höhen der Sierra von Béjar angenehm kühl waren. Im Winter liessen sie sich dann jeweils in diesem kleinen Haus am Strand nieder, um dem eisigen und kalten Winter in den spanischen Bergen auszuweichen. Da das Haus also über Sommer leer stand, durften wir dieses als Ferienresidenz benutzen. Alles hier war familiär und heimelig eingerichtet. An den Wänden hingen die Bilder und Gedichte, die meine Grossmutter selber gemalt und geschrieben hatte. Auf den Möbeln im Wohnzimmer standen unzählige Fotos aller Familienmitglieder in unterschiedlichen Lebensabschnitten. Ich lief den langen, dunklen Flur entlang zum letzten Zimmer auf der linken Seite, wo ich meinen Koffer auf das Bett unter dem Fenster warf, mich auf das gegenüberliegende setzte und kurz durchatmete. Ich fühlte mich gerade so leer. So ratlos und sinnsuchend. Ich war es gar nicht gewohnt, in einen Tag zu starten, ohne zu wissen, was mich morgen oder übermorgen erwartete. Ich war es nicht gewohnt, ohne ein Ziel in die Zukunft zu blicken. Gerade fühlte ich mich, als würde ich schweben, ohne festen Boden unter meinen Füssen. Das, was ich hier gerade tat, war das Verlassen meiner Komfortzone, die Überwindung meiner Grenzen. Was möchte ich jetzt eigentlich aus meinem Leben machen? Eigentlich habe ich alle Ziele erreicht, die ich erreichen wollte. Um ehrlich zu sein, das Studium an sich war nie eines dieser Lebensziele, das aus eigener, tiefster Überzeugung auf meiner Liste stand. Ich habe es nur zu einem gemacht, weil ich den Eindruck hatte, dass es von der Gesellschaft erwartet wurde, nach der Matura ein Studium anzuhängen. Wieso ich das Gymnasium und die Matura überhaupt besucht und gemacht hatte? Weil ich damals noch der festen Überzeugung war, dass ich nach den vier Jahren, nach der Matura, studieren möchte. Aber in vier Jahren, in denen man von einem Teenager zu einer jungen Erwachsenen heranwächst, kann so viel passieren und gewisse Visionen verändern sich. Natürlich auch beeinflusst durch alles, was um einen herum passiert. Bevor meine Gedanken einen Abflug machen konnten und sich in Richtungen ausdehnten, die ich nicht mehr kontrollieren konnte, gab ich mir einen Ruck und holte die wichtigsten Sachen aus dem Koffer. Diese räumte ich in den Schrank, der zur Hälfte gefüllt war mit den Habseligkeiten meiner Grosseltern. Den Rest liess ich im Koffer auf dem Bett. Ich beschloss, auf den Strand zu verzichten und mich stattdessen in einer Sporteinheit auszutoben. Also zog ich mir meine Sportsachen an, kurze Shorts und ein Top, und schlenderte in die Küche. Aus dem Kühlschrank nahm ich den Teller mit den saftigen Wassermelonenstücken und setzte mich damit an den kleinen Küchentisch. Gerade als ich mir das erste Stück in den Mund schob, betrat mein zwei Jahre älterer Bruder den Raum. Seine Frisur war total verwuschelt von der Siesta und seine dunkelblonden Haare verdeckten seine graublauen Augen. Er stibitze sich ein Stück Wassermelone vom Teller und holte sich ein Glas aus dem Schrank, das er mit Wasser füllte. Mit vollem Mund nuschelte ich:
„Hey Alejandro, was geht? Hat sich hier viel verändert?“
Er drehte sich um und lehnte sich dann lässig an die Arbeitstheke. Mit Schwung schüttelte er sich die Haare aus den Augen.
„Nee, nicht wirklich, unsere Nachbaren kennst du ja alle noch. Aber kannst du dich noch an das Ferienhaus am anderen Ende des Dorfes erinnern, das mit dem riesigen Pool? Dieses ist im Moment vermietet an eine coole, gemischte Freundesgruppe. Zwei davon sind aus Nordspanien und drei aus dem Süden. Wir sind viel zusammen unterwegs, am Strand oder auch mal am Abend für eine Runde auf der Gokart-Bahn oder zum Bowling im Einkaufscenter.“
Ich lächelte.
„Wenn du magst, kannst du ja mal mitkommen, du würdest dich bestimmt auch gut mit ihnen verstehen. Wir gehen heute Abend erst was essen und dann ins Kino gegenüber vom Einkaufszentrum.“
„Nein, heute lieber nicht, ich bin gerade erst angekommen und will mich noch ein bisschen ausruhen.“
Alejandro nickte und stellte sein leeres Glas in die Spüle. Dann begab er sich zur Türe, doch er drehte sich nochmals um.
„Aber ein anders mal, ja? Da wäre jemand, der dir gefallen würde“, sagte er und zwinkerte mir zu.
„Hey!“, rief ich spielerisch empört und warf das Geschirrtuch neben mir nach ihm. Alejandro war schneller, verschwand zur Tür raus und das Tuch blieb in der Türklinke hängen.
„Gehst du joggen?“, hielt mich die Stimme meiner Mutter zurück, als ich etwa eine Stunde später gerade das Tor passieren wollte. Die Nachmittagshitze wich einer lauen Kühle, begleitet von einer angenehmen, frischen Brise. Ich drehte mich um und sah sie mit einer erhobenen Augenbraue an. Man konnte auch nichts machen, ohne dass jemand aus der Familie etwas mitbekam.
„Ist schon gut, aber übertreib nicht!“, erwiderte sie sofort und wandte sich wieder ihrer Lektüre zu, einem dieser Heftchen, die man für wenig Geld am Kiosk bekam. Auf dem Titelbild prangte Felipe VI., König von Spanien mit seiner Frau Letizia und den beiden Töchtern Leonor und Sofia von Spanien. Ich fragte mich, was dieses Mal von den Medien über die Königsfamilie berichtet wurde und ob es überhaupt der Wahrheit entsprach. Ich schüttelte die Gedanken ab, öffnete das kleine, weisse Tor, trat auf die Strasse, wandte mich nach rechts in Richtung Strand und setzte mir meine grossen, gepolsterten Kopfhörer auf. Zum Lied „Vivir Mi Vida“ von Marc Anthony joggte ich der Meeresluft entgegen.
Etwa zwanzig Minuten später, als ich das Meer bereits wieder im Rücken hatte und auf dem Heimweg war, wollte ich eine Abkürzung über den alten Fussballplatz nehmen, der seit Jahren schon nicht mehr bespielt wurde. Doch der Weg war mir versperrt. Da stand ein Stall mit vier Boxen. Obwohl dieser klein war, wirkte er sehr einladend. Auf der Weide im Schatten eines Baumes stand nur ein Pferd, das Fell glänzte wunderschön sandfarben. Die Beine waren bis zu den Knien schwarz, genauso wie seine Mähne und sein Schweif. Ich erkannte seinen muskulösen und anmutigen Hals, seinen athletischen Körperbau und seinen eleganten Kopf. Es war ein wunderschönes Exemplar der Pura Raza Española, der reinen spanischen Rasse. Ein Hinterhuf war angewinkelt und die Augen leicht geschlossen, doch als ich durch das dürre Gras auf den Zaun zulief, schreckte es zusammen, warf den Kopf hoch und beäugte mich misstrauisch. Ich trat an den Zaun und versuchte, es anzulocken. Es bewegte sich nicht, starrte mich aber weiterhin an. Seine Muskeln waren angespannt, seine Nüstern geweitet und seine Ohren bewegten sich unruhig. Ich hatte das Gefühl, dass ein Konflikt in ihm tobte. Ich pfiff leise. Nach einem kurzen Zögern setzte sich das sandfarbene Tier in Bewegung und kam langsam und bedächtig zu mir an den Zaun. Es hielt aber genau diesen Sicherheitsabstand, dass ich es nicht berühren konnte. Plötzlich fiel ein riesiger Schatten neben mich. Daraufhin drehte ich mich langsam um. Ich schaute geradewegs in ein weiteres elegantes Gesicht eines Pferdes. Dieses Mal war es eine schöne Schimmelstute, mit hoch erhobenem Kopf. Sie bliess mir ihren warmen Atem ins Gesicht, so nahe stand sie vor mir. Die schweissnassen Flanken des Pferdes hoben und senkten sich schnell. Ich nahm meine Kopfhörer von den Ohren, hängte sie mir um den Hals, stoppte die Musik, trat einen Schritt zur Seite und schenkte nun endlich auch ihrem Reiter Beachtung, indem ich seinen Blick suchte. Ich musste meine Hand an die Stirn halten, da die Sonne blendete. Der Mann, der locker im Sattel der Stute sass, hielt in einer Hand die Zügel, die andere hatte er zum Gruss an seinen Vaquerohut gehoben und nickte mir zu. Stotternd grüsste ich ihn auf Spanisch. Er lächelte mich distanziert, aber dennoch freundlich an und sagte:
„Wie ich sehe, hast du dich mit meinem Pferd angefreundet.“
Er sprach kein Kastilisch, das fiel mir sofort auf. Sein Spanisch klang viel weicher und sanfter, fast so wie ein selbst komponiertes Lied. Die Wörter reihte er melodisch aneinander, indem er gewisse Endungen einfach wegliess. Ich war fasziniert von dem Charme dieses Klanges. Noch mehr aber faszinierte mich sein Charisma. Er wirkte so unnahbar und distanziert, doch genau das packte mich. Irgendwas an diesem Mann mir gegenüber löste Gefühle aus, von denen ich im Moment eigentlich nichts wissen wollte. Ich versuchte, das leichte Kribbeln in meinem Magen zu unterdrücken, und schluckte. Dann erkannte ich an seinem erwartungsvollen Blick, dass er noch auf eine Reaktion meinerseits wartete, auch wenn er keine Frage gestellt hatte. Verdattert nickte ich und er stieg mit einer Leichtigkeit ab. Er war fast einen Kopf grösser als ich und hatte dunkle, fast schwarze Augen. Von der gleichen Farbe waren auch seine dichten Haare, die ihm bis in den Nacken reichten. Als er seinen Hut vom Kopf gezogen hatte, war ihm eine Strähne in die Stirn gefallen, die er sich jetzt mit einer geschmeidigen Bewegung zurückstrich.
„Das ist Amira“, stellte er die Stute am Zügel vor, dann deutete er auf den sandfarbenen Hengst auf der Weide.
„Und der da, das ist Fandango“, sagte er knapp, schnell und fast ablehnend. Es erstaunte mich, dass er bei der Vorstellung von Amira eine andere Haltung eingenommen hatte als bei der von Fandango. Ich sah zu dem Pferd hinüber, das nach einem andalusischen Tanz benannt war. Irgendwie passte der Name wie die Faust aufs Auge zu dem Hengst, der ein zärtliches Feuer ausstrahlte. Mein Blick kehrte zu dem Mann zurück, der mich noch immer musterte. Ich streckte ihm die Hand entgegen und stellte mich vor. Er umfasste sie mit einem kräftigen Griff, in dem trotzdem so viel Sanftheit und Vorsicht lag. Wie konnte das sein, dass ein Mensch so viele Gegensätze miteinander vereinbaren konnte? Wie konnte es sein, dass er sowohl Kälte und Distanz als auch Wärme und Vertrautheit gleichermassen ausstrahlte? Ich versuchte krampfhaft, die Wärme seiner Berührung zu ignorieren.
„Solea“, sprach er meinen Namen aus. Dann stellte er sich selbst als Enrico vor.
Ungeschönte Wahrheit
Ich sass auf einer umgedrehten Kiste am Putzplatz im kühlen Stall und nippte an der kalten Cola, die ich von Enrico bekommen hatte. Ich beobachtete ihn, wie er Amira absattelte, sie putzte und ihre Beine mit kaltem Wasser abspritzte. Mir fiel auf, mit wie viel Ruhe und Hingabe er sich um seine Stute kümmerte. Er war mit allen seinen Sinnen bei ihr und schenkte ihr seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Währenddessen summte er vor sich hin. Die sanfte, rhythmische Melodie kam mir vertraut vor, obwohl ich sie noch nie zuvor gehört hatte. Ich räusperte mich und fragte: „Woher kommst du eigentlich?“
Er hielt sofort inne, verstummte und sah mich über Amiras Rücken hinweg aus seinen dunkeln, fast schwarzen Augen aus an.
„Aus Sevilla. Andalusien“, erwiderte er knapp, ohne den Blick von mir zu wenden. Das leuchtete mir ein, daher kam also sein Dialekt. Dieser war bekannt dafür, dass einige Buchstaben nicht deutlich artikuliert oder sogar ganz weggelassen wurden. Dies betraf vor allem das „S“ oder „D“, die an einem Wortende einfach verschluckt oder wie ein „H“ ausgesprochen oder nur gehaucht wurden. Das war der Grund dafür, dass es viel sanfter und melodischer klang als das bekannte Kastilisch. Auch hier in San Javier fiel mir das im Dialekt von Südostspanien teilweise ganz leicht auf, aber in Sevilla war dieser natürlich sehr ausgeprägt.
„Was treibt dich denn hierher nach San Javier?“
„Ferien. Ein paar Freunde haben mich eingeladen, mit ihnen zwei Wochen hier zu verbringen.“
„Und Amira und Fandango, gehören sie beide dir?“
„Gewissermassen, ja“, antwortete er nickend und sah mich mit einem prüfenden Blick lange an. Ich erwiderte diesen stumm, aber meine unausgesprochenen Fragen lagen in der Luft. Enrico seufzte, kam um die Stute herum und lehnte sich leicht an ihre Schulter. Er verschränkte die Arme. Dann beantwortete er mir meine Fragen, als könnte er meine Gedanken lesen.
„Meine Familie hat eine Ranch in der Nähe von Sevilla. Sie züchtet und trainiert seit Generationen Rejoneopferde, die für den spanischen Stierkampf eingesetzt werden. Ich habe vor einigen Jahren zudem angefangen, geführte Reittouren durch Andalusien anzubieten, Amira ist dabei mein Hauptpferd. Gemäss Pass ist die Ranch übergeordnet Eigentümer von Amira. Sie gehört also dem Betrieb, dem Unternehmen.“
Jetzt stockte er kurz und presste die Kiefer aufeinander. Dann räusperte er sich und sagte: „In Fandangos Pass bin ich aber als alleiniger Eigentümer eingetragen, er gehört mir als Privatperson. Die Ranch hat keinen Anspruch auf ihn.“
Staunend hörte ich ihm zu. Aber ein kleines Detail war mir nicht entgangen. Er sprach davon, dass seine Familie Rejoneopferde züchtete. Und er? Bot er nur die Reittouren an? Hatte er sich bewusst aus der Zucht rausgenommen? Ich versuchte ihm diese Information zu entlocken, indem ich Enrico in meiner nächsten Frage bewusst mit involvierte.
„Wenn du sagst, ihr züchtet Pferde für den Stierkampf … bedeutet das auch, dass ihr selber ebenfalls Stierkämpfe bestreitet?“