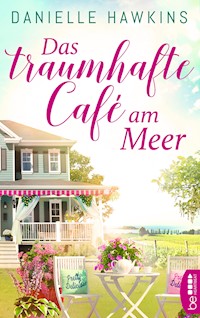8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Liebe enttäuscht, flieht Josie zu ihrer Tante Rose nach Neuseeland. Zwischen Kühen und Schafen hofft sie, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Rose empfängt sie mit offenen Armen – und einem kräftigen Gin Tonic. Das hilft fürs Erste. Aber dann wird Rose schwer krank und Josie beschließt, sich um ihre Tante zu kümmern. Ihre Jugendliebe Matt wird dabei zu ihrer wichtigsten Stütze, und Josie muss sich fragen, ob die große Liebe nicht vielleicht doch in der neuseeländischen Provinz auf sie wartet.
Doch kann sie ihr altes Leben endgültig aufgeben und ihr Glück in der Ferne finden?
Dieses E-Book erschien vormals unter "Dinner mit Rose".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Von der Liebe enttäuscht, flieht Josie zu ihrer Tante Rose nach Neuseeland. Zwischen Kühen und Schafen hofft sie, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Rose empfängt sie mit offenen Armen – und einem kräftigen Gin Tonic. Das hilft fürs Erste. Aber dann wird Rose schwer krank und Josie beschließt, sich um ihre Tante zu kümmern. Ihre Jugendliebe Matt wird dabei zu ihrer wichtigsten Stütze, und Josie muss sich fragen, ob die große Liebe nicht vielleicht doch in der neuseeländischen Provinz auf sie wartet.
Doch kann sie ihr altes Leben endgültig aufgeben und ihr Glück in der Ferne finden?
Dieses E-Book erschien vormals unter »Dinner mit Rose«.
Über Danielle Hawkins
Danielle Hawkins arbeitet als Tierärztin und lebt gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern auf einer Schaffarm in Neuseeland.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Danielle Hawkins
Wo vielleicht die Liebe wartet
Roman
Aus dem Englischenvon Nina Bader
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Epilog
Danksagung
Impressum
Kapitel 1
ZEHN KILOMETER SÜDLICH der Stadt fuhr ich die steile, von tiefen Furchen durchzogene Auffahrt hoch, lenkte den Wagen um ein großes Schlagloch und eine mit Eierkürbissen gefüllte Schubkarre herum und parkte auf dem staubigen Schotter neben dem Haus, wo ich von einer hysterisch kläffenden Hundemeute empfangen wurde.
Ich öffnete die Autotür einen Spaltbreit und rief in scharfem Ton »Schluss! Aus! Platz!«, worauf hin sich die Hunde hechelnd auf den Boden sinken ließen. Jetzt, wo sie wie zu Salzsäulen erstarrt waren, konnte ich sie zählen. Es waren vier.
»Kindchen!« Tante Rose rauschte mit einem halb ausgewachsenen rosigen Schweinchen im Schlepptau um die Hausecke. »Wie geht es dir, mein Herz?«
»Ausgezeichnet«, versicherte ich ihr. »Ich freue mich, dich wiederzusehen.« Tante Rose war weit über eins achtzig groß und gebaut wie ein Panzer, so dass ich mich recken musste, um sie zu umarmen, was mir nur selten passiert. Da ich selbst fast die Einsachtzigermarke erreiche, war das zur Abwechslung einmal ganz angenehm.
Sie lächelte mich liebevoll an. »Ganz meinerseits«, sagte sie. Ihre Stimme klang weich und samtig, mit voll tönenden Vokalen, und man dachte beim Zuhören unwillkürlich an Übungen in Sprechtechnik, Gurkensandwiches und Teestunden mit dem Vikar, ja man neigte dabei sogar eher dazu, in seinen Gedanken das distinguierte Wort ›man‹ zu verwenden. Solche sprachlichen Gepflogenheiten sind seltsam ansteckend.
»Und? Gibt es was Neues?«, erkundigte ich mich.
»Ach, ich war schrecklich beschäftigt. Dieses unfähige Bibliothekskomitee hat diese Woche unglaublich viel meiner Zeit in Anspruch genommen, und der Garten rächt sich. Ich werde deine Dienste benötigen, Kind.«
»Kein Problem«, nickte ich. »Du kannst mich in Kürbissen bezahlen.«
»Diese verflixten Dinger!«, schimpfte Rose. »Jedes Jahr pflanze ich ein paar kleine, mickrige Setzlinge, die in den ersten beiden Monaten ständig einzugehen drohen und jede halbe Stunde gegossen werden müssen. Und dann gehe ich nur kurz zum Milchholen, und schon verwandeln sie sich in Monster.«
»Warum pflanzt du dann überhaupt noch welche?«
»Es ist wie eine Sucht«, entgegnete sie düster. »Vermutlich brauche ich eine Therapie.«
»Du könntest ja eine Selbsthilfegruppe besuchen. Du weißt schon – nach dem Motto ›Hallo, ich bin Rose Thornton, und mein letzter Kürbisrückfall ist erst zwei Tage her.‹«
»Gute Idee«, lobte sie. »Komm rein. Es müsste langsam Zeit für einen Gin Tonic sein.«
* * *
Wir machten es uns mit unseren Drinks in der Hand nebeneinander in zwei alten Liegestühlen auf der Veranda bequem. Roses Haus diente einst als Wohngebäude einer großen Farm, die schon vor langer Zeit in mehrere kleinere Gehöfte aufgeteilt worden war. Mittlerweile ist die auf einem Hügelkamm erbaute alte Villa mit ihren hohen Decken und ihrem Spitzdach aber so baufällig, dass sich Reparaturarbeiten kaum mehr lohnen würden. Die Veranda weist eine bedenkliche Schräglage auf, die der des abgesackten Küchenfußbodens entspricht, die Wohnzimmertür muss mit einer alten Ausgabe der Woman’s Weekly zugeklemmt werden, damit es nicht ständig zieht, und in allen Schränken sammeln sich kleine Häufchen Holzwurmstaub. Überall blättert die Farbe ab, das Gitterwerk ist morsch, und im Dach klaffen mindestens drei Löcher. Doch dafür rankt sich eine riesige rote Kletterrose über die Veranda, und der Blick über die Bergketten ist atemberaubend. In den vier Jahren, die seit meinem letzten Besuch vergangen sind, hatte sich nichts verändert, und ich empfand sofort wie früher ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.
Ich trank einen großen Schluck von meinem Gin Tonic und musste prompt husten. »Ist da überhaupt Tonic drin, Tante Rose?«
»Ein Schuss.« Sie nippte vorsichtig an ihrem eigenen Drink. »Hmm, vielleicht war ich ein bisschen zu großzügig mit dem Gin. Wie geht es deinen Eltern?«
»Mum steht morgen eine Qualitätsprüfung ins Haus, deshalb schrubbt sie den Melkschuppen mit einer Zahnbürste. Dad geht’s gut.«
»Spielt er immer noch Gitarre?«
»Ja«, gestand ich bekümmert.
»Es könnte schlimmer sein. Stell dir vor, er würde auf Dudelsack umsteigen.«
»Das Schlimme ist der Gesang. Er kann den Ton nicht halten.«
»Deine Eltern sind beide Prachtmenschen«, tröstete mich Rose. »Nur ein bisschen verrückt.«
Das Ferkel kletterte auf die Veranda und ließ sich neben ihrem Stuhl auf den Boden plumpsen. Sie nahm eine Gabel vom Tisch neben sich und kratzte ihm den Bauch.
»Benutzt du diese Gabel ausschließlich dazu, das Schwein zu kraulen?«, erkundigte ich mich neugierig.
»Ja. Du brauchst mich nicht darauf hinzuweisen, dass ich ebenfalls verrückt bin, sondern solltest lieber erwägen, selbst zur Exzentrikerin zu werden, Josephine. Das macht das Leben so viel interessanter.«
»Ich denke darüber nach«, versprach ich, dann trank ich einen weiteren Schluck Gin und genoss es, wie er mir auf der Zunge brannte, bevor er meine Kehle hinunterrann.
Nach einigen weiteren Drinks schlug ich vor, unser Abendessen zuzubereiten.
»Unser Dinner bitte, Josephine«, korrigierte mich Rose, während wir uns – leicht schwankend – in die Küche begaben. (Meine Eltern haben mir die Frage, warum sie ausgerechnet ›Josephine‹ einen passenden Namen für mich fanden, nie zufriedenstellend beantwortet. Ich finde, er klingt nach einer Gouvernante aus dem 19. Jahrhundert. Niemand sonst darf ihn benutzen, nur aus Roses Mund höre ich ihn ganz gerne.) »Es heißt nicht Abendessen, sondern Dinner.«
»Ich bin und bleibe ein unkultiviertes Mädchen aus den Kolonien, Rose, damit musst du dich abfinden«, gab ich zurück.
»Du bist genauso schlimm wie Matthew.« Sie nahm eine schon etwas schlaffe Karotte aus dem Vorratsschrank und zeigte damit auf mich, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen. »Jahrelang habe ich an ihm herumgenörgelt, und trotzdem sagt er immer noch ›Nju-Sillend‹ und ›Mülk‹.« Matt war Roses leiblicher Neffe – der Sohn ihrer jüngeren Schwester –, wohingegen ich nur eine Nennnichte war. Rose war in den Siebzigern als frisch gelernte Krankenschwester im Rahmen eines Regierungsprogramms zur Anwerbung von Angestellten für die Provinzkrankenhäuser aus England nach Neuseeland gekommen. Sie beschloss sofort (und nach Meinung einiger Leute unerklärlicherweise), dass Waimanu der ideale Ort war, um sich dort niederzulassen, und blieb. Ihre Schwester kam ein paar Jahre später zu Besuch, heiratete nach dreiwöchiger stürmischer Werbung einen einheimischen Milchfarmer und klagte dann in den folgenden fünfundzwanzig Jahren ständig über seinen Mangel an Bildung und Kultiviertheit.
Ich grinste. »Wie geht es Matt?«
»Gut. Er arbeitet entschieden zu viel, ist offenbar aber ganz glücklich damit. Wobei mir einfällt, dass er gleich zum Dinner kommt.«
»Wunderbar.« Aber auch ein bisschen beängstigend. »Willst du diese Karotte nun kochen oder nur damit herumfuchteln?«
»Hör auf, mich abzulenken, und verschwinde«, knurrte Rose. »Warum packst du nicht deine Sachen aus und machst dich frisch?«
Als ich eine halbe Stunde später in die Küche zurückkam, rieb Rose mit einem solchen Elan Käse, dass ich um die Unversehrtheit ihrer Finger fürchtete.
»Ah«, sagte sie. »Da bist du ja. Wie wäre es, wenn du uns ein Glas von dem edlen Tropfen eingießt, den du mitgebracht hast?«
»Wenn ich die ganze Woche so weitermache, bekomme ich eine Leberzirrhose«, orakelte ich.
»Unsinn«, widersprach sie. »Die Leber muss beansprucht werden, sonst verkümmert sie – wie alle Muskeln.«
»Ich bin mir fast sicher, dass die Leber kein Muskel ist.«
Sie winkte unbeeindruckt ab. »Das Prinzip ist dasselbe, Josephine. Ich höre ein Auto – das muss Matthew sein. Geh doch nach draußen und sag ihm hallo.«
Das hielt ich für eine gute Idee. Außerdem wollte ich lieber keine weiteren Drinks ausschenken, bevor das Abendessen (oder vielmehr das Dinner) nicht auf dem Tisch stand. Rose war schon immer eine etwas gewöhnungsbedürftige Köchin gewesen, und wenn sie einen Schluck zu viel intus hatte, war ihr zuzutrauen, dass sie befand, Dörrpflaumen wären eine ideale Zutat für ein Risotto. Ich trat gerade rechtzeitig aus der Küche, um Matt aus einem verbeulten roten Kleintransporter klettern zu sehen. Mit dem Geschick langjähriger Übung wehrte er die Hunde ab und stapfte über den Kiesplatz zum Haus. Das Ferkel warf sich vor ihm auf den Rücken, und er blieb stehen, um ihm mit dem Fuß den Bauch zu rubbeln.
»Hey, Matt«, begrüßte ich ihn. Äußerlich hatte er sich kaum verändert – er war immer noch hochgewachsen, schlank, braunhaarig und wirkte ein wenig ungepflegt –, aber nach vier Jahren Farmarbeit machte er einen zäheren und härteren Eindruck als früher. Das letzte Mal hatte ich ihn bei der Beerdigung seines Vaters gesehen: vor Trauer und Jetlag ganz benommen und blass vom britischen Winter. Jetzt war er braun gebrannt und gut gelaunt und ließ die klassische Farmerbräune erkennen: sonnenverbrannte Beine, die unterhalb des Gummistiefelrandes schneeweiß wurden.
Er blickte auf und grinste mich an. »Hey, Jo.« Das Ferkel grunzte unmutig, als er mit dem Kraulen innehielt. Er stieß es sacht mit dem Zeh an. »Das reicht jetzt, Percy, verzieh dich. Du siehst gut aus.«
Ich ging davon aus, dass der letzte Satz mir und nicht dem Schwein galt. »Du auch. Wie läuft’s bei dir?«
»Gut. Und bei dir?«
»Auch gut.« Es folgte ein etwas verlegenes Schweigen, während ich fieberhaft nach einer geistreichen, unverfänglichen Bemerkung suchte. Endlich rang ich mich zu einem »Wie sieht es auf der Farm aus?« durch, während er zeitgleich fragte: »Wie geht es deinen Eltern?«
»Gut«, antworteten wir beide wie aus einem Mund und lächelten uns unsicher an.
»Ich freue mich jedenfalls, dich zu sehen.« Er legte den Arm um meine Taille und drückte mich freundschaftlich an sich. »Glaubst du, du kannst das pralle Großstadtleben von Waimanu ertragen?«
»Ich hoffe es.« Vor drei Wochen hatte ich noch in der Innenstadt von Melbourne gelebt. Waimanu hat ungefähr viertausend Einwohner. »Aber es war ein kleiner Schock, als ich feststellen musste, dass es auch hier inzwischen einen McDonald’s gibt.«
»Kann ich verstehen«, nickte Matt. »Wir sind quasi eine Metropole.«
* * *
»Was soll denn das sein, Tante Rose?« Matt stach mit der Gabel in eine undefinierbare orangefarbene Masse auf seinem Teller.
»Ein Karotten-Apfelauf lauf«, erwiderte sie und fügte überflüssigerweise hinzu: »Nach meinem eigenen Rezept. Wie wäre es jetzt mit noch einem Schlückchen Wein, Josephine?«
»Gieß mir auch noch etwas ein, damit ich das Zeug hier runterspülen kann«, bat Matt, und ich musste mein Kichern mit einem Hüsteln überspielen.
»Du warst einmal ein so netter Junge«, bemerkte Rose wehmütig.
»Wann denn?«, wollte ich wissen, worauf hin Matt eine Erbse nach mir warf und mich an der Nase traf.
»Kinder!«, kam es sofort von Rose. »Benehmt euch!«
»Ist es nicht schön, als Kind bezeichnet zu werden?«, fragte ich verträumt. »Da fühlt man sich doch gleich wieder jung.«
»Mir war nicht klar, dass du schon mit einem Fuß im Grab stehst«, warf Rose ein.
»Ich werde in zwei Monaten dreißig.«
»Da bin ich besser dran«, feixte Matt. »Mir bleibt bis dahin noch ein ganzes Jahr. Aber mach dir keine Gedanken, Jose, für dein Alter siehst du gar nicht schlecht aus.«
»Vielen herzlichen Dank«, knurrte ich und schenkte den Wein nach.
* * *
»Er ist ein lieber Junge«, sagte Rose, die Matt hinterhergewinkt hatte und nun in die Küche zurückkam.
Ich wusch das Geschirr ab – Rose hatte offensichtlich bei der Zubereitung des Abendessens jeden verfügbaren Topf benutzt – und stimmte ihr zu, während ich grimmig an einem Grillrost herumschrubbte. »Da hast du recht. Deshalb ist er ja auch einer meiner engsten Freunde.«
»Ich glaube, er trifft sich mit einem Mädchen, das Düngemittel verkauft«, fuhr Rose fort.
»Schön für ihn.« Das meinte ich sogar ernst. Dennoch versetzte mir der erneute Beweis, dass niemand auf der Welt – außer mir – allein durchs Leben ging, einen Stich. Mit fast dreißig müsste ich eigentlich glücklich verheiratet sein und an Kinder denken, statt dem Trümmerhaufen meiner gescheiterten Beziehung zu entfliehen, aus der besagte Kinder hätten hervorgehen sollen. Das war zwar eine bedauernswerte Ansicht für eine junge Frau, die mit Rose Thornton aufgewachsen war, dem Paradebeispiel dafür, wie man das Singledasein zur Kunstform erhebt, aber was will man machen?
»Weich den Rost erst mal ein, Kindchen«, riet Rose. »Ich mache ihn morgen früh sauber.«
* * *
Am nächsten Morgen wachte ich viel zu früh auf. Was vor allem daran lag, dass ich die Nacht zusammengekrümmt wie eine Krampe verbracht hatte. Das Bett im Rosa Zimmer war wohl etwa sechzig Jahre alt und bestand aus einer Kapokmatratze auf einem Rost aus Drahtgef lecht. Draußen schimmerte der Himmel blassgelb und grün, und ich hörte ein beunruhigendes Schnüffelgeräusch, für das – wie ich hoffte – das Schwein verantwortlich war. Ich stand auf und blickte aus dem Fenster. Das Schnüffeln kam tatsächlich von Percy, und der Nebel, der über die mit Büschen bewachsenen Hügel zog, war so schön, dass ich in Shorts und ein T-Shirt schlüpfte und nach draußen ging, um Zwiesprache mit der Natur zu halten.
Als ich in Begleitung einer vierköpfigen Hundemeute und eines Schweins den Hügel hinunterkam, saß Tante Rose auf der Veranda beim Frühstück. Sie trug einen karminroten Satinmorgenrock, und ihr langes graues Haar fiel ihr offen über den Rücken. Als ich durch das kleine Tor unter dem Walnussbaum trat, winkte sie mir mit dem Buttermesser zu und rief: »Der Toast ist noch heiß, Kindchen, und ich habe gerade frischen Tee aufgebrüht.«
»Very British«, bemerkte ich, setzte mich zu ihr und griff nach der Orangenmarmelade.
»Vermutlich huldigst du dieser neuen Mode, zum Frühstück schwarzen Kaffee zu trinken und zum Lunch nur ein Salatblatt zu essen?«
»Sehe ich etwa so aus, als würde ich mich von Salatblättern und schwarzem Kaffee ernähren?«, hielt ich dagegen.
Rose musterte mich von Kopf bis Fuß. »Du siehst sehr hübsch aus«, erwiderte sie bestimmt. »Du hast die Beine deiner Mutter geerbt, du Glückliche. Wann trittst du deinen neuen Job an?«
»Ich fahre heute Morgen in die Stadt, damit Cheryl mir das Computerprogramm erklären kann, und am Montag fange ich offiziell an. Die Marmelade schmeckt wirklich gut.«
»Das Geheimnis besteht darin, die Orangen in ganz feine Streifen zu schneiden. Manche Leute …«, ihr Tonfall besagte deutlich, dass sie auf den Umgang mit solchen Leuten keinen Wert legte, »… benutzen doch tatsächlich eine dieser neumodischen Küchenmaschinen zum Zerkleinern.«
»Ist das nicht ganz egal?«
Rose seufzte. »Manchmal verzweif le ich an dir, Josephine.«
Ich frühstückte ausgiebig, machte anschließend Jagd auf eine Schar quer über den hinteren Rasen entf lohener Hühner und gönnte mir danach eine Katzenwäsche unter der kläglichsten Dusche der Welt: Der Wasserdruck war so niedrig, dass nur ein schwaches Rinnsal herauskam. Dann suchte ich ein Outfit zusammen, das – so hoffte ich – sowohl geschäftsmäßig als auch schmeichelhaft wirkte. Ich zog mich an, verabschiedete mich von Rose, die gerade Kürbisse über den hinteren Zaun wuchtete, und machte mich auf den Weg in die Stadt.
Kapitel 2
WAIMANU LIEGT MITTEN im King Country, etwa auf halber Strecke, wenn man die Westseite von Neuseelands Nordinsel hinunterfährt. Es ist eigentlich eine Kleinstadt, ziemlich schäbig und ohne jegliche Cafékultur, die aber das Zentrum einer großen Acker- und Weidelandregion bildet. Folglich kann man hier zwar Schuhe kaufen, allerdings würde sie keine Frau unter hundertzehn, die etwas auf sich hält, in der Öffentlichkeit tragen. Immerhin gibt es aber ein Krankenhaus, einen ziemlich großen Supermarkt, ein riesiges Geschäft für landwirtschaftlichen Bedarf sowie eine Firma für Tiefkühlkost.
Ich parkte auf der Hauptstraße vor Heather Anne’s Fashion (wo man außer pfirsichfarbenen Polyesterblusen nicht viel finden kann) und öffnete die Tür der angrenzenden Praxis für Physiotherapie.
Hinter der Empfangstheke blickte eine junge Frau Anfang zwanzig mit auffallend blauen Augen und fliehendem Kinn auf, schniefte und wischte sich die Nase mit dem Handrücken ab. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie.
»Hi«, erwiderte ich. »Ich bin Jo. Und du musst wohl Amber sein.«
»Oh.« Amber wirkte nur mäßig interessiert. »Du wirst hier arbeiten, nicht wahr? Cheryl ist gerade auf dem Klo.«
Nach ein paar Minuten rauschte die Spülung, und Cheryl tauchte im Türrahmen auf. Sie war hochschwanger, und da sie überdies noch ziemlich klein war, erinnerte sie mich an einen Wasserball auf zwei Zahnstochern.
»Morgen, Jo«, begrüßte sie mich fröhlich. »Ich hab schon fast damit gerechnet, dass du dich nicht blicken lässt.«
»Vielen herzlichen Dank«, murmelte ich.
»Oh, das soll nicht heißen, dass ich dich für unzuverlässig halte. Ich habe nur in den letzten beiden Monaten mit drei Bewerberinnen einen Termin vereinbart, und alle haben in der letzten Minute kalte Füße bekommen.«
»Wie bitte? Was läuft denn hier schief, Cher?«
»Gar nichts«, gab sie würdevoll zurück. »Nicht wahr, Amber?«
Amber starrte blicklos ins Leere und wand sich eine schlaffe blonde Haarsträhne um den rechten Zeigefinger. Als sie ihren Namen hörte, zuckte sie zusammen und zog die Nase hoch. »Was?«
Cheryl drehte sich seufzend wieder zu mir um. »Komm mit, Jo, ich zeige dir, wo alles ist.«
»Wann ist es denn so weit?«, erkundigte ich mich, als ich ihr einen mit beigefarbenem Teppichboden ausgelegten Gang hinunter folgte.
»In zehn Tagen.« Sie presste sich die Hände ins Kreuz und rieb erschöpft darüber. »Du bist keinen Moment zu früh gekommen.«
»Sieht ganz so aus. Meinen Glückwunsch.«
»Danke. So, hier ist das Behandlungszimmer – alles läuft über Computer. Amber ist dabei, die gesamten Patientenakten in das System einzugeben. Wenn sie so weitermacht, dürfte sie innerhalb der nächsten fünf Jahre damit fertig werden.« Mit gedämpfter Stimme fügte sie hinzu: »Dir ist sicher nicht entgangen, dass sie nicht gerade eine Intelligenzbestie ist.«
Ich lächelte. »Verstehe. Also dient sie hauptsächlich zu Dekorationszwecken.«
Zu meiner Überraschung schüttelte Cheryl den ordentlich frisierten kastanienbraunen Kopf. »Keineswegs. Mir ist noch nie jemand begegnet, der den Leuten so gut das Geld aus der Tasche ziehen kann wie Amber. Du weißt ja, dass sie die Gesetze zur Unfallversicherung verschärft haben?«
»Hast du sehr darunter zu leiden?«, fragte ich zurück. Das alte System der ›Accident Compensation Corporation‹ war erschreckend leicht auszunutzen und ehrlich gesagt längst reif für eine Reform gewesen, doch die drastischen Kürzungen der Zuschüsse für Physiotherapien hatten die Privatpraxen hart getroffen. Es ist erstaunlich, wie wenig Behandlungen die Leute auf einmal brauchen, wenn sie selbst dafür aufkommen müssen.
»Es geht«, entgegnete sie. »Kurz vor der Einführung des neuen Systems wollte ich expandieren und noch jemanden einstellen, habe es dann aber gelassen, daher haben wir im Moment bergeweise Arbeit. So, was wäre da noch? Stützbandagen und solche Sachen sind in diesem Schrank – ich muss ganze Horden von Schafscherern mit Rückenproblemen behandeln. Hypochonder und die Leute, die einfach nur herkommen, weil sie einsam sind und Unterhaltung suchen, haben einen roten Punkt in ihrer Akte, aber Amber kann dir auch so sagen, wer sie sind. Notgeile Typen haben wir zurzeit nicht, glaube ich – du weißt schon, die Kerle, die dir erzählen, sie hätten sich wohl einen Muskel in der Leistengegend gezerrt, und auf eine Massage hoffen.«
»Im Krankenhaus hat man mit denen kaum zu tun«, bemerkte ich. »Während der letzten eineinhalb Jahre habe ich hauptsächlich Rehamaßnahmen mit Schlaganfallpatienten durchgeführt.«
»An alles andere erinnerst du dich bestimmt schnell wieder, da bin ich mir ganz sicher«, beruhigte mich Cheryl. »Du schaffst das schon.«
Ich war amüsiert über ihre tröstlichen Worte, gleichzeitig lösten sie in mir aber auch leisen Ärger aus. Ich bin gut in meinem Job und arbeite hart daran, noch besser zu werden. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich in unserem dritten Universitätsjahr einmal eine gesamte Nacht damit zugebracht habe, Cheryl vor einem Examen am nächsten Tag auf die Schnelle noch ein paar anatomische Grundkenntnisse einzupauken. »Danke«, erwiderte ich verstimmt.
»Hast du schon eine Bleibe gefunden?«
»Noch nicht. Vorerst wohne ich bei Rose Thornton.«
»Die neue Buchhalterin von Horne and Plunkett’s sucht eine Mitbewohnerin«, sagte Cheryl. »Wenn du Interesse hast, kann ich ihr deine Nummer geben.«
Ich rümpfte skeptisch die Nase. »Ich dachte eher an ein kleines Häuschen auf dem Land; ich weiß nicht, ob ich Lust habe, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen.«
»Josie, Schatz, du kannst doch nicht deinen Verlobten verlassen und …«
»Er war nicht mein Verlobter«, stellte ich richtig.
»Aber so gut wie«, beharrte Cheryl ungeduldig. »Auf jeden Fall kannst du nicht von einer Großstadt wie Melbourne in das hinterwäldlerische Waimanu ziehen und dich mutterseelenallein in irgendeinem Haus im Nirgendwo vergraben. Du würdest durchdrehen und dir die Pulsadern aufschneiden.«
* * *
Als ich um die Hausecke bog und dabei eine Seite des Rasenmähers anhob, damit er nicht den Blumen am Rand des Beetes die Köpfe abrasierte, tauchte Rose an der Hintertür auf und fuchtelte wild mit den Armen. Ich schaltete den Motor aus, und sie rief fröhlich: »Josephine! Telefon!«
»Hallo?«, keuchte ich atemlos, nahm das schnurlose Telefon und lehnte mich gegen das Verandageländer. Roses Rasen fiel zu allen Seiten steil vom Haus ab, und ihn zu mähen bedeutete vor allem, das schwere Gerät mühsam hangaufwärts und über die Wurzeln von Obstbäumen zu schieben.
»Hallo?«, erklang eine Frauenstimme, die mich an einen zwitschernden Spatz erinnerte. »Ich bin Sara Rogers. Cheryl hat mich gestern angerufen und gesagt, dass du vielleicht ein Zimmer suchst.«
»Das stimmt«, antwortete ich.
»Nun, Andy und ich – Andy ist mein Mitbewohner – haben noch ein Zimmer frei. Möchtest du es dir ansehen?«
»Gerne«, sagte ich. Das traf zwar nicht ganz zu, aber nach reiflicher Überlegung war ich zu dem Schluss gekommen, dass Cheryl vielleicht doch recht hatte. »Danke.«
»Du rauchst doch nicht, oder?«
»Nein.«
»Hast du Haustiere?«
»Auch nicht.«
»Und hörst du oft laute Musik?«
»Nein«, sagte ich. »Allerdings spiele ich Tuba und koche gern nackt.«
Besorgte Stille trat ein; diese Informationen musste sie wohl erst mal verdauen.
»Sorry, war nur ein Scherz«, entschuldigte ich mich hastig. »Was hältst du davon, wenn ich vorbeikomme, damit wir uns kennenlernen können?«
»Okay.« Jetzt klang Sara etwas misstrauisch und längst nicht mehr so munter. »Wann würde es dir passen?«
* * *
»Und?«, fragte Rose, als ich am nächsten Vormittag aus dem Auto stieg.
Ich bückte mich und streichelte mit der einen Hand einen Hund und mit der anderen das Schwein, bevor ich über den Kiesweg zur Wäscheleine ging, wo sie gerade Laken abnahm.
»Alles geklärt.« Ich nahm zwei Ecken des Lakens, das sie mir hinhielt, und half ihr, es zusammenzulegen. »Das Haus ist nicht schlecht, und die beiden sind anscheinend auch ganz in Ordnung. Ich ziehe irgendwann in der nächsten Woche dort ein.«
»Wie gut, dass ich nicht schnell beleidigt bin, sonst würde ich annehmen, dass meine Kochkünste der Grund für deinen überstürzten Umzug sind.«
»Ganz und gar nicht«, versicherte ich ihr. »Manche Leute würden Oliven und Broccoli ja als eine etwas ungewöhnliche Kombination bezeichnen, aber ich persönlich finde sie einen Beweis für kulinarische Genialität.«
»Danke«, erwiderte sie hoheitsvoll. »Komplimente hört man immer gern. Ach ja, ich habe mit deiner Mutter telefoniert – wenn du ohne dieses Haargel absolut nicht leben kannst, sag ihr Bescheid, dann schickt sie es dir nach.«
»Ich kann sehr gut ohne das Zeug leben, es taugt nämlich überhaupt nichts, wie ich leider feststellen musste«, sagte ich. »Was hast du heute noch vor?«
»Ah«, machte Rose. »Ich bin froh, dass du das fragst. Was hast du denn vor, Kindchen?«
»Deinem Ton nach zu urteilen etwas Unangenehmes.«
»Ich weiß, dass du es nicht gern tust, aber Edwin und Mildred leiden schrecklich unter der Hitze, die Ärmsten. Und Matthew hat so viel zu tun, dass ich ihn nicht damit behelligen möchte.«
Ich drehte mich um und spähte über den Zaun hinweg zu Edwin und Mildred hinüber, zwei fettleibigen Schafen, die faul unter einem Apfelbaum lagen. »Ich werde es versuchen«, sagte ich zweifelnd. »Aber ich fürchte, das Ergebnis wird nicht gerade berauschend ausfallen.«
»Nach dem Lunch schärfe ich die Wollkämme für dich«, versprach Tante Rose glücklich. »Freu dich doch, eine so vielseitig begabte junge Frau zu sein.«
»Vielseitig begabt« ist nicht unbedingt der Ausdruck, den jemand verwenden würde, der mir beim Scheren zusieht. Lange, ebenmäßige Striche mit der Handschermaschine sind nicht mein Fall; ich säbele nur aufs Geratewohl irgendwelche Wollsträhnen ab. Und Roses verwöhnte Schafe waren nicht nur extrem groß, sondern hatten überdies auch noch äußerst schlechte Manieren. Der Höhepunkt des Schauspiels war erreicht, als Edwin auf mir und der Schermaschine lag und mich wiederholt in den Bauch trat. Rose war mir auch keine Hilfe. Sie lehnte sich vor Lachen prustend gegen den Zaun und hielt sich die Seiten.
»Ich hasse dich«, rief ich ihr entgegen, als Edwin der Schreckliche sich hochrappelte und pikiert davonstakste. Seine Fettwülste schwabbelten, und lange Wollbüschel, die ich übersehen hatte, flatterten in der leichten Brise.
»Oh, Kindchen«, japste Rose, als sie endlich wieder einen Ton herausbrachte, und betupfte sich die Augen mit einem weißen Spitzentaschentuch. »Ich wünschte, ich hätte eine Videokamera dabeigehabt! Das war ein Bild für die Götter!«
Ich wischte mein schweißnasses Gesicht mit dem Saum meines T-Shirts ab. »Ich hab mir schon immer gedacht, dass du eine sadistische Ader hast. Der Sonntag soll eigentlich ein Ruhetag sein, falls dir das entfallen ist.«
»Komm, setz dich auf die Veranda und trink etwas Kaltes«, schlug sie vor.
Nach einer Flasche Corona-Bier (perfekt serviert mit einem Zitronenschnitz, da Rose Schuldgefühle plagten) auf der von Rosenduft umwehten Veranda, über die der große Magnolienbaum seinen Schatten warf, fühlte ich mich erfrischt genug, um ins Haus zu gehen und mich unter den spärlichen Wasserstrahl der Dusche zu stellen. Die nächsten zwei Stunden verbrachte ich gemütlich mit der Lektüre von Im Dutzend billiger, das ich im Bücherregal des Rosa Zimmers gefunden hatte, dann machte ich mich auf die Suche nach Rose.
Ich fand sie unter dem großen Busch im hinteren Garten. »Kann ich mir deine Gummistiefel ausborgen?«, fragte ich.
»Natürlich. Willst du zu Matthew rübergehen und ihm beim Melken helfen?«
»Ich dachte, das wäre eine gute Idee.«
»Bring ihm ein Bier mit«, sagte Rose. »Und viel Spaß.«
Ich schlurfte in Roses Gummistiefeln, die mir drei Nummern zu groß waren und in denen ich mir wie ein Yeti vorkam, die steile Auffahrt hinunter und überquerte die Straße sowie drei Weiden, um zum Kuhstall der Kings zu gelangen – ein reizloses, senfgelb gestrichenes Betongebäude mit Blick über die Abwasserteiche. Jetzt, im Spätsommer, war es im Stall angenehm kühl, aber im Winter und im Frühling pfiff der Wind von den Bergen im Süden herunter und drang einem bei der Arbeit mit eisigen Fingern oben in den Kragen.
Kurz vor dem Gipfel des Hügels blieb ich stehen, drehte mich um und betrachtete Roses Haus, das in dem unkrautüberwucherten Garten langsam verfiel. Das Gestrüpp eroberte die kleinen Koppeln zurück, die sich bis zur Straße hinunter erstreckten. In der heißen Nachmittagssonne lag alles ruhig und friedlich vor mir; das Einzige, was sich bewegte, war ein träge am Himmel kreisender Falke.
Von dort, wo ich stand, konnte ich das Haus, in dem ich aufgewachsen war, nicht sehen, da es hinter einem weiteren Hügel lag. Vor fünf Jahren hatten meine Eltern aus einer Laune heraus alles verkauft und waren nach Nelson gezogen, um Milchziegen zu züchten. Sie verdienten kaum Geld damit, aber daran waren sie als ehemalige Schaffarmer ja gewöhnt.
Ich war froh, dass mir der Anblick meines Elternhauses erspart blieb, denn die neuen Eigentümer waren offenbar sehr tatkräftig gewesen und hatten ein Gewächshaus sowie eine Stützmauer errichtet und reihenweise Yuccas angepflanzt. All dies mochten zwar Verbesserungen sein (obwohl ich das bezweifelte), aber es ist nicht leicht, von Fremden vorgenommene Veränderungen an einem Ort gutzuheißen, den man einst geliebt hat. Von meinem Standpunkt aus sah ich nur eine Ecke der hinteren Koppel und den Bach, in dem eine verschlagene alte braune Forelle gelebt hatte. Beides sah genauso aus wie früher, was ein kleiner Trost war. Ich wandte mich ab und ging rasch zum Stall hoch.
Als ich durch das Tor des Melkstands trat, besprühte Matt gerade die Euter einiger Kühe mit einem kleinen Handzerstäuber und sang dabei laut und etwas schief »Smells Like Teen Spirit« im Radio mit. Die Kühe wurden bei meinem Anblick unruhig, und Matt hob den Kopf.
»Tag«, sagte er.
»Hallo«, entgegnete ich. »Bier?«
»Es wäre unhöflich, so ein Angebot abzulehnen. Gehst du mal zur Seite?«
Ich gehorchte, und die Kühe trotteten an mir vorbei. Dann zog ich aus jeder Tasche eine Flasche Bier und reichte ihm eine davon. »Mist, ich habe vergessen, einen Öffner mitzubringen.«
»Kein Problem. Gib mir mal die andere.« Matt griff nach meinem Bier, verhakte die beiden Kronkorken ineinander und öffnete die Flaschen.
»Respekt«, bemerkte ich.
»Eines meiner wenigen Talente.« Er gab mir meine Flasche zurück und nahm einen tiefen Schluck aus seiner. »Jose, du bist ein Schatz.«
»Ich weiß«, erwiderte ich bescheiden. »Die Kühe sehen gut aus.«
»Seit wann kannst du das beurteilen?«
Ich grinste ihn an, ohne mich beleidigt zu fühlen. »Eingebildeter Affe.«
»Nein, mal im Ernst – sie sind wirklich in Topform. Ich habe die Futtermenge neu berechnet. Was hast du denn heute so getrieben?«
»Ich war ausgesprochen produktiv«, sagte ich. »Ich habe mir ein Dach über dem Kopf gesucht und die zwei grässlichsten Schafe auf diesem Planeten geschoren.«
»Mildred und Edwin? Davor konnte ich mich zum Glück seit Monaten erfolgreich drücken.«
»Deine Glückssträhne hat leider ein Ende. Das nächste Mal bist du an der Reihe. Ich hätte es beinahe nicht überlebt.«
»Wundert mich nicht. Diese hässlichen, überfütterten Viecher sind gemeingefährlich. Gute Arbeit, Jose.«
»Sie sehen ziemlich gerupft aus«, gab ich zu.
»Wen stört das schon?« Er hob eine Hand, um das Tor vorne an der Schranke zu schließen, und die erste Kuh stellte sich in Position. »Übrigens – es ist schön, dich wieder zu Hause zu haben.«
»Danke.« Der Kloß, der sich ungefähr seit einem Monat in den unpassendsten Momenten in meiner Kehle bildete, hielt es nun für den geeigneten Zeitpunkt, sich wieder einmal zu melden. Ich trank hastig einen großen Schluck Bier, um ihn herunterzuspülen, was keine gute Idee war, weil ich mich prompt verschluckte und Matt mir auf den Rücken klopfen musste. »D… danke«, stammelte ich.
»Keine Ursache.« Er nahm der ersten Kuh links die Saugnäpfe ab und schob sie auf das Euter der ersten Kuh rechts, einem großen, fetten rotbraunen Tier, das aussah, als wäre es hundert Jahre alt. Ohne den Blick von seiner Tätigkeit zu wenden, fragte er beiläufig: »Hast du eine harte Zeit hinter dir, Jo?«
»Eine ziemlich harte.« Ich stellte die Bierflasche ab und begann den nächsten Satz Saugnäpfe zu wechseln, obwohl die Kuh die unvertrauten Hände an ihrem Euter mit unwilligen Schwanzschlägen quittierte. Wenn ich näher auf das Thema einginge, würde ich wahrscheinlich in Tränen ausbrechen, und das würde uns beide in Verlegenheit bringen. »Ich bin dir keine große Hilfe, du kommst ohne mich schneller voran.«
»Unsinn«, widersprach er. »Außerdem mag ich es, wenn du mir Gesellschaft leistest.«
Kapitel 3
GLEICH AN MEINEM ersten Arbeitstag bekam ich es mit einem von Cheryls Hypochondern zu tun, einem dicklichen Mann um die dreißig, der, wie er mir mitteilte, in der Highschool als Hausmeister arbeitete – wenn die Säule glühenden Schmerzes, die andere als sein Rückgrat bezeichneten, es zuließ. Er konnte es einfach nicht ertragen, untätig dazusitzen, er gehörte zu der Sorte Mensch, die sich noch zur Arbeit schleppte, wenn der Tod schon an ihre Tür klopfte, nur um ja niemanden im Stich zu lassen.
Auf dem Weg zur Tür sagte er zu Amber, er würde die Rechnung nächste Woche begleichen; er würde zum Arzt gehen, sich das erforderliche Rezept holen und es bei seinem nächsten Termin mitbringen. Sie lächelte ihn mit kinnlosem Charme an und erwiderte, das wäre nett, es wäre überhaupt kein Problem, ihm das Geld zurückzuerstatten, und in der Zwischenzeit mache das vierzig Dollar. Karte oder bar, Ron? Schönen Tag noch, und passen Sie gut auf sich auf.
»Idiot«, stellte sie leidenschaftslos fest, als sich die Tür hinter ihm schloss.
»Das war ja gekonnt«, lobte ich fast ehrfürchtig. »Ziemlich gute Vorstellung.«
»Nö«, sagte sie. »Der Typ ist so dumm wie Brot. Hat in seinem ganzen Leben keinen Tag richtig gearbeitet.«
»Das hab ich mir gedacht.«
»Ich hab dich aber sagen hören, du könntest sehen, dass er normalerweise ziemlich aktiv ist, und das sei ein Glück, denn es sei für seinen Rücken besser als Stillsitzen«, hielt sie mir vorwurfsvoll vor.
»Glaubst du, es funktioniert?«, fragte ich.
»Oh.« Amber dämmerte offenbar im Zeitlupentempo, was ich beabsichtigt hatte. »War das eine Art psychologisches Umkehrprinzip?«
»Das war die Idee.«
* * *
Mittwochabend zog ich in meine neue Wohnung ein, nachdem ich Cheryls Schwägerin ein Bett abgekauft hatte, das im Gegensatz zu dem, das im Waimanu Second-Hand-Palast zum Verkauf stand, keine verdächtigen dunklen Flecken in der Mitte der Matratze aufwies oder einen leichten Uringeruch verströmte. »Aber Sie beziehen es doch mit einem Laken!«, hatte die Ladeninhaberin protestiert. »Und der Preis ist überaus günstig.« Ich weigerte mich trotzdem, es zu kaufen, und überlegte, ob mich das Leben in der Großstadt vielleicht ein bisschen zimperlich gemacht hatte.
Cheryls Mann (er heißt entweder Ian oder Alan, ich kann mir den richtigen Namen einfach nicht merken) brachte mein neues Bett netterweise mit seinem Kleintransporter zum Haus und half, es die vorderen Stufen hoch und durch die Schiebetür ins Wohnzimmer zu wuchten. »Wohin jetzt?«, erkundigte er sich.
»Bis zum Ende des Flurs und dann links«, sagte ich.
»Ich hoffe, du hast nicht noch mehr Möbel gekauft«, bemerkte er, als er die Matratze an die Wand stellte. »Das ist kein Schlafzimmer, sondern ein Besenschrank.«
Sara, die klein und rundlich war und einen großen Busen hatte, den ihr tief ausgeschnittenes Oberteil nur notdürftig verhüllte, gesellte sich zu uns und lehnte sich gegen den Türrahmen, als ich meine beiden Taschen neben einem kleinen Stapel Handtücher und Bettzeug – eine Leihgabe meiner Mutter – auf den Boden stellte. Mein gesamter Besitz befand sich – so hoffte ich zumindest – irgendwo auf dem Seeweg zwischen Australien und Neuseeland. Obwohl es laut meinem Freund Stu, der seine Habseligkeiten vor Jahren von England nach Melbourne verschifft hatte, wahrscheinlicher war, dass die Sachen auf irgendeinem Kai von Papua-Neuguinea standen und entweder in einem tropischen Unwetter durchweicht oder von Ratten angenagt wurden – oder beides.
»Mehr Sachen hast du nicht?«, fragte Sara; dabei hielt sie zweifellos verstohlen nach einem Tubakoffer Ausschau.
»Nein«, erwiderte ich. »Ziemlich minimalistisch, nicht?«
»Ich koche heute Abend«, sagte Sara. »Magst du Huhn Chow Mein?«
Das Abendessen entpuppte sich als ein Gemisch aus Fertigsauce, Hühnchenteilen, Tiefkühlgemüse und Kochbeutelreis, das in einer Müslischüssel serviert wurde. Es gab nichts daran auszusetzen, aber mich beschlich dennoch das Gefühl, irgendwo einen falschen Weg eingeschlagen zu haben. Wenn mein Exfreund das Kochen übernommen hatte, hatte er Pasta mit Kalamar in eigener Tinte und Garnelen gezaubert und zusammen mit einem Glas Pinot Gris auf der Veranda aufgetragen. Und hier saß ich auf einer schäbigen Couch, die nicht mir gehörte, balancierte eine Schüssel auf den Knien und schaute Shortland Street im Fernsehen, während draußen jugendliche Möchtegern-Rennfahrer ihre Runden um das Wohngebiet von Waimanu drehten.
Andy, der andere Mitbewohner, war Anfang zwanzig und Viehmakler. Während des Essens brachte er kaum ein Wort heraus, danach verschwand er in seinem Zimmer und tauchte für den Rest des Abends nicht mehr auf. Und als Sara die Fernbedienung auch weiterhin fest umklammert hielt, sich langweilige Reality-TV-Shows anschaute und dabei ununterbrochen knirschend Bonbons zerkaute, bis sie gegen zehn ins Bett ging, fing ich an, ihn zu verstehen.
* * *
Nach den ersten vierzehn Tagen gewöhnte ich mich allmählich an die Art, wie die Dinge in der Waimanu-Physiotherapie gehandhabt oder – von Amber – auch nicht gehandhabt wurden.
Am Dienstagnachmittag tippte ich Notizen über eine Patientin (ein zierliches blondes Mädchen namens Cilla, die sich einen Schultermuskel gezerrt hatte; sie hatte mir stolz mitgeteilt, sie sei bei einer großartigen Party vom Dach einer Scheune gefallen) in den Computer, als jemand den Kopf zur Tür hereinsteckte und »Josie!« rief.
Ich drehte mich auf meinem Stuhl um und sah ein junges Mädchen mit rundem Gesicht, Grübchen und glänzenden dunkelbraunen, zu einer Ponyfrisur geschnittenen Haaren. Sie trug die Uniform der Waimanu Highschool und schwang einen abgewetzten Lederranzen von ihrer Schulter.
»Kim!«, entfuhr es mir. »Himmel, bist du hübsch geworden. Aber ich dachte, du gehst in Hamilton ins Internat?«
»Nicht mehr«, entgegnete Matts kleine Schwester zufrieden. »Ich habe Mum gedroht, ich würde alles hinschmeißen und bei Woolworth arbeiten, wenn sie mich nicht nach Hause kommen lässt. Und jetzt bin ich seit einer Woche wieder hier.«
Ich grinste. Schon als kleines Mädchen war ihre Mutter Kim nicht gewachsen gewesen. Alle anderen natürlich auch nicht. Ich musste es wissen, denn ich hatte oft genug bei ihr Babysitter gespielt. »Hat deine Entscheidung etwas mit Aaron Henderson zu tun?«
»Nein.« Sie schüttelte energisch den Kopf und erklärte in sachlichem Ton: »Es ist bewiesen, dass reine Mädchenschulen die soziale Entwicklung behindern.« Dann verdarb sie die sachliche Erklärung allerdings dadurch, dass sie hastig hinzufügte: »Woher weißt du das mit Aaron?«
»Matt erwähnte, dass du dich mit jemandem triffst.« Seine genauen Worte hatten gelautet: »Das hirnlose Küken hat sich in einen pickeligen kleinen Strohkopf verguckt«, aber ich bin schließlich für mein Taktgefühl bekannt.
Kim trat nun ganz in den Raum und schloss die Tür hinter sich. »Also«, flüsterte sie. »Was hältst du von der süßen Cilla?«
»Es wäre unprofessionell, über eine Patientin zu sprechen«, erwiderte ich bestimmt. »Woher kennst du sie überhaupt?«
»Sie ist Matts Freundin.«
»Tatsächlich?«, vergewisserte ich mich erstaunt. Irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass sie sein Typ sein könnte.
»Yeah«, bestätigte Kim. »Wenn du mich fragst, müsste man ihm mal ordentlich den Kopf zurechtrücken. Sie hält sich für die Krone der Schöpfung – macht auf ›Ich bin ja so ein zupackendes Mädchen vom Land, ich kann Zäune aufbauen und fahre einen dicken fetten Pick-up-Truck‹. Aber ich bin sicher, er geht nur mit ihr aus, weil er sie flachlegen will.«
»Kim, so solltest du nicht reden«, rügte ich sie. »Außerdem ist Matt schon ein großer Junge, er kann ausgehen, mit wem er will.«
»Hmm«, machte sie düster. »Das wird sich alles finden. Deine Shorts sehen übrigens super aus, Josie.«
»Danke.«
»Deine Schuhe auch. Ich wünschte, ich wäre so groß und blond und athletisch.«
Ich lächelte, obwohl mir klar war, dass sie mit dieser Schmeichelei für den wahrscheinlichen Fall vorsorgte, mich für irgendetwas einzuspannen – vermutlich brauchte sie ein Alibi für ihre Treffen mit dem pickeligen Strohkopf. Kim hatte es schon immer ausgezeichnet verstanden, ihre Mitmenschen zu manipulieren.
»Die korrekte Beschreibung für mich lautet wohl eher ›stramme Deern‹«, berichtigte ich sie. »Zu mir kommen große, fette Männer mit Rückenschmerzen und sagen: ›Schätzchen, wer soll es schaffen, mich wieder einzurenken, wenn nicht du?‹ Das ist ausgesprochen deprimierend.«
In sehr optimistischen Momenten hoffe ich darauf, künftig einmal eine Art heitere Gelassenheit zu erlangen; zu anderen Zeiten tröste ich mich mit dem Gedanken, dass ich Leute, die mir auf die Nerven gehen, auch zu Boden ringen und auf ihnen herumtrampeln könnte, bis sie um Gnade winseln.
»Matt findet dich hübsch«, murmelte Kim, dabei schielte sie durch die Wimpern zu mir herüber, um zu sehen, wie ich auf diese Mitteilung reagierte.
»Wirklich?«
»Aber du gehst nur mit Ärzten aus, nicht wahr?«
»Wie bitte?«
»Das hat er gesagt, als ich wissen wollte, warum er nicht einmal mit dir ausgeht?«
»Er wollte dich vermutlich nur schnell zum Schweigen bringen. Schade, dass es ihm nicht gelungen ist.«
»Aber du würdest mit ihm ausgehen, oder nicht?«
»Nun … nein, das nicht.«
Kim wirkte gekränkt. »Warum denn nicht?«
»Menschenskind, Kim, lass mir doch Zeit, über den letzten Reinfall hinwegzukommen!«
»Aber ihr wart euer ganzes Leben lang so gute Freunde«, wandte sie ein. »Ihr wärt das perfekte Paar.«
»Ich denke, du verrennst dich da ein bisschen«, seufzte ich. »Wir haben uns früher ständig gestritten. Wie Hund und Katze. Außerdem hat der Mann schon die ideale Freundin.«
»Viel Kampfgeist hast du nicht, oder?«
Ich begann, Matts zahlreiche Teenagersünden an den Fingern abzuzählen: »Er hat meinen Nagellack umgekippt, er hat die Bänder aus meinen Kylie-Minogue-Kassetten gezogen, er hat meine BH-Träger verknotet und dann zu allem Überfluss noch behauptet, ich bräuchte gar keinen BH.« Was in meinem zarten Alter von dreizehn nicht ganz aus der Luft gegriffen war – aber er hätte es trotzdem nicht sagen sollen. »Und er hat mich jedes Mal links liegenlassen, sobald er einen Jungen zum Spielen da hatte …«
Kim kicherte. »Er sagt, du hättest ihn einmal fast zum Eunuchen gemacht.«
»Nicht mit Absicht«, protestierte ich.
»Wie kann man jemandem unbeabsichtigt in die Eier treten?«
»Es war ein Unfall«, beharrte ich. »So lautet meine Version der Geschichte, und dabei bleibe ich. Außerdem hat er angefangen.«
Amber klopfte an die Tür und steckte den Kopf herein. »Dein Vier-Uhr-Termin ist da«, verkündete sie.
»Brauchst du eine Mitfahrgelegenheit?«, fragte ich Kim.
»Nein, ich habe Mums Auto. Schön, dass du wieder da bist, Josie.« Sie warf sich ihre Tasche über die Schulter und schlenderte aus dem Raum.
Meinem nächsten Patienten und seinem steifen Hals habe ich bedauerlicherweise nicht meine komplette und ungeteilte professionelle Aufmerksamkeit widmen können; ich war zu sehr mit Nachgrübeln darüber beschäftigt, was Matt King wohl an der kleinen blonden Barbie-Puppe fand. Vermutlich hielt er sich für einen Glückspilz, aber ich fand, er sollte trotzdem lieber nach einer Frau Ausschau halten, die besser zu ihm passte. Nach einer Frau wie … wie …
Mir, schlug eine leise Stimme tief in meinem Inneren vor.
Nein. Nein!
Der arme Ralph Godwin stieß zischend den Atem aus, und ich richtete meine Gedanken schuldbewusst wieder auf seinen Trapezmuskel, den ich unnötig fest massiert hatte.
Kapitel 4
WIE LÄUFT ES bei der Arbeit?«, erkundigte sich meine Mutter, als sich mein erster Monat in der Praxis dem Ende zuneigte.
»Gut.« Ich klemmte mir das Telefon zwischen Ohr und Schulter, um mir beim Sprechen die Nägel feilen zu können. »Es ist eine Umstellung, alleine zu arbeiten, aber ich kann jederzeit die Mädels im Krankenhaus anrufen, wenn ich nicht weiterweiß.«
Cheryl hatte vor zwei Wochen endlich ihr Baby auf die Welt gebracht. Seitdem bekam sie kaum noch Schlaf. Außerdem war ihre Schwiegermutter für längere Zeit zu Besuch gekommen, um sie in die Geheimnisse der korrekten Kinderaufzucht einzuweihen, und somit war die arme Frau nicht in der Verfassung, schwierige Fälle mit mir zu besprechen.
»Und wie ist die Wohnung?«
Ich seufzte. »Soweit ganz in Ordnung. Aber ich denke, ich werde mir etwas anderes suchen, wenn meine Möbel jemals hier ankommen. Sara folgt mir auf Schritt und Tritt durchs Haus, knipst überall das Licht aus und achtet darauf, dass ich nicht mehr Wasser aufsetze, als ich für eine Tasse Tee brauche.«
»Sie legt eben großen Wert auf Umweltschutz«, bemerkte Mum.
»Gestern Abend habe ich mein Handy an die Ladestation angeschlossen und im Wohnzimmer liegen lassen, und sie hat den Stecker herausgezogen. Eine halbe Stunde nachdem ich heute das Haus verlassen hatte war der Akku leer.«
»Ah, das erklärt alles. Graeme hat uns heute Nachmittag angerufen und gefragt, wie er dich erreichen kann. Er sagt, auf deinem Handy läuft nur die Mailbox. Ich habe ihm deine Festnetznummer gegeben – du hast doch hoffentlich nichts dagegen?«
»Nein«, erwiderte ich traurig. Was wollte er wohl schon von mir? Dieser Tage rief mich mein Exfreund nur an, wenn eine größere Ausgabe anstand – die Raten fällig waren oder die Badezimmerdecke einen bedrohlichen Riss aufwies. »Was machen die Ziegen?«
»Oh, denen geht’s gut«, sagte Mum. »Gestern ist allerdings eine mittelschwere Panik ausgebrochen, weil der Traktor liegengeblieben ist, aber zum Glück lag es nur an einem geplatzten Schlauch.«
»Was macht ihr bloß, wenn er mal endgültig den Geist aufgibt?«, fragte ich.
»Das weiß der Himmel. Vielleicht könnte ich mich bei einem Escort-Service bewerben.«
»Ich glaube nicht, dass ich meine Mutter in Minirock und kniehohen Stiefeln an einer Straßenecke herumlungern sehen möchte. Ich kaufe euch einen neuen Traktor.«
»Wir können von unserer einzigen Tochter doch kein Geld annehmen. Normalerweise läuft das andersherum.«
»Das geht schon in Ordnung«, versicherte ich ihr. »Ich vertraue darauf, in ungefähr fünfzig Jahren eine Farm zu erben, die Millionen wert ist.«
»Das wäre eine Lösung«, sagte Mum. »Vielleicht sogar schon früher, wenn dein Vater so weitermacht.«
»Was ist denn mit ihm?«
»Er spielt im Bett Gitarre, das ist mit ihm«, entgegnete sie grimmig. »Wenn ich noch ein einziges Mal ›Rhinestone Cowboy‹ hören muss, füge ich ihm eine ernsthafte Verletzung zu.«
* * *
An diesem Abend entfloh ich den TV-Shows und dem Kampf im Wohnzimmer um genügend Licht zum Lesen und fuhr zu meiner alten Schulfreundin Clare zum Abendessen. Sie hatte vor fünf Jahren einen Anwalt aus Hamilton geheiratet, ihn in ihre Heimat mitgenommen und seitdem ein Kind nach dem anderen in die Welt gesetzt.
Brett und Clare lebten auf einem Gehöft am Stadtrand. Sie hielten Hühner und Enten, Schweine, Alpakas, Miniponys und einen bösartigen Ziegenbock namens Alfred. Die Kinder waren alle weißblond, hatten große blaue Augen, rosige Wangen und waren reichlich anstrengend.
Als ich ankam, wälzten sich die beiden großen Jungen in einem menschlichen Knäuel über den Rasen und versuchten offenbar, sich gegenseitig zu erwürgen. Da es ein ausgeglichener Kampf zu sein schien, griff ich nicht ein, blieb aber an der Hintertreppe stehen, wo die zweijährige Lucy sorgsam eine ganze Reihe frisch gepflanzter Stiefmütterchen an den Wurzeln aus der Erde riss. »Hey, Lucy, ich glaube, das ist keine gute Idee«, rief ich. »Komm, wir pflanzen sie lieber wieder ein.«
Lucys schöne Augen wurden schmal, als sie mich ansah. Sie strich mit einer schmutzigen Hand ihre Locken zurück und erklärte kategorisch: »Nein.«
»Das sollten wir aber besser tun«, beharrte ich. »Wenn du die Blumen ausreißt, können sie nicht wachsen und bekommen auch keine schönen Blüten.«
»Neinneinneinneinneinnein! Geh weg!«
Clare kam zur Tür. Sie wirkte erhitzt und ein wenig verlegen. »Lucy«, sagte sie ohne große Hoffnung. »Lass meine Blumen in Ruhe und sag Josie hallo.«
Lucy warf sich auf den Boden und schlug mit dem Kopf auf den Weg. Ich trat erschrocken einen Schritt vor, aber Clare hielt mich müde zurück. »Lass sie. Wir dürfen sie bloß nicht beachten, dann hört sie von selber auf.«
»Okay«, erwiderte ich skeptisch und bückte mich, um die jungen Stiefmütterchen wieder in die Erde zu setzen.
»Ach, lass sie liegen«, sagte Clare. »Ich weiß nicht, warum ich mir überhaupt die Mühe mache. Michael! Charlie! Seid so gut und hört auf, euch gegenseitig die Augen auszukratzen – ach, schon gut. Komm rein, Josie, und erzähl mir, was es Neues gibt.«
Clare hat ein schönes Haus, oder zumindest macht es von außen einen schönen Eindruck. Aber der Fußboden war heute zentimeterhoch mit billigem Plastikspielzeug übersät, und jemand hatte erfolgreich versucht, bis zu einer Höhe von circa einem Meter die Tapete von der Wand zu reißen. Ein Kätzchen mit lauerndem Blick beobachtete uns von seinem Platz oben auf der Mikrowelle, und die Küchenbank verschwand unter Stapeln von schmutzigem Geschirr.
»Setz dich«, forderte Clare mich auf. »Nein, nicht dorthin! Charlie ist heute Nachmittag ein kleines Missgeschick passiert. Hier.« Sie hob einen Stoß alter Zeitungen von einem anderen Stuhl und legte sie auf den Tisch, von wo sie langsam zu Boden glitten. »Lass nur«, stöhnte sie. »Wirklich. Wein?«
»Ja, bitte.« Ich gab ihr die mitgebrachte Flasche. »Hoffentlich ist der hier okay – ich habe ihn gekauft, weil mir das Etikett bekannt vorkam, aber dann hatte ich den schrecklichen Verdacht, dass es mir bekannt vorkam, weil wir den schon mal getrunken haben und er wie Terpentin geschmeckt hat.«
»Wen stört’s?«, versetzte Clare. »Hauptsache, er enthält Alkohol. Wie geht es dir übrigens so?«
»Gut.« Ich setzte mich an den Tisch und schuf Platz für zwei Weingläser. Es war ein stiller, sonniger Abend, und die mit Büschen bewachsenen Hügelketten hinter der Glastür waren in goldenes Licht getaucht und wirkten zum Greifen nah. Sie bildeten eine hübsche Kulisse für die zwei kleinen Jungen, die jetzt in der Mitte des Rasens ein Loch buddelten. Lucy konnten wir nicht sehen, aber sie kreischte immer noch mit bemerkenswerter Ausdauer. »Wie war das Kindergartenpicknick?«
»Oh, bestens.« Clare grinste. »Michael hat sich im Auto übergeben, und Lucy hat Maureen Staceys kleinen Sohn gebissen und musste in der Ecke stehen, aber sonst lief alles rund. Gott, der Wein ist himmlisch.«
»Da fällt mir ein Stein vom Herzen.«
»Fehlen dir die funkelnden Großstadtlichter nicht?«
»Nein. Wenn du in der Stadt lebst, dann redest du dauernd von Restaurants und Theatern, in die du gehen könntest, und am Ende kaufst du dir auf dem Nachhauseweg irgendetwas Fertiges und setzt dich vor den Fernseher.«
»Trotzdem stelle ich es mir herrlich vor, das tun zu können, wenn dir danach ist. Bevor ich Kinder hatte, habe ich meine Freiheit nie zu schätzen gewusst. Mittlerweile ist es schon ein größeres Unterfangen, loszugehen und etwas zum Anziehen zu kaufen.«
»Du hast doch hoffentlich nicht auf Heather Anne’s zurückgegriffen?«
»Noch nicht«, erwiderte Clare düster. »Nur auf das Kaufhaus. Und letzte Woche habe ich bei Farmlands eine richtig schicke Jeans gefunden.«
Michael erschien schwer atmend auf der Türschwelle. »Ich will ein Sandwich«, verlangte er.
»Es ist fast Zeit fürs Abendessen«, entgegnete seine Mutter.
»Will ein Sandwich!« Er trat mit einem schmutzigen Gummistiefel gegen den weiß gestrichenen Türrahmen. »Mum! Sandwich! Mum! Sandwich! Mum!«
»Um des lieben Friedens willen.« Clare stand mit grimmiger Miene auf. »Also schön! Am besten nimmst du auch gleich eins für deinen Bruder mit.«
»Er hat Aa in die Hose gemacht«, teilte Michael ihr schadenfroh mit. »Es läuft an seinem Bein herunter.«
»Na großartig«, stöhnte Clare.
»Ich mache das Sandwich, wenn du dich um die andere Bescherung kümmerst«, bot ich mich an.
»Danke.«
Ich machte Michael ein Erdnussbuttersandwich, das er angeekelt musterte, weil ich es in Quadrate statt in Dreiecke geschnitten hatte. Also teilte ich die Stücke nochmals diagonal, und jetzt lehnte er sie ab, weil die Dreiecke zu klein waren. Charlie saß auf dem Knie seiner Mutter, quengelte unaufhörlich und hielt ein Buch zwischen Clare und mich, so dass wir uns nicht sehen konnten. Lucy fiel die Stufen hinunter und schürfte sich das Knie auf – aber man hätte denken können, ihr Bein wäre abgetrennt worden, so ein Spektakel veranstaltete sie –, und zur Schlafenszeit musste Clare sich zu jedem der drei abwechselnd ins Bett legen, bis sie einschliefen.
»Die Freuden des Elternseins«, bemerkte Brett, der mit geschlossenen Augen auf der Couch lag, säuerlich. Clare war seit einer Dreiviertelstunde verschwunden, und ich fragte mich allmählich, ob sie überhaupt zurückkommen würde. »Seit vier Jahren haben wir kein richtiges Gespräch mehr geführt.«
»Wie um alles in der Welt habt ihr es dann geschafft, die letzten beiden zu zeugen?«, fragte ich.
»Weiß ich nicht mehr. Vermutlich haben wir uns ein oder zwei Mal im Flur getroffen.« Er schlug die Augen auf und grinste mich an – er hatte ein ausgesprochen anziehendes Grinsen. »Na ja, in ungefähr fünfzehn Jahren wird sich das alles einrenken.«
»Und überleg mal – wenn man sich so gut wie nie sieht, kehrt auch kein Alltagstrott ein. Das hält die Romantik am Leben«, scherzte ich.
»Und ist wahrscheinlich einfacher, als eine Affäre zu haben«, sagte er, dann fuhr er mit einem Ruck hoch. »Scheiße, tut mir leid!«
»Schon gut«, beschwichtigte ich ihn. »Wirklich, Brett. Sieh mich nicht so erschrocken an.«
* * *
Ich kam gegen neun nach Hause und fand Andy in der Küche vor, wo er sich ein Sandwich machte. Er hob grüßend den Kopf und murmelte: »Irgendein Typ hat für dich angerufen.«
»Er heißt Graeme, hat er gesagt«, mischte sich Sara hilfsbereit ein und wuchtete sich von der Couch hoch (es war gerade Werbepause). »Du sollst ihn zurückrufen, es sei dringend.«
»Danke.« Ich griff nach dem Wasserkessel. Vor dem unterhaltsamen Gespräch mit meinem Ex brauchte ich dringend einen starken Kaffee.
»Nimmst du etwa warmes Wasser?«, fragte Sara entsetzt. »Das ist doch unnötige Energieverschwendung!«
Andy sah mich eine Sekunde lang mit stummem Mitgefühl an, dann drehte er sich um und schlurfte aus der Küche. Sara entwand mir den Kessel, kippte das warme Wasser in die Spüle und drehte den Kaltwasserhahn auf. Ich erwog f lüchtig, sie mit der Suppenkelle zu erschlagen, bevor ich widerwillig zu dem Schluss kam, dass eine solche Tat zwar überaus befriedigend wäre, aber die darauffolgenden dreißig Jahre Gefängnis nicht aufwiegen würde. Stattdessen griff ich nach dem Telefon und zog mich in meine winzige Kammer zurück, wobei ich rachsüchtig jedes Licht auf dem Weg anknipste.
Kapitel 5
AUS! PLATZ!«, BRÜLLTE ich. Die Hunde gehorchten, doch das Ferkel zeigte sich unbeeindruckt, zwängte sich zwischen meine Beine und schmiegte sich liebevoll gegen mein rechtes Knie. Ich kraulte es zwischen den Ohren, woraufhin es die kleinen Schweinsäuglein schloss und leise, wonnevolle Grunzlaute ausstieß. Dieses Tier verfügte wirklich über einen unwiderstehlichen Charme.
»Tante Rose?« Ich spähte durch die offene Tür in die Küche.
»Hier draußen, Kindchen.«
Ich schlenderte, eine am Handgelenk baumelnde Plastiktüte schwenkend, durchs Haus und fand sie auf der Veranda ausgestreckt in einem Liegestuhl. »Hallo.« Ich bückte mich und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Ich hab dir eine Kostprobe von Mums neuem Käse mitgebracht.«
»Wie schön. Ich kann nicht aufstehen, ich bin viel zu faul. Du könntest uns dazu etwas zu trinken holen.«
Ich ging in die Küche und kam mit zwei Gläsern Riesling, einem Messer für den Käse und einer offenen Packung Cracker zurück, die ich hinter dem Brotkasten entdeckt hatte. Rose nahm ihr Weinglas mit einem Seufzer entgegen und lehnte sich wieder in ihrem Stuhl zurück. »Ich hab keine Ahnung, wie alt diese Cracker sind«, gab sie zu bedenken.
»Macht nichts. Wenn sie muffig sind, wird Percy sie fressen.« Das Schwein war außen um das Haus herumgetrottet und kauerte leise schnaufend am Fuß der Stufen in der Nachmittagssonne. »Wie geht es dir?«
»Ich fühle mich wie zerschlagen.« Rose nahm einen langen, dankbaren Schluck aus ihrem Glas.
»Warum?«
»Was weiß ich? Das Alter, nehme ich an. Schau mal, wie sich das Sonnenlicht in der Distelwolle fängt – sieht das nicht herrlich aus?«
Ich blickte über den Zaun in ein riesiges, silbern wogendes Meer aus kalifornischen Disteln. »Schon, aber ich bezweifle, dass Matt deine Ansicht teilen wird. Bist du mutig genug, den Käse zu kosten?«
»Warum nicht?«
Ich schnitt für jeden ein kleines Stück ab und reichte Rose ihres. Wir schnüffelten beide argwöhnisch – das Zeug roch mehr als streng –, dann bissen wir vorsichtig hinein.
»Du lieber Himmel!« Rose versprühte einige Crackerkrümel, bevor sie den Rest ihrer Portion über das Verandageländer schleuderte, einen großen Schluck Wein nahm und ihn im Mund kreisen ließ. Ich bewies sogar noch weniger Klasse, sprang auf und spuckte den Käse ins nächstgelegene Blumenbeet, wo Percy sofort interessiert auf die Suche ging.
»Da hast du ihn, Kumpel.« Ich wickelte den Rest des Käses aus und warf ihn Percy hin. »Wohl bekomm’s.«
»Das ist ein Giftanschlag auf eine alte Frau!« Rose schüttelte den Kopf. »Zu meiner Zeit hatte die jüngere Generation etwas mehr Respekt vor der älteren. Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig war, Percy den Rest zu geben – wahrscheinlich fällt er gleich tot um.«
»Nie im Leben«, widersprach ich. »Er ist aus härterem Holz geschnitzt. Aber Mum und Dad können den unmöglich auf dem Markt verkaufen. Sie würden aus der Stadt gejagt.«
»Sie müssen es mit Absicht getan haben. Was für einen Grund hast du deinen Eltern gegeben, dich so zu hassen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung. Ich versuche doch nach Kräften, eine gute Tochter zu sein.«
Eine lange, schläfrige Stille trat ein; wir tranken unseren Wein und verscheuchten träge die Wespen.
»Verdammte Biester«, brummte Tante Rose. »Sie sind im Pflaumenbaum. Ich müsste die Pflaumen pflücken, aber es ist mir einfach zu anstrengend.«
Ich runzelte die Stirn. Rose ist eine hingebungsvolle Nutzerin von Gaben der Natur – sie würde genauso wenig eine Ernte verderben lassen wie eine Affäre mit einem halbwüchsigen Latinotänzer beginnen. »Geht es dir nicht gut?«, fragte ich.
»Ich bin nur müde.«
»Das sieht dir gar nicht ähnlich.«
Sie seufzte. »Stimmt. Ich habe auch schon daran gedacht, zu Dr. Milne zu gehen. Vielleicht leide ich unter Eisenmangel oder etwas Ähnlichem.« Sie lächelte. »Oder ich brauche einfach nur etwas mehr Wein – sei ein Schatz und schenk mir noch ein Glas ein, ja?«
* * *
An einem schwülen Nachmittag, der eher in den Februar als in den April passte, reichte mir Amber eine mit einem roten Punkt versehene Akte.