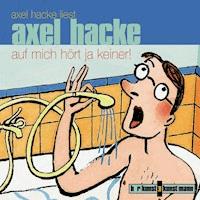Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Antje Kunstmann
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wofür stehst Du? Ein Plädoyer gegen die Gleichgültigkeit Giovanni di Lorenzo und Axel Hacke haben zusammen ein ungewöhnliches Buch geschrieben: Sie stellen die große Frage nach den Werten, die für sie maßgeblich sind – oder sein sollten. Zwei Freunde, nahezu gleichaltrig, stellen fest, dass sie sich in Jahrzehnten über vieles Private ausgetauscht haben, Leidenschaften, Ehen und Trennungen, Erfolge, Ängste und Todesfälle, dass aber eines zwischen ihnen seltsam unbesprochen blieb: An welche grundlegenden Werte glaubst du eigentlich, wenn es nicht um dich, sondern um uns alle geht? Was ist wirklich wichtig in diesem Land? Für welche Ziele der Gemeinschaft bist du bereit, dich einzusetzen? Kurz: Wofür stehst du? Wir leben in Zeiten unübersehbaren Rückzugs ins Persönliche, einer nachgerade verbissenen, ja, verzweifelten Glückssuche im Privaten, der massenhaften Ablehnung gesellschaftlicher Verantwortung, in Zeiten von Missmut, Frust und Gemoser über den Staat. Die Beteiligung an Wahlen sinkt kontinuierlich, die Bereitschaft, sich als Bürger zu verstehen, wird immer geringer. Dafür wachsen Ansprüche auf der einen, Gleichgültigkeit auf der anderen Seite. Das ist angesichts großer Herausforderungen eine unakzeptable Situation, aus der viele Menschen für sich selbst ratlos und vergeblich einen Ausweg suchen. In diesem Buch versuchen die Autoren zu beschreiben, welche Werte sie für wichtig halten – und dies auf sehr ungewöhnlichen Wegen: nicht als abstrakten Tugendkatalog, sondern als eine Art Inventur bisheriger Lebensführung. Manchmal jeder für sich, dann wieder beide gemeinsam oder im Schlagabtausch, mal essayistisch, mal im Stile von Reportern, geradezu psychoanalytisch suchend, bisweilen poetisch und assoziativ, dann wieder sehr nüchtern reflektierend, immer subjektiv erzählend und sehr selbstkritisch suchen die Autoren nach Antworten in den großen Themenfeldern Politik und Staat, Klimawandel, Gerechtigkeit, Migration und Fremdheit, Angst und Depression, Krankheit und Tod.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Axel Hacke / Giovanni Di Lorenzo
Wofür stehst Du?
Was in unserem Leben wichtig ist – Eine Suche
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Axel Hacke / Giovanni Di Lorenzo
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Axel Hacke / Giovanni Di Lorenzo
Axel Hacke, geboren 1956 in Braunschweig, lebt als Schriftsteller und Journalist in München. Von 1981–2000 Reporter und »Streiflicht«-Autor bei der Süddeutschen Zeitung, für deren Magazin er bis heute die beliebte Kolumne »Das Beste aus aller Welt« schreibt. Axel Hacke veröffentlichte eine Vielzahl erfolgreicher Bücher, u.a. »Der kleine Erziehungsberater«, und erhielt für seine Arbeit zahlreiche Preise.
Giovanni di Lorenzo, 1959 in Stockholm geboren, arbeitete nach Abschluss des Studiums in München zunächst als politischer Reporter und Leiter des Reportageressorts Die Seite Drei bei der Süddeutschen Zeitung. Seit 1989 moderiert er die Fernsehtalkshow 3 nach 9 von Radio Bremen. 1999 wurde er zum Chefredakteur der Berliner Tageszeitung Der Tagespiegel berufen. 2004 wechselte er als Chefredakteur zur Wochenzeitung Die Zeit.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Der Dauer-Bestseller des letzten Jahres jetzt als Taschenbuch
Eine der großen Überraschungen auf dem Buchmarkt des letzten Jahres waren Axel Hacke und Giovanni di Lorenzo mit ihrem Bestseller »Wofür stehst Du?«.
Zwei Freunde, nahezu gleichaltrig, stellten fest, dass sie sich in den Jahrzehnten über vieles Private ausgetauscht haben, Leidenschaften, Ehen und Trennungen, Erfolge, Ängste und Todesfälle, dass aber eines zwischen ihnen seltsam unbesprochen blieb: An welche grundlegenden Werte glaubst du eigentlich, wenn es nicht um dich, sondern um uns alle geht? Für welche Ziele der Gemeinschaft bist du bereit, dich einzusetzen? Kurz: Wofür stehst du?
Ihre Antworten sind kein abstrakter Tugendkatalog, sondern eine Art Inventur bisheriger Lebensführung. Manchmal jeder für sich, dann wieder beide gemeinsam oder im Schlagabtausch, mal essayistisch, mal im Stile von Reportern, immer subjektiv erzählend und sehr selbstkritisch nähern sich die Autoren den großen Themenfeldern Politik und Staat, Klimawandel, Gerechtigkeit, Migration und Fremdheit, Angst und Depression, Krankheit und Tod.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2010, 2011, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2010, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung>: Barbara Thoben, Köln, nach einer Idee von Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Jim Rakete
ISBN978-3-462-30214-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Damit das klar ist
Meine Leidenschaft für Politik
Meine Heimat in der Fremde
Mein Glaube an den Untergang
Meine Eroberung der Familie
Mein größtes Dilemma: Gerechtigkeit
Meine Krankheit namens Angst
Meine Sehnsucht nach Helden
Danksagung
Für unsere Kinder, in der Hoffnung, dass sie uns glauben werden
Damit das klar ist –
Ein Vorwort
Wir kennen uns seit 25 Jahren. In dieser Zeit haben wir einiges geteilt und vieles besprochen: Trennungen, Erfolge, Ängste, Fluchten, Kinderwünsche, Leidenschaften, Todesfälle in der Familie. Einmal haben wir uns gemeinsam in einer Bürgerinitiative gegen Rechtsextremismus engagiert. Nur ein einziges Thema haben wir immer sorgsam ausgespart, vielleicht müsste man eher sagen: nie in Worte gefasst, denn es ist aus allen anderen Lebenserfahrungen kaum herauszuhalten. Wir haben nie darüber gesprochen, an welche Werte wir glauben und für welche Werte wir einstehen würden.
Das ist seltsam, nicht wahr? Aber woran liegt das?
Es trifft vielleicht zu, dass Bekennermut nicht die Stärke der heute Vierzig- oder Fünfzigjährigen ist, unserer Generation. Doch es gibt da noch ein Problem. Jeder klangvolle Begriff (und gehört das Wort »Werte« denn nicht zu den klangvollsten?) ist so oft benutzt und missbraucht worden, dass einem schon das Aussprechen gleichzeitig pathetisch und leer vorkommt. Auf unseren Klassenfeten wurden noch die Platten einer Berliner Anarcho-Band gespielt, die in eines ihrer Booklets den schönen Satz geschrieben hatte:
»Wie kann ich dir sagen, dass ich dich liebe?
Nachdem ich gehört hab: ›Autos lieben Shell‹?«
Aber diese Begründungen sind, wenn überhaupt, nur ein Teil der Wahrheit. Am schlimmsten an der Vorstellung, sich auf Werte festzulegen, sie gar zu propagieren, ist die drohende Aussicht, als Tugendbold Hohn und Spott ausgesetzt zu sein oder ein Leben lang daran gemessen zu werden, was man selbst einst eingefordert hatte. Es gibt nur sehr wenige, die dem standhalten könnten. Wir gehören mit Sicherheit nicht zu ihnen.
Seit einigen Jahren sind jüngere Menschen dabei, die Schlüsselstellen in unserem Staat zu besetzen. Bezeichnend ist, dass ihnen allen – von Philipp Rösler, dem Gesundheitsminister in der schwarz-gelben Regierung, über Sigmar Gabriel, dem vorerst letzten Hoffnungsträger der SPD, bis hin zu Reinhold Beckmann, dem Fernsehjournalisten der ARD – etwas attestiert wird, was sogleich als Schwäche erscheint: sie seien pragmatisch und dabei so flexibel, dass sie ihre Haltungen immer wieder justierten, je nachdem, was gerade opportun ist, also kollektiv unfähig, auf die Frage zu antworten: Wofür stehst Du eigentlich?
Die Frage provoziert Abwehr, und das ist verständlich: Sie ist voller Vorwurf, sie dient manchmal, wenn sie von Älteren gestellt wird, auch zur Überhöhung der eigenen Generation. Und sie ist leider auch nur von einigen Helden und Heldinnen oder von etwas tumben Menschen immer eindeutig zu beantworten. Die großen Themen unserer Zeit – Klimawandel, Überbevölkerung oder Gerechtigkeit – sind nicht nur gewaltig groß, sie sind auch unfassbar kompliziert. Die Vielschichtigkeit der Probleme und ihre monströsen Ausmaße machen offenbar ohnmächtig oder etwas feige oder beides zugleich.
Es gibt in Deutschland einen massenhaften Rückzug aus gesellschaftlicher Verantwortung, was allein schon daran sichtbar wird, wie wenig Auswahl es bei der Besetzung der meisten politischen Ämter gibt, von den Kommunen bis in die Parlamente. Und daran, wie viele Menschen selbst noch den kleinsten Schritt der Teilhabe am Ganzen scheuen: den Gang an die Wahlurne, alle paar Jahre. Ja, selbst Politiker in höchsten Ämtern scheinen bisweilen die Last der politischen Verantwortung abschütteln zu wollen, wie im Jahr 2010 die Fälle Koch, Köhler und von Beust zeigten.
Was hilft dagegen?
Jedenfalls kein Kanon neuer Werte – die altbekannten wie Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit oder Bewahrung der Schöpfung sind fordernd genug. Und bitte auch kein Handbuch der Alltagsmoral! Wer von diesem Buch einen Leitfaden, Anweisungen und Tipps für das eigene Leben erwartet, vielleicht sogar ein vollständiges Kompendium von Werten für alle Lebenslagen – der legt es am besten jetzt aus der Hand!
Von uns kommt erst einmal das Eingeständnis einer Schwäche, nämlich das Bekenntnis der eigenen Ambivalenz. Aus kaum einer Krise oder Konfrontation, sei sie beruflich, privat oder politisch, kommt man mit nur einer einzigen Erkenntnis heraus, oft aber mit vielen Widersprüchen. Aber das zu akzeptieren, ist am Ende keine Schwäche, sondern eine Stärke.
Beim Versuch zu beschreiben, was uns wichtig ist im Leben und was uns fehlt, haben wir uns an unsere eigene Erfahrungswelt gehalten. Es war unvermeidlich, dass wir dabei viel von uns preisgeben mussten, mehr als wir uns am Anfang vorgestellt hatten – und oft mehr als uns lieb war. Anders aber scheint uns ein Buch wie dieses nicht glaubwürdig zu sein. Es ist deshalb auch eine Inventur geworden: Was haben wir erlebt? Was regt uns noch auf? Wo haben wir uns davongestohlen? Wann belügen wir uns?
Überall in der Gesellschaft ist eine große Sehnsucht nach Klarheit, nach Führung und Eindeutigkeit zu spüren. Wir kennen das von uns selbst. Dieses Bedürfnis ist indes kaum zu erfüllen: Es führt in die Irre, wenn man nur dem Leben ständig mit Moral entgegentritt, es muss ja auch die Moral dem Leben standhalten.
Viele Menschen fühlen sich deswegen orientierungslos. Einige suchen Halt in Heilslehren, weitaus mehr (was in jedem Fall ungefährlicher ist) in Ratgebern. Andere flüchten sich in Zynismus. Und wir? Relativieren wir mit unserem Bekenntnis zur Ambivalenz Werte und entwerten sie damit?
Nein, denn wir wissen sehr wohl, dass man auch heute noch in vielen Situationen sehr klar zwischen Gut und Böse unterscheiden kann – und muss. Wir haben nur versucht, ehrlich zu bleiben: Es reicht nicht, die richtigen Maßstäbe im Leben zu finden. Man muss sie auch vermitteln können, sie mit sich und anderen immer wieder ausmachen.
Wir sind aber auch getrieben von dem Wunsch, der durch Erklärungsversuche aller Art vertuschten Gleichgültigkeit vieler Menschen gegenüber anderen, der Gesellschaft und dem Staat etwas entgegenzusetzen.
Die meisten von uns leben in einem Umfeld, das von ihnen fast nie tief greifende Wert-Entscheidungen verlangt. Wer von uns muss je sein Leben, seinen Wohlstand, die Sicherheit seiner Familie aufs Spiel setzen, indem er für etwas Gerechtes eintritt: einen Menschen vor der Verfolgung durch die Polizei einer Diktatur verstecken oder sich gegen Schläger stellen, die andere bedrohen, oder an einer Demonstration teilnehmen, deren Teilnehmer damit rechnen müssen, im Gefängnis zu landen? Wie viele von uns verzichten auf etwas Wichtiges, weil ihnen ein moralischer Aspekt noch wichtiger ist?
Aber gerade weil wir so wenig riskieren, darf man von uns etwas erwarten: dass wir uns jeden Tag erinnern, wofür wir stehen möchten, ein bewusstes Leben führen, uns der Momente entsinnen, an denen wir den eigenen Werten nicht gewachsen waren und von uns selbst verlangen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Dieses Buch versucht das in Texten unterschiedlicher Art, Erinnerungen, Anmerkungen, kurzen Essays, vor allem aber in Geschichten, die wir abwechselnd erzählen. Sie sollen, so verschieden sie auch ausgefallen sind, ein Plädoyer sein gegen die Gleichgültigkeit.
Unsere Texte unterscheiden sich, wie man beim Lesen schnell erkennen wird, im Schrifttyp.
Meine Leidenschaft für Politik
oderWie es kommt, dass ich mich manchmal wie ein kleines Arschloch fühle
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man an Politik nicht interessiert sein kann. Bei mir begann dieses Interesse, als ich ein kleiner Junge war. Lag das an besonderen Einflüsterungen meiner Familie? Oder an der Zeit, in die ich hineingeboren wurde?
Als ich klein war, protestierten fast überall in Europa die Studenten auf den Straßen, und in Vietnam führten die Amerikaner Krieg. Meine Eltern diskutierten bei jeder Gelegenheit über diese Themen, es waren aufregende Zeiten, zu aufregend für einen Neunjährigen, wie sie fanden. Sie erlaubten nicht, dass ich Zeitung las; ein Fernseher wurde gar nicht erst angeschafft.
Das machte das Weltgeschehen für mich natürlich noch interessanter, als es ohnehin schon war. Und ich fand einen Weg, fast jeden Tag Zeitung zu lesen, schon als Drittklässler.
Mein Vater kaufte, als wir in Rimini lebten, ein Blatt namens Il resto del carlino. (Der Name stammt aus einer anderen Zeit: Der carlino war einst eine Münze, die niemand mehr kennt, il resto war der Rest dieser Münze. Das Blatt kostete also ursprünglich offenbar nicht mehr als das Wechselgeld.) Das Mietshaus, in dem wir damals wohnten, war das letzte an einer längeren Straße, die direkt zum Strand führte. Der Blick von meinem Zimmer im vierten Stock war unverbaut, ich lag oft viele Stunden am Tag oben auf einem Etagenbett und schaute aufs Meer, ein Blick, der mich zugleich beruhigte und langweilte.
Zum Zeitungsladen waren es vielleicht zweihundert Meter stadteinwärts, und mein Trick, doch irgendwie zum Zeitunglesen zu kommen, bestand darin, dem Vater anzubieten, ihm morgens den Resto del carlino vom Kiosk zu holen, wie das in Italien üblich ist: Jeder kauft sich dort seine Zeitung am Kiosk, weil die Post oder jedes andere Zustellverfahren viel zu unzuverlässig wären.
Manchmal, wenn der Wind das zuließ und es nicht zu heiß war, setzte ich mich zur Lektüre gleich auf das Mäuerchen an der Strandpromenade. Meistens jedoch las ich im Wohnzimmer, während mein Vater im Bad mit der Rasur und schier endlosen morgendlichen Waschungen beschäftigt war. Trat er dann aus dem Bad, legte ich die Zeitung rasch sorgfältig wieder zusammen. Er sollte ja das Gefühl haben, ein noch ungelesenes Blatt zur Hand zu nehmen.
Meine große Sorge als kleiner Junge war, dass die Amerikaner in Vietnam verlieren könnten. Ich hielt zu den Amerikanern, wie man zu einer Fußballmannschaft hält, und zählte Tag für Tag aufgrund der Angaben im Resto del carlino die Opfer beider Seiten zusammen, was mir zunächst das Gefühl gab, dass Südvietnamesen und Amerikaner die Oberhand behielten. Ein trügerisches Gefühl, wie sich herausstellen sollte.
Der erste Politiker, den ich kennenlernte, war mein Großvater, der in einem Dorf in der Nähe von Braunschweig lebte. Er war Handelsvertreter von Beruf, später besaß er ein Möbelgeschäft. Weil er viel unterwegs sein musste, hatte er schon sehr früh ein Auto. Eines Tages hatte er mit diesem Auto einen Unfall, bei dem er sich das Knie schwer verletzte. Seitdem ging er am Stock.
Nach dem Krieg baute mein Großvater ein Haus, in dem ich während meiner ersten Lebensjahre zusammen mit meinen Eltern lebte. Viele Jahre lang war er dann Bürgermeister dieses Dorfes, als Sozialdemokrat, weshalb für mich, da auch mein Vater nie etwas anderes als SPD wählte, als Kind keine andere Partei als die SPD akzeptabel erschien.
Nachmittags spazierte mein Großvater mit einem Dackel namens Waldmann an der Leine durch den Ort. Er war eine Erscheinung von großer Autorität: immer in einem grauen Anzug mit Weste, Krawatte und goldener Uhrkette, das Haar straff zurückgekämmt und schlohweiß wie der Schnauzbart, würdevoll wie alle seine Brüder, meine Großonkels. Kaum je sah ich meinen Großonkel Willi, der Schlosser war und Mitglied der IG Metall, meinen Großonkel Otto, der den Krieg als Holzfäller in Finnland überlebt hatte, meinen Großonkel Walter, meinen Großonkel Kurt oder einen anderen aus der unübersehbar großen Großonkelmenge anders als in Anzügen mit Weste und Krawatte.
Wenn ich als kleiner Junge gemeinsam mit dem Sohn des Bäckers und dem des Feuerwehr-Kommandanten das Wasser im Dorfgraben aufstaute, um Schiffchen fahren zu lassen, zeigte der Großvater mit seinem Gehstock auf den Staudamm und sagte, das müssten wir nachher aber wieder wegmachen. Wir gehorchten. Nicht zu tun, was er angeordnet hatte, kam nicht infrage.
Jedenfalls nicht für uns Kinder.
Andere widersetzten sich ihm sehr wohl. Der Großvater besaß einen Kirschbaum, direkt vor seinem Haus. Und in jedem Winter träumte er davon, im Sommer Kirschen von diesem Baum zu essen, er schwärmte von den Früchten dieses Baumes, von frischen Kirschen, von Kirschkuchen mit Schlagsahne und eingelegten Kirschen im Glas.
Und in jedem Sommer, wenn sich die ersten Kirschen am Baum röteten, erschien am Himmel ein Schwarm von Staren, ließ sich auf den Ästen nieder und fraß, was der Baum hergab.
»Die verdammten Stare! Die Stare!«, schrie mein Großvater, rannte ins Haus, holte sein Gewehr und schoss in den Baum, während die Großmutter uns Kinder eilig beiseitezog und die Stare halb höhnisch, halb erschreckt kreischend aufflatterten, den Baum leer und den Großvater in ohnmächtigem Zorn zurücklassend.
Er war ein cholerischer, kraftvoller, energischer, autoritärer Mann, mein Großvater, aber er war mir auch fern, ganz anders als meine Großmutter, die mich behandelte, als sei ich ein spät geborener Ersatz für ihren ältesten Sohn, meinen Onkel, der gegen Ende des Krieges in einem Krankenhaus unserer Heimatstadt gestorben war. Irgendwie muss sie immer Angst gehabt haben, auch ich könnte verschwinden. Deshalb mästete sie mich regelrecht. Jedes Mal, wenn ich sie besuchte, machte die Großmutter mir sofort etwas zu essen, egal, was ich sagte, auch wenn ich gerade vom Essen kam – ich musste essen bei ihr, und ich tat es, ihr zuliebe.
Noch viel mehr als über die Kirschendiebe erregte sich mein Großvater indes über den Oppositionsführer im Gemeinderat, er hieß Schubmann und gehörte der CDU an. Oft hörte ich ihn, wenn er von einer Sitzung zurückkehrte, laut und wütend »dieser Schubmann!« rufen und meiner Großmutter Vorträge halten, welchen Unsinn »dieser Schubmann!« wieder einmal geredet habe.
Eines Tages fiel mein Großvater auf dem Heimweg vom Gemeinderat vor dem Haus tot um. Nicht auszuschließen, dass seine letzten Worte mit Schubmann zu tun hatten.
Vielleicht identifizierte ich mich damals mehr mit meinem italienischen Großvater als mit meinem Vater. Der Großvater war Wollfabrikant und ein Patriarch wie aus dem vorvorletzten Jahrhundert: Brillantine im rabenschwarzen Haar, schwarzer Nadelstreifenanzug, schwarz-weiße Schuhe, aufbrausend, aber mit einem Herz so groß wie der Eingang zum Grand Hôtel von Rimini, das in der Nähe seiner kleinen Fabrik lag.
Schon zu Lebzeiten umrankten ihn Mythen, wie die Geschichte vom sagenhaft azurblauen Bugatti, den Großvater bis zum Ausbruch des Krieges fuhr. Es war ein besonders seltenes Modell, von dem es in Italien nur sechs bis zehn Stück gegeben haben soll. Als die von Verbündeten zu Kriegsgegnern gewordenen Deutschen in Richtung Rimini vorrückten, ließ mein Großvater das gute Stück im Haus eines Bauern einmauern. Doch die Deutschen entdeckten das Auto, vielleicht hatte auch jemand gepetzt. Mein Großvater jedenfalls sah den Bugatti nie wieder.
Für ihn gab es nichts Schöneres, als seine Familie und Freunde zum Essen einzuladen. Er ließ es sich selten nehmen, persönlich den Einkauf zu erledigen, und kaufte riesige Mengen an Obst, Fleisch oder Fisch. Die reichten damals, als noch kein Mensch irgendeine Diät kannte, gerade für ein größeres Abendessen. Wenn alles verspeist war, ging mein dicker Opa manchmal noch fröhlich in die Küche und kochte für alle Spaghetti aglio, olio e peperoncino.
Der Großvater hatte eine Sekretärin namens Natalia, die ihm eines Tages aufgewühlt von ihrem Freund erzählte. Ich belauschte das Gespräch vom Verkaufsraum seines Wollgeschäftes aus: Der Freund studierte in Rom und hatte offenbar Ärger bekommen mit dem Rektorat, der Polizei oder der Justiz – oder mit allen dreien. Jedenfalls brachte mein Opa sein Unverständnis gegenüber diesem Protestler zum Ausdruck, während Natalia versuchte, sein Verständnis zu wecken.
Der Protestler war »links«, womöglich Kommunist, mein Opa war Fabrikbesitzer und fühlte sich von ihm bedroht, die Gegner der Amerikaner in Vietnam waren ebenfalls Kommunisten. So verliefen die Fronten, so sah die Welt für mich als Kind aus.
Und für einen Moment geriet diese Welt für mich aus den Fugen. Selbst mein Großvater schien schon in Gefahr zu sein! Ich ging zu meiner Mutter und sagte traurig (die Lage in Vietnam hatte sich nun auch in meiner Wahrnehmung verändert): »Überall gewinnen die Linken.« Doch meine Mutter lachte nur und sagte: »Jeder intelligente Mensch ist doch heute links!«
Vielleicht wirkte Großvaters Gespräch mit seiner Sekretärin auf mich auch deshalb so bedrohlich, weil ich damals schon eine andere Großvatergeschichte kannte, die mein Vater gut zwanzig Jahre vorher erlebt hatte, auch er als Kind.
Es war das Jahr 1948. Das vom Faschismus befreite Italien wählte sein erstes Parlament, und es schien möglich, dass die Volksfront siegen könnte. Mein Vater war damals seinerseits Zeuge eines Gesprächs, nämlich zwischen einer Verkäuferin und einem Fabrikarbeiter meines Großvaters. Er wurde vor Angst ganz starr, denn der Arbeiter sagte: »Wenn wir morgen die Wahlen gewinnen, dann rechnen wir hier mit dem padrone ab.«
Aber es triumphierten die Christdemokraten. Als ihnen nach einer halben Ewigkeit schließlich die Macht entwunden wurde, war Großvater längst gestorben.
Doch ich werde nie den Satz vergessen, den er am Ende jenes Gespräches zu seiner Sekretärin Natalia sagte und der meine zersprungene Welt wieder ein wenig kittete, weil ich eine Ahnung davon bekam, dass es etwas gab, das über der Politik stand und wichtiger war als sie. Der Großvater sagte: »Hören Sie, wenn Sie etwas brauchen«, und es war klar, dass in dieses Angebot auch ihr linker, so bedrohlicher Freund in Rom eingeschlossen war, »dann lassen Sie es mich wissen.«
Wenn ich an meinen Vater denke, sehe ich oft sein rechtes Auge vor mir. Es war ein Auge aus Glas. Er hatte sein richtiges Auge im Krieg verloren, seltsamerweise rettete ihm das sein Leben, denn er kam nach dieser Verletzung zu spät aus dem Lazarett, um in den Kessel von Stalingrad noch hineinzugelangen; so starb er dort nicht.
Das Glasauge füllte die rote, offene Höhle, in der sich einmal sein richtiges Auge befunden hatte, es war kaum von einem echten Auge zu unterscheiden. Aber abends, wenn mein Vater schlafen ging, nahm er das Glasauge heraus und legte es im Badezimmer in eine Schale mit Borwasser. Und wenn ich nachts noch einmal ins Bad ging, traf mich der Blick dieses toten Auges, ich konnte ihm nicht entgehen, es war nicht einmal unheimlich.
Er war mir ganz selbstverständlich, dieser Blick aus der Borwasserschale, meine ganze Kindheit lang.
Auch konnte mein Vater das Lid über dem Glasauge nicht schließen. Oft, wenn es Sonntag war, schlief er nachmittags im Wohnzimmersessel ein. Er schloss dann das gesunde Auge, aber das Glasauge blieb offen, es starrte mich aus dem schlafenden Vatergesicht heraus an, wenn ich das Wohnzimmer betrat, und obwohl ich das so viele Jahre lang immer wieder sah, war es, als würde mich der Vater, selbst wenn er schlief, nicht aus dem Auge lassen. Und als träfe mich, mitten aus dem Gesicht meines Vaters heraus, ein Blick aus einer fremden, kalten, toten Welt.
Ich kannte meinen Vater als einen, der bisweilen über seine physischen Verletzungen klagte, der aber über sein Inneres nie redete.
Immer wieder, wenn seine Freunde zu Besuch kamen, wenn jene da waren, die ihn vor dem Krieg gekannt hatten, wenn sich die Wohnzimmertür für uns Kinder schloss und dann bis in die Nacht hinein überbordendes Gelächter nach außen drang, bekam ich eine Ahnung davon, dass mein Vater ein Mensch war, den ich nie wirklich kennen würde.
Ich wuchs damals in einer Straße auf, in der die meisten Männer in irgendeiner Weise kriegsverletzt waren. Allein drei Blinde lebten hier, einer wurde morgens von seinem Sohn zum Bus geführt und zur Arbeit gebracht. Ein anderer Mann hatte eine tiefe Beule im kahlen Schädel, ein weiterer besaß nur einen Arm, einem Dritten fehlte das Bein, meinem Vater eben ein Auge.
Aber diese physischen Verletzungen waren, so seltsam das klingen mag, nicht einmal das Schlimmste, jedenfalls nicht für uns, die Kinder. Furchtbarer war das ewige Schweigen vieler dieser Männer, das sich am absurdesten bei jenem Vater äußerte, der in seinem Haus ein Zimmer mit einer Funkstation einrichtete, von dem aus er mit Hobbyfunkern auf dem ganzen Globus in Verbindung trat – nur mit seiner eigenen Familie wechselte er an manchen Tagen kaum ein Wort. Stattdessen kaufte er bisweilen säckeweise Reis, weil er den nächsten Krieg und eine damit verbundene Hungersnot fürchtete.
Erst spät verstand ich, dass diese Männer nicht nur äußerlich krank, ja, innerlich oft nahezu tot waren nach sieben Jahren Krieg. Liest man nicht heute, dass Soldaten, die in Afghanistan waren, sich traumatisiert in die Behandlung geschulter Psychologen begeben müssen? Wer hätte je dringender einer solchen Behandlung bedurft als unsere Väter?
Ich provozierte, seit ich etwa fünfzehn geworden war, meinen Vater Tag für Tag. Ich trug die Haare lang, ich stand spät auf, ich wurde von einem Jahr aufs andere vom Klassenbesten zu einem Versetzungsgefährdeten – und ich tat das alles nicht, weil ich ihn hasste, sondern weil ich irgendeine Reaktion von ihm verlangte. Weil ich wollte, dass er mich sah.
Und weil ich nicht wollte, dass er schwieg.
Aber es gab ein Thema, bei dem mein Vater stets quicklebendig wurde: die Politik. Er interessierte sich sehr dafür, las jeden Tag gründlich die Zeitung, dazu wöchentlich ausführlich die Zeit und den Spiegel, und nachdem wir endlich nach vielen Jahren einen Fernseher gekauft hatten, saß er jeden Sonntagmorgen um zwölf vor dem Apparat, um den Internationalen Frühschoppen zu sehen, eine Sendung, in der ein Moderator namens Werner Höfer mit fünf Gästen, Journalisten aus verschiedenen Ländern, Weltprobleme aller Art debattierte. Selten habe ich meinen Vater leidenschaftlicher begeistert gesehen als bei dieser Sendung, in der stets heftig gestritten wurde, sei es über das Palästina-Problem, sei es über die Ostverträge. Noch beim Mittagessen berichtete er uns mäßig interessierten Kindern und seiner diesen Fragen nur am Rande zugänglichen Frau, worum es in der Sendung gegangen war und wer welche Positionen in welcher Art vertreten hatte.
Warum war er so? Warum erreichte auch die Cholerik des Großvaters ihren Höhepunkt, wenn es um Politik ging? Warum war überhaupt in jenen Jahren mein Bild von der Politik bestimmt von laut streitenden, schreienden Männern, die Wehner hießen oder Strauß?
War ihre Leidenschaft in dieser Hinsicht der einerseits hilflose, andererseits notwendige Versuch, nach der deutschen Katastrophe etwas durch und durch Gutes aufzubauen? Und war mein Vater nicht genau das, was in unserem Staat heute oft zu fehlen scheint: ein mündiger, interessierter, informierter Bürger?
Oder war die Politik nur das Ausweichfeld, auf dem sich diese Männer überhaupt Gefühle gestatten konnten, eine Welt wirklich großer Emotionen, wie es sie (für die meisten Männer damals) ansonsten nur noch auf dem Fußballplatz gab? Wie oft habe ich erlebt, dass meine Mutter abends, wenn es schon dunkel war, weinend aus dem Haus lief, nachdem sie gerufen hatte, sie ertrage dieses Schweigen des Mannes, den sie liebte, nicht mehr, diese Berührungslosigkeit? Wie oft habe ich oben auf dem Treppenabsatz gesessen und auf ihre Rückkehr gewartet?
Ich hielt weiter zu den Fabrikbesitzern, bis ich während der Sommerferien einmal nach Deutschland fuhr, um meine Großmutter zu besuchen, auch meinen Onkel Stefan, der damals Mitte zwanzig war, Student an der Werkkunstschule in Hannover und ein sehr feinsinniger, in seiner Sensibilität auch gefährdeter Mann. Das muss Ende der 60er-Jahre gewesen sein, jedenfalls gab mein Onkel in Großmutters Wohnung eine Party, von der ich allerdings nur die Vorbereitungen mitbekam. Als es richtig losging, wurde ich ins Bett geschickt.
Durch die Schiebetür des Gästezimmers hörte ich Onkel Stefan und seine Künstlerfreunde feiern.
Welch eine Verheißung das war! Die Musik, die rote Glühbirne, die jemand eingeschraubt hatte, der Rauch, die Gespräche, die sich auch um Politik drehten – all das ließ in mir die schöne Illusion wachsen, dass alles, was im Leben aufregend ist, irgendwie links ist. Denn natürlich hielt ich Onkel Stefan für einen Linken, der damals hauptsächlich damit beschäftigt war, politische Happenings mit seinen Kommilitonen zu veranstalten.
Aber er war nicht links, nicht im Geringsten.
Er habe, erzählte er mir sehr viel später, ein so schlechtes Verhältnis zu seinem Vater gehabt, einem recht bekannten Sozialdemokraten, dass er von Politik nichts, aber auch wirklich nichts wissen wollte. Nur waren damals eben »links« und emotionale Rebellion kaum auseinanderzuhalten.
Onkel Stefan für sein Teil war jedenfalls ganz und gar unpolitisch.
Was mir von jenem Abend blieb, war die Ahnung, dass es noch eine andere Welt gab als die meiner Eltern und Großeltern, eine Welt, die viel aufregender und eben auch jünger war. Ich wünschte mir einen Freund wie Onkel Stefan. Und vielleicht spürte ich damals auch die Sehnsucht nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Ich hatte unter Gleichaltrigen wenig Vertraute, was vor allem daran lag, dass meine Eltern die komische Angewohnheit hatten, alle paar Jahre das Land, die Stadt oder das Wohnviertel zu wechseln. Jahre später hätte ich das, was ich empfand, als ich hinter der Schiebetür stand und die Party meines Onkels belauschte, womöglich als eine geheimnisvolle Macht aus Rebellion, Liebe und Ausbruch beschreiben können. Aber so weit war ich noch lange nicht. Das Disko-Licht, das durch den Türspalt strömte, kam mir nur vor wie das Morgenrot.
Später, am Gymnasium, sahen wir uns nicht selten teils lächerlichen, teils dummen, teils unbelehrbaren Figuren gegenüber, einer Spezies von Paukern, die (vielleicht schon zermürbt von etlichen aufmüpfigen Schülerjahrgängen) in jedem Schüler mit längerem Haar, der im Unterricht provokante Fragen stellte, einen kleinen Staatsfeind sahen – obwohl mangelhafte Haarpflege und Sticheleien doch meistens nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder einfach Spaß an der Freude waren.
Jener Griechischlehrer, der in der Klasse »Lange Haare, kurzer Verstand« verkündete.
Der Oberstudienrat, der tönte: »Einen Panzer lassen sie mich nicht mehr fahren, aber eine Panzerfaust könnte ich immer noch halten.« Sein Sohn, der sanftmütig war und halblange Haare trug, war dann später mein Mathe-Nachhilfelehrer.
Der Oberstudiendirektor, der verlangte, dass man aufstand, wenn er den Klassenraum betrat, und der meiner Mutter einmal eröffnete, ich hätte alle Anlagen für eine kriminelle Karriere. Als Beweis dienten ihm einige Einträge ins Klassenbuch, die ich wegen kleinerer disziplinarischer Vergehen bekommen hatte.
Bei uns gab es den Direktor, der im Krieg ein Auge verloren hatte, den Spitznamen »Geier« trug und eine Eiseskälte verströmte, dass ich schauderte, wenn ich ihn nur auf einem Gang irgendwo vorbeigehen sah.
Andererseits denke ich auch an den Deutschlehrer, mit dem wir über Böll und Grass diskutierten, oder den Studienrat in, wie es damals hieß, »Gemeinschaftskunde«, der sich geduldig in jeder Stunde meine scharfe Kritik an seinem Unterricht anhörte und dessen Wortgefechte mit mir dem ganzen Rest der Klasse zur Unterhaltung dienten.
Ich fand so meine Rolle unter den Mitschülern: als jener allseits respektierte, andererseits auch belächelte Politfreak, der schon mit 15 den Spiegel las und die Zeit, in den rororo-Bänden das Grundsatzprogramm der Jungsozialisten studierte und sich mit dem Buch Sprache und soziale Herkunft des Soziolinguisten Ulrich Oevermann herumschlug – während die anderen Jungs in der Klasse sich keinen Deut darum scherten und lieber ihren Spaß mit den Mädchen hatten.
Verführerisch war für uns natürlich die neue Generation von Lehrern, deren Vorboten die Referendare waren. Sie sahen aus wie wir, nur dass sie etwas älter waren, sie luden uns zu den »Feten« ein, die sie bei sich zu Hause veranstalteten, entpuppten sich aber doch ziemlich schnell als Enttäuschung. Denn von einem Lehrer, der einem so sehr ähnelt, kann man eben nicht besonders viel für sein eigenes Leben lernen. Sie hatten etwas anbiedernd Unerwachsenes. Es war furchtbar, den Gemeinschaftskunde-Referendar dabei zu beobachten, wie er sich in unserer Gegenwart eine Selbstgedrehte ansteckte, in der – auch für Nichtraucher schnell zu begreifen – Gras war. Noch verheerender war der Studienrat, der mit dem schönsten Mädchen meiner Jahrgangsstufe knutschte.
Erst recht irritierte diese Verschiebung der Lebensphasen, wenn man sie an den eigenen Eltern beobachten konnte. Mein Vater wäre in den Siebzigerjahren eigentlich ein Grund dafür gewesen, sich sofort mindestens der Schülerunion, besser noch einer schlagenden Verbindung oder einer Organisation katholischer Fundamentalisten anzuschließen. Seine Familie hatte ihn in ihrer wirtschaftlich besten Zeit in ein Schweizer Internat geschickt, als Teenager trug er maßgeschneiderte Hemden mit Initial, und zu Hause in Rimini leistete man sich zeitweilig eine Lehrerin, die mit ihm nur Französisch sprach. In den Siebzigern führte er plötzlich das Leben eines Bohemiens, in dem für Kinder kaum Platz war. Dafür stand in seinem römischen Dachgarten eine groß gewachsene und gut gepflegte Marihuana-Pflanze.
Aber als ich kürzlich mit einem Mitabiturienten über unsere Schulzeit sprach, sagte er, im Grunde gebe es nur wenige Schulstunden, die ihm bis heute im Gedächtnis geblieben seien, und das seien jene Stunden gewesen, die drei oder vier junge Referendare über den Spanischen Bürgerkrieg hielten. Sie taten das fächerübergreifend, behandelten das Thema also gleichzeitig in Musik, Kunst, Deutsch und Geschichte, behandelten hier die Lieder von Ernst Busch, da Picassos Guernica, dort Texte von Alfred Kantorowicz oder Ernest Hemingway, schließlich die Rolle der Legion Condor. Und wir waren begeistert von der Begeisterung dieser jungen Leute, die einmal alles anders machten, als wir es kannten. Und die das mit Freude taten, nicht mit der Routine alter Männer.