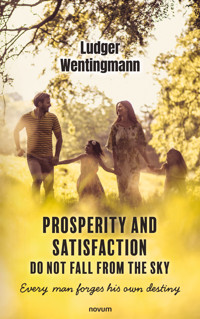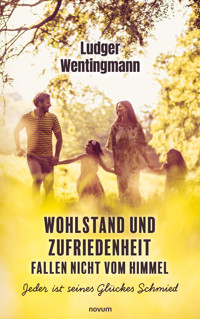
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie können unsere Gesellschaft und die gesamte Welt gerechter und lebenswerter werden? Diese Frage geht Ludger Wentingmann nach, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Er beschäftigt sich mit den Aufgaben der Politik, die dringend angegangen werden müssen – von der Finanzierung der Renten bis zu einer nachhaltigeren, ressourcenschonenden Wirtschaft. Aber auch dem Menschen und seinen Bedürfnissen, als Individuum und als Teil der Gesellschaft, gilt sein Interesse. Er beschreibt, wie echte Kommunikation gelingen kann und was sie vom Einzelnen abfordert. Dabei plädiert Wentingmann für Empathie, Ehrlichkeit, Optimismus und den Mut, bei Missständen nicht wegzusehen. Denn auch wenn die Welt immer komplexer und weniger durchschaubarer wird, können nur wir sie zum Besseren hin verändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99146-769-4
ISBN e-book: 978-3-99146-770-0
Lektorat: Susanne Schilp
Umschlagfoto: Liderina | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Der Mensch, ein individueller Akteur, auf vielen Wegen unterwegs
Vor einigen Jahren war ich mit der Familie über Ostern im Allgäu. Am Ostersonntag, bei herrlichem Sonnenschein und blauem Himmel, sind wir mit einer Gondel auf den Breitenberg hochgefahren. Je höher wir kamen, umso mehr wurden unsere Blicke durch tiefziehende Wolken versperrt. Am Stationsende der geschlossenen Gondel ging es mit einem Sessellift den Berg weiter hinauf. Am Ende, beim Ausstieg, immer noch Wolkennebel. Zur Berghütte auf dem Berggipfel ging es nur zu Fuß auf einem schmalen und verschneiten Weg mit starken Steigungen. Spaß machte das nicht mehr. Doch wir wollten unser Ziel, die kleine Gastronomie auf dem Gipfel, erreichen. Etwas unterhalb des Gipfels wurden wir mit Sonnenschein, einem blauen Himmel und weitem Rundblick über den Wolken belohnt. Da erinnerte ich mich an den Song von Reinhard Mey: „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.“
Rückblickend für mich eine Erfahrung, dass es sich lohnt, ein Ziel zu haben und nicht zu resignieren, auch wenn es anstrengend ist. Ja, für vieles im Leben und insbesondere für Entscheidungen ist es von Vorteil, einen ungetrübten Blick, eine klare Sicht der Dinge zu haben. Mit etwas Abstand, auch zeitlich gesehen, gelingt das besser. Extreme Emotionen oder sogenannte Schnellschüsse können so vermieden werden. Abwarten und etwas sacken lassen ist in der heutigen schnelllebigen Welt in sehr vielen Bereichen nicht mehr die Regel beziehungsweise wird zunehmend weniger akzeptiert.
Die deutschen ISS-Astronauten Alexander Gerst und Matthias Mauerer hatten einen optimalen Weitblick aus dem All auf unseren Planeten Erde. Und das mehrmals täglich. Sie berichten über die sichtbaren, zum Teil sehr dramatischen Veränderungen unseres Lebensraums. Aus der Distanz und mit freiem Blick von oben sind Wahrnehmungen ungetrübte Fakten, denen wir nicht ausweichen können. Ein „Weiter so“ wird häufig aus Gewohnheit und Bequemlichkeit bevorzugt. Das hat früher oder später Folgen, die sehr massiv und schmerzlich sein können. Rückschläge, Krisen und Chaossituationen haben viele Gesichter und niemand kann ihnen letztlich aus dem Wege gehen. Menschen mit einer eher pessimistischen Lebenseinstellung gelingt eine Wendung zum Besseren nicht so gut. Optimismus, Mut und Tatkraft sind persönliche Stärken, die jeder für ein besseres Leben nutzen kann. Doch die Mentalitäten bei uns Menschen sind sehr verschieden, mit individuellen Einflüssen für Erfolg und Glück im Leben. Im Miteinander, mit dem „Du“, können Schwächen zu Stärken gewandelt werden. Es ist die Solidarität, die Menschen insbesondere in schweren Krisenzeiten zusammenschweißt und zu enormen Leistungen beflügelt.
Man muss kein Hellseher sein, um die Veränderungen für unseren Lebensraum zu erkennen. Als Erstes braucht es Interesse und den ernsthaften Willen, mit den jeweils eigenen Fähigkeiten und Ressourcen wahrzunehmen, was gut oder schlecht läuft. Egal ob im Privatbereich oder in unserer Gesellschaft beziehungsweise im Kontext der ganzen Weltbevölkerung. Der Blick auf Fakten und Entwicklungen, nicht mit der rosaroten Brille, sondern mit Wahrheit und Klarheit, realitätsbezogen. Und nicht mit Ausreden oder Resignation: „Was kann ich als Einzelner, als kleines Rädchen im großen Weltgetriebe schon ausrichten?“ Mit Wegsehen und Schweigen bleibt der Einzelne eher machtlos. Es braucht Verbündete, die ein Mahnen und Klagen hören. Die in Schweden begonnene Bewegung „Fridays for Future“ mit der starken, mahnenden Stimme von Greta Thunberg hat weltweit eine regelrechte Lawine im positiven Sinne erzeugt. Ein Umdenken der Menschen bezüglich unseres Lebensraumes Erde ist am Wachsen. Das Anliegen von Fridays for Future wird als notwendig und richtig gesehen; doch in der täglichen Verhaltensänderung gibt es noch viel zu tun.
Seit meiner Jugend hatte ich immer den Drang, etwas in unserer Gesellschaft mitzugestalten und, wenn notwendig, zu verändern. Ich wollte nicht schweigen, wenn etwas schieflief oder ungerecht war. Für die Diskussion und Konfrontation mit anderen Meinungen fehlte mir in jungen Jahren häufig der Mut zum Durchhalten. Da spielten wohl meine strenge Erziehung im Elternhaus und meine Verhaltensmentalität eine Rolle. Später, bei einem Führungskräfteseminar der Bank, bestätigte mir der Moderator und Psychologe mein großes Harmoniebedürfnis, das mich tendenziell eher friedlich und zurückhaltend sein ließ. Darüber habe ich lange nachgedacht und mir vorgenommen, mich hier weiterzuentwickeln und auch manches einfach mal auszuprobieren. Mit den Jahren lernte ich, dass es die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen und Erwartungen braucht, um Klarheit und Fortschritt zu erreichen. Das machte mir Mut und stärkte mein Selbstbewusstsein. Für mein Engagement im Beruf, in Vereinen, in der katholischen Kirche als Diakon und in der Kommunalpolitik war mir stets wichtig, dass es sich lohnt, seine eigenen Ideen und Beiträge einzubringen und im Miteinander letztlich gute Lösung zu finden.
Fehler zu machen, war mir nicht mehr peinlich. Mir wurde bewusst, dass Fehlermachen sehr menschlich ist. Einen Fehler offen, ohne Verdrängungstaktik, zuzugeben, ist persönliche Stärke und nicht Schwäche. Deshalb habe ich immer bewusst über meine Fehler gesagt: „Ich entschuldige mich und biete Wiedergutmachung an.“ Dafür habe ich stets eine positive Anerkennung bekommen. Die häufig gebrauchte Wendung „Ich bitte um Entschuldigung“ ist eine Bitte um Nachsicht und Vergebung. Oder anders ausgedrückt: „Seid bitte gnädig mit mir.“ Eine Bitte an andere, die ja nicht schuldig geworden sind, werden zum Handeln aufgefordert. Auch wenn es nur darum geht, zugegebene Fehler anderer zu akzeptieren. Wo schwere Fehler grob fahrlässig oder sogar bewusst begangen werden, bleibt die Verantwortung für Konsequenzen jedoch stets beim Verursacher. Das heißt Wiedergutmachung, sofern möglich. Beispielsweise von einem Amt oder einer Leitungsposition rechtzeitig zurücktreten und auf eine Abfindungszahlung verzichten. Und bei großen Vergehen gerichtliche Verurteilung mit entsprechenden Strafen akzeptieren. Hier dürfen wir, anders als in Diktaturen oder autokratisch geführten Staaten, auf unsere Gerichtsbarkeit stolz sein.
Manchmal muss man einfach etwas Neues ausprobieren und wenn erforderlich auch mal einen Schritt zurück machen. Wer behauptet, er mache keine Fehler, der hat sich weggeduckt oder versteckt sich hinter anderen. Mit Kreativität und Mut sowie Unterstützung in einem Team können Missstände vermieden werden und Fortschritte gelingen. Mir selbst ist dabei klar: Ich muss mich mit den Fakten und Argumenten vertraut machen und mögliche Folgewirkungen in Erwägung ziehen. Aus der Vorbereitung von Kreditentscheidungen in der Bank kenne ich die Phasen „Faktenklärung/Analyse“ sowie „Perspektiven“ mit Darstellung von Szenarien von best case bis worst case. Ich habe mir angewöhnt, die Faktenlage genau zu betrachten und nicht mit Schnellschüssen Zustimmung oder Ablehnung zu verkünden. Im heutigen Alltag mit Kommunikation über E-Mail oder WhatsApp wird prompte Rückmeldung erwartet. Mit etwas Geduld und Nachdenken steigt der Nachhaltigkeitswert von Entscheidungen. Den Erwartungen von Mail- und WhatsApp-Sendern bezüglich einer umgehenden Rückmeldung sollte nicht immer sofort gefolgt werden. Eine kurze Zwischennachricht wie „Ich werde das noch prüfen oder klären und melde mich dann“ ist für die Kommunikation und in der Sache förderlich.
Mit Eintritt in das Rentenalter ist mein Interesse an gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen weiter gewachsen. Plakativ von der Politik verkündete Milliardenbeträge relativieren sich, wenn ich die Summen auf ein Jahr und auf betroffene Bürger umrechne. Als Banker habe ich immer mit Zahlen zu tun gehabt und das Analysieren und Bewerten von Fakten gehörte zu meiner täglichen Arbeit. Aus beispielsweise mehrjährig zusammengefassten Steuerentlastungen werden, relativiert, häufig Peanuts für die betroffenen Bürger. Unsere moderne Gesellschaft hat sich darauf eingerichtet, möglichst plakativ, ohne viele Details, öffentlich Wirkung zu erzielen. Das führt zu Fehleinschätzungen und früher oder später zu großen Enttäuschungen.
Journalisten bevorzugen Schlagzeilen, die beim Leser wirken, aber wenig Konkretes vermitteln. Im nachstehenden, klein gedruckten Text lese ich dann, wer welche Äußerung getan hat oder wer wem widerspricht. Streit, Falscheinschätzungen oder Fehlverhalten beherrschen unsere Nachrichten. Wir Menschen sind primär für das Negative empfänglich. Etwa nach dem Motto: Andere sind nicht gut. Das beklagt schon Jesus in der Bibel „Du siehst den Splitter im Auge deines Nächsten, aber nicht den Balken in deinem Auge.“ Ein menschlicher Mechanismus, um sich selbst in einem besseren Licht darzustellen. Nach dem Motto „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land?“
Unsere Gesellschaft braucht keinen Wettbewerb um Popularität oder ein Ranking in der Beliebtheitsskala. Wir brauchen Politiker*innen und Interessenvertretungen in Wirtschaft und Gesellschaft, die angesichts der massiven Nachhaltigkeitsprobleme von Klima, Hunger, Krieg etc. nichts beschönigen und konstruktiv und ehrlich nach guten Lösungen suchen. Der Mensch kann sich hierfür oder dafür entscheiden. Die individuelle Verantwortung für mögliche Folgen bleibt. Sowohl für den Einzelnen als auch für das gemeinschaftliche Miteinander.
Menschen sehen ihr „Ich“ und brauchen täglich auch das „Du“
Täglich werden wir alle damit konfrontiert, dass diese Welt weder gerecht noch perfekt ist. Die Nachrichten in den Printmedien sowie in Rundfunk und Fernsehen bringen tagtäglich in einer noch nie dagewesenen Vielfalt und Transparenz das Weltgeschehen in unsere Wohnzimmer. Ein Bierchen, ein Glas Wein mit den rituellen Knabbereien schmecken uns vor dem Fernseher trotz all der negativen Schlagzeilen recht gut. Bilder von zerstörten Städten wie seit Jahren beispielsweise in Syrien und ab dem 24.02.2022 in der europäischen Ukraine oder in anderen Kriegsgebieten dieser Erde sind uns sehr vertraut. Erst durch die intensiven Flüchtlingsströme in das vermeintliche Paradies Deutschland 2015 und jetzt im Jahr 2022 aus der Ukraine berühren uns die Nöte der Kriegsflüchtlinge auch persönlich. Plötzlich ist das Leid nicht mehr fern von uns, sondern durch Menschen in unserer Nähe präsent. Es geht uns zu Herzen. Auch die täglichen Nachrichten und Bilder im Juli 2021 über die dramatischen Zerstörungen durch die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz mit vielen Toten und Sachschäden in Höhe mehrerer Milliarden machten betroffen und führten zu einer großen, teils spontanen Solidarität. Immer dann, wenn die Not anderer Menschen uns hautnah berührt, spüren wir Empathie und die Bereitschaft zur Hilfe. Krisen und Notlagen verbinden Menschen und stärken in der Gemeinschaft den Willen und die Tatkraft.
Häufig im Leben wird auch der bequemere Weg mit Wegschauen und Verdrängen gewählt. Manchmal aus der Sorge um die eigene Überforderung. Ich erlebe auch die Haltung „Was geht mich das an?“ Eine egoistische Haltung und ein Ausblenden der Mitverantwortung für das Gelingen von Gemeinschaft und Solidarität. Motiv ist möglicherweise auch die eigene Unzufriedenheit oder eine resignative Lebenseinstellung. Wird aber selbst eine Hilflosigkeit erfahren, ist das Geschrei recht groß.
Losgelöst von den lebhaften Diskussionen über die motivierende Botschaft der Kanzlerin Angela Merkel im Herbst 2015 („Wir schaffen das“), zeigten Bürger und Bürgerinnen ihre Verantwortung in dieser globalen Welt. Sie praktizierten einfach Menschlichkeit. Ein Bedürfnis, das tief in jedem von uns verankert ist. Es geht um anerkennende Wertschätzung. Und dazu brauchen wir das menschliche Gegenüber. Oder anders ausgedrückt, wir wollen in unserer Persönlichkeit respektiert und geliebt werden. Das gilt für jede zwischenmenschliche Beziehung. Es schmerzt schon sehr, wenn die urmenschlichen Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Jeder Mensch ist ein Individuum mit seinen Stärken, aber auch mit seinen Ecken und Kanten. Letztere empfinden wir oft als ärgerlich, ja manchmal können sie auch sehr verletzend sein. Stärken, die mit Arroganz und Dominanz von außen auf uns einwirken, bringen uns schon mal zur Irritation, zur Einschüchterung oder gar zur Wut.
Ich erinnere mich an das Sprichwort „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“. Mir ist klar, wenn Entscheidungen getroffen, Lösungen gefunden oder etwas erarbeitet wird, dann gibt es keine Garantie für Erfolg und Perfektion. Der Anspruch ist da, doch wer kann ihn auch erfüllen? Kein Mensch auf dieser Erde ist vollkommen. Die menschliche Begrenztheit und das eigene Schwächeln in unterschiedlichsten Facetten erfahren wir doch irgendwie jeden Tag. Da ist der heutige, moderne Mensch weder besser noch schlechter als alle Generationen vor uns. Immer wieder sind unser Reden sowie das Tun mit dem Makel des Unperfekten behaftet. Die Ursachen dafür sind vielschichtig. Menschen sind beispielsweise vergesslich und machen aus vielerlei Gründen Fehler. Eines der größten Schwächepotenziale erlebe ich in der Kommunikation mit unserem Reden, Denken und Handeln. Es sind unsere Emotionen, die Kommunikation und das Miteinander wesentlich mitbestimmen. Das Reden über Gefühle ist selbst schon eine riesige Überwindung. Da begleitet uns die Angst, wir könnten missverstanden oder gar ausgelacht werden. Das möchte niemand. So werden Mechanismen genutzt wie Ausreden, Lüge, Schweigen, Thema wechseln, Belächeln oder auch das Betrachten durch einer rosaroten Brille. Das gibt dann Schutz nach außen, zumindest in der aktuellen Situation. Die Gefühlslage nach innen mag für den Augenblick beruhigt sein. Doch alles, was unterdrückt wird, kommt früher oder später wieder an die Oberfläche und dann in stärkerer Potenz.
Der Philosoph und Buchautor Richard David Precht sagte 2011 in einem WDR-Talk:
„Der Mensch ist ein unglaublich anpassungsfähiges Tier. Aber er ist auch in der Lage, sich selbst unglaublich gut in die Tasche zu lügen. Das ist eine Fähigkeit, die den Menschen von allen Tieren unterscheidet. Kein Tier beherrscht die doppelte Buchführung in Sachen Moral so gut wie der Mensch. Das heißt, wir krücken (lügen) und räumen uns die Welt zurecht, indem wir uns mit anderen immer wieder vergleichen und wir sie für schlechter halten als uns selbst. Und dann sind wir auf einmal wieder sehr viel besser als andere.“ 1
1Richard David Precht, Mon Talk, www.wdr.de, WDR 2, 08.02.2011.
Die menschliche Unvollkommenheit wirkt sowohl nach innen als auch nach außen. Wie oft bereuen wir unberechtigte Vorwürfe oder unser fehlerhaftes Handeln. Wir ärgern uns über uns selbst und tun uns doch schwer, unser Fehlverhalten offen zuzugeben. Stattdessen Ablenkung mit Fokussierung auf Schwächen anderer. Gefühle wie Neid oder Missgunst spielen im Zusammenleben offen oder unterschwellig sehr oft eine Rolle. Wir fühlen uns benachteiligt. Ein Arbeitskollege erzählte mir einmal, dass sein Sohn eines Tages begeistert von seinem Freund nach Hause kam und berichtete: „Papa, die Eltern von Michael, die sind richtig reich und fahren einen Porsche.“ Der Vater habe darauf erwidert: „Du siehst den Porsche und das ist ein großartiges Auto. Du kannst aber nicht sehen, ob der Porsche nur geliehen oder mit Schulden gekauft wurde.“ Menschen schauen immer zuerst auf das, was wir mit den Augen wahrnehmen können. Viele andere Dinge im Hintergrund bleiben unsichtbar. Deshalb kommt es immer wieder vor, dass wir uns blenden lassen.
In der Bank habe ich Kunden kennengelernt, die wirklich reich waren, die sich aber äußerlich bescheiden zeigten. Umgekehrt sind mir auch Kunden begegnet, die sich verschuldeten, nur um nach außen mit etwas Luxus angegeben zu können. Der Wert einer Person ist niemals mit dem messbar, was er ist oder was er hat. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich nur mein Gesicht. Damit kann ich zufrieden oder eben auch unzufrieden sein. Das hängt von meinen Erwartungen und Wünschen ab. Diese werden auch durch Vergleiche mit anderen Personen geprägt. Ein gewisses Maß an Bescheidenheit und Dankbarkeit fürs Leben fördern eher unsere Glücksempfindungen. Aus einer so gewonnenen Rundumzufriedenheit kann es mir auch gelingen, insgesamt etwas gelassener zu sein. In den letzten Jahren ist mir bewusst geworden, dass viele äußerliche Wohlstandssymbole für mich nicht mehr so wichtig sind. So sehe ich das Auto nur noch als einen praktischen Gebrauchsgegenstand. Das regelmäßige Autowaschen und Polieren der glänzenden Chromleisten ist längst Vergangenheit. Beim Einkaufen frage ich mich oft: Brauche ich das oder ist es für mich nicht so wichtig? Früher folgte ich allen Einladungen, weil ich meinte, dass ich dabei sein müsste. An meinem 50. Geburtstag fragte mich mein Chef in der Bank, ob sich denn für mich jetzt etwas ändere. Ich sagte mit einer inneren Gelassenheit: „Jetzt kann ich sagen, was ich denke und was mir wichtig ist.“ Ergänzend sagte ich: „Okay, ich darf natürlich niemanden persönlich angreifen oder beleidigen.“ Respektvoll und achtsam mit sich selbst sowie mit anderen umzugehen, ist ein hoher Anspruch und in der Wirklichkeit des Alltages nie perfekt zu erreichen. Schon das Wissen und das Bemühen darum sind ein guter Weg.
Mit all diesen Themen sind wir privat und beruflich unterwegs. In meinem Berufsleben als Kreditberater wurde ich nicht nur mit den Fakten konfrontiert, sondern immer auch mit den Menschen, die ich häufig über viele Jahre betreut habe. Die Zahlen für oder gegen die Bereitstellung eines Kredites waren für mich immer nur eine Seite der Medaille. Der Mensch und seine Bedürfnisse, soweit die Bank sie erfüllen konnte, standen für mich immer mit im Vordergrund. Gewiss hatte ich auch die Zielvorgaben meines Arbeitgebers stets im Auge. Mein Weg zur Zielerfüllung war nicht das rhetorische Verkaufsgespräch, sondern die offene und faire partnerschaftliche Beziehung. Aus diesem sehr lebendigen und vertrauensvoll geprägten Miteinander konnte ich für meine Kunden und für die Bank über viele Jahre recht erfolgreich tätig sein. Und über Erfolge habe ich mich selbst natürlich auch sehr gefreut. Das stärkte dann auch meine Motivation und Zufriedenheit.
Das Morgen ist anders als das Heute. Herausforderungen brauchen Weitsicht und Mut
„Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf. Denn Dunkelheit für immer gibt es nicht. Die gibt es nicht.“ Ein Lied, das Zuversicht und Hoffnung verbreitet. So sang es der inzwischen verstorbene Udo Jürgens. Licht und Schatten des Lebens gehörten für ihn als Realität auch in seine Songtexte. Das machte ihn authentisch. Sein Gesang berührte die Zuhörer. Höhen und Tiefen, Freude und Trauer, Aufbruch und Resignation, Erfolg und Niederlage sind Teil unseres Lebens.
Seit Milliarden von Jahren dreht sich unser Planet Erde um die Sonne. Jahr für Jahr mit Zeiteinheiten von Monaten, Tagen, Stunden und Sekunden. Tag und Nacht. Und alles wirkt sehr winzig im Verhältnis zum grenzenlosen Universum, das die Menschheit stets mit Interesse und immer leistungsfähigeren Techniken weiter und tiefer zu ergründen sucht. Es scheint, dass alles eine Zeit des Werdens und eine Zeit des Vergehens hat. Und dazwischen liegen große Veränderungen, die wir für unsere Erde als Evolution bezeichnen und die im Heute auch noch nicht beendet sind. Uns Menschen in der Entwicklung als Homo sapiens gibt es erst etwa seit einigen Millionen Jahre. Eine sehr lange Zeit; aber auch das ist relativ.
So wie sich das Universum und unsere Mutter Erde stets im Wandel befinden, so geht es jedem einzelnen Erdenbürger im Laufe seines Lebens. Nichts bleibt für immer gleich. In der Tier- und Pflanzenwelt sorgten die Kräfte der Evolution dafür, dass die nötigen Anpassungen über lange Zeiträume und Generationen ein Überleben möglich machten. Neue Erkenntnisse und Anpassungen sind oftmals Tag für Tag erforderlich.
Der Mensch mit großartigen Fähigkeiten und seinem eigenen Willen verhält sich nicht immer klug und verantwortlich und schaut primär auf das Jetzt und weniger perspektivisch auf das, was kommen mag. „Ich lebe jetzt und will mein Leben genießen!“ Das tut im Moment gut. Allein das Festhalten an alten Traditionen und das Verhaltensmuster „Das war immer so“ blockieren nötige Fortschritte. Es gibt den Ausspruch: „Wer sich nicht bewegt, der wird bewegt.“
Der im Dezember 2014 plötzlich verstorbene Komponist und Sänger Udo Jürgens hat auch Lieder auf die Zukunft gesungen. Das Lied „Ihr von Morgen“ hat eine besondere Aktualität im Hinblick auf die Probleme der Welt und insbesondere auf den Umgang mit irdischen Ressourcen und dem Klima.
Zu diesem Lied habe ich selbst eine besondere Beziehung. Einmal, weil mich das Thema auch mit Sorge für künftige Generationen beschäftigt. Und weil ich in unserem Männerchor schon bei den Proben vom Inhalt und der Melodie immer wieder berührt wurde. Für mich ist es ein Wachrütteln und eine Botschaft an die heute Lebenden. Im Konzert unseres Chores fand dieses Lied von Udo Jürgens einen großen Zuspruch mit langem Applaus. Das war für uns Sänger schön. Doch fürchte ich, dass die Botschaft dieses Liedes im Alltag schnell verstaubt. Von Udo Jürgens war es kurz vor seinem Tod wohl intuitiv eine wichtige letzte Botschaft an uns alle heute.
In der modernen Welt des 20. und 21. Jahrhunderts haben sich gravierende, weltumfassende Veränderungen mit einem rasanten Tempo ergeben. Die Reinheit von Luft, Wasser und Boden ist weltumspannend starken Belastungen ausgesetzt. Das enorme Bevölkerungswachstum, die Mobilität mit ihren Umweltbelastungen, ein Leben mit Freizeit- und Wohlstandmehrungen sowie der Verbrauch der irdischen Ressourcen wie Öl, Gas und vieler Bodenschätze sind gewaltig. Was einmal verbraucht ist, kann nicht mehr genutzt werden. Stellen wir uns die Folgen vor, wenn die gesamte Weltbevölkerung so verbrauchsorientiert lebte, wie es die Menschen in den Wohlstandsländern in den letzten Jahrzehnten gewohnt sind.
Alle Menschen dieser Erde sollten die gleichen Rechte und Lebensbedingungen haben. Ein schöner Wunsch, der wohl nie Realität wird. Jeder möchte von anderen achtsam und fair behandelt werden. Ein hoher Anspruch, den wir Mensch niemals perfekt und permanent selbst leben. Egoistische Verhaltensweisen und persönliche Schwächen gehören zum unperfekten Menschen in allen Zeiten.
Der Mensch wird nackt und hilflos als Säugling geboren. Er braucht Jahre, um erwachsen zu werden und seine Persönlichkeit zu entwickeln. Die Zeit der Pubertät als Tor zur Eigenständigkeit ist für Eltern genauso schwierig wie für die Tochter oder den Sohn. Vater und Mutter lernen das Loslassen durch Verantwortungsübergabe an ihr Kind. Schlaflose Nächte und das Verständnis für einen anderen Lebensweg erfordern Vertrauen und Toleranz. Eine große Herausforderung für Eltern. Junge Menschen brauchen Zeit und Raum, um ihre Charaktereigenschaften und Mentalitäten kennenzulernen. Ausprobieren, Fehler machen, Sackgassenerlebnisse und Niederlagen stärken letztlich für das ganze Leben. Ein Einser-Abitur und Studium entscheiden nicht über Lebensglück und Erfolg. Menschen haben unterschiedliche Mentalitäten, Fähigkeiten und Interessen. Wo diese weitgehend frei gelebt werden können, wächst die ganz persönliche Zufriedenheit; das individuelle „Glücklichsein.
Der Lebensalltag, Familie, Arbeit und Freizeit, aller Generationen gestaltet sich sehr verschieden, weil die Rahmenbedingungen sich verändern und sehr unterschiedlich sein können. Ich selbst gehöre beispielsweise der Nachkriegsgeneration an, die ohne Krieg in einer freiheitlichen Demokratie mit einer permanenten Wohlstandsmehrung aufwachsen konnte. In den 50er-Jahren, nach dem 2. Weltkrieg, wuchs ich behütet mit vier Geschwistern auf einem Bauernhof auf. Die teils schwere Handarbeit auf dem Acker, das Melken und Füttern der Kühe auch am Sonntag bestimmten den Lebensalltag. Für meine Geschwister und mich war es selbstverständlich, dass wir bei leichten Arbeiten auf dem Hof mitgeholfen haben. Das Treckerfahren, insbesondere mit dem alten Lanz-Bulldog, machte ja auch riesigen Spaß. Als Jugendlicher gab es am Sonntagmorgen nach einer Party keine Möglichkeit zum Ausschlafen, denn die Kühe mussten ja gemolken werden. Das fand ich gar nicht schön, habe es aber akzeptiert. Das Mithelfen auf dem Hof wurde in der damaligen Zeit nicht in Frage gestellt. Es war ja üblich. Nach Eintritt in das Berufsleben mit einer Lehre zum Bankkaufmann fühlte ich mich sehr zufrieden, weil die Kontakte mit Kunden und die Tätigkeiten mein Ding waren. Parallel entwickelte ich Interessen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Kirche und Vereinen und später auch in der Kommunalpolitik. Meine Engagements waren erfolgreich und mein Lohn waren Freude und Zufriedenheit. Weil die Arbeit meinen Neigungen entsprach und ich Freude daran erlebte. Freude und Engagement, mit Mut und Weitsicht verbunden, sind die Basis für Erfolg. Und den habe ich stets genossen.
Beruflich hatte ich neben der Freude an der Arbeit auch Erfolg und ein wachsendes gutes Einkommen. Mein erstes Gehalt 1970 nach der Lehre betrug 486 D-Mark, was in heutiger Währung 248 Euro sind. In Urlaub fahren oder Fliegen war damals nicht finanzierbar und allgemein noch nicht üblich. Als Realist habe ich das ohne Enttäuschung angenommen. In Deutschland folgten wirtschaftlich wachstumsstarke Jahrzehnte mit guten tariflichen Lohnerhöhungen und parallel gab es für mich gute Aufstiegschancen im Beruf. Trotz wachsendem Wohlstand blieben mir eine gewisse Sparsamkeit und weitsichtige Ausgabenplanung, die ich in der Kindheit gelernt hatte.
Als Bankkaufmann im Bereich der Kreditvergaben bekam ich immer wieder mit, dass ein Kredit die Anschaffung eines Autos oder einer Reise und somit ein angenehmeres Leben ermöglicht. Ein Kredit muss jedoch zurückgezahlt werden und reduziert damit die laufende Liquidität, die Freiheit für neue Ausgaben in der Zukunft. Leben auf Pump mit einem Kredit ist sicherlich für den Bau oder Kauf eines Hauses sinnvoll und notwendig, aber nicht immer für kurzlebige Ausgaben. Geld, was heute ausgegeben ist, fehlt in der Zukunft. Das gilt für den Staat ebenso wie für alle Bürgerinnen und Bürger. Schulden machen ist somit eine Wohlstandsvorwegnahme.
Die vergangenen Jahrzehnte waren stark geprägt durch Wachstum in fast allen Bereichen. Die Wirtschaft expandierte von Jahr zu Jahr und der Export deutscher Produkte in die ganze Welt ist heute gewaltig. Made in Germany wurde regelrecht zu einem Exportschlager. Die Globalisierung hat hier vieles ermöglicht. Wo Licht ist, gibt es aber auch immer Schatten. Manche Lebensgewohnheiten und die schrankenlose Ausbeutung irdischer Bodenschätze führten nicht zu den erhofften rosigen Zeiten.
In allen Ländern der Erde hat die Mobilität der Menschen enorm zugenommen. Die Flugverbindungen der verschiedenen Airlines sind weltumspannend. Fliegen ist schnell und wurde durch den Wettbewerb der Anbieter auch für jeden erschwinglich. Billigangebote wie beispielsweise für 69 Euro nach Mallorca sind weder kostendeckend noch ein Beitrag zum Umweltschutz. Insbesondere Urlauber und junge Leute nutzen diese Angebote und es ist eine Bereicherung für das weltweite Miteinander. Die Menschen der Welt, unabhängig von ihrer Hautfarbe und Herkunft, rücken zusammen. Einerseits gut, es verursacht aber auch weltweit stärkere Belastungen für Umwelt und Klima. Die aktuell mehr als acht Milliarden Menschen auf unserem begrenzten Planeten verbrauchen in der Summe mehr Ressourcen, als unsere Erde perspektivisch ertragen kann.
Niedrigpreise sind bei den Anbietern Kampfpreise für Marktanteile und Umsatzgröße. Das macht Kosteneinsparungen in anderen Bereichen erforderlich. Arbeitnehmer*innen spüren den zunehmenden Arbeitsdruck durch personalsparende Arbeitsverdichtungen. Lohnerhöhungen konnten in den letzten Jahren oftmals nur nach gewerkschaftlich unterstützten Streiks mit sehr maßvollen Ergebnissen erreicht werden. Öffentliche wie private Arbeitgeber tendieren dazu, den großen Kostenblock „Personalkosten“ zu deckeln. Steigende Bürokratie und zunehmende Komplexität erhöhen den Druck auf die Mitarbeiter*innen und führen immer häufiger zu Überforderungen bis hin zum Burnout oder einer inneren Kündigung. Sehr massiv zeigt sich das auch in den Pflegeberufen wie in Seniorenheimen und Krankenhäusern. Diese Berufe sind mit einer besonderen Empathie verbunden, was den Leistungsdruck bei personellen Unterbesetzungen zusätzlich erhöht.
Das Leben auf unserer Erde hat sich vielschichtig verändert. Die Lebenserwartungen sind dank Wohlstandssteigerungen und großen medizinischen Entwicklungen deutlich gestiegen. Die Tendenz scheint sich weiter fortzusetzen, was dazu führt, dass gesellschaftspolitisch neue Herausforderungen zu lösen sind. Jeder möchte gern alt werden, aber nicht alt sein. Ein längeres Leben gibt es nicht umsonst. Neben der gesundheitlichen Vorsorge in Eigenverantwortung sind die Kosten für das Gesundheitssystem mit immer mehr Heilungsmöglichkeiten stark angestiegen. Das meiste wird über eine Krankenkasse bezahlt. Das Geld kommt jedoch immer von uns, den Bürgerinnen und Bürgern. Egal, ob über direkte Krankenkassenbeiträge oder über Subventionierung aus den Steuereinnahmen.
Auch unser Rentensystem ist eine soziale Errungenschaft. Getragen von einer Solidargemeinschaft und deren Beitragseinzahlungen über Jahrzehnte. Da wir in der Regel alle älter werden als frühere Generationen, ist ein zeitlich höheres Renteneintrittsalter nur logisch und notwendig. Zur Sicherung des Rentensystems in Deutschland bedarf es für die heute noch Jüngeren dringend einer großen Reform. Eine Rentenhöhe von nur 48 % des letzten Einkommens ist für Großteile der Gesellschaft keine ausreichende Lebensgrundlage im Alter. Bereits heute wird das Rentensystem jährlich mit mehr als 100 Milliarden Euro aus Steuermittel subventioniert und damit am Leben erhalten. Eine Erhöhung der Rentenbeiträge oder ein Absenken der Rentenhöhe ist seit Jahren erforderlich. Da das unpopulär und mit sozialen Härten verbunden ist, möchte die Politik uns Bürgerinnen und Bürgern das nicht zumuten. Motiv ist die Angst der Politiker, nicht wieder gewählt zu werden. Die seit Dezember 2021 regierende Ampel-Koalition will das Rentensystem mit einer kapitalgedeckten Stütze zukunftsfähiger machen. Wie das konkret erfolgen soll, ist derzeit noch offen. Der Ansatz, hier etwas zu ändern, ist auf jeden Fall notwendig und richtig. Das wird aber zusätzlich hohe Milliardenbeträge binden, die für unseren gewohnten Wohlstand nicht mehr verfügbar sein werden.
Weitere Herausforderungen für unsere Gesellschaft zeigen sich in dem Erneuerungsbedarf der Infrastruktur in allen staatlichen Zuständigkeiten. Ob im Hochbau oder im Tiefbau, alles muss regelmäßig instandgehalten und irgendwann erneuert werden. Ein ordentlicher Kaufmann würde vorsorgen und etwa in Höhe der Abschreibungen (Wertverlust) laufend sanieren oder Rücklagen bilden. In der Summe kommen jährlich Beträge zusammen, die aus den laufenden Steuereinnahmen bei Weitem nicht finanzierbar sind. Ganz offensichtlich hat sich hier in den letzten Jahrzehnten ein Investitionsstau aufgetan, der dringend beseitigt werden muss. Faktisch haben wir jahrelang über die Verhältnisse gelebt. Inzwischen haben wir eine Situation erreicht, in der es in unserer Gesellschaft kein Weiter so geben darf und auch nicht kann. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Erstens: Unsere staatlichen Ebenen von den Kommunen bis zum Bund nehmen neue Kredite auf und erhöhen die Gesamtverschuldung. Das finanzielle Problem wird dabei auf künftige Generationen verlagert. Das wäre nicht verantwortbar und daher ist die Einhaltung der grundgesetzlichen Schuldenbremse gerecht und notwendig.
Zweitens: Die Ausbaustandards in architektonischer Hinsicht könnten auf ein zweckentsprechendes Maß reduziert werden. Städtebauliche Anforderungen und die Überzeugungskraft der planenden Architekten führen häufig zu attraktiven, aber kostensteigenden Gestaltungselementen. Bei Ausschreibungen für Planungsbüros werden anfangs noch die Gebäudepraktikabilität und eine möglichst kostengünstige Gebäudeunterhaltung gefordert. Im Zuge der weiteren Detailplanungen und durch nachträgliche Änderungen laufen Bauzeiten- und Kostenplan sehr schnell aus dem Ruder. Schöne, bunte 3D-Ansichten und ansprechende Baumodelle finden bei Entscheidungsträgern*innen und Bürger*innen eher Zuspruch als mehrere 100 Seiten Ausschreibungstexte. Was Menschen brauchen, ist wichtiger als überteuerte öffentliche Investitionen.
Drittens: Viele Neubauten in den Innenstädten haben eine sehr lange Realisierungszeit von der Planung bis zur Fertigstellung, weil die archäologischen Bodenuntersuchungen sehr intensiv und zeitaufwändig sind. Neben den Kosten für archäologische Arbeiten führen Verzögerungen des Baubeginnes zu erheblichen Preissteigerungen. Für manche private Bauherren wird das zu einem unkalkulierbaren Risiko. So ist es beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Die Archäologie darf nicht über die Grundbedürfnisse der Bürger gestellt werden. Denn die Finanzkraft der Kommunen ist schon stark geschwächt. Kürzungen bei Sozialleistungen wären unverantwortbar. Wo nicht in die Tiefe neu gebaut wird, sollten beispielsweise alte Gebäudefundamente im Boden unangetastet bleiben. Wo die Archäologie zulasten der Grundstückseigentümer Narrenfreiheit für Schippchen und Pinsel hat, sollte es Grenzen geben. Das braucht Anpassungsmut, den ernsthaften Willen von Politikern und entsprechende Behördenregelungen.
Viertens: Intensivierung der Einbindung der Bürger bezüglich Festlegung der Ausbaustandards. Beispielsweise bei einer Erneuerung von Wohn- und Anliegerstraßen. Da, wo Anlieger für Straßenerneuerungen zur Kasse gebeten werden, sollten sie zumindest ein Mitspracherecht haben.
Fünftens: