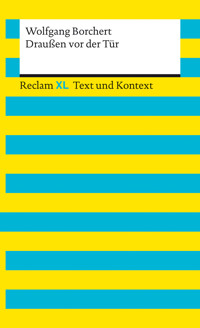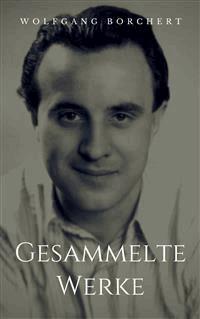Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Borchert - Alle Werke, alle Schriften [Das Gesamtwerk] | Neu überarbeitete 2021er Ausgabe | Wolfgang Borchert (20. Mai 1921 - 20. November 1947) war zwölf Jahre alt, als die Nazis die Macht übernahmen, 18 Jahre, als der Zweite Weltkrieg begann, und 24, als er zum Schriftsteller wurde. Literarisch lag hinter ihm - symbolisch gesprochen - nichts. Nur Frontkämpfe, Kriegshorror, Verwundungen und Krankheiten. Borchert erfand die Literatur im Nachkriegsdeutschland für sich und andere neu. Das macht sein Werk so besonders. Das erschütternde Drama »Draußen vor der Tür« - in dieser Gesamtausgabe enthalten - traf wie kein anderes literarisches Werk jener Zeit das verstörte Deutschland ins Mark: Mit einem schonungslosen Einblick darüber, wie ein junger Mensch unter den Folgen des Naziregimes zerdrückt wird - ohne Aussicht auf Heilung. So wurde auch Borchert selbst erdrückt. Er starb an den Folgen der Kriegsstrapazen im November 1947 an Leberversagen - im Alter von nur 26 Jahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorbemerkung des Herausgebers
Die Hundeblume und andere Erzählungen
Die Hundeblume
Die Krähen fliegen abends nach Hause
Stimmen sind da in der Luft - in der Nacht
Gespräch über den Dächern
Generation ohne Abschied
Eisenbahnen, nachmittags und nachts
Bleib doch, Giraffe
Vorbei vorbei
Die Stadt
An diesem Dienstag - Neunzehn Geschichten
Im Schnee, im sauberen Schnee
Die Kegelbahn
Vier Soldaten
Der viele viele Schnee
Mein bleicher Bruder
Jesus macht nicht mehr mit
Die Katze war im Schnee erfroren
Die Nachtigall singt
Die drei dunklen Könige
Radi
An diesem Dienstag
Der Kaffee ist undefinierbar
Die Küchenuhr
Vielleicht hat sie ein rosa Hemd
Unser kleiner Mozart
Das Känguruh
Nachts schlafen die Ratten doch
Er hatte auch viel Ärger mit den Kriegen
Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck
Die lange lange Straße lang
Draußen vor der Tür (Drama)
Liebe blaue graue Nacht - Verstreute und nachgelassene Erzählungen
Stadt, Stadt: Mutter zwischen Himmel und Erde
Hamburg
Billbrook
Die Elbe
Lyrik
Ich seh in einen Spiegel - Frühe GedichteLaterne, Nacht und Sterne - Gedichte um Hamburg
Essays, Rezensionen, Fragmente, Vermischtes
Helmuth Gmelins 50. Geburtstag
Stalingrad
Tucholsky und Kästner
Bücher - für morgen
Neues aus Hamburger Verlagen
Kartoffelpuffer, Gott und Stacheldraht - KZ-Literatur
Sechzig Jahre Hamburg
Von des Glücks Barmherzigkeit.
Disteln und Dornen
Unter der Laterne
Die Blume
Fahrt zu dem Töpfer Grimm
Unser Pusteblumendasein
Der Schriftsteller.
Das ist unser Manifest
Sechs Fragen an Wolfgang Borchert
Dann gibt es nur eins!
Vorbemerkung des Herausgebers
WOLFGANG BORCHERT (20. Mai 1921 - 20. November 1947) war zwölf Jahre alt, als die Nazis die Macht übernahmen, 18 Jahre, als der Zweite Weltkrieg begann, und 24, als er zum Schriftsteller wurde. Literarisch lag hinter ihm – symbolisch gesprochen – nichts. Nur Frontkämpfe, Kriegshorror, Verwundungen und Krankheiten. Und nach ihm kam ein Heinrich Böll, sein zahmerer literarischer Nachfahr. Borchert musste die Literatur im frühen Nachkriegsdeutschland für sich (und andere) neu finden und erfinden. Das macht sein Werk so besonders.
Heraus aus der naiven Schreiberei der Pubertät – seit dem Alter von 15 Jahren hatte er Gedichte verfasst –, über verstörende und entlarvende Kurzgeschichten aus der Endzeit des Krieges, bis hin zum erschütternden Drama Draußen vor der Tür< (S. →) – das wie kein anderes literarisches Werk das zerstörte und verstörte Deutschland ins Mark traf: Mit einem schonungslosen Einblick darüber, wie ein junger Mensch unter den Folgen des Naziregimes zerdrückt wird – ohne Aussicht auf Heilung, auch nicht nach der Befreiung aus dem Sumpf. Denn Schuld, Selbstvorwürfe und Verstörung bleiben für immer.
So wurde auch der Autor Borchert erdrückt, psychisch und physisch. Als kranker Mann, mit Gelbsucht, Krampfanfällen, Fieberschüben kam er aus dem Kriege heim, nur zwei knappe Jahre blieben ihm, um zu schreiben, oft bettlägrig und fiebernd. Er starb auf dem Weg zu einer Genesungskur in die Schweiz am 20. November 1947 an Leberversagen – im Alter von nur 26 Jahren. Und nur einen Tag vor der Premiere seines Theaterstücks Draußen vor der Tür<.
Das junge Magazin >Der Spiegel<, gerade gegründet, resümierte nach der Uraufführung: »Selten hat ein Theaterstück die Zuschauer so erschüttert.«
© Redaktion AuraBooks, 2021
Die Hundeblume und andere Erzählungen
Und wer fängt uns auf? Gott?
Die Hundeblume
DIE TÜR ging hinter mir zu. Das hat man wohl öfter, dass eine Tür hinter einem zugemacht wird – auch dass sie abgeschlossen wird, kann man sich vorstellen. Haustüren zum Beispiel werden abgeschlossen, und man ist dann entweder drinnen oder draußen. Auch Haustüren haben etwas so Endgültiges, Abschließendes, Auslieferndes. Und nun ist die Tür hinter mir zugeschoben, ja, geschoben, denn es ist eine unwahrscheinlich dicke Tür, die man nicht zuschlagen kann. Eine hässliche Tür mit der Nummer 432. Das ist das Besondere an dieser Tür, dass sie eine Nummer hat und mit Eisenblech beschlagen ist – das macht sie so stolz und unnahbar; denn sie lässt sich auf nichts ein, und die inbrünstigen Gebete rühren sie nicht.
Und nun hat man mich mit dem Wesen allein gelassen, nein, nicht nur allein gelassen, zusammen eingesperrt hat man mich mit diesem Wesen, vor dem ich am meisten Angst habe: Vor mir selbst.
Weißt du, wie das ist, wenn du dir selbst überlassen wirst, wenn du mit dir allein gelassen bist, dir selbst ausgeliefert bist? Ich kann nicht sagen, dass es unbedingt furchtbar ist, aber es ist eines der tollsten Abenteuer, die wir auf dieser Welt haben können: Sich selbst zu begegnen. So begegnen wie hier in der Zelle 432: nackt, hilflos, konzentriert auf nichts als auf sich selbst, ohne Attribut und Ablenkung und ohne die Möglichkeit einer Tat. Und das ist das Entwürdigendste: Ganz ohne die Möglichkeit zu einer Tat zu sein. Keine Flasche zum Trinken oder zum Zerschmettern zu haben, kein Handtuch zum Aufhängen, kein Messer zum Ausbrechen oder zum Aderndurchschneiden, keine Feder zum Schreiben – nichts zu haben als sich selbst.
Das ist verdammt wenig in einem leeren Raum mit vier nackten Wänden. Das ist weniger als die Spinne hat, die sich ein Gerüst aus dem Hintern drängt und ihr Leben daran riskieren kann, zwischen Absturz und Auffangen wagen kann. Welcher Faden fängt uns auf, wenn wir abstürzen?
Unsere eigene Kraft? Fängt ein Gott uns auf? Gott, was ist das? Ist das die Kraft, die einen Baum wachsen und einen Vogel fliegen lässt – ist Gott das Leben? Dann fängt er uns wohl manchmal auf – wenn wir wollen.
Als die Sonne ihre Finger von dem Fenstergitter nahm und die Nacht aus den Ecken kroch, trat etwas aus dem Dunkel auf mich zu – und ich dachte, es wäre Gott. Hatte jemand die Tür geöffnet – war ich nicht mehr allein? Ich fühlte, es ist etwas da, und das atmet und wächst. Die Zelle wurde zu eng – ich fühlte, dass die Mauern weichen mussten vor diesem, das da war und das ich Gott nannte.
Du, Nummer 432, Menschlein – lass dich nicht besoffen machen von der Nacht! Deine Angst ist mit dir in der Zelle, sonst nichts. Die Angst und die Nacht. Aber die Angst ist ein Ungeheuer, und die Nacht kann furchtbar werden wie ein Gespenst, wenn wir mit ihr allein sind.
Da trudelte der Mond über die Dächer und leuchtete die Wände ab. Affe, du! Die Wände sind so eng wie je, und deine Zelle ist leer wie eine Apfelsinenschale. Gott, den sie den Guten nennen, ist nicht da. Und was da war, das was sprach, war in dir. Vielleicht war es ein Gott aus dir – du warst es! Denn du bist auch Gott, alle, auch die Spinne und die Makrele sind Gott. Gott ist das Leben – das ist alles. Das ist so viel, dass er nicht mehr sein kann. Denn sonst ist nichts. Aber dieses Nichts überwältigt uns oft.
Die Zellentür war so zu wie eine Nuss – als ob sie nie offen war, und von der man wusste, dass sie allein nicht aufging – dass sie aufgebrochen werden musste. So zu war die Tür. Und ich stürzte, mit mir allein gelassen, ins Bodenlose. Aber da schrie mich die Spinne an wie ein Feldwebel: Schwächling! Der Wind hatte ihre Netze zerrissen, und sie rülpste mit Ameiseneifer ein neues und fing mich, den Hundertdreiundzwanzigpfündigen, in ihren hauchfeinen Seilen. (Ich bedankte mich bei ihr, aber davon nahm sie überhaupt keine Notiz.)
So gewöhnte ich mich langsam an mich. Man mutet sich so leichtfertig andern Menschen zu, und dabei kann man sich kaum selbst ertragen. Ich fand mich allmählich ganz unterhaltsam und vergnüglich – ich machte Tag und Nacht die merkwürdigsten Entdeckungen an mir und fühlte mich als eine rechte Wundertüte.
Aber ich verlor in der langen Zeit den Zusammenhang mit allem, mit dem Leben, mit der tätigen Welt. Die Tage tropften schnell und regelmäßig von mir ab. Ich fühlte, wie ich langsam leerlief von der wirklichen Welt und voll wurde von mir selbst. Ich fühlte, dass ich immer weiter wegging von dieser Welt, die ich eben erst betreten hatte.
Die Wände waren so kalt und tot, dass ich krank wurde vor Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Man schreit wohl ein paar Tage seine Not raus – aber wenn nichts antwortet, ermüdet man bald. Man schlägt wohl ein paar Stunden an Wand und Tür – aber wenn sie sich nicht auftun, sind die Fäuste bald wund, und der kleine Schmerz ist dann die einzige Lust in dieser Öde.
Es gibt doch wohl nichts Endgültiges auf dieser Welt. Denn die eingebildete Tür hatte sich aufgetan und viele andere dazu, und jede schubste einen scheuen, schlechtrasierten Mann hinaus in eine lange Reihe und in einen Hof mit grünem Gras in der Mitte und grauen Mauern ringsum.
Da explodierte ein Bellen um uns und auf uns zu – ein heiseres Bellen von blauen Hunden mit Lederriemen um den Bauch. Die hielten uns in Bewegung und waren selbst dauernd in Bewegung und bellten uns voll Angst. Aber wenn man genug Angst in sich hatte und ruhiger wurde, erkannte man, dass es Menschen waren in blauen, blassen Uniformen.
Man lief im Kreise. Und wenn das Auge das erste erschütternde Wiedersehen mit dem Himmel überwunden und sich wieder an die Sonne gewöhnt hatte, konnte man blinzelnd erkennen, dass viele so zusammenhanglos trotteten und tief atmeten wie man selbst – siebzig, achtzig Mann vielleicht.
Und immer im Kreis – im Rhythmus ihrer Holzpantoffeln, unbeholfen eingeschüchtert und doch für eine halbe Stunde froher als sonst. Wenn die blauen Uniformen mit dem Bellen im Gesicht nicht gewesen wären, hätte man bis in die Ewigkeit so trotten können – ohne Vergangenheit, ohne Zukunft: Ganz genießende Gegenwart: Atmen, Sehen, Gehen!
So war es zuerst. Fast ein Fest, ein kleines Glück. Aber auf die Dauer – wenn man monatelang kampflos genießt – beginnt man abzuschweifen. Das kleine Glück genügt nicht mehr – man hat es satt, und die trüben Tropfen dieser Welt, der wir ausgeliefert sind, fallen in unser Glas. Und dann kommt der Tag, wo der Rundgang im Kreis eine Qual wird, wo man sich unter dem hohen Himmel verhöhnt fühlt und wo man Vordermann und Hintermann nicht mehr als Brüder und Mitleidende empfindet, sondern als wandelnde Leichen, die nur dazu da sind, uns anzuekeln – und zwischen die man eingelattet ist als Latte ohne eignes Gesicht in einem endlosen Lattenzaun, ach, und sie verursachen einem eher Übelkeit als sonst was. Das kommt dann, wenn man monatelang kreist zwischen den grauen Mauern und von den blassen, blauen Uniformen mürbe gebellt ist.
Der Mann, der vor mir ging, war schon lange tot. Oder er war aus einem Panoptikum entsprungen, von einem komischen Dämon getrieben, zu tun, als sei er ein normaler Mensch – und dabei war er bestimmt längst tot. Ja. Nämlich seine Glatze, die von einem zerfransten Kranz schmutzig-grauer Haarbüschel umwildert ist, hat nicht diesen fettigen Glanz von lebendigen Glatzen, in denen sich Sonne und Regen noch trübe spiegeln können – nein, diese Glatze ist glanzlos, duff und matt wie aus Stoff. Wenn sich dieses Ganze da vor mir, das ich gar nicht Mensch nennen mag, dieser nachgemachte Mensch, nicht bewegen würde, könnte man diese Glatze für eine leblose Perücke halten. Und nicht mal die Perücke eines Gelehrten oder großen Säufers – nein, höchstens die eines Papierkrämers oder Zirkusclowns. Aber zäh ist sie, diese Perücke – sie kann schon aus Bosheit allein nicht abtreten, weil sie ahnt, dass ich, ihr Hintermann, sie hasse. Ja, ich hasse sie. Warum muss die Perücke – ich will nun man den ganzen Mann so nennen, das ist einfacher – warum muss sie vor mir hergehen und leben, während junge Spatzen, die noch nichts vom Fliegen gewusst haben, sich aus der Dachrinne zu Tode stürzen? Und ich hasse die Perücke, weil sie feige ist – und wie feige! Und sie fühlt meinen Hass, während sie blöde vor mir her trottet, immer im Kreis, im ganz kleinen Kreis zwischen grauen Mauern, die auch kein Herz für uns haben, denn sonst würden sie eines Nachts heimlich fortwandern und sich um den Palast stellen, in dem unsere Minister wohnen.
Ich denke schon eine ganze Zeit darüber nach, warum man die Perücke ins Gefängnis gesperrt hat – was für eine Tat kann sie begangen haben – sie, die zu feige ist, sich nach mir umzudrehen, während ich sie andauernd quäle. Denn ich quäle sie: Ich trete ihr fortwährend auf die Hacken – mit Absicht natürlich – und mache mit meinem Mund ein übles Geräusch, als spucke ich viertelpfundweise Lungenhaschee gegen ihren Rücken. Sie zuckt jedes Mal verwundet zusammen. Trotzdem wagt sie es nicht, sich ganz nach ihrem Quäler umzusehen – nein, sie ist zu feige dazu. Sie dreht sich nur um ein paar Grad mit steifem Genick in meine Richtung nach hinten, aber die halbe Drehung bis zum Treffen unserer Augenpaare zu machen wagt sie nicht.
Was mag sie denn ausgefressen haben? Vielleicht hat sie unterschlagen oder gestohlen? Oder hat sie in einem Sexualanfall öffentliches Ärgernis erregt? Ja – das vielleicht. Einmal war sie berauscht von einem buckligen Eros aus ihrer Feigheit rausgehüpft in eine blöde Geilheit – na, und nun trottete sie vor mir her, stillvergnügt und erschrocken, einmal etwas gewagt zu haben.
Aber ich glaube, jetzt zittert sie insgeheim, weil sie weiß, dass ich hinter ihr gehe – ich: ihr Mörder! Oh, es würde mir leicht sein, sie zu morden, und es könnte ganz unauffällig geschehen. Ich hätte ihr nur das Bein zu stellen brauchen, dann wäre sie mit ihren viel zu stakigen Stelzen vornüber gestolpert und hätte sich dabei bestimmt ein Loch in den Kopf gestoßen – und dann wäre ihr die Luft mit einem phlegmatischen pfff ... entwichen wie einem Fahrradschlauch. Sicher wäre: Ihr Kopf, diese dufte Perücke wäre in der Mitte auseinandergeplatzt wie weißlich-gelbes Wachs, und die wenigen Tropfen rote Tinte daraus hätten lächerlich verlogen gewirkt wie Himbeersaft auf der blauseidenen Bluse eines erdolchten Komödianten.
So hasste ich die Perücke, einen Kerl, dessen Visage ich nie gesehen hatte, dessen Stimme ich nie gehört hatte, von dem ich einen muffigmottenpulverigen Geruch kannte. Sicher hatte er – die Perücke – eine milde, müde Stimme ohne jede Leidenschaft, so kraftlos wie seine milchigen Finger. Sicher hatte er die vorstehenden Augen eines Kalbes und eine dicke, hängende Unterlippe, die dauernd Pralinen essen möchte. Es war die Maske eines Lebemannes, ohne Größe und mit dem Mut eines Papierhändlers, dessen Hebammenhände oftmals den ganzen Tag nichts getan hatten, als siebzehn Pfennige für ein Schreibheft vom Ladentisch zu streichen.
Nein, kein Wort mehr über die Perücke! Ich hasse sie wirklich so sehr, dass ich mich leicht in einen Wutausbruch hineinsteigern könnte, bei dem ich mich zu sehr entblößen würde. Genug. Schluss. Ich will nie wieder von ihr reden, nie! –
Aber wenn einer, den du gerne ganz verschweigen möchtest, ständig mit eingeknickten Knien in der Melodie eines Melodramas vor dir hergeht, dann wirst du ihn nicht los. Wie ein Juckreiz im Rücken, wo du mit den Händen nicht ankommst, reizt er dich immer wieder, an ihn zu denken, ihn zu empfinden, ihn zu hassen.
Ich glaube, ich muss die Perücke doch ermorden. Aber ich habe Angst, der Tote würde mir einen gräulichen Streich spielen. Er würde sich plötzlich mit ordinärem Lachen daran erinnern, dass er früher ja Zirkusclown war und sich aus seinem Blut hoch wälzen. Vielleicht etwas verlegen, als hätte er das Blut nicht halten können wie andere Leute das Wasser. Kopfüber würde er durch die Gefängnishof-Manege hampeln, hielte womöglich die Wärter für bockende Esel, die er bis zum Wahnsinn reizen würde, um dann mit gemachter Angst auf die Mauer zu springen. Von dort aus würde er dann seine Zunge wie einen Scheuerlappen gegen uns lüpfen und auf immer verschwinden.
Es ist nicht auszudenken, was alles geschehen würde, wenn sich plötzlich jeder auf das besinnen würde, was er eigentlich ist.
Denke nicht, dass mein Hass auf meinen Vordermann, auf die Perücke, hohl und grundlos ist – oh, man kann in Situationen kommen, wo man so von Hass überläuft und über die eigenen Grenzen hinweggeschwemmt wird, dass man nachher kaum zu sich selbst zurückfindet – so hat einen der Hass verwüstet.
Ich weiß, es ist schwer, mir zuzuhören und mit mir zu fühlen. Du sollst auch nicht zuhören, als wenn einer dir etwas von Gottfried Keller oder Dickens vorliest. Du sollst mit mir gehen, mitgehen in dem kleinen Kreis zwischen den unerbittlichen Mauern. Nein, nicht in Gedanken neben mir – nein, körperlich hinter mir als mein Hintermann. Und dann wirst du sehen, wie schnell du mich hassen lernst. Denn wenn du mit uns (ich sage jetzt »uns«, weil wir dieses eine alle gemeinsam haben) in unserm lendenlahmen Kreise wankst, dann bist du so leer von Liebe, dass der Hass wie Sekt in dir aufschäumt. Du lässt ihn auch schäumen, nur um diese entsetzliche Leere nicht mehr zu fühlen. Und glaube nur nicht, dass du mit leerem Magen und leerem Herzen zu besonderen Taten der Nächstenliebe aufgelegt sein wirst.
So wirst du also als ein von allem Guten Geleerter hinter mir her dammeln und monatelang nur auf mich angewiesen sein, auf meinen schmalen Rücken, den viel zu weichen Nacken und die leere Hose, in die der Anatomie nach ein Hintern gehört. Am meisten wirst du aber auf meine Beine sehen müssen. Alle Hintermänner sehen auf die Beine ihres Vordermannes, und der Rhythmus seines Schrittes wird ihnen aufgezwungen und übernommen, auch wenn er ihnen fremd und unbequem ist. Ja, und da wird der Hass dich anfallen wie ein eifersüchtiges Weib, wenn du merkst, dass ich keinen Gang habe. Nein, ich habe keinen Gang. Es gibt tatsächlich Menschen, die keinen Gang haben – sie haben mehrere Stilarten, die sich nicht miteinander vereinen können zu einer Melodie. Ich bin so einer. Und du wirst mich deswegen hassen, ebenso sinnlos und begründet, wie ich die Perücke hassen muss, weil ich ihr Hintermann bin. Wenn du dich gerade auf meinen etwas unsicheren, verspielten Schritt eingestellt hast, stellst du stockend fest, dass ich plötzlich ganz reell und energisch auftrete. Und kaum hast du diesen neuen Typ meines Gehens registriert, da fange ich einige Schritte weiter an, zerfahren und mutlos zu bummeln. Nein, du wirst keine Freude und Freundschaft über mich empfinden können. Du musst mich hassen. Alle Hintermänner hassen ihre Vordermänner.
Ja, vielleicht würde alles anders werden, wenn sich die Vordermänner mal nach ihren Hintermännern umsehen würden, um sich mit ihnen zu verständigen. So ist aber jeder Hintermann – er sieht nur seinen Vordermann und hasst ihn. Aber seinen Hintermann verleugnet er – da fühlt er sich Vordermann. So ist das in unserm Kreis hinter den grauen Mauern – so ist es aber wohl anderswo auch, überall vielleicht.
Ich hätte die Perücke doch umbringen sollen. Einmal heizte sie mir so ein, dass mein Blut an zu kochen fing. Das war, als ich die Entdeckung machte. Keine große Sache. Nur eine ganz kleine Entdeckung.
Hab ich schon gesagt, dass wir jeden Morgen eine halbe Stunde lang einen kleinen schmutzig-grünen Fleck Rasen umkreisten? Ja, in der Mitte der Manege von diesem seltsamen Zirkus war eine blasse Versammlung von Grashalmen, blass und der einzelne Halm ohne Gesicht – wie wir in diesem unerträglichen Lattenzaun. Auf der Suche nach Lebendigem, Buntem, lief mein Auge ohne große Hoffnung eigentlich und zufällig über die paar Hälmchen hin, die sich, als sie sich angesehen fühlten, unwillkürlich zusammennahmen und mir zunickten – und da entdeckte ich unter ihnen einen unscheinbaren gelben Punkt – eine Miniaturgeisha auf einer großen Wiese. Ich war so erschrocken über meine Entdeckung, dass ich glaubte, alle müssten es gesehen haben, wie meine Augen wie festgebackt auf das gelbe Etwas starrten, und ich sah schnell und sehr interessiert auf die Pantoffeln meines Vordermannes. Aber so wie du einem, mit dem du sprichst, immer auf den Fleck, den er an der Nase hat, stieren musst und ihn ganz unruhig machst – so sehnten meine Augen sich nach dem gelben Punkt. Als ich jetzt dichter an ihm vorbeikam, tat ich so unbefangen wie möglich. Ich erkannte eine Blume, eine gelbe Blume. Es war ein Löwenzahn – eine kleine gelbe Hundeblume.
Sie stand ungefähr einen halben Meter links von unserm Weg, von dem Kreis, auf dem wir jeden Morgen eine Huldigung an die frische Luft darbrachten. Ich stand förmlich Angst aus und bildete mir ein, einer der Blauen folge schon mit Stielaugen der Richtung meines Blickes. Aber so sehr unsere Wachthunde gewohnt waren, auf jede individuelle Regung des Lattenzaunes mit wütendem Bellen zu reagieren – niemand hatte an meiner Entdeckung teilgenommen. Die kleine Hundeblume war noch ganz mein Eigentum.
Aber richtig freuen konnte ich mich nur wenige Tage an ihr. Sie sollte mir ganz gehören. Immer wenn unser Rundgang zu Ende ging, musste ich mich gewaltsam von ihr losreißen, und ich hätte meine tägliche Brotration (und das will was sagen!) dafür gegeben, sie zu besitzen. Die Sehn-sucht, etwas Lebendiges in der Zelle zu haben, wurde so mächtig in mir, dass die Blume, die schüchterne kleine Hundeblume, für mich bald den Wert eines Menschen, einer heimlichen Geliebten bekam: Ich konnte nicht mehr ohne sie leben – da oben zwischen den toten Wänden!
Und dann kam die Sache mit der Perücke. Ich fing es sehr schlau an. Jedes Mal, wenn ich an meiner Blume vorbeikam, trat ich so unauffällig wie möglich einen Fuß breit vom Wege auf den Grasfleck. Wir haben alle einen tüchtigen Teil Herdentrieb in uns, und darauf spekulierte ich. Ich hatte mich nicht getäuscht. Mein Hintermann, sein Hintermann, dessen Hintermann – und so weiter – alle latschten stur und folgsam in meiner Spur. So gelang es mir in vier Tagen, unsern Weg so nahe an meine Hundeblume ranzubringen, dass ich sie mit der Hand hätte erreichen können, wenn ich mich gebückt hätte. (Zwar starben einige zwanzig der blassen Grashalme durch mein Unternehmen einen staubigen Tod unter unsern Holzpantinen – aber wer denkt an ein paar zertretene Grashalme, wenn er eine Blume pflücken will?)
Nun näherte ich mich der Erfüllung meines Wunsches. Zur Probe ließ ich einige Male meinen linken Strumpf runterrutschen, bückte mich ärgerlich und harmlos und zog ihn wieder hoch. Niemand fand etwas dabei. Also – morgen denn!
Ihr müsst mich nicht auslachen, wenn ich sage, dass ich am nächsten Tag mit Herzklopfen den Hof betrat und feuchte, erregte Hände hatte. Es war auch zu unwahrscheinlich, die Aussicht, nach monatelanger Einsamkeit und Lieblosigkeit unerwartet eine Geliebte in der Zelle zu haben.
Wir hatten unsere tägliche Ration Runden mit monotonem Pantoffelgeklöppel fast beendet – bei der vorletzten Runde sollte es geschehen. Da trat die Perücke in Aktion, und zwar auf die abgefeimteste und niederträchtigste Weise.
Wir waren eben in die vorletzte Runde eingebogen, die Blauen rasselten wichtig mit den Riesenschlüsselbunden, und ich näherte mich dem Tatort, von wo meine Blume mir ängstlich entgegensah. Vielleicht war ich nie so erregt wie in diesen Sekunden. Noch zwanzig Schritte. Noch fünfzehn Schritte, noch zehn, fünf...
Da geschah das Ungeheure! Die Perücke warf plötzlich, als begänne sie eine Tarantella, die dünnen Arme in die Luft, hob das rechte Bein graziös bis an den Nabel und machte auf dem linken Fuß eine Drehung nach hinten. Nie werde ich begreifen, wo sie den Mut hernahm – sie blitzte mich triumphierend an, als wüsste sie alles, verdrehte die Kalbsaugen, bis das Weiße zu schillern anfing, und klappte dann wie eine Marionette zusammen. (Oh, nun war es gewiss: er musste früher Zirkusclown gewesen sein, denn alles brüllte vor Lachen!)
Aber da bellten die blauen Uniformen los, und das Lachen war weggewischt, als ob es nie gewesen war. Und einer trat gegen den Liegenden und sagte so selbstverständlich, wie man sagt: es regnet – so sagte er: Er ist tot!
Ich muss noch etwas gestehen – aus Ehrlichkeit gegen mich selbst. In dem Augenblick, als ich mit dem Mann, den ich Perücke nannte, Auge in Auge war und fühlte, dass er unterlag, nicht mir, nein, dem Leben unterlag – in dieser Sekunde verlief mein Hass wie eine Welle am Strand, und es blieb nichts als ein Gefühl der Leere. Eine Latte war aus dem Zaun gebrochen – der Tod war haarscharf an mir vorbeigepfiffen –, da bemüht man sich schnell, gut zu sein. Und ich gönne der Perücke noch nachträglich den vermeintlichen Sieg über mich.
Am nächsten Morgen hatte ich einen anderen Vordermann, der mich die Perücke sofort vergessen machte. Er sah verlogen aus wie ein Theologe, aber ich glaube, er war eigens aus der Hölle beurlaubt, mir das Pflücken meiner Blume völlig unmöglich zu machen.
Er hatte eine impertinente Art aufzufallen. Alles feixte über ihn. Sogar die blassblauen Hunde konnten ein menschliches Grinsen nicht unterdrücken, was sich ungeheuer merkwürdig ausmachte. Jeder Zoll ein Staatsbeamter – aber die primitive Würde der stumpfen Berufssoldatengesichter war zu einer Grimasse verzerrt. Sie wollten nicht lachen, bei Gott, nein! Aber sie mussten. Kennst du das Gefühl, das gönnerhafte, wenn du mit jemandem böse bist und ihr seid beide Masken der Unversöhnlichkeit, und nun geschieht irgendetwas Komisches, das euch beide zum Lachen zwingt – ihr wollt nicht lachen, bei Gott, nein! Dann zieht sich das Gesicht aber doch in die Breite und nimmt jenen bekannten Ausdruck an, den man am treffendsten mit »Saures Grinsen« benennen könnte. So erging es nun den Blauen, und das war die einzige menschliche Regung, die wir überhaupt an ihnen bemerkten. Ja, dieser Theologe, das war eine Motte! Er war gerissen genug, verrückt zu sein – aber er war nicht so verrückt, dass seine Gerissenheit darunter litt.
Wir waren siebenundsiebzig Mann in der Manege, und eine Meute von zwölf uniformierten Revolverträgern umkläffte uns. Einige mochten zwanzig und mehr Jahre diesen Kläfferdienst ausüben, denn ihre Münder waren im Laufe der Jahre bei vielen tausend Patienten eher schnauzenähnlich geworden. Aber diese Angleichung an das Tierreich hatte nichts von ihrer Einbildung genommen. Man hätte jeden einzelnen von ihnen so wie er war als Standbild benutzen können mit der Aufschrift: L'Etat c'est moi.1
Ja, und der Theologe (später erfuhr ich, dass er eigentlich Schlosser war und bei Arbeiten an einer Kirche verunglückt war – Gott nahm sich seiner an!) war so verrückt oder gerissen, dass er ihre Würde vollkommen respektierte. Was sag ich – respektierte? Er pustete die Würde der blauen Uniformen auf zu einem Luftballon von ungeahnten Dimensionen, von denen die Träger selbst bislang keine Ahnung hatten. Wenn sie auch über seine Blödheit lachen mussten, ganz heimlich blähte doch ein gewisser Stolz ihre Bäuche, dass sich die Lederkoppel spannten.
Immer wenn der Theologe einen der Wachthunde passierte, die breitbeinig stehend ihre Macht zum Ausdruck brachten und, sooft es ging, bissig auf uns losfuhren – jedes Mal machte er eine durchaus ehrlich wirkende Verbeugung und sagte so innig-höflich und gut gemeint: Gesegnetes Fest, Herr Wachtmeister! – dass kein Gott ihm hätte zürnen können – viel weniger die eitlen Luftballons in Uniform. Und dabei legte er seine Verbeugung so bescheiden an, dass es immer aussah, als wiche er einer Ohrfeige aus.
Und nun hatte der Teufel diesen Komiker-Theologen zu meinem Vordermann gemacht, und seine Verrücktheit strahlte so stark aus und nahm mich in Anspruch, dass ich meine neue kleine Geliebte, meine Hundeblume, beinahe vergaß. Ich konnte ihr kaum einen zärtlichen Blick zuwerfen, denn ich musste einen irrsinnigen Kampf mit meinen Nerven austragen, der mir den Angstschweiß aus allen Löchern jagte. Jedes Mal, wenn der Theologe seine Verbeugung machte und sein »Gesegnetes Fest, Herr Wachtmeister« wie Honig von der Zunge tropfen ließ – jedes Mal musste ich alle Muskeln anspannen, es ihm nicht nachzutun. Die Versuchung war so stark, dass ich mehrere Male den Staatsdenkmälern schon freundlich zunickte und es erst in der letzten Sekunde fertigbrachte, keine Verbeugung zu machen und stumm zu bleiben.
Wir kreisten täglich etwa eine halbe Stunde im Hof, das waren täglich zwanzig Runden, und zwölf Uniformen umstanden unsern Kreis. Der Theologe machte also auf jeden Fall zweihundertundvierzig Verbeugungen pro Tag, und zweihundertundvierzig Mal musste ich alle Konzentration aufbieten, nicht verrückt zu werden. Ich wusste, wenn ich das drei Tage gemacht hätte, würde ich mildernde Umstände bekommen – dem war ich nicht gewachsen. Ich kam völlig erschöpft in meine Zelle zurück. Die ganze Nacht aber ging ich im Traum eine unendliche Reihe blauer Uniformen entlang, die alle wie Bismarck aussahen – die ganze Nacht bot ich diesen Millionen blassblauer Bismarcks mit tiefem Bückling ein »Gesegnetes Fest, Herr Wachtmeister!«
Am nächsten Tag wusste ich es so einzurichten, dass die Reihe an mir vorbeiging und ich einen andern Vordermann bekam: Ich verlor meinen Pantoffel, fischte ihn ganz umständlich und humpelte in den Lattenzaun zurück. Gott sei Dank! Vor mir ging die Sonne auf. Vielmehr – sie verdunkelte sich. Mein neuer Vordermann war so unverschämt lang, dass meine 1,80 m glatt in seinem Schatten verschwanden. Es gab also doch eine Vorsehung – man musste ihr nur mit dem Pantoffel nachhelfen. Seine unmenschlich langen Gliedmaßen ruderten sinnlos durcheinander, und das Originelle war, er kam dabei sogar vorwärts, obgleich er sicher keinerlei Übersicht über Beine und Arme hatte. Ich liebte ihn beinahe – ja, ich betete, er möchte nicht plötzlich tot umsinken wie die Perücke oder verrückt werden und anfangen, feige Verbeugungen zu machen. Ich betete für sein langes Leben und seine geistige Gesundheit. Ich fühlte mich in seinem Schatten so geborgen, dass meine Blicke länger als sonst die kleine Hundeblume umfingen, ohne dass ich Angst zu haben brauchte, mich zu verraten. Ich verzieh diesem himmlischen Vordermann sogar sein abscheulich näselndes Organ, ja, ich verkniff mir großzügig, ihm allerlei Spitznamen wie Oboe, Krake oder Gottesanbeterin zu verleihen. Ich sah nur noch meine Blume – und ließ meinen Vordermann so lang und so blöde sein, wie er es wollte!
Der Tag war wie alle anderen. Er unterschied sich nur dadurch von ihnen, dass der Häftling aus der Zelle 432 zum Ende der halben Stunde einen rasenden Pulsschlag bekam und seine Augen den Ausdruck von kaschierter Harmlosigkeit und schlecht verdeckter Unsicherheit annahmen.
Wir bogen in die vorletzte Runde ein – wieder wurden die Schlüsselbunde lebendig, und der Lattenzaun döste durch die sparsamen Sonnenstrahlen wie hinter ewigen Gittern.
Aber was war das? Eine Latte döste ja gar nicht! Sie war hellwach und wechselte vor Aufregung alle paar Meter die Gangart. Merkte das denn kein Mensch? Nein. Und plötzlich bückte sich die Latte 432, fummelte an ihrem runtergerutschten Strumpf herum und – fuhr dazwischen blitzschnell mit der einen Hand auf eine erschrockene kleine Blume zu, riss sie ab – und schon klöppelten wieder siebenundsiebzig Latten in gewohntem Schlendrian in die letzte Runde.
Was ist so komisch: Ein blasierter, reuiger Jüngling aus dem Zeitalter der Grammophonplatten und Raumforschung steht in der Gefängniszelle 432 unter dem hochgemauerten Fenster und hält mit seinen vereinsamten Händen eine kleine gelbe Blume in den schmalen Lichtstrahl – eine ganz gewöhnliche Hundeblume. Und dann hebt dieser Mensch, der gewohnt war, Pulver, Parfüm und Benzin, Gin und Lippenstift zu riechen, die Hundeblume an seine hungrige Nase, die schon monatelang nur das Holz der Pritsche, Staub und Angstschweiß gerochen hat – und er saugt so gierig aus der kleinen gelben Scheibe ihr Wesen in sich hinein, dass er nur so aus Nase besteht.
Und da öffnet sich in ihm etwas und ergießt sich wie Licht in den engen Raum, etwas, von dem er bisher nie etwas gewusst hatte: Eine Zärtlichkeit, eine Anlehnung und Wärme ohnegleichen erfüllte ihn zu der Blume und füllte ihn ganz aus.
Er ertrug den Raum nicht mehr und schloss die Augen und staunte: Aber – du riechst ja – nach Erde – nach Sonne, Meer und Honig, liebes Lebendiges du! Er empfand ihre keusche Kühle wie die Stimme seines Vaters, den er nie sonderlich beachtet hatte und der nun so viel Trost war mit seiner Stille – er empfand sie wie die helle Schulter einer dunklen Frau und er gab ihr einen Namen: Aline – sagte er.
Und dann trug er sie behutsam wie eine Geliebte zu seinem Wasserbecher, stellte das erschöpfte kleine Wesen da rein, und dann brauchte er mehrere Minuten – so langsam setzte er sich, Angesicht in Angesicht mit seiner Blume.
Er war so gelöst und glücklich, dass er alles abtat und abstreifte, was ihn belastete: die Gefangenschaft, das Alleinsein, den Hunger nach Liebe, die Hilflosigkeit seiner zweiundzwanzig Jahre, die Gegenwart und die Zukunft, die Welt und das Christentum – ja, auch das.
Er war ein brauner Balinese, ein »Wilder« eines »wilden« Volkes, der das Meer und den Blitz und den Baum fürchtete und anbetete. Der Kokosnuss, Kabeljau und Kolibri verehrte, bestaunte, fraß und nicht begriff. Ja, er war so glücklich, und nie war er so bereit zum Guten gewesen, als er der Blume zuflüsterte ... werden wie du ...
Die ganze Nacht umspannten seine glücklichen Hände das vertraute Blech seines Trinkbechers, und er fühlte im Schlaf, wie sie Erde auf ihn häuften, dunkle, gute Erde, und wie er sich der Erde angewöhnte und wurde wie sie – und wie aus ihm Blumen brachen: Anemonen, Akelei und Löwenzahn – winzige, unscheinbare Sonnen.
Die Krähen fliegen abends nach Hause
SIE HOCKEN auf dem steinkalten Brückengeländer und am violettstinkenden Kanal entlang auf dem frostharten Metallgitter. Sie hocken auf ausgeleierten muldigen Kellertreppen. Am Straßenrand bei Stanniolpapier und Herbstlaub und auf den sündigen Bänken der Parks. Sie hocken an türlose Häuserwände gelehnt, hingeschrägt, und auf den fernwehvollen Mauern und Molen des Kais.
Sie hocken im Verlorenen, krähengesichtig, grauschwarz übertrauert und heisergekrächzt. Sie hocken und alle Verlassenheiten hängen an ihnen herunter wie lahmes loses zerzaustes Gefieder. Herzverlassenheiten, Mädchenverlassenheiten, Sternverlassenheiten.
Sie hocken im Gedämmer und Gediese der Häuserschatten, torwegscheu, teerdunkel und pflastermüde. Sie hocken dünnsohlig und graubestaubt im Frühdunst des Weltnachmittags, verspätet, ins Einerlei verträumt. Sie hocken über dem Bodenlosen, abgrundverstrickt und schlafschwankend vor Hunger und Heimweh.
Krähengesichtig (wie auch anders?) hocken sie, hocken, hocken und hocken. Wer? Die Krähen? Vielleicht auch die Krähen. Aber die Menschen vor allem, die Menschen.
Rotblond macht die Sonne um sechs Uhr das Großstadtgewölke aus Qualm und Gerauch. Und die Häuser werden samtblau und weichkantig im milden Vorabendgeleuchte.
Aber die Krähengesichtigen hocken weißhäutig und blassgefroren in ihren Ausweglosigkeiten, in ihren unentrinnbaren Menschlichkeiten, tief in die buntflickigen Jacken verkrochen.
Einer hockte noch von gestern her am Kai, roch sich voll Hafengeruch und kugelte zerbröckeltes Gemäuer ins Wasser. Seine Augenbrauen hingen mutlos, aber mit unbegreiflichem Humor wie Sofafransen auf der Stirn. Und dann kam ein Junger dazu, die Arme ellbogentief in den Hosen, den Jackenkragen hochgeklappt um den mageren Hals. Der Ältere sah nicht auf, er sah neben sich die trostlosen Schnauzen von einem Paar Halbschuhen und vom Wasser hoch zitterte ein wellenverschaukeltes Zerrbild von einer traurigen Männergestalt ihn an. Da wusste er, dass Timm wieder da war.
Na, Timm, sagte er, da bist du ja wieder. Schon vorbei?
Timm sagte nichts. Er hockte sich neben den andern auf die Kaimauer und hielt die langen Hände um den Hals. Ihn fror.
Ihr Bett war wohl nicht breit genug, wie? fing der andere sachte wieder an nach vielen Minuten.
Bett! Bett! sagte Timm wütend, ich liebe sie doch.
Natürlich liebst du sie. Aber heute Abend hat sie dich wieder vor die Tür gestellt. War also nichts mit dem Nachtquartier. Du bist sicher nicht sauber genug, Timm. So ein Nachtbesuch muss sauber sein. Mit Liebe allein geht das nicht immer. Na ja, du bist ja sowieso kein Bett mehr gewöhnt. Dann bleib man lieber hier. Oder liebst du sie noch, was?
Timm rieb seine langen Hände am Hals und rutschte tief in seinen Jackenkragen. Geld will sie, sagte er viel später, oder Seidenstrümpfe. Dann hätte ich bleiben können.
Oh, du liebst sie also noch, sagte der Alte, je, aber wenn man kein Geld hat!
Timm sagte nicht, dass er sie noch liebe, aber nach einer Weile meinte er etwas leiser: Ich hab ihr den Schal gegeben, den roten, weißt du. Ich hatte ja nichts anderes. Aber nach einer Stunde hatte sie plötzlich keine Zeit mehr.
Den roten Schal? fragte der andere. Oh, er liebt sie, dachte er für sich, wie liebt er sie! Und er wiederholte noch einmal: Oha, deinen schönen roten Schal! Und jetzt bist du doch wieder hier und nachher wird es Nacht.
Ja, sagte Timm, Nacht wird es wieder. Und mir ist elend kalt am Hals, wo ich den Schal nicht mehr hab. Elend kalt, kann ich dir sagen.
Dann sahen sie beide vor sich aufs Wasser und ihre Beine hingen betrübt an der Kaimauer. Eine Barkasse schrie weißdampfend vorbei und die Wellen kamen dick und schwatzhaft hinterher. Dann war es wieder still, nur die Stadt brauste eintönig zwischen Himmel und Erde und krähengesichtig, blauschwarz übertrauert, hockten die beiden Männer im Nachmittag. Als nach einer Stunde ein Stück rotes Papier mit den Wellen vorüberschaukelte, ein lustiges rotes Papier auf den bleigrauen Wellen, da sagte Timm zu dem andern: Aber ich hatte ja nichts anderes. Nur den Schal.
Und der andere antwortete: Und der war so schön rot, du, weißt du noch, Timm? Junge, war der rot.
Ja, ja, brummte Timm verzagt, das war er. Und jetzt friert mich ganz elend am Hals, mein Lieber.
Wieso, dachte der andere, er liebt sie doch und war eine ganze Stunde bei ihr. Jetzt will er nicht mal dafür frieren. Dann sagte er gähnend: Und das Nachtquartier ist auch Essig.
Lilo heißt sie, sagte Timm, und sie trägt gerne seidene Strümpfe. Aber die hab ich ja nicht.
Lilo? staunte der andere, Schwindel doch nicht, sie heißt doch nicht Lilo, Mensch.
Natürlich heißt sie Lilo, antwortete Timm aufgebracht. Meinst du, ich kann keine kennen, die Lilo heißt? Ich liebe sie sogar, sag ich dir.
Timm rutschte wütend von seinem Freund ab und zog die Knie ans Kinn. Und seine langen Hände hielt er um den mageren Hals. Ein Gespinst von früher Dunkelheit legte sich über den Tag und die letzten Sonnenstrahlen standen wie ein Gitter verloren am Himmel. Einsam hockten die Männer über den Ungewissheiten der kommenden Nacht und die Stadt summte groß und voller Verführung. Die Stadt wollte Geld oder seidene Strümpfe. Und die Betten wollten sauberen Besuch in der Nacht.
Du, Timm, fing der andere an und verstummte wieder.
Was ist denn, fragte Timm.
Heißt sie wirklich Lilo, du?
Natürlich heißt sie Lilo, schrie Timm seinen Freund an, Lilo heißt sie, und wenn ich mal was hab, soll ich wiederkommen, hat sie gesagt, mein Lieber.
Du, Timm, brachte der Freund dann nach einer Weile zustande, wenn sie wirklich Lilo heißt, dann musstest du ihr den roten Schal auch geben. Wenn sie Lilo heißt, finde ich, dann darf sie auch den roten Schal haben. Auch wenn es mit dem Nachtquartier Essig ist. Nein, Timm, den Schal lass man, wenn sie wirklich Lilo heißt.
Die beiden Männer sahen über das dunstige Wasser weg der aufsteigenden Dämmerung entgegen, furchtlos, aber ohne Mut, abgefunden. Abgefunden mit Kaimauern und Torwegen, abgefunden mit Heimatlosigkeiten, mit dünnen Sohlen und leeren Taschen abgefunden. Ans Einerlei vertrödelt ohne Ausweg.
Überraschend am Horizont hochgeworfen, von irgendwo her geweht, kamen Krähen angetaumelt, Gesang und das dunkle Gefieder voll Nachtahnung, torkelten sie wie Tintenkleckse über das keusche Seidenpapier des Abendhimmels, müdegelebt, heisergekrächzt, und dann unerwartet etwas weiter ab schon von der Dämmerung verschluckt.
Sie sahen den Krähen nach, Timm und der andere, krähengesichtig, blauschwarz übertrauert. Und das Wasser roch satt und gewaltig. Die Stadt, aus Würfeln wild aufgetürmt, fensteräugig, fing mit tausend Lampen an zu blinken. Den Krähen sahen sie nach, den Krähen, die lange verschluckt schon, sahen ihnen nach mit armen alten Gesichtern, und Timm, der Lilo liebte, Timm, der zwanzig Jahre war, der sagte: Die Krähen, du, die haben es gut.
Der andere sah vom Himmel weg mitten in Timms weites Gesicht, das blassgefroren im Halbdunkel schwamm. Und Timms dünne Lippen waren traurige Striche in dem weiten Gesicht, einsame Striche, zwanzigjährig, hungrig und dünn von vielen verfrühten Bitterkeiten.
Die Krähen, sagte Timms weites Gesicht leise, dieses Gesicht, das aus zwanzig helldunklen Jahren gemacht war, die Krähen sagte Timms Gesicht, die haben es gut. Die fliegen abends nach Hause. Einfach nach Hause.
Die beiden Männer hockten verloren in der Welt, angesichts der neuen Nacht klein und verzagt, aber furchtlos mit ihrer furchtbaren Schwärze vertraut. Die Stadt glimmte durch weiche warme Gardinen millionenäugig schläfrig auf die lärmleeren Nachtstraßen mit dem verlassenen Pflaster. Da hockten sie, hart ans Bodenlose hingelehnt wie müdmorsche Pfähle, und Timm, der Zwanzigjährige, hatte gesagt: Die Krähen haben es gut. Die Krähen fliegen abends nach Hause. Und der andere plapperte blöde vor sich hin: Die Krähen, Timm, Mensch, Timm, die Krähen.
Da hockten sie. Hingelümmelt vom lockenden lausigen Leben. Auf Kai und Kantstein gelümmelt. Auf Mole und muldiges Kellergetrepp. Auf Pier und Ponton. Zwischen Herbstlaub und Stanniolpapier vom Leben auf staubgraue Straßen gelümmelt. Krähen? Nein, Menschen! Hörst du? Menschen! Und einer davon hieß Timm und der hatte Lilo liebgehabt für einen roten Schal. Und nun, nun kann er sie nicht mehr vergessen. Und die Krähen, die Krähen krächzen nach Hause. Und ihr Gekrächz stand trostlos im Abend.
Aber dann stotterte eine Barkasse schaummäulig vorbei und ihr gesprühtes Rotlicht verkrümelte sich zitternd in der Hafendiesigkeit. Und das Gediese wurde rot für Sekunden. Rot wie mein Schal, dachte Timm. Unendlich weit ab vertuckerte die Barkasse. Und Timm sagte leise: Lilo. Immerzu: Lilo Lilo Lilo Lilo Lilo –
Stimmen sind da in der Luft - in der Nacht
DIE STRAßENBAHN fuhr durch den nebelnassen Nachmittag. Der war grau und die Bahn war gelb und verloren darin. Denn es war November und die Straßen waren leer und lärmlos und ohne Lust. Nur das Gelb der Straßenbahn schwamm einsam im nebeligen Nachmittag.
In der Bahn aber saßen sie, warm, atmend, erregt. Fünf oder sechs saßen da, Menschen, verloren, einsam im Novembernachmittag. Aber dem Nebel entronnen. Saßen unter tröstlichen trüben Lämpchen, ganz vereinzelt saßen sie, dem nassen Nebel entronnen. Leer war es in der Bahn. Nur fünf waren da, ganz vereinzelt, und atmeten. Und der Schaffner war der sechste an diesem späten einsamen Nebelnachmittag, war da mit seinen milden Messingknöpfen und malte große schiefe Gesichter an die feuchten behauchten Scheiben. Die Straßenbahn stieß und stolperte gelb durch den November.
Drinnen saßen die fünf Entronnenen und der Schaffner stand da und der ältere Herr mit den vielfältigen Tränensäcken unter den Augen fing wieder an – halblaut fing er wieder davon an:
»In der Luft sind sie. In der Nacht. Oh, sie sind in der Nacht. Darum schläft man nicht. Nur darum. Das sind einzig und allein die Stimmen, glauben Sie mir, das sind nur die Stimmen.«
Der ältere Herr beugte sich weit vor. Seine Tränensäcke schlotterten leise und sein seltsam heller Zeigefinger piekste der alten Frau, die ihm gegenübersaß, auf die flache Brust. Sie zog geräuschvoll die Luft durch die Nase und starrte erregt auf den hellen Zeigefinger. Immer wieder zog sie laut die Luft hoch. Sie musste das, denn sie hatte einen schönen abgrundtiefen Novemberschnupfen, der ihr tief bis in die Lunge zu reichen schien. Aber trotzdem machte sie der Finger erregt. Die beiden Mädchen in der anderen Ecke kicherten. Aber sie sahen sich nicht an, als von den nächtlichen Stimmen die Rede war. Sie wussten es längst, dass es nachts Stimmen gab. Gerade sie wussten es vor allem. Aber sie kicherten, weil sie sich voreinander schämten. Und der Schaffner malte große schiefe Gesichter auf das nebelbeschlagene Fensterglas. Und dann saß da ein junger Mann, der hatte die Augen zu und war blass. Sehr blass saß er da unter dem trüben Lämpchen. Er hatte die Augen zu, als ob er schliefe. Und die Straßenbahn stieß schwimmend gelb durch den einsamen Nebelnachmittag. Der Schaffner malte ein schiefes Gesicht an die Scheibe und sagte zu dem älteren Herrn mit den leise schlotternden Tränensäcken: »Ja, das ist klar: Stimmen sind da. Allerhand Stimmen gibt es. Und nachts natürlich besonders.«
Die beiden Mädchen schämten sich heimlich und machten ein kribbeliges Gekicher und die eine dachte: Nachts, nachts besonders.
Der mit den schlotternden Tränensäcken nahm seinen hellen Finger von der Brust der verschnupften alten Frau und piekste nun damit auf den Schaffner los:
»Hören Sie«, flüsterte er, »was ich sage, was ich sage! Stimmen sind da. In der Luft, in der Nacht. Und, meine Herrschaften – «er nahm den Zeigefinger vom Schaffner weg und stach damit steil nach oben, »wissen Sie auch, wer das ist? In der Luft? Die Stimmen? Nachts die Stimmen? Wissen Sie das denn auch, wie?«
Leise schlotterten die Tränensäcke unter seinen Augen. Der junge Mann am anderen Ende des Wagens war sehr blass und hatte die Augen zu, als ob er schliefe.
»Die Toten sind es, die vielen vielen Toten.« Der mit den Tränensäcken flüsterte: »Die Toten, meine Herrschaften. Es sind zu viele. Sie drängeln sich nachts in der Luft. Die viel zu vielen Toten sind das. Sie haben keinen Platz. Denn alle Herzen sind voll. Überfüllt bis an den Rand. Und nur in den Herzen können sie bleiben, das ist sicher. Aber es sind zu viel Tote, die nicht wissen: Wohin!?«
Die anderen in der Bahn an diesem Nachmittag hielten den Atem an. Nur der blasse junge Mann holte mit geschlossenen Augen tief und schwer Luft, als ob er schliefe.
Der ältere Herr piekste mit seinem hellen Zeigefinger nacheinander auf seine Zuhörer los. Auf die Mädchen, auf den Schaffner und auf die alte Frau. Und dann flüsterte er wieder: »Und darum schläft man nicht. Nur darum. Es sind zu viel Tote in der Luft. Die haben keinen Platz. Die reden dann nachts und suchen ein Herz. Darum schläft man nicht, weil die Toten nachts nicht schlafen. Es sind zu viele. Besonders nachts. Nachts reden sie, wenn es ganz still ist. Nachts sind sie da, wenn das andere alles weg ist. Nachts haben sie dann Stimmen. Darum schläft man so schlecht.« Die alte Frau mit dem Schnupfen zog piepend die Luft hoch und starrte erregt auf die faltigen, schlotternden Tränensäcke des flüsternden älteren Herrn. Aber die Mädchen kicherten. Sie kannten andere Stimmen in der Nacht, lebendige, die wie warme männliche Hände auf der nackten Haut lagen, die sich unter das Bett schoben, leise, gewalttätig, besonders nachts. Sie kicherten und schämten sich voreinander. Und keine wusste, dass die andere auch die Stimmen hörte, nachts, in den Träumen.
Der Schaffner malte große schiefe Gesichter an die nebelnassen Scheiben und sagte:
»Ja, die Toten sind da. Die reden in der Luft. In der Nacht, ja. Das ist klar. Das sind die Stimmen. Die hängen nachts in der Luft, überm Bett. Dann schläft man davon nicht. Das ist klar.«
Die alte Frau zog ihren Schnupfen durch die Nase und nickte: »Die Toten, ja, die Toten: Das sind die Stimmen. Überm Bett. O ja, immer überm Bett.«
Und die Mädchen fühlten fremde männliche Hände heimlich auf der Haut, und sie hatten rote Gesichter an diesem grauen Nachmittag in der Straßenbahn. Aber der junge Mann, der war blass und sehr einsam in seiner Ecke und hatte die Augen zu, als ob er schliefe. Da stach der mit den Tränensäcken mit seinem hellen Finger in die dunkle Ecke hinein, in der der Blasse saß, und flüsterte:
»Ja, die Jungen! Die können schlafen. Nachmittags. Nachts. Im November. Immer. Die hören die Toten nicht. Die Jungen, die verschlafen die heimlichen Stimmen. Nur wir Alten haben inwendig Ohren. Die Jungen haben keine Ohren für die Stimmen nachts. Die können schlafen.«
Sein Zeigefinger piekste von ferne verächtlich auf den blassen jungen Mann los und die anderen atmeten erregt. Da machte er die Augen auf, der Blasse, und stand plötzlich und schwankte auf den älteren Herrn zu. Erschrocken verkroch sich der Zeigefinger in der Handfläche und die Tränensäcke standen einen Augenblick lang still. Der Blasse, der Junge, griff nach dem Gesicht des älteren Herrn und sagte:
»Oh, bitte. Werfen Sie nicht die Zigarette weg. Geben Sie sie bitte mir. Mir ist schlecht. Ich habe nämlich etwas Hunger. Geben Sie sie mir. Das tut gut. Mir ist nämlich schlecht.«
Da feuchteten sich die Tränensäcke an und fingen faltig an zu schlottern, traurig, leise, erschrocken. Und der ältere Herr sagte: »Ja, Sie sind sehr blass. Sie sehen sehr schlecht aus. Haben Sie keinen Mantel? Wir haben November.«
»Ich weiß doch, ich weiß doch«, sagte der Blasse, »meine Mutter sagt jeden Morgen zu mir, ich soll den Mantel anziehen, es wäre November. Ja, ich weiß. Aber sie ist schon drei Jahre tot. Sie weiß ja nicht, dass ich keinen Mantel mehr habe. Jeden Morgen sagt meine Mutter: Es ist doch November, sagt sie. Aber sie kann das ja nicht wissen mit dem Mantel, sie ist ja tot.«
Der junge Mann nahm die glimmende Zigarette und schwankte aus dem Wagen. Draußen war Nebel, war Nachmittag und November. Und in den einsamen späten Nachmittag hinein ging ein junger, sehr blasser Mann mit einer Zigarette. Er hatte Hunger. Er hatte keinen Mantel. Seine Mutter war tot, und es war November. Und drinnen saßen die anderen und sie atmeten nicht. Leise, traurig schlotterten die Tränensäcke. Und der Schaffner malte große schiefe Gesichter an die Scheibe. Große schiefe Gesichter.
1LEtat c'est moi: Der Staat bin ich! (franz., Aussage Ludwig XIV)
Gespräch über den Dächern
Für Bernhard Meyer-Marwitz
DRAUßEN steht die Stadt. In den Straßen stehn die Lampen und passen auf. Dass nichts passiert. In den Straßen stehen die Linden und die Mülleimer und die Mädchen, und ihr Geruch ist der Geruch der Nacht: schwer, bitter, süß. Schmaler Rauch steht steil über den blanken Dächern. Der Regen hat zu trommeln aufgehört und hat sich davongemacht. Aber die Dächer sind noch blank von ihm und die Sterne liegen weiß auf den dunkelnassen Ziegeln. Manchmal ragt ein Katzengestöhn brünstig bis an den Mond. Oder ein Menschenweinen. In den Parks und den Gärten der Vorstädte steht der bleichsüchtige Nebel auf und spiralt sich durch die Straßen. Eine Lokomotive schluchzt ihren Fernwehschrei tief in die Träume der tausend Schläfer. Unendliche Fenster sind da. Nachts sind diese unendlichen Fenster. Und die Dächer sind blank, seit der Regen entfloh.
Draußen steht die Stadt. Ein Haus steht in der Stadt. Stumm, steinern, grau wie die andern. Und ein Zimmer ist in dem Haus. Ein Zimmer, eng, kalkig, zufällig, wie die andern auch. Und in dem Zimmer sind zwei Männer. Einer ist blond und sein Atem geht weich und das Leben geht wie sein Atem weich in ihn hinein, aus ihm heraus. Seine Beine liegen schwer wie Bäume auf dem Teppich, und der Stuhl, auf dem er sitzt, knackt verstohlen im Gefüge. Das ist der tief im Zimmer. Und einer steht am Fenster. Lang, hoch, gekrümmt, schrägschultrig. Seine Schläfenknochen, der Rand seines Ohres, schwimmen weißgrau und mehlig im Zimmer. Im Auge blinkt zage das Licht von der Lampe im Hof. Aber der Hof, das ist draußen und die Lampe glimmt sparsam. Ein Atem geht am Fenster auf und ab wie eine Säge. Manchmal schlägt das Fensterglas mit einem duffen warmen Hauch von diesem Atem. Eine Stimme ist da am Fenster wie von einem Amokläufer, panisch, atemlos, gehetzt, übertrieben, erregt:
»Siehst du das nicht? Siehst du nicht, dass wir ausgeliefert sind. Ausgeliefert an das Ferne, an das Unaussprechliche, an das Ungewisse, das Dunkle? Fühlst du nicht, dass wir ausgeliefert sind an das Gelächter, an die Trauer und die Tränen, an das Gebrüll. Du, das ist furchtbar, wenn das Gelächter in uns aufstößt und schwillt, das Gelächter über uns selbst. Wenn wir an den Gräbern unserer Väter und Freunde und unserer Frauen stehen und das Gelächter steht auf. Das Gelächter in der Welt, das den Schmerz belauert. Das Gelächter, das die Trauer anfällt, in uns, wenn wir weinen. Und wir sind ihm ausgeliefert.
Furchtbar ist es, du, oh, furchtbar, wenn die Trauer uns anweht und die Tränen durch die Ritzen sickern, wenn wir an den Wiegen unserer Kinder stehen. Furchtbar, wenn wir an den bräutlichen Betten stehen, und die Trauer, die schwarzlakige Lemure, kriecht in uns hoch, eisig einsam. Steht auf in uns, wenn wir lachen, und wir sind ihr ausgeliefert.
Weißt du das nicht? Weißt du nicht, wie furchtbar das Gebrüll ist, das anwächst in der Welt, voll Angst wächst in der Welt, das in dir hochkommt und brüllt. Brüllt in der Stille der Nacht, brüllt in der Stille der Liebe, brüllt in der stummen Einsamkeit. Und das Gebrüll heißt: Spott! Heißt: Gott! Heißt: Leben! Heißt: Angst. Und wir sind ihm ausgeliefert mit all unserm Blut in uns.
Wir lachen. Und unser Tod ist geplant von Anfang an.
Wir lachen. Und unsere Verwesung ist unausweichlich.
Wir lachen. Und unser Untergang steht bevor.
Heute Abend. Übermorgen.
In neuntausend Jahren. Immer.
Wir lachen, aber unser Leben ist dem Zufall vorgeworfen, ausgeliefert, unvermeidlich. Dem Zufälligen, begreifst du? Was fällt in der Welt, kann auf dich fallen und dich erdrücken oder stehenlassen. Wie der Zufall zufällig fällt. Und wir: ausgeliefert ihm, vorgeworfen zum Fraß.
Dabei lachen wir. Stehen dabei und lachen. Und unser Leben, unsere Liebe und unser geliebtes gelebtes Leid – sie sind ungewiss und zufällig wie die Welle und der Wind. Willkürlich. Begreifst du? Begreifst du!«
Aber der andere schweigt. Und der am Fenster krächzt wieder: »Und dann wir hier in der Stadt, tief drinnen in diesem einsamsten der Wälder, tief unter diesem erdrückendsten Steinberg, in dieser Stadt, in der uns keine Stimme anspricht, in der uns kein Ohr gehört und kein Auge begegnet. In dieser Stadt, in der die Gesichter ohne Gesicht an uns vorüberschwimmen, namenlos, zahllos, wahllos. Ohne Anteil, herzlos. Ohne Bleibe, ohne Anfang, ohne Hafen. Algen. Algen im Strom der Zeit. Algen, grün, grau, gelb, dunkelweiß aus der Tiefe auftauchend, spurlos wieder hinabtauchend in die Wasser der Welt: Algen, Gesichter, Menschen.
In dieser Stadt, wir hier, heimatlos, ohne Baum, ohne Vogel, ohne Fisch: vereinsamt, verloren, untergegangen. Ausgeliefert, verloren an ein Meer von Mauern, an ein Meer von Mörtel, Staub und Zement. Den Treppen, den Tapeten, den Türmen und Türen vorgeworfen. Wir hier in der Stadt, mit unserer unheilbaren unheilvollen Liebe verkauft an sie. Verlaufen im einsamen Wald Stadt, im Wald aus Wänden, Fassaden, Eisen, Beton und Laternen. Verlaufen auf diese Welt, ohne Herkunft, ohne Zuhause. Verschenkt an die antwortlose einsame Nacht in den Straßen. Ausgeliefert an den millionengesichtigen Tag mit seinem millionenstimmigen Gebrüll, ausgeliefert mit unserem wehrlosen weichen Stück Herzen. Ausgeliefert mit unserem unüberlegten Mut und unseren kleinen Begriffen. An das Pflaster gekettet, an die Steine, an den Teer und die Siele, Pontons und Kanäle mit jedem Pulsschlag, mit unseren Nasen, Augen und Ohren. Ohne Ziel für eine Flucht. Unter Dächer gedrückt, den Kellern, den Decken, den Stuben ausgeliefert. Hörst du das? Du, das sind wir und so ist das mit uns. Und du glaubst, du hältst das aus bis morgen, bis Weihnachten, bis zum März?«
Der Amokläufer klirrt mit seiner blechernen Stimme tief in das dunkel gewordene Zimmer hinein. Aber der Blonde atmet weich und sicher, und er nimmt die Lippen zu keiner Antwort voneinander. Und der am Fenster sticht mit seiner Stimme weiter in die Stille des späten Abends, unbarmherzig, gequält, gezwungen:
»Wir halten das aus. Wie findest du das, wie? Wir halten das aus. Wir lachen. Ausgeliefert den Bestien in uns und um uns, lachen wir. Oh, und wie wir den Frauen, unseren Frauen, verfallen sind. Den gemalten Lippen, den Wimpern, dem Hals, dem Geruch ihres Fleisches verfallen. Vergessen im Spiel ihrer Sehnsüchte, untergegangen im Zauber ihrer Zärtlichkeiten, lächeln wir. Und die Trennung hockt frierend und grinsend auf den Türdrückern, tickt in den Uhrwerken. Wir lächeln, als wären uns Ewigkeiten gewiss, und der Abschied, alle Abschiede, warten schon in uns. Alle Tode tragen wir in uns. Im Rückenmark. In der Lunge. Im Herzen. In der Leber. Im Blut. Überall tragen wir unseren Tod mit uns herum und vergessen uns und ihn im Schauer einer Liebkosung. Oder weil eine Hand so schmal und eine Haut so hell ist. Und der Tod, und der Tod, und der Tod lacht über unser Gestöhn und Gestammel!«
Der am Fenster hat mit seinem Panikatem alle Luft in dem Zimmer verschlungen, heruntergewürgt, und als heiße heisere Worte wieder ausgestoßen. Es ist keine Luft mehr in dem Zimmer, und er stößt das Fenster weit auf. Die Chitinpanzer der Nachtinsekten klickern erregt und knisternd gegen das Glas. Etwas rasselt vorbei, halblaut. Es quietscht verstohlen, als wenn eine Frau aus einem lauten Lachen ein kleines Kichern macht.
»Enten.« Sagt weich und rund der im Zimmer. Und er hält sich noch einen Augenblick fest an seinem Wort, als der am Fenster sich wieder über ihn ausschüttet:
»Hast du gehört, wie sie kichern, die Enten? Alles lacht über uns. Die Enten, die Frauen, die ungeölten Türen. Überall lauert das Gelächter. Oh, dass es dieses Gelächter gibt in der Welt! Und die Trauer gibt es und den Gott Zufall. Und es gibt das Gebrüll, das riesenmäulige Gebrüll! Und wir haben den Mut: Und wohnen. Und wir haben den Mut: Und planen. Und lachen. Und lieben. Wir leben! Wir leben, leben ohne Tod, und unser Tod war beschlossen von Anfang an. Abgemacht. Von vornherein. Aber wir sind mutig, wir Todtragenden: Wir machen Kinder, wir fahren, wir schlafen. Jede Minute, die war, ist unwiederbringlich. Unübersehbar jede, die kommt. Aber wir Mutigen, wir Untergangsgezeichneten: Wir schwimmen, wir fliegen, wir gehen über Straßen und Brücken. Und über die Planken der Schiffe schwanken wir – und unser Untergang, hörst du, unser Untergang feixt hinter der Reling, lauert unter den Autos, knistert in den Pfeilern der Brücken. Unser Untergang, unabwendbar.
Und wir, Zweibeiner, Leute, Menschentiere, mit unserm bisschen roten Saft, mit unserm bisschen Wärme und Knochen und Fleisch und Muskel – wir halten das aus. Unsere Verwesung ist beschlossen, unbestechlich, und: Wir pflanzen. Unser Verfall kündigt sich an, unwiderruflich, und: Wir bauen. Unser Verschwinden, unsere Auflösung, unser Nichtsein ist gewiss, ist notiert, unauslöschlich – unser Nicht-mehr-hier-Sein steht unmittelbar bevor, und: Wir sind. Wir sind noch. Wir haben den unfassbaren Mut: Und sind.
Und der Zufall, der unberechenbare verspielte Gott über uns, der Zufall, der grausame gewaltige Zufall balanciert betrunken auf den Dächern der Welt. Und unter den Dächern sind wir Sorglosen mit unserem unfassbaren Glauben.
Ein paar Gramm Gehirn versagen, zwei Gramm Rückenmark meutern: und wir sind lahm. Wir sind blöd. Steif. Elend. Aber wir lachen.
Ein paar Herzschläge kommen nicht: Und wir bleiben ohne Erwachen, ohne Morgen. Aber wir schlafen – zuversichtlich. Tief und tierisch getrost.
Ein Muskel, ein Nerv, eine Sehne setzt aus: Wir stürzen. Abgrundtief, endlos. Aber wir fahren, wir fliegen und schwanken breitspurig auf den Planken der Schiffe.
Dass wir so sind – was ist das, du? Dass wir so sein können, dass wir so sein müssen – keine Lippe gibt das frei. Ohne Lösung, ohne Grund, ohne Gestalt ist das. Dunkel. Und wir? Wir sind. Sind dennoch, immer noch. Oh, du – wir sind immer noch. Immer noch, du, immer noch.«
Die beiden Männer in dem Zimmer atmen. Weich und ruhig der eine, rasselnd und hastig der am Fenster. Draußen steht die Stadt. Der Mond schwimmt wie ein schmutziges Eigelb in der bickbeerblauen Suppe des Nachthimmels. Er sieht faulig aus und man hat das Gefühl, er müsse stinken. So krank sieht der Mond aus. Aber der Gestank kommt aus den Kanälen. Aus den klotzigen klobigen Würfelmassen des Häusermeeres mit den Millionen von glasigen Augen im Dunkel. Aber der Mond sieht ungesund aus, dass man glauben kann, der Geruch käme von ihm. Doch dazu ist er wohl zu weit ab und es werden die Kanäle sein. Ja, die Kanäle sind es, die grauschwarzen Blöcke der Häuser, die blauschwarzen blanken Autos, die gelben blechernen Straßenbahnen, die dunklen rußroten Güterzüge, die lila Löcher der Siele, die nassgrünen Gräber, die Liebe, die Angst – die sind es, die die Nacht so voll Geruch machen. Der Mond kann es wohl doch nicht sein, obgleich er so faulig und kränklich, so entzündet und breiig im asternfarbenen Himmel schwimmt. Viel zu gelb im asternfarbenen violetten Himmel.
Der am Fenster, der Heisere, Hastige, Hagere, der sieht diesen Mond, und er sieht die Stadt unter dem Mond und er streckt seine Arme aus dem Fenster hinaus und greift diese Stadt. Und seine Stimme kratzt durch die Nacht wie eine Feile: