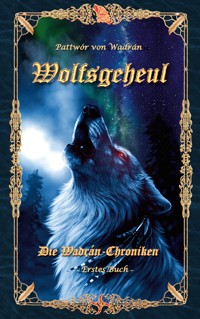
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Wadrán-Chroniken
- Sprache: Deutsch
Fliehen oder kämpfen? Was würdest du tun, wenn beides das Ende deines bisherigen Lebens bedeutet? Bei einem scheinbar harmlosen Spaziergang entkommen die Wilsons nur knapp einem tödlichen Anschlag. Bald entdecken sie, dass ihr zwölfjähriger Sohn Wolf das eigentliche Ziel war. Ungeachtet ihrer Bemühungen bleiben die Drahtzieher unerkannt. Als weitere Attentate folgen, bleibt der Familie nur eine verzweifelte Wahl: ein Leben im Verborgenen unter neuer Identität. Doch die Bedrohung findet sie erneut, und Wolf steht vor einer Entscheidung, die sein Leben für immer verändern wird. Tauche ein in eine Welt, in der nichts so ist, wie es scheint, und erlebe Wolfs dramatischen Wandel im Angesicht einer finsteren Macht. Wolfsgeheul, ein Mystery-Thriller mit garantiertem Gänsehautfaktor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 832
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»opalan«
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich allen für ihre Unterstützung danken, ohne die das Buch in der jetzigen Form nicht entstanden wäre. Mein besonderer Dank geht dabei an Bernd Müller und René Noack für ihre Lektoratsarbeit und die zahlreichen Stunden, in denen wir im konstruktiven Dialog standen.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Der Penn-Valley-Vorfall
Das verfallene Haus
Eine folgenschwere Entscheidung
Indianische Wurzeln
Ein neues Leben
Der Schrei des Wolfes
Ein großer Verlust
Ein neuer Freund
Flucht
Lästige Obliegenheiten
Eine lange Reise
Ankunft
Neue Herausforderungen
Fremdes Blut, fremdes Leben
Epilog
Prolog
»Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen.«
– Konfuzius
Meine Großmutter sagte mir, es gäbe keine Monster, als ich ihr von jenem schockierenden Ereignis im Penn Valley Park erzählte – dem Beginn einer Reihe mysteriöser Vorfälle, die mich und meine Jugend tief geprägt haben.
Ich war ein misstrauischer, schreckhafter Junge, der kaum Anschluss fand. Grandma vermutete, dass der Mangel an sozialen Kontakten die Ursache für mein auffälliges Verhalten sei. Wie sollte ich Sicherheit im Umgang mit anderen gewinnen und mich später in einer Führungsrolle behaupten, wenn ich nicht richtig gefördert und angemessen sozialisiert würde? Nur der Besuch einer privaten Internatsschule könne das gewährleisten, meinte sie – und machte meinen Eltern große Vorwürfe, weil sie ihrem Rat nicht folgten.
Sie verstand nicht, warum ich abweisend war und niemanden an mich heranließ. Wie sollte sie auch? Ich verschwieg ihr das meiste, denn es war mir von meinen Eltern streng verboten worden, von jenen Ereignissen zu erzählen, die der wahre Grund für mein Verhalten waren – jene Ereignisse, die mir die kindliche Unbeschwertheit und das Bild einer heilen Welt raubten.
Trotzdem konnte ich nicht verstehen, warum man Kindern die grausame Realität – die Existenz von Werwölfen und anderen Kreaturen – verschweigt, so wie es Grandma beharrlich tat, als ich ihr, entgegen dem Verbot meiner Eltern, von dem Werwolf erzählte. Etwa, um uns Jugendliche zu schützen, damit wir nicht bibbernd unter der Bettdecke Zuflucht suchen und keinen Fuß mehr vor die Tür setzen?
Ich wusste, dass sie existierten, denn ich hatte sie gesehen – mit eigenen Augen. Und das entlarvte Grandmas sicherlich gut gemeinte Behauptung als Lüge – und sie als Lügnerin. Dabei fürchtete ich nicht einmal die Werwölfe. Meine Monster hatten durchweg menschliche Gestalt.
Heute jedoch würde ich mit ihr nicht mehr so streng ins Gericht gehen. Inzwischen ist mir bewusst, dass meine Realität nicht ihre war. In ihrer Welt existierten keine Monster – und somit auch keine Werwölfe. Für sie war ihre Aussage die Wahrheit. Wenn sie log, dann nur aus Unwissenheit.
Im Gegensatz zu Grandma hörte mir Granny, meine Großmutter mütterlicherseits, immer zu, wenn ich mit Problemen zu ihr kam. Sie stand mir bei und versuchte mir tatkräftig zu helfen. Ich nannte sie Granny, weil sie klein und von zierlicher Gestalt war. Sie war warmherzig und aufgeschlossen – das genaue Gegenteil meiner Großmutter väterlicherseits, die ich stets Grandma nannte. Grandma wirkte eher kalt und unnahbar. Es ist leicht nachvollziehbar, dass ich mich mit Granny viel besser verstand. Sie war es auch, der ich mich letztendlich anvertraute.
Einst war ich Wolf Wilson, der Sohn erfolgreicher amerikanischer Unternehmer. Ich hatte schon recht früh feste Vorstellungen, anhand derer ich die Geschehnisse um mich herum bewertete – vor allem aber darüber, wie das Zusammenleben in Familie und Gesellschaft zu funktionieren habe. Seitdem sind viele Jahre vergangen. Mittlerweile bin ich dreiundzwanzig Jahre alt und um zahlreiche Erfahrungen reicher. Ich glaube, mit gutem Gewissen behaupten zu können, dass ich in all den Jahren viele schöne, seltsame und, sagen wir mal, weniger schöne Erlebnisse gehabt habe, die viele meiner damaligen Sichtweisen erschüttert und mich nachhaltig geprägt haben.
Aus mir ist ein anderer geworden. Jetzt bin ich Pattwóŗ von Wadŗán vom Clan der Wadŗáns und möchte nun, da ich kurz vor der Erfüllung meines Schwures stehe und die Zeit meiner Rache gekommen ist, die Geschichte meiner Kindheit und Jugend erzählen.
Meine Eltern lernten sich während ihres Studiums an der Harvard University kennen. Dad war Ingenieur und beschäftigte sich mit dem Design neuartiger Materialien, deren Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten in komplexen Systemen. Nach seiner Promotion erbte er Grandpas Konzern samt aller Liegenschaften und Ländereien und trat an die Spitze des Wilson-Imperiums. Gemeinsam mit Mom verließ er Cambridge, Massachusetts, und ließ sich in Kansas City nieder, wo sie Wilson’s Manor bezogen – das elterliche Anwesen meines Vaters und Stammsitz unserer Familie.
Kaum angekommen, übernahm Dad die Leitung des Familienunternehmens und entband seinen älteren Bruder Matthew vom operativen Geschäft – obwohl dieser als Erstgeborener nach Familientradition eigentlich alleiniger Erbe und Konzernführer hätte sein sollen. Doch Onkel Matthew hatte sich als lebenslustiger Draufgänger ohne Gespür fürs Geschäft erwiesen und den Konzern beinahe in den Ruin getrieben. Wohl deshalb entschied sich Grandpa, mit der Tradition zu brechen, und setzte Dad kurz vor seinem Tod testamentarisch als Alleinerben ein. Onkel Matthew wurde mit unserem Anwesen in Palm Beach und einem zweistelligen Millionenbetrag abgefunden.
In seiner neuen Rolle als Konzerndirektor erschloss mein Vater neue Geschäftsfelder, strukturierte das Unternehmen grundlegend um und formte es zu einem modernen Hightech-Konzern. Damit brachte er das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs. Auch auf gesellschaftlicher Ebene knüpfte er wichtige Kontakte zu Politik, Wirtschaft und Militär, die ihm zusätzlichen Auftrieb verliehen.
Meine Mutter war promovierte Betriebswirtin, doch ihr Herz schlug für die Botanik. Schon früh entdeckte sie ihre Liebe zu Pflanzen und widmete sich während des Studiums nebenbei der Hobbybotanik. Später fand sie einen Weg, Beruf und Leidenschaft zu vereinen: Sie beteiligte sich an einem Fachbetrieb für Landschaftsgärtnerei und übernahm die Geschäftsführung. Ihr Engagement war maßgeblich für die Neugestaltung des botanischen Gartens in Kansas City.
Schon bald zählten meine Eltern zur High Society von Kansas City. Der Name Wilson hatte wieder Gewicht – und zwar weit über die Grenzen des Staates Kansas hinaus. Wir waren erfolgreich und sehr wohlhabend.
Zwei Jahre später kam ich dann zur Welt. Ich war ein sogenanntes Millenniumskind, geboren im Zeichen des Wolfes nach dem indianischen Kalender – für Astrologen ein besonderes Datum. Die Weichen waren auf kompromisslosen Erfolg gestellt, und mit meiner Geburt schien auch dem Aufstieg zur amerikanischen Musterfamilie nichts mehr im Weg zu stehen.
Dad war sogar als Kandidat für das Gouverneursamt im Gespräch. Eine politische Laufbahn hatte er jedoch nie anstrebt.
Über vierzehn Jahre hatte mein Vater das Unternehmen geleitet, als tiefgreifende Ereignisse über uns hereinbrachen und alles begann.
Am Anfang all jener Vorfälle, die das Ende unseres elitären Lebens in ausschweifendem Luxus einläuteten, stand ein gemeinsamer Spaziergang an einem Wochenende im Juni des Jahres 2012, der sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat.
Der Penn-Valley-Vorfall
»Gefahr versteinert Hasen und erzeugt Löwen.«
– Friedrich Hebbel
Es war Freitag. Mom und Dad waren früher von der Arbeit heimgekommen. Sie wollten mit mir den Nachmittag verbringen. Wir waren in den Penn Valley Park gefahren, um dort ein wenig zu wandern. Später wollten wir noch in die Stadt zu einem Italiener fahren und dort Eis essen.
Der Park war nicht nur für Touristen ein beliebtes Ausflugsziel. Auch Einheimische suchten hier Erholung, um der Hektik des Alltags zu entfliehen, mal abzuschalten und die Natur zu genießen. Die Wege waren dementsprechend belebt. Überall war das Gemurmel sich unterhaltender Personen zu hören, in der Ferne kreischten spielende Kinder, und nirgends war man wirklich allein.
Unter Natur genießen verstand ich etwas anderes, wie etwa dem Vogelgezwitscher lauschen, das Rauschen der Bäume hören, die Tiere bei ihrem Tagewerk beobachten – und das fernab von Stimmengewirr und Bewegung von umherwandernden Menschenmassen. Hier war das nicht möglich. Jedenfalls nicht zur Primetime der Outdoor-Aktivitäten. Vielleicht war ich komisch. Oder einfach nur stiller als andere Kinder.
Es war heiß, die Sonne stand in einem wolkenlosen Himmel, und selbst der Wind schien sich ausgeruht zu haben. Schon kleine Bewegungen reichten, um ins Schwitzen zu geraten. Für mich war jener Spaziergang allenfalls eine körperliche Betätigung – die lästige Pflicht, bevor es zur Kür kam. Ich wollte so bald wie möglich zur Eisdiele. Dort war es kühl, und italienisches Eis liebte ich eh.
Gerade erzählte ich Dad vom Film The Hunger Games, den ich mir am Vorabend mit meinem Freund Ronald im Kino angesehen hatte, als Mom uns plötzlich unterbrach.
»Jack, schau mal zu der Bank da drüben. Da sitzt ein Mann, der uns schon die ganze Zeit beobachtet. Besonders Wolf.«
Dad und ich blickten hinüber. Der Mann sah ungepflegt aus, ausgemergelt, seine Kleidung war schmutzig und voller Löcher. Er sah aus, als hätte er seit Monaten kein Dach mehr über dem Kopf gehabt – oder sich gewaschen. Sein strähniges, dunkelblondes Haar hing zerzaust bis zu den Schultern. Sein Gesicht war unter einem wirren, ungepflegten Bart kaum zu erkennen, und seine Haut wirkte ledrig, schmutzig – wie ein Stück altes Leder, das zu lange in der Sonne gelegen hatte. Seine Bewegungen waren langsam, fast kraftlos, wie bei jemandem, der mehr durch die Welt schlich als ging. Ich wollte ihn nicht anfassen müssen. Nicht einmal aus Versehen.
»Lass ihn doch gucken, wenn er nichts Besseres zu tun hat«, sagte Dad beiläufig. »Das ist bestimmt so ein perverser Päderast, der sich an vorbeilaufenden Kindern ergötzt. Anders kann ich mir sein Verhalten nicht erklären. Mach dir keine Sorgen, Mary-Sue. Gefährlich sind solche Leute nur für Kinder ohne Begleitung.«
Ich runzelte die Stirn und schaute zu ihm hoch. »Was ist denn ein Päderast?«
Er wandte sich mir zu und erklärte: »Jemand, der sich zu Kindern hingezogen fühlt und schlimme Sachen mit ihnen anstellt, Wolf.« Seine Augenbrauen hoben sich dabei bedrohlich.
Ich schaute wieder zu dem Mann, der sich jetzt erhob und in unsere Richtung ging.
»Der sieht aber nicht böse aus, Dad«, sagte ich.
»Das ist ja gerade das Heimtückische«, erwiderte er. »Es steht ihnen nicht auf der Stirn geschrieben. Jeder Fremde könnte einer sein. Egal ob sauber, dreckig, reich oder arm. Wenn dich also jemand anspricht und mitnehmen will – lauf weg, Wolf! Hast du verstanden?«
»Ja, Mom. Aber was ist, wenn der Mann wirklich lieb ist? Wenn er zum Beispiel Hilfe braucht?«
Dad blieb stehen, ging vor mir in die Hocke und sah mir ernst in die Augen.
»Das ist das Gefährliche, Wolf. Du kannst Menschen nicht einschätzen. Deshalb geh immer vom Schlimmsten aus. Kein Erwachsener braucht die Hilfe eines Kindes. Wenn er das behauptet, lügt er.«
Ich grinste. »Dann brauche ich am Wochenende den Tisch ja nicht mehr decken.«
Beide lachten, und Dad wuschelte mir durch die Haare.
In dem Moment trat der Mann zu uns. »Sir? Entschuldigen Sie, Sir! Ich bin obdachlos. Hätten Sie vielleicht ein oder zwei Dollar für mich?«
Eine Duftwolke aus altem Schweiß, Urin und Schmutz schlug uns entgegen. Ich verzog das Gesicht und trat instinktiv hinter Dad.
Er sah den Mann kurz an, dann sagte er: »Zwei Dollar willst du? Ich gebe dir zehn. Kauf dir was zu essen.«
Er zog eine Zehn-Dollar-Note aus der Tasche und reichte sie ihm. Der Mann wirkte überrascht – fast wie jemand, der mit Ablehnung gerechnet hatte.
Wir drehten uns um und wollten weitergehen. Doch da rief er uns wieder nach und stellte sich uns in den Weg.
»Sir, das kann ich so nicht annehmen. Lassen Sie mich dafür etwas tun.«
»Du willst arbeiten?« Dads Stimme klang nun kühler. »Dann such dir einen Job.« Er zückte eine Visitenkarte. »Montag gehst du da hin. Wir finden schon was für dich.«
Der Fremde schüttelte den Kopf. »Ich … ich möchte lieber jetzt etwas tun.«
Dad atmete tief durch. »Ich habe dir eben eine goldene Brücke gebaut. Versau dir das nicht.«
Doch der Mann wich nicht. »Ich kenne mich sehr gut mit dem Ersten Weltkrieg aus. Ich könnte … ich könnte Führungen durchs Museum machen.«
Dad schob mich unmerklich zu Mom zurück. Ich spürte, wie ihre Hand sich fester um meine schloss.
»Muss ich noch deutlicher werden!? Ich geh sicher nicht mit einem verlausten Penner durchs Memorial! Was an zieh Leine verstehst du nicht!? Rede ich Chinesisch!?«
Ich erschrak. Mein Vater konnte sehr laut werden. Und sehr bestimmt. Trotzdem blieb der Mann, wo er war.
Er sah uns an – erst Dad, dann mich. Und in diesem Moment … war da etwas Seltsames in seinem Blick.
Nicht Bedrohung. Nicht Wut. Etwas wie … Traurigkeit? Oder Erkenntnis?
Er schien innerlich zu kämpfen. Als wollte er etwas sagen, das er nicht sagen durfte. Immer wieder wanderte sein Blick zum Liberty Memorial hinüber, das zu unserer Rechten lag – groß und wie ein Radierstift in den Himmel ragend.
Ich folgte seinem Blick. Alles sah normal aus. Doch ein ungutes Gefühl breitete sich in meinem Bauch aus – wie eine Ahnung, dass etwas nicht stimmte, auch wenn ich es nicht benennen konnte.
Dann sagte der Mann leise, fast wie zu sich selbst: »Vielleicht interessiert sich ja Ihr Sohn für die Geschichte des Memorials … oder … für das, was darunter verborgen liegt.«
Seine Stimme bebte.
Und dann griff er nach mir.
Ich zuckte zurück.
»Wenn du meinen Sohn anfasst, breche ich dir sämtliche Knochen!«, fauchte Dad.
Er packte den Mann am Kragen und schleuderte ihn zu Boden.
»Du hast deine goldene Brücke gerade eingerissen. Mach, dass du verschwindest!«
Plötzlich knackte und knirschte es neben mir im Gebüsch. Äste und Zweige brachen. Erschrocken fuhr ich herum und erstarrte vor Angst. Aus dem Gebüsch stürmte ein gewaltiges, behaartes Tier, richtete sich auf und sprang in unsere Richtung. Ich riss meine Augen auf und starrte das Monstrum an. Die Kreatur war weder Mensch noch Tier. Sie besaß sowohl physische Charakteristika eines Wolfes als auch die eines Menschen. Der Kopf war wolfsähnlich, massiv und das Gebiss sehr kräftig ausgebildet. Der Körper wurde von einer mächtigen Muskulatur geformt, die unter dem dichten, schwarzen Fell deutlich hervortrat. Rote, tribalähnliche Muster, ähnlich den Tätowierungen der Maori, zierten Kopf und Körper dieses Ungeheuers. Uns attackierte ein leibhaftiger Werwolf, der meinen Vater um mehr als eine zwei Körperlängen überragte.
Entsetzt schrie ich auf.
Plötzlich knackte und knirschte es im Gebüsch neben mir. Äste brachen, Zweige wurden zur Seite gedrückt. Erschrocken fuhr ich herum – und erstarrte.
Ein gewaltiges, haariges Wesen sprang aus dem Dickicht, richtete sich ruckartig auf und raste in unsere Richtung. Mein Blick klebte an der Kreatur. Sie war weder ganz Tier noch ganz Mensch. Der Kopf – wolfs-ähnlich, massiv, mit einem Gebiss wie aus einer anderen Welt. Der Körper – von dicker, schwarzer Behaarung bedeckt und von mächtigen Muskeln durchzogen, die sich bei jeder Bewegung unter dem Fell abzeichneten. Rote, tribalähnliche Muster, wie von einem Maori-Tätowierer geschaffen, zogen sich über Körper und Schädel. Ein lebendiger Albtraum. Ein Werwolf. Und er war riesig – er überragte meinen Vater um mindestens zwei Körperlängen.
Ich schrie auf. Plötzlich wurde der Oberkörper des Wesens zur Seite gerissen – als hätte es einen Schlag getroffen. Seine linke Schulter explodierte regelrecht. Fast gleichzeitig zerriss ein scharfer Knall die Luft. Blut, Knochensplitter und Fell flogen auf uns zu. Ein wütendes Jaulen, gepaart mit tiefem Knurren, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Der Werwolf taumelte, versuchte, das Gleichgewicht zu halten, stolperte – und stürzte. Er krachte nur wenige Meter von uns entfernt auf den Boden.
Um uns herum geriet alles in Panik. Menschen schrien, rannten, rempelten sich an, stürzten. Einige fielen, wurden überrannt. Chaos brach aus. Jemand riss mich grob an meinem Arm – ich wurde aus Moms Griff gezerrt. Es tat weh, ich schrie erneut.
Vor mir tauchte das Gesicht des Obdachlosen auf – verzerrt zu einer Fratze. In seiner Hand hielt er ein Messer. Groß und bedrohlich. Er zischte wie ein Reptil, hob die Waffe und holte langsam aus. In seinen Augen lag Hass.
Gerade, als das Messer auf mich niederfahren wollte, schnellte eine Pranke heran – riesig, mit Klauen – und traf den Obdachlosen mit voller Wucht. Sein Körper wurde wie eine Stoffpuppe durch die Luft geschleudert – der Schlag war so heftig, dass er in der Mitte zerriss. Gleichzeitig riss ein weiteres Geschoss die Brust des Werwolfs auf. Ein zweiter, ohrenbetäubender Knall folgte. Ich wandte mich schreiend ab und vergrub mein Gesicht zitternd in den Armen meiner Mutter.
Blut spritzte auf den Boden, mischte sich mit Staub. Dann – ein drittes Projektil. Es schlug nur Zentimeter neben mir ein.
»Runter!«, rief Dad uns zu, warf sich gegen Mom und mich und brachte uns zu Fall. Dann sprang er in den nächstgelegenen Graben.
»Schnell! Geht hier unten in Deckung!«, rief er uns hektisch zu.
Während er Mom zu sich in den Graben zog, rollte ich mich zu ihm hinunter. Weitere Geschosse schlugen währenddessen dicht neben mir ein.
Dann wurde es still. Nur noch das Kreischen der Menschen war zu hören, das allmählich von Sirenen übertönt wurde. Ich hob vorsichtig den Kopf über den Rand des Grabens – der Werwolf war verschwunden. Nur eine Blutspur verriet, wohin er geflohen war.
Dad zog mich mit den Worten »bleib unten!« zurück in den Graben.
Endlich sah ich die ersten Polizisten. Zielstrebig kamen sie auf uns zu und sicherten die Gegend ab. Es mochten nur Minuten vergangen sein, bis sie bei uns eintrafen. Mir kamen sie vor wie Stunden.
Einer der Beamten trat an uns heran. »Kommen Sie! Alles ist gut. Sie sind in Sicherheit.«
Zögernd krochen wir aus unserer Deckung. Dad versuchte, mir mit der Hand die Augen zu verdecken, doch ich sah es trotzdem: der Platz war ein Schlachtfeld. Das Innere des Obdachlosen war auf dem Boden verteilt, seine Leiche grotesk verdreht, in zwei Hälften. Überall war Blut.
Während der Tatort abgesperrt wurde, führte uns ein Polizist fort zum Rand des Parks. Viele Menschen hatten sich dort um die Einsatzfahrzeuge versammelt – darunter Schaulustige und Reporter, die von dem Zwischenfall erfahren hatten, aber auch weitere Polizisten und medizinisches Personal.
Als wir den Platz betraten, stürmten schon die Reporter herbei und versuchten, an uns heranzukommen. Die anwesenden Polizisten scheuchten sie fort und schirmten uns ab. Aus der Ferne überschütteten sie uns mit Fragen, während wir an ihnen vorbei zu einem der Rettungswagen geführt wurden. So gut es eben ging, mied ich jeglichen Sichtkontakt zu ihnen und hüllte mich in Schweigen. Von Sanitätern wurden wir in Empfang genommen.
Ein junger Mann sprach uns an. »Hier, nehmen sie Platz. Möchten sie etwas trinken?«
»Ja, gerne. Vielen Dank«, antwortete Dad und nahm die Plastikbecher für uns in Empfang.
»Ruhen sie sich erst einmal aus. Ein Detective wird bald zu ihnen kommen und sie zu dem Vorfall befragen, wenn sie sich dazu in der Lage fühlen.«
Mein Vater nickte. »Ja, er kann kommen.«
Ich saß auf dem Boden des Rettungswagens und nippte an meinem Becher. Das Gewusel der vielen Menschen um uns herum nahm ich nicht wahr. Mein Verstand hatte sie einfach ausgeblendet, denn ich mochte mit keinem von ihnen interagieren. Die Sensationsgier der Reporter und der Schaulustigen war mir zuwider. Die einen ergötzten sich am Leid der Betroffenen und die anderen machten damit ihr Geschäft. Bad news are good news, hieß es in Medienkreisen. Weswegen wohl? Mein Kopf war leer. Mir fiel es schwer, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen, und die Ereignisse zu sortieren. Dabei war doch alles klar. Der aufdringliche Obdachlose war wegen Dads rigider Abfuhr außer sich geraten und wollte mich erstechen – womöglich im Affekt. Wir wurden aber von einem Werwolf attackiert, der ihn erschlug, bevor er mich töten konnte. Ein Heckenschütze der Polizei traf den Werwolf und vertrieb ihn, bevor er auch uns noch zerfetzen konnte.
Genauso hatten wir es zu Protokoll gegeben, als der Detective erschien und uns zu den Geschehnissen befragte. Nach der Befragung sollte noch ein Psychologe mit uns sprechen. Auf den psychologischen Beistand verzichteten wir jedoch. Wir wollten nichts mehr davon hören oder sehen – nur noch so schnell wie möglich nach Hause.
Als wir endlich daheim ankamen, war der Vorfall bereits Thema in sämtlichen Lokalsendern. Radio und Fernseher schalteten wir sofort aus und mieden das Thema, so gut es eben ging. Stattdessen versuchten wir uns mit Gesellschaftsspielen abzulenken und den Abend halbwegs normal hinter uns zu bringen. Aber meine Gedanken waren immer noch im Penn Valley Park. Ich schwitzte, und die Angst schlug mir auf den Magen. Mir war schlecht. An Essen war nicht zu denken. Ich wollte mich nur noch verkriechen. Also verabschiedete ich mich früh von meinen Eltern und ging ins Bett.
Doch ich konnte nicht schlafen. Die ganze Nacht lag ich wach – gefangen in einer rastlosen Spirale aus Angst und Verzweiflung. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich ihn wieder: den Obdachlosen mit seinem entstellten Gesicht, als hätte etwas Dämonisches von ihm Besitz ergriffen. Und dann – die Bestie. Der Werwolf. Die Art, wie er sich bewegte, wie er zuschlug, wie er den Mann zerfetzte … Es war nicht nur grausam. Es war unmenschlich.
Mein Körper zitterte, meine Gedanken überschlugen sich. Ich kannte Werwölfe nur aus Spielen und Filmen – reine Fantasiegestalten. Doch dieses Ding im Penn Valley Park war real gewesen. Ich hatte es gesehen, gehört, gespürt. Der Gestank von Blut hing mir noch immer in der Nase.
Das durfte nicht sein. Es konnte nicht sein.
Ich presste die Hände gegen meine Schläfen, versuchte, mich zu beruhigen – aber meine Gedanken rasten weiter. Wenn es Werwölfe gab – was noch? Magie? Okkulte Mächte? War all das, woran ich nie geglaubt hatte, plötzlich real?
Ich wollte das nicht. Ich wollte, dass es einfach nur ein Albtraum war. Aber die Bilder ließen mich nicht los. Es gab keine Antworten. Nur Fragen, Angst – und das Gefühl, in etwas hineingezogen worden zu sein, das ich nicht verstand.
Irgendwann, als die ersten Lichtstrahlen durch mein Fenster drangen, gaben meine Nerven nach. Erschöpft und ausgebrannt fiel ich in einen ruhelosen Schlaf.
In der Ferne hörte ich Stimmen. Sie tuschelten miteinander und wurden allmählich lauter. Ich schlug die Augen auf und fuhr hastig hoch. Gleißendes Licht blendete mich – die Sonne schien direkt durchs Fenster in mein Gesicht. Meine Augen schmerzten, und pochende Kopfschmerzen malträtierten meinen Schädel. Die Stimmen gehörten Mom und Dad. Offenbar waren sie schon unten. Ich streckte mich ausgiebig und gähnte laut. Die Nacht war viel zu kurz gewesen. Ich fühlte mich müde, abgeschlagen, und mir war übel. Der Schock über die Ereignisse des Vortags saß mir noch immer in den Knochen. Immerhin war ich beinahe von einem Obdachlosen erstochen worden – und wir alle fast von einem Werwolf erschlagen. Ein Obdachloser, der ganz offensichtlich den Verstand verloren hatte. Und ein Werwolf, der am helllichten Tag in Kansas City sein Unwesen trieb. All das widersprach meiner Erfahrungswelt. Ich hatte Angst.
Wieder hörte ich ihre Stimmen, dumpf durch die geschlossene Tür meines Zimmers. Sie schienen über etwas aufgebracht zu sein. Ich schloss die Augen, holte tief Luft und ließ sie langsam wieder entweichen, um den Druck in meinem Magen loszuwerden. Dann sah ich auf den Wecker.
Es war halb neun.
Mich durchfuhr ein Schreck.
»Mist, verschlafen! Der Unterricht hat längst begonnen! Und der Wagen wartet auch schon auf mich! Warum hat der Wecker nicht geschellt? Weswegen haben Mom und Dad mich nicht geweckt? Und warum sind sie überhaupt noch im Haus?«, fragte ich mich tadelnd, während ich hastig die Bettdecke zurückwarf.
Stöhnend sprang ich aus dem Bett und taumelte mit unsicherem Schritt aus dem Zimmer zum Bad am Ende des Flures. Ich fühlte mich wie gerädert.
›Heute muss eine Katzenwäsche reichen‹, dachte ich mir, während ich zum Waschbecken hastete.
Ich spritzte mir etwas Wasser ins Gesicht, zog eilig meine Schuluniform an und rannte dann die breite Treppe hinunter – direkt in den kleinen Salon, wo wir an Wochentagen frühstückten. Doch er war leer. Also stürmte ich weiter in die Küche und riss die Tür auf. Dort saßen Mom und Dad am Tisch und unterhielten sich.
Völlig aufgelöst rief ich: »Ich habe verschlafen!«
Verwundert sahen sie zu mir auf. Beide hatten Ränder unter den Augen und wirkten abgespannt. Offenbar hatten sie ebenfalls eine schlechte Nacht hinter sich. Sie begannen zu lächeln – ein bemühtes, aufgesetztes Lächeln. Sie waren mit den Gedanken ganz woanders, das merkte ich sofort. Und ich wusste auch, woran sie dachten.
»Und so wolltest du zur Schule gehen? Ungekämmt und mit dem Shirt auf links? Du siehst aus wie ein Schlafwolf«, spottete Dad und fotografierte mich mit seinem Smartphone. Er wollte mir Normalität vorgaukeln, um mich nicht an die Schwere der Situation zu erinnern. Schließlich war ich noch ein Kind – aber nicht dumm. Ich durchschaute das. Dennoch griff ich nach dem Strohhalm, den sie mir reichten, und spielte mit. Und man mag es kaum glauben – es tat gut.
»Och Dad!«
Grinsend ergänzte Mom: »Es ist Samstag. Du hast keine Schule. Geh und zieh dir was anderes an. Dann frühstücken wir.«
»Oh Mann!«, murmelte ich und blies meine Backen auf.
Mir hätte schon ein Licht aufgehen müssen, als ich den leeren Salon sah – denn am Wochenende frühstückten wir immer in der Küche, wenn das Hauspersonal frei hatte.
›Wie kann man nur so kopflos sein?‹, schalt ich mich selbst.
Meine Eltern trugen legere, sportliche Kleidung. Offenbar wollten sie später Tennis spielen. Auf dem Tisch lag die Kansas City Star – neben der Times Dads morgendliche Pflichtlektüre. Auf der Titelseite prangte eine reißerische Fotomontage eines Werwolfs vor dem Liberty Memorial. Groß darüber stand in roter Frakturschrift: Werwölfe in Kansas City?
Fragend sah ich meine Eltern an. »Wart ihr wegen diesem Bericht so aufgebracht? Ich habe euch schon reden hören.«
»Ja«, bestätigte Dad knapp und schob mir die Zeitung zu.
Darunter stand in kleinerer Schrift: Amoklauf im Penn Valley Park! Mann in Werwolf-Kostüm erschlägt Obdachlosen!
Für Polizei und Medien schien der Fall klar. Doch im Artikel war kaum etwas wahrheitsgemäß dargestellt. Dass mich der Obdachlose ermorden wollte, wurde ebenso wenig erwähnt wie unsere Aussage, dass es sich nicht um einen verkleideten Mann gehandelt hatte. Auch war dort zu lesen, der Schütze habe »ziellos in die Menge« gefeuert – was schlichtweg falsch war. Er hatte ganz gezielt auf uns geschossen. Um das nachzuweisen, hätte man nur einen Metalldetektor gebraucht. Außerdem wurde verschwiegen, dass der Schütze ein Polizist gewesen war. Wenn er keiner war – wer dann?
Von der schweren Verletzung des Werwolfs war ebenfalls keine Rede. Dabei hatten sich die Hinweise direkt am Tatort befunden. Als wir unsere Deckung verließen, konnten wir Blutspritzer, Knochensplitter und Fellreste der Kreatur deutlich erkennen. Doch von ihr selbst fehlte jede Spur. Sie war verschwunden – so plötzlich, wie sie gekommen war. Der Penn Valley Park bot kaum Versteckmöglichkeiten. Es war, als hätte sich das Wesen einfach aufgelöst.
Nichts davon wurde im Artikel erwähnt.
Verwirrt sah ich Dad an. »Das haben wir der Polizei so aber nicht erzählt.«
»Genau. Und deswegen haben wir uns darüber unterhalten«, bestätigte er ernst.
Ich nickte langsam und verließ die Küche. Oben zog ich mir etwas Leichtes an – es sollte über 35 Grad werden. Während ich mich umzog, kreisten meine Gedanken weiter um die Ereignisse vom Vortag. Was hatten die Menschen gesehen? Was hatten die Medien berichtet?
Ich schnappte mir mein Notebook, warf mich aufs Bett und durchstöberte das Internet. Die Berichte auf den Nachrichtenportalen unterschieden sich kaum – alle wichen stark von der Wahrheit ab. Nur auf Facebook, Instagram und Twitter fand man halbwegs echte Inhalte. Doch die Bilder waren unscharf, überbelichtet oder so schlecht, dass man kaum etwas erkennen konnte. In den Kommentaren wurden sie schnell als Fake News abgetan – als Horrorgeschichten für Werwolf-Fans. Es war bemerkenswert, wie schnell so etwas passierte. Aber wir wussten es besser.
Ich sprang vom Bett und lief mit dem Notebook in die Küche zurück. Mom hatte inzwischen gedeckt. Pfannkuchen mit Honig und ein großer Becher Kakao warteten auf mich. Ich setzte mich und schob meinen Eltern das Notebook zu.
»Schaut euch das mal an. Das habe ich im Netz zu gestern gefunden.«
Sie überflogen die Seiten flüchtig, während ich den ersten Pfannkuchen verschlang.
Schließlich meinte Dad: »Das sieht stark nach einer Vertuschung aus. Aber das war zu erwarten.«
»Was soll denn vertuscht werden, Dad? Die Existenz des Werwolfs? So einfach?«, fragte ich.
Beide schüttelten die Köpfe, und Dad antwortete: »Selbst wenn – ich würde die Existenz eines Werwolfs auch geheim halten. Allein, um eine Massenpanik zu verhindern. Aber ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Überleg doch mal: Wenn der Werwolf das Ziel des Heckenschützen war, warum schoss er dann noch auf uns, als das Wesen längst verschwunden war?«
Er beugte sich vor. »Und warum steht in keinem Bericht, dass die Polizei Heckenschützen eingesetzt hat? Das hätten die Medien doch nie verschwiegen. Warum also war überhaupt ein Scharfschütze dort? Ich glaube nicht, dass der Werwolf das eigentliche Ziel war – sondern wir.«
Mom starrte ihn fassungslos an und schüttelte den Kopf. »Wenn wir das Ziel waren – wie passen dann der Obdachlose und der Werwolf ins Bild?«
»Das weiß ich nicht«, erwiderte Dad nachdenklich. »Noch nicht. Aber ich kenne ein paar Leute, die bei der Aufklärung helfen könnten.«
»Aber warum sollte uns jemand töten wollen, Dad?«, fragte ich entsetzt.
»Wolf, deine Mom und ich sind in der Geschäftswelt erfolgreich. Und dort geht es mitunter hart zu. Der Erfolg des einen ist oft der Misserfolg des anderen. Und je höher du steigst, desto mächtiger werden deine Feinde. Es ist wie Krieg – und Geschäfte sind wie Schlachten.«
Ich nickte langsam und bemerkte: »Wie in der Schule. Da gibt’s auch ein paar, die mich nicht leiden können, weil ich gute Noten schreibe. Die mobben mich.«
»Ja, genau so«, meinte Dad.
»Wer denn?«, fragte Mom empört.
»John Ashley und seine Kumpane.«
»Davon hast du mir nie erzählt!«, rief sie erschüttert.
»Weil es nichts Besonderes ist. Die mobben auch andere – mich nur besonders gern.«
»Und warum?«, fragte sie und zog die Brauen hoch.
»Weil Granny Indianerin ist. Weil ich braune Haut und schwarze Haare habe – weil ich indianisch aussehe.«
Wut flackerte in Moms Augen. »Rassistisch motiviertes Mobbing an der Pembroke Hill School? Wir zahlen ein Vermögen! Das bleibt nicht ohne Konsequenzen!«
»Mom, bitte nicht!«, rief ich. »Das macht alles nur schlimmer! Dann denken die, ich sei ein Muttersöhnchen, das seine Probleme nicht allein lösen kann. Ich komme klar. Die sind alle Weicheier.«
»So, Weicheier? Wer sagt denn so was?«, fragte sie schmunzelnd.
»Ronald, Mom. Er sagt, Leute, die nur reden und nichts machen, sind Weicheier.«
»Treffend«, warf Dad ein.
»Jack!«, rief Mom empört.
»Was denn?«, fragte er mit einem schelmischen Grinsen und zwinkerte mir zu.
Mom schüttelte den Kopf. »Typisch Männer! Aber ich verstehe das, Wolf. Wenn es schlimmer wird – dann sag Bescheid, okay?«
Ich nickte.
»Gut. Dann ist das ja geklärt«, meinte Dad und erhob sich. »Ich muss ein paar Telefonate führen.«
Mit diesen Worten griff er zum Handy und verließ die Küche.
Gegen Mittag klingelte es an der Tür.
Mom öffnete und führte einen Mann ins Foyer. Freundlich bat sie ihn, dort einen Moment zu warten. Während sie zu Dad ins Büro ging, nahm der Fremde in einem der Cocktailsessel Platz.
Er war mittelgroß, durchtrainiert und an mehreren Stellen tätowiert. Besonders fiel mir ein Motiv auf der Innenseite seines rechten Unterarms ins Auge: ein Jagdmesser, das den Schriftzug Semper Fidelis teilweise überdeckte – geschrieben in Frakturschrift. Seine Haare waren extrem kurz geschnitten und hellblond, seine Augen stachen in stahlblau hervor. Er sah sich aufmerksam um.
Der in hellen Farben gehaltene Eingangsbereich schien ihn zu beeindrucken – und das zu Recht. Boden und Wände bestanden aus weiß-beigem Carrara-Marmor. In der Mitte des etwa dreieinhalb Meter hohen Raumes hing ein großer, goldener Kronleuchter mit zahlreichen Kristallglas-Applikationen. Die Stufen der breiten Treppe, auf der ich mich gerade versteckt hielt, bestanden aus schwarzem Marmor und bildeten einen eleganten Kontrast.
Als der Mann mich entdeckte, huschte ein kaum merkliches Grinsen über sein Gesicht – er sagte aber kein Wort.
Er war der klassische Söldnertyp, wie man ihn aus Actionfilmen kennt. Ich hatte ihn hier noch nie gesehen und hoffte, es würde auch bei diesem einen Besuch bleiben. Mir war er vollkommen unsympathisch. Ich fragte mich, woher Dad so jemanden kannte.
Als Dad erschien, stand der Fremde auf, lächelte und begrüßte ihn. Gemeinsam verschwanden sie im Büro. Kaum hatte Dad die Tür hinter sich geschlossen, schlich ich mich neugierig heran, um zu lauschen. Ihre Stimmen waren durch die geschlossene Tür nur gedämpft zu hören. Es war mühsam, überhaupt etwas zu verstehen. Doch einzelne Wortfetzen drangen zu mir durch – es ging offenbar um die gestrigen Ereignisse und um Software.
Eigentlich sollte ich nicht an Türen horchen, das gehört sich nicht. Aber dieser Mann war mir suspekt, und ich wollte wissen, was Dad mit so einem Typen zu besprechen hatte. Mehrmals sah ich mich mit flauem Gefühl im Magen um. Wenn ich erwischt würde, gäbe es Ärger.
Nach einer Weile wandte ich mich ab und ging zur großen Treppe. Ich hatte genug gehört. Es war besser, auf mein Zimmer zu gehen.
Gerade als ich die Stufen emporstieg, öffnete Dad die Tür und rief: »Mary-Sue, Wolf, kommt bitte zu mir!«
»Ja, Dad, ich komme«, antwortete ich und kehrte um.
Mom kam aus der Bibliothek, und gemeinsam betraten wir das Büro. Der Fremde saß am Schreibtisch meines Vaters, vor sich ein aufgeklapptes Notebook. Dad stand neben ihm.
»Das ist Mr. Marcus Russle, Inhaber der Alpha-Securitas INC«, stellte Dad ihn vor. »Marcus, das ist meine Frau Mary-Sue, und das ist mein Sohn Wolf.«
Der Mann erhob sich, nickte uns zu. »Ma’am. Wolf.« Dann setzte er sich wieder und wandte sich erneut dem Notebook zu. Offenbar waren er und Dad alte Bekannte – sonst hätte Dad ihn wohl kaum beim Vornamen genannt.
Ich umrundete den Schreibtisch und spähte neugierig auf den Monitor. Auf dem Display war eine dreidimensionale Karte des Parks zu sehen. Darauf waren die Positionen aller Beteiligten zum Zeitpunkt des ersten Schusses markiert.
Mr. Russle erklärte, laut Polizeiangaben habe sich der Schütze auf dem Dach des National World War I Museums positioniert. Dort habe man ein Scharfschützengewehr und den zerfetzten Leichnam des Täters gefunden.
Er markierte die Position des Schützen und die des Werwolfes und zog eine Gerade. So wurde die Flugbahn des Projektils sichtbar. Laut der Rekonstruktion hätte die Kugel meinen Kopf durchschlagen, wenn sie nicht zuvor die Schulter des Werwolfs getroffen und dadurch ihre Bahn verändert hätte.
Ich wäre also beinahe erschossen worden. Entsetzt öffnete ich den Mund und suchte den Blick meiner Eltern.
Es war ein Schock. Schließlich wird man nicht jeden Tag so schonungslos mit der Möglichkeit des eigenen Todes konfrontiert. In meinem damaligen Alter erschien das Leben selbstverständlich und unzerstörbar. Diese Illusion wurde mir in diesem Moment genommen.
»Wo sind die anderen Projektile eingeschlagen?«, fragte Dad.
Der Söldner klickte durch einige Menüs im Programm. Vier weitere Marken erschienen auf dem Display. Sie bildeten eine Linie – vom Weg bis zu dem Graben, in den ich mich gerollt hatte.
»Genau dort entlang ist Wolf doch in Deckung gegangen«, stellte Dad fest.
»Sir, das ist ein eindeutiges Schussmuster«, antwortete Mr. Russle. »Der Heckenschütze hatte es offenbar auf Ihren Sohn abgesehen.«
Mom und Dad sahen sich entsetzt an, während mir heiß und kalt zugleich wurde.
Das gestrige Geschehen erschien plötzlich in einem ganz neuen Licht. Die Intention des Obdachlosen blieb gleich, doch sie musste nicht mehr aus dem Affekt entstanden sein.
Wenn beide – der Obdachlose und der Schütze – auf meinen Tod aus waren, dann war es naheliegend, dass sie zusammenarbeiteten. Der Obdachlose sollte uns in ein Gespräch verwickeln, um dem Heckenschützen ein ruhiges Ziel zu liefern. Als der Schuss sein Ziel verfehlte, griff er zum Messer. Ganz klar – sie waren ein Team. Und wo ein Team agierte, da gab es vermutlich auch einen Auftraggeber.
Wer wollte mich tot sehen? Und wie passte der Werwolf in dieses Bild? Er hatte den Obdachlosen erschlagen, als dieser mich töten wollte. War er etwa zu meinem Schutz erschienen? Hatte er sich absichtlich in die Schussbahn geworfen?
Auf seinem Weg zu uns hätte er auch leichtere Opfer wählen können. Warum also dieser Sprung?
Wenn er wirklich die Kugel abfangen wollte, musste er vom Schützen gewusst haben.
Hatte er vielleicht auch den Heckenschützen getötet? Die Umstände seines Todes sprachen dafür.
Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr Fragen taten sich auf. Dad hatte recht – beim Penn-Valley-Vorfall passte nichts zusammen. Es sei denn, Menschen hätten sich gegen uns verschworen und Werwölfe versuchten, uns zu schützen – ein absurder, beinahe surrealer Gedanke.
»Was für ein Perverser trachtet nach dem Leben eines Schuljungen?«, empörte sich Dad.
Der Söldner antwortete kühl: »Meistens Angehörige mafiöser oder politisch motivierter Organisationen – oder Verwandte, die sich durch den Tod des Jungen einen Vorteil erhoffen.«
»Mit solchen Leuten habe ich nichts zu tun. Und für meine Familie verbürge ich mich!«, entgegnete Dad scharf.
Er stand auf, nahm ein Kuvert aus dem Schreibtisch und überreichte es Mr. Russle.
»Ich danke dir für deine Informationen. Halte weiterhin die Augen offen und erledige das wie besprochen.«
»Es wird erledigt, Sir. Danke, Sir.«
Der Fremde stand auf, klappte sein Notebook zu, verstaute es in einer Tasche und nickte meinen Eltern zum Abschied zu. »Ma’am. Sir.« Dann verließ er die Villa.
Mom sah Dad fragend an. »Was soll er erledigen, Jack?«
»Dinge, über die man besser nicht spricht. Besser, du weißt es nicht«, antwortete er knapp.
An die Einzelheiten der nachfolgenden Geschehnisse kann ich mich nur noch bruchstückhaft erinnern. Vielleicht habe ich manches verdrängt. Vieles wurde mir aber auch bewusst vorenthalten – angeblich, um mich zu schützen. Offenbar waren meine Eltern der Meinung, dass ein Zwölfjähriger noch nicht bereit sei für die ungeschönte Realität. Dabei hatte ich ihre hässliche Fratze längst gesehen. Das von Hass verzerrte Gesicht des Obdachlosen hatte sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Der Tod selbst hatte fortan ein Gesicht – ein wahres.
Der abrupte Wandel des Obdachlosen – von einem aufdringlichen, doch harmlos wirkenden Mann zu einer dämonisch-bösartigen Bestie – erschütterte mein Grundvertrauen in andere Menschen nachhaltig und raubte mir die kindliche Unbeschwertheit. Wenn meine Eltern Besuch empfingen, hielt ich mich fortan im Hintergrund. Ich trat Fremden nicht mehr offen entgegen, sondern beobachtete sie misstrauisch aus der Ferne. Berührungen ließ ich gar nicht mehr zu.
Die Wochen vergingen, und allmählich legte sich die Aufregung um den Vorfall. Auch von dem Söldner hörten wir kaum noch etwas. Einmal rief er Dad an und teilte ihm mit, dass er nichts herausfinden konnte. Entweder wussten die Behörden selbst nichts – oder sie mauerten. Beides ließ nur einen Schluss zu: Der Auftraggeber musste eine einflussreiche Position innehaben und über enorme Macht verfügen. Für mich waren das dürftige Informationen, und ich fragte mich, ob der Söldner wirklich das Geld wert gewesen war, das Dad ihm zugesteckt hatte. Dennoch deutete die Stille um ihn auf eine gewisse Entspannung hin.
Meine Eltern jedenfalls ließen sich nicht lumpen. Der Anschlag auf mich veranlasste sie, unsere Villa sicherheitstechnisch aufzurüsten. Die Alarmanlage wurde auf den neuesten Stand gebracht und direkt mit dem Kansas City Police Department verbunden. Um das Grundstück herum installierte man Bewegungsmelder, die leistungsstarke LED-Strahler aktivierten und Vorhof sowie Terrassenbereich taghell ausleuchten konnten. In puncto Sicherheit überließen Mom und Dad nichts dem Zufall.
So kehrte nach und nach eine Art Alltag zurück. Das Leben musste schließlich weitergehen. Mom und Dad widmeten sich wieder ihren geschäftlichen Verpflichtungen, und ich besuchte weiterhin die Pembroke Hill School – eine Privatschule mit Abschluss auf Highschool-Niveau. Das Thema Werwolf aber ließ mich nicht los. Ich durchstöberte das Internet nach Sichtungen und stieß auf zahlreiche Treffer. Die meisten verwiesen auf mittelalterliche Berichte über europäische Werwolf-Vorfälle. Einige wenige behandelten den Wendigo – ein bösartiges, menschenfressendes Geistwesen aus der Mythologie der Cree. Und dann gab es noch das sogenannte Furry-Fandom. Doch nichts davon passte zu meinem Werwolf.
Die europäischen Werwölfe verwandelten sich ausschließlich bei Vollmond – bei meinem Erlebnis jedoch war es Tag, und der Mond bei Weitem nicht voll. Wendigos waren geistartige Wesen. Und Furries? Nun ja … Furries schlüpften offenbar in tierische Rollen, um gesellschaftliche Konventionen abzustreifen und sich freier zu fühlen. Manche von ihnen hatten sogar mehrere sogenannte »Fursonae« – heute ein Drache, morgen ein Wolf, übermorgen ein Leopard. Eine echte, seelische Verbindung zu einem Tier sah anders aus. Doch genau diese galt als Voraussetzung, um – nach Ansicht mancher Schamanen – ein Werwolf sein zu können. Für sie war die äußere Erscheinung bloß ein Spiegel des inneren Seelenzustands. Ein Mensch konnte sich jederzeit in einen Wolf verwandeln – und wieder zurück.
Das klang wie eine plausible Erklärung für das plötzliche Verschwinden meines Werwolfs und lenkte mein Augenmerk auf eine kleine Untergruppe der Furries: die Therians. Sie sprachen von einer tiefen, seelischen Verbindung zu einem Tier, manchmal sogar zu mehreren. Oft war bei ihnen die Rede von mentalen Shifts und Tagträumen. Das alles war spannend – brachte mich aber nicht wirklich weiter. Denn körperliche Transformationen erwähnte in der Szene niemand. Mein Werwolf hatte jedoch physisch geshiftet – sonst wäre er keiner gewesen.
Und doch: Im Penn Valley Park hatte offenbar keine Verwandlung stattgefunden. Der Ort war gut besucht, es hätte Zeugen geben müssen. Niemand hatte aber von einer Rückverwandlung berichtet – oder von einem nackten, verletzten Mann, der geflüchtet war. Das Wesen blieb ein Mysterium.
Doch das sollte nicht meine einzige Begegnung mit einem Werwolf bleiben. Wenige Wochen später begegnete mir ein weiterer – und diese Begegnung sollte mein Leben verändern.
Es geschah an einem Spätsommerabend desselben Jahres in einem »Lost Place« – einem halb zerfallenen Haus in einer einsamen Sackgasse am Rand eines Vororts von Kansas City, unweit unserer Villa. Was sich dort zutrug, entzog mir das letzte Quäntchen Vertrauen in meine Mitmenschen – und führte zu einer radikalen Wende in meinem Leben.
Das verfallene Haus
»I know a place where no one's lost
I know a place where no one cries
Crying at all is not allowed
Not in my castle on a cloud.«
– Jean-Claude Jos
Es war später Nachmittag. Ich war gerade heimgekommen und hatte meine Schuluniform gegen einen schwarzen Freizeitanzug getauscht. Üblicherweise saß ich dann in meinem Zimmer vorm Rechner, brütete über Programmcode oder recherchierte im Web. An diesem Tag jedoch wollte ich mir die Zeit mit einem neuen Rollenspiel vertreiben. Ich hatte es einige Tage zuvor bestellt, und nun war es endlich geliefert worden.
Ich legte die DVD ins Laufwerk und startete die Installation.
Unten klingelte es an der Tür. Kurz darauf klopfte es an meiner Zimmertür.
»Ja bitte!«, rief ich.
Die Tür öffnete sich, und unser Butler, Mr. James Hunter, trat ein. Er war schon seit vielen Jahren in unserem Dienst – ein fester Bestandteil unseres Haushalts und fast schon ein Teil der Familie. Ich war quasi mit ihm aufgewachsen. Was er zuvor gemacht hatte, wusste ich nicht genau. Ich meine mal gehört zu haben, dass er einst Soldat war. Gefragt hatte ich ihn jedoch nie.
Ich wandte mich ihm zu und sah ihn fragend an. »Ja?«
»Ronald O’Kinsey wartet im Foyer. Werden Sie ihn empfangen, Mr. Wilson?«
»Ja, das werde ich, James. Ich hole ihn selbst. Danke«, antwortete ich, sprang auf und lief aus meinem Zimmer.
Ronald O’Kinsey war ein Straßenjunge aus ärmlichen Verhältnissen, der jedoch über eine gute Kinderstube verfügte und Manieren besaß. Ich glaube, dass Mom und Dad mir deshalb – trotz der sozialen Stellung seiner Familie – den Umgang mit ihm gestatteten. Außerdem war er mir gegenüber absolut loyal und wusste sich zu verteidigen. Er würde mir immer beistehen. Vor allem aber war Ronald mein bester Freund.
Oben auf der Veranda blieb ich stehen und sah zu ihm hinunter. Er saß entspannt in einem der Cocktail-Stühle und wartete auf mich.
»Ronald, komm hoch! Ich installiere gerade ein neues Spiel. Du wirst es bestimmt mögen«, rief ich, während James an mir vorbeiging und wieder die Treppe hinabstieg.
Lächelnd sprang Ronald auf und eilte neugierig die Stufen hinauf. Mein Freund war eine imposante Erscheinung. Mit fünfzehn Jahren war er bereits einen Kopf größer als Mom und beinahe so groß wie Dad. Seine roten, lockigen Haare und das Gesicht, übersät mit Sommersprossen, ließen ihn aussehen, als hätte er einen Ausschlag. Ansonsten war er so bleich wie ein Vampir, obwohl er viel Zeit im Freien verbrachte.
Im Gegensatz zu ihm hatte ich durch meine indianische Abstammung einen deutlich dunkleren Teint. Während ich in der Sonne noch brauner wurde, reagierte seine Haut höchstens mit einer leichten Rö-tung. Wahrscheinlich hatte er irische Vorfahren – sein Familienname O’Kinsey sprach jedenfalls dafür.
»Was hast du dir denn an Land gezogen?«, fragte er, als er mich erreicht hatte.
Ich führte ihn in mein Zimmer. »Du wirst es gleich sehen.«
Als wir uns dem Monitor näherten, jauchzte er begeistert auf. Seine Augen begannen zu leuchten.
»Boah! Du hast dir wirklich Skyrim besorgt?«
»Ja, ist heute geliefert worden.«
»Du weißt ja hoffentlich, dass es nur eine Rasse gibt, mit der man das spielt«, meinte er grinsend.
Schmunzelnd entgegnete ich: »Du wirst es mir bestimmt gleich zeigen.«
Wir setzten uns und starteten das Spiel. Den Charakter-Editor hatten wir schnell hinter uns gebracht. Ronald wählte einen Khajiit – eine katzenartige Spezies – und gestaltete seine Spielfigur so muskulös und imposant wie möglich. Schon befanden wir uns mitten in der ersten Quest.
Nach einer Weile speicherte er den Spielstand und beendete das Programm.
Verwundert sah ich ihn an. »Was ist los, Ronald? Gefällt dir das Spiel etwa nicht?«
»Doch, doch. Skyrim ist großartig. Eigentlich hatte ich heute nur etwas anderes mit dir vor. Wir können ja später weiterspielen.«
Ich seufzte, sah auf den Monitor und startete erneut den Launcher. Ich verstand ihn nicht. Monatelang hatte er mir von diesem Spiel vorgeschwärmt, weil er es unbedingt spielen wollte, es sich aber nicht leisten konnte. Und jetzt, wo ich es endlich hatte, wollte er etwas anderes machen? Begeisterung sah anders aus.
»Was möchtest du denn stattdessen machen?«, fragte ich enttäuscht.
»Sieh mal – wir haben so einen schönen Tag. Viel zu schade, um im Haus zu vergammeln. Mir steht der Sinn mehr nach Bewegung.«
Ich verzog das Gesicht. »Wirklich? Es ist doch viel zu warm, und die Sonne brennt. Du bekommst bestimmt wieder einen Sonnenbrand. Wär ja nicht das erste Mal.«
Er grunzte und winkte ab.
»Okay, wenn du unbedingt raus willst, könnten wir auch in den Pool gehen und ein bisschen schwimmen«, schlug ich vor.
»Nein, ich hab keine Badesachen dabei – dafür aber mein Fahrrad.«
»Das ist eine sehr gute Idee«, ertönte es aus dem Flur.
»Och, Mom! Lauschst du etwa?«
»Nein, ich bin nur zufällig hier oben«, sagte sie und schob die Zimmertür auf. Auffordernd sah sie mich an. »Etwas Bewegung wird dich schon nicht umbringen, Wolf. Ganz im Gegenteil. Wir haben dir das Rennrad nicht gekauft, damit es im Schuppen verstaubt. Also los – schnapp dir dein Rad und raus mit dir!«
Stöhnend gab ich mich geschlagen. Zusammen mit Ronald verließ ich das Haus und wir gingen zum Schuppen.
»Wo willst du überhaupt mit mir hin?«, fragte ich ihn lustlos und nahm mein Rennrad vom Haken.
»Da fällt uns bestimmt etwas ein. Du wirst schon sehen, das macht Spaß«, antwortete er und klopfte mir auf die Schulter.
Wir stiegen auf unsere Räder und fuhren los.
Seit einigen Stunden waren wir unterwegs. Unsere Fahrt hatte uns in die Vororte von Kansas City geführt, etwa zehn Meilen von unserer Villa entfernt. Wir waren kreuz und quer durch die Siedlungen geradelt, hatten versteckte Wege erkundet, die nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad passierbar waren. Inzwischen neigte sich die Sonne dem Horizont zu. Die Straßen lagen bereits im Zwielicht, und es war spürbar kühler geworden. Eigentlich war es höchste Zeit für mich, den Heimweg anzutreten. Seit dem Vorfall im Penn Valley Park erlaubten mir meine Eltern nicht mehr, das Anwesen allein zu verlassen – schon gar nicht nach Sonnenuntergang. Es sei denn, Ronald begleitete mich.
Ich war außer Atem, durchgeschwitzt, und mein Körper schrie nach einer Pause. Ein Muskelkater am nächsten Tag war mir gewiss. Keuchend blieb ich stehen.
»Ronald, halt! Es reicht! Ich hab keine Lust mehr!«
Sofort wendete er sein Rad und kam neben mir zum Stehen. Im Gegensatz zu mir schien er kaum erschöpft. Allenfalls ein paar Schweißperlen glänzten auf seiner Stirn. Kein Wunder bei dieser brütenden Hitze.
»Mann, du siehst echt fertig aus, Wolf. Okay, das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Jetzt wird es langsam dunkel – das macht es noch interessanter.«
»Wovon redest du? Ist es noch weit?«, fragte ich misstrauisch.
»Nein, überhaupt nicht. Ich spreche von einer Mutprobe. Wenn du die bestehst, weiß ich, dass du kein verwöhntes Weichei bist. Wir erkunden jetzt einen Lost Place. Einen ganz besonderen Ort.«
Ich verzog das Gesicht und seufzte.
»Na komm schon, das wird spannend!«
»Okay. Aber danach fahren wir nach Hause. Wir haben eh noch einen weiten Weg vor uns.«
Ronald nickte, wendete sein Rad und trat in die Pedale. Ich folgte ihm zögerlich. In diesem Teil der Vorstadt war ich noch nie gewesen. Es war menschenleer, einige Straßenlaternen flackerten oder waren ganz ausgefallen, Müll türmte sich an den Straßenrändern. Alles sah aus, als hätte die Stadt dieses Viertel längst aufgegeben. Als wir eine Seitenstraße erreichten, flackerte die letzte Laterne über uns. Ronald bog dort ein – in eine dunkle Gasse, in der keine einzige Lampe funktionierte. Die Umgebung wirkte unheimlich. Unwohl verringerte ich das Tempo.
»Ronald! Bist du dir sicher, dass du hier durch willst?«, rief ich.
»Ja, komm schon! Wir sind gleich da. Oder bist du nicht neugierig auf ein kleines Abenteuer?«
Ich war immer für Abenteuer zu haben. Also trat ich wieder kräftiger in die Pedale. Nach etwa zweihundert Metern endete die Straße abrupt vor einem alten, halb verfallenen Gebäude, das einmal sehr imposant gewesen sein musste. Jetzt war es nur noch eine Ruine – dem Wetter ausgeliefert, überwuchert von Moos, Efeu und Pilzen. Die einstige Fassade war von der Natur zurückerobert worden, und auch das Gelände davor – vermutlich ein ehemaliger Parkplatz – war nur noch wild bewachsen.
›Das war bestimmt mal eine Pension oder ein Klubheim‹, dachte ich.
Ronald hatte keine Zeit verloren und stand bereits am Eingang. Er winkte mir zu, ich solle mich beeilen. Doch ich war völlig erschöpft, stieg vor der Treppe ab und ließ mein Fahrrad achtlos auf den Boden fallen.
»Wo bleibst du denn? Komm!« rief er.
Mit schweren Beinen quälte ich mich die Treppe hoch.
»Warum musst du … so hetzen?«, keuchte ich, während ich mir den Schweiß von der Stirn wischte. »Ich bin fix und fertig.«
Ronald grinste und wandte sich dann der schweren, morschen Eingangstür zu. Das Holz war aufgequollen, die Scharniere verrostet. Hier war schon lange niemand mehr hindurchgegangen.
›Wird die Tür überhaupt aufgehen?‹, fragte ich mich.
Ronald zögerte nicht. Mit einem kräftigen Tritt riss er die Tür einen Spalt auf. Sie knarrte laut – ich zuckte zusammen. Der Spalt war gerade breit genug, dass wir hindurchpassen konnten. Neugierig spähte ich ins Dunkel. Aber ich sah kaum etwas.
»Also«, begann Ronald, »man sagt, dass hier vier Männer ermordet wurden. Bevor sie starben, haben sie ihre Mörder – und dieses Haus – verflucht. Seitdem soll es hier spuken.«
Ich betrachtete die bemooste Fassade. Das Haus hatte wirklich etwas von einem Spukschloss. Ein kalter Schauder überlief mich. Hätte er bloß nichts gesagt.
Ronald zwinkerte. »Ich geh mal nachsehen, ob die Luft rein ist. Wenn ich in fünf Minuten nicht zurück bin, kommst du nach, okay?«
Ich sah auf meine Uhr und nickte zögerlich. »Okay.«
Er klopfte mir auf die Schulter und schlüpfte durch den Spalt. Dann war er verschwunden.
›Als hätte ihn das Haus verschluckt‹, dachte ich – und bekam sofort ein ungutes Gefühl.
›Ach was, er ist gleich wieder da. Alles halb so schlimm‹, redete ich mir ein. Doch die Minuten verstrichen, ohne dass ich ein Geräusch hörte. Nervös blickte ich auf meine Uhr. Die fünf Minuten waren längst vorbei.
›Darum heißt es Mutprobe‹, hörte ich eine Stimme in meinem Kopf. ›Aber du bist kein Mutiger. Du bist ein Weichei. Also lauf! Fahr heim!‹
»Ich bin kein Weichei!«, flüsterte ich trotzig. Dann zwängte ich mich durch den Spalt in die Dunkelheit – fest entschlossen, meinen Freund zu finden.
Es dauerte, bis sich meine Augen an das Dunkel gewöhnten. Ich sah nur wenig. Das Innere war so verwahrlost wie das Äußere. Überall lag Müll, übler Gestank hing in der Luft. Die zerstörten Türen gaben Einblick in finstere, verrottete Räume. Der Geruch von Alkohol, Urin, Schimmel und Erbrochenem war kaum zu ertragen. Ich fühlte mich schmutzig, nur weil ich hier war. Es juckte mich am ganzen Körper.
›Was kann Ronald an diesem Ort spannend finden?‹, fragte ich mich.
Jetzt war er verschwunden – und ich hatte keine Ahnung, was ihm zugestoßen war. Spaßig sollte es sein; unter Spaß verstand ich aber etwas anderes.
Mittlerweile hatten sich meine Augen vollständig an die Dunkelheit gewöhnt, und ich konnte deutlich mehr erkennen. Das Foyer, in dem ich stand, war geräumig und ungewöhnlich hoch. Auch die Türen wirkten wie aus einem Palast: riesig, schwer, kunstvoll verziert mit filigranen Intarsien. Ohne Zweifel war dies einst ein Klubhaus der High Society von Kansas City gewesen. Misstrauisch blickte ich mich nach Ronald um – doch von ihm war weit und breit nichts zu sehen.
›Vielleicht versteckt er sich nur irgendwo und lauert darauf, mich zu erschrecken‹, versuchte ich mich zu beruhigen. ›Das war schließlich die Abmachung: Ich soll ihn suchen. Das ist alles Teil der Mutprobe.‹ Doch ein ungutes Gefühl nagte an mir. So lange hätte er mich normalerweise nicht im Dunkeln gelassen.
In der hinteren Wand war ein großer Kamin eingelassen, darüber hing ein riesiges Ölgemälde. Es war verschimmelt, von Stockflecken übersät, die Leinwand gewellt, der Holzrahmen von tiefen Rissen durchzogen. Eigentlich nichts Besonderes – und doch packte mich ein Schauder, als ich das Motiv erkannte: ein alter, weißhaariger Mann im Smoking, die Hände lässig in den Hosentaschen. Der Ausdruck seines Gesichts war herablassend, der Blick durchdringend. So ließ sich nur jemand porträtieren, der wusste, dass ihm niemand widersprechen würde.
Mir war der Mann auf Anhieb unsympathisch. Er wirkte unheimlich, fast so, als würde er jeden Moment aus dem Bild springen.
›Die Hände in den Hosentaschen – das sollte wohl cool wirken. Aber wer weiß, was er da versteckte. Wahrscheinlich vier tote Präsidenten‹, dachte ich zynisch.
Unter dem Gemälde entdeckte ich eine bronzene Tafel, angelaufen und verdreckt. ›Da steht doch etwas drauf‹, stellte ich fest. Die Inschrift war kaum sichtbar. Mit den Fingernägeln kratzte ich den gröbsten Schmutz weg. Die Inschrift war immer noch kaum zu lesen und die widrigen Lichtverhältnisse machten es auch nicht einfacher sie zu entziffern. Mit Mühen gelang es mir dennoch: Christopher Austin Wilson.
›Mein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater? Der Gründer des Wilson-Imperiums?‹, stellte ich verblüfft fest und fragte mich, was das Gemälde hier, in diesem Klubhaus machte, in welcher Beziehung Christopher Austin zu dieser Einrichtung stand, dass sein Portrait in Überlebensgröße hier, über dem Kamin, thronte? Konnte es sein, dass dieses Landhaus einst im Besitz unserer Familie gewesen war? Dad hatte mir von ihm erzählt – von seiner Rücksichtslosigkeit und dem Gerücht, er habe sogar vor Mord nicht zurückgeschreckt, um seine Ziele zu erreichen. In unseren Familienalben fand sich kein einziges Bild von ihm. Man hatte sie alle entfernt. Jetzt, da ich sein Konterfei erstmalig sah, verstand ich warum. Der Maler hatte den finsteren Charakter dieses Mannes meisterhaft eingefangen und in Öl festgehalten.
Plötzlich schienen seine Augen für einen kurzen Moment aufzuglimmen. ›Ein Lichtreflex?‹, schoss mir durch den Kopf. Dann knarrte eine Tür, gefolgt von einem unheimlichen Summen. Erschrocken wirbelte ich herum. Mein Blick fiel auf eine breite Marmortreppe, die vom Keller bis ins oberste Stockwerk führte. Langsam schlich ich los, mein Blick haftete an den schmutzverkrusteten Stufen. Seltsame Geräusche drangen aus dem Gemäuer, ließen mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Verängstigt sah ich mich noch einmal zu dem Gemälde um. Es hätte mich nicht gewundert, wenn mein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater aus ihm herausgestiegen wäre, um sein Unwesen zu treiben. Meine Nerven lagen blank.
»Wolf, das sind irrationale Gedanken! Komm wieder runter!«, ermahnte ich mich.
Wieder ein Knarren – diesmal aus dem Keller, als würde dort jemand Türen öffnen und schließen. Ich zuckte zusammen. Da schlich doch jemand herum. Ob es Ronald war? Ich schlich weiter heran und wagte einen Blick hinunter, konnte aber nichts erkennen. Unten lag alles in Dunkelheit. Keine zehn Pferde hätten mich dorthin gebracht.
Oben war es etwas heller – schwaches Licht fiel durch die zerbrochenen Fenster, ließ Umrisse erkennen. Der Wind pfiff durch die Ritzen im Gemäuer und erzeugte das typische »Woohoo«, das man mit Geistern in Verbindung brachte. Ich versuchte, mich an der Vernunft festzuhalten. Natürlich war das alles nur der Wind. Und doch war mein Herz anderer Meinung.
Ich zwang mich dazu, weiterzugehen. Ronald könnte irgendwo liegen, verletzt, hilflos – und ich war der Einzige, der ihm helfen konnte. Mit klopfendem Herzen setzte ich den Fuß auf die erste Stufe. Der Schweiß brach mir aus, mein Puls raste.
Plötzlich knackte es hinter mir – Holz, das unter schwerem Gewicht ächzte. Ich erstarrte. Da war jemand … oder etwas. Das Geräusch kam aus dem Nebenraum. Es klang, als würde ein sehr schwerer Mann über knarrende Dielen gehen.
Das konnte nicht Ronald sein. Er war leicht und beweglich. Ich lauschte, wagte kaum zu atmen. Die Tür zum Nebenraum war angelehnt. Ich schlich näher. Als ich sie vorsichtig aufzog, knarrte sie laut. In der Sekunde polterte es im Zimmer – jemand oder etwas hatte etwas umgestoßen!
Eisige Furcht griff nach mir. Ich wollte nur noch weg. Das hier war kein Abenteuer mehr. Ich hatte genug Mut bewiesen. Mir war, als würde mir der kalte Atem eines Geistes über den Nacken streichen. Dann knirschte etwas direkt hinter mir.
Ich wirbelte herum – und stand einer dunklen Gestalt gegenüber. War es etwa mein Urahn, der nun doch aus dem Gemälde gesprungen war? Ein Schrei entrang sich meiner Kehle. Ich wollte fliehen, doch eine Hand griff nach meinem Arm und hielt mich fest.
»Wow-wow-wow! Ich bin’s doch – Ronald!«, sagte er hastig und packte mich am Kragen. Als sich sein Gesicht ins Licht drehte, erkannte ich ihn endlich. Es war wirklich Ronald, und er grinste breit.
Erleichtert schnaufte ich auf und gab ihm einen Hieb gegen die Schulter – nicht ganz freundschaftlich, denn ich war erbost. »Puh, du hast mir einen ganz schönen Schreck eingejagt. Wie kannst du mich nur so lange im Ungewissen lassen!? Ich habe mich um dich gesorgt!«
Ronald zuckte mit den Schultern. »Du bist eben ein ängstliches Weichei.«
»Bin ich nicht!«, fuhr ich ihn an und stieß ihn zurück.
Für einen Moment stand er einfach nur da und grinste. Doch irgendetwas an seinem Blick ließ mich innehalten.
»Du warst das doch mit dem Knarzen vorhin, oder?« fragte ich langsam.
Ronald hob eine Augenbraue. »Welches Knarzen?«
Ich schluckte. »Das Knarren … als ob jemand Türen geöffnet hätte. Unten im Keller. Ich hab’s ganz deutlich gehört.«
Ronald sah mich ruhig an. »Ich war die ganze Zeit hier. Hielt mich versteckt und hab dich beobachtet.«
»Wirklich?«
Er grinste wieder, aber diesmal wirkte es irgendwie gezwungen. »Klar. Was sonst? Ich lass dich an so einem Ort doch nicht alleine.«
Ich sagte nichts. Meine Gedanken überschlugen sich. Vielleicht log er. Aber warum sollte er? Er war stets zu mir ehrlich gewesen. Vielleicht hatte ich mir alles auch nur eingebildet. Oder vielleicht … war ich gar nicht allein gewesen, bevor er auftauchte.
Ich wagte einen letzten Blick zurück zur Tür. Sie stand noch halb offen. Dahinter nur Dunkelheit.
Ronald trat neben mich. »Du guckst, als hättest du einen Geist gesehen.«
»Das habe ich vielleicht auch«, entgegnete ich ihm und schielte kurz zum Portrait meines Ur-Ur-Ur-Urgroßvaters. Dann sah ich wieder Ronald an und zwang mich zu einem Lächeln. Aber in meinem Hinterkopf nagte es: ›Wenn Ronald das nicht war … wer dann?‹
Ich schnaufte und versuchte meine Zweifel hinwegzuwischen. Ich wollte einfach nur weg. Ich rempelte meinen Freund freundschaftlich an. »Komm, gehen wir! Zuhause warten ein Snack und ein schönes Spiel auf uns.«
Normalerweise hätte Ronald mir freundschaftlich seine Knöchel über den Kopf gerieben und mich wegen der späten Mahlzeit aufgezogen. Doch er erstarrte, sein Blick war auf einmal leer, seine Augen weiteten sich. Ich zuckte zusammen. In ihnen lag etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Worauf starrte er nur? Ich sah mich um, konnte aber nichts hinter mir erkennen. War das nur ein makabres Schauspiel, um mich zu triggern, oder war etwas Böses in ihn hineingefahren? Ich erkannte ihn nicht wieder.
Ich versuchte lässig zu wirken und frotzelte: »Was ist los, Ronald? Da ist nichts. Wer ist hier nun das Weichei?«





























