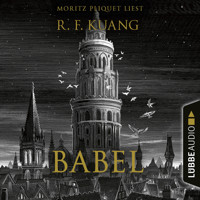6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
In Armut geboren, als Sklave gedient, als Gladiator gekämpft, und als Yborianer geächtet – Wulferans Leben war bisher hart, entbehrungsreich und hat ihn zum Verbrecher werden lassen. Die Halbelbenzauberer haben den berüchtigten und genialen Großmeister im Zirkel der Jagd, Tyronnimus Tarlin, auf ihn angesetzt. Wulferan gelingt einmal mehr die Flucht, aber ihm wird bewusst, dass es so für ihn nicht weitergehen kann. Lang hat er mit allem gehadert, nun kreisen Fragen in seinem Kopf. Widerfuhr ihm jeder Schicksalsschlag aus einem triftigen Grund? Gibt es eine Aufgabe, für die er vorbereitet wird? Schon zu Beginn von Wulferans Suche nach seiner Bestimmung ist eines klar: Ohne Veränderung ist sein Leben verwirkt. Seine Vergangenheit aber lässt sich nicht so einfach abschütteln …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 607
Ähnliche
Kilian Braun
Wulferan
Der dunkle Held
Roman
Prolog
Legendär. Mühsam schleppte ich mich vorwärts. So hatten sie mich genannt: legendär. Ich bin schon vieles geheißen worden, aber das konnte ich ruhig als Kompliment verstehen. Sie fürchteten und sie hassten mich, was auf Gegenseitigkeit beruhte. Dass der Weg zum Galgen kein leichter Gang ist, müsste jedem schon bei der bloßen Vorstellung klar sein. Ich durfte mich dessen gerade in Wirklichkeit überzeugen und quälte mich, geleitet von vier Ordenskriegern der Arasti, mit schmerzenden Schritten voran. Für einen verächtlichen Seitenblick aus halb zugeschwollenen Augen reichte die Kraft noch. Ich sollte diese Mistkerle … Nein. Zorn war der falsche Weg. Sie machten nur ihre Arbeit, ich war hier das Problem. Wenigstens war ich zu schwach, um mich vor dem Ende zu fürchten, wollte es jetzt einfach nur noch hinter mich bringen. Normalerweise weiß niemand, wann einen der Tod ereilt, ich aber konnte es beinahe schrittgenau sagen. So hatte ich mir das sicherlich nicht vorgestellt. Was war schiefgegangen? Wo war ich im Leben falsch abgebogen? Genauer gesagt: Wo war es das eine Mal zu viel? Bei so viel Mist, der mir passiert ist, frage ich mich ernsthaft, ob ich je eine Chance auf ein normales Leben hatte. Vermutlich nicht. Eigentlich war das für mich nie vorgesehen. Ich schlurfte weiter, während sich meine Augen mit Schweiß und Tränen füllten. Wenn ich ehrlich war, und es gab keinen Grund mehr sich selbst zu belügen, hätte ich das gerne gehabt, ein normales Leben. Ehrliche Arbeit, eine hübsche Frau und eine Schar Kinder um mich herum. Es blieb ein Traum.
Die Menge johlte und jubelte, es musste ohrenbetäubend sein, doch ich befand mich in meiner eigenen Welt, nahm davon nur wenig wahr. Unter den Zuschauern konnte ich immer wieder die hochgewachsenen Qel’tar in ihren feinen Roben entdecken. Für gewöhnlich überließ dieses hochnäsige Pack solche Spektakel einfachen Bürgern. Aber bei mir machten sie eine Ausnahme. Ich hatte mir auch alle Mühe gegeben, mir seit meiner Flucht vor fünf Jahren einen schlechten Ruf zu erarbeiten. Niemand hat es verdient, versklavt zu werden! Niemand hat es verdient, nur wegen seiner Abstammung diskriminiert zu werden. Das wollte ich diesen Mistkerlen klarmachen – allerdings auf völlig falsche Weise. Verdammt, ich hätte das erkennen sollen, als ich noch die Gelegenheit für eine Veränderung hatte. Diesmal sah es ganz so aus, als hätten sie dazugelernt und wollten die Sache richtig machen: Kein dunkler Kerker, kein riskantes Verschiffen zur berühmt-berüchtigten Gefängnisinsel der Zauberer mehr, von der angeblich noch niemand jemals entkommen konnte. Auf mich wartete nur noch der Galgen. Trotz der Schmerzen bemühte ich mich um eine aufrechte Haltung, um dem Henker entgegenzusehen. Der blöde Hund hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, seine Henkerskapuze überzuziehen. Normalerweise verlangten es der Respekt und der Anstand gegenüber dem Verurteilten, aber bei mir … richtig, machten sie eine Ausnahme. Bedächtig schwang der sorgsam geknotete Strick unheilvoll auf der Holzkonstruktion, zu der ich mich gerade hinquälte. Schon bald würde die Schlinge unsanft um mein Genick gelegt werden, um dann mit einer Falltür für das Ende zu sorgen. Ich kannte mich nicht sonderlich gut mit derartigen Hinrichtungsmethoden aus, aber beim Tod durch Erhängen gab es nur zwei Möglichkeiten: Entweder fiel man tief genug, sodass das Genick brach und der Tod sofort eintrat, oder man baumelte eine ganze Weile und erstickte qualvoll. Ich leckte mir über die aufgesprungenen Lippen und bekam eine erste Kostprobe akuter Todesangst. Irgendwie war ich sicher, dass der Henker kein schnelles Ende eingeplant hatte.
Verflucht, war der Weg weit. Ich hatte gerade erst einmal die Hälfte bis zum Galgen geschafft und nahm vage die missmutigen Blicke der Arasti-Krieger neben mir wahr. Sie wurden langsam ungeduldig. Tja, hätten sie mich nicht halb totgeschlagen, hätte ich jetzt auch schneller gehen können. Eilig hatte ich es nicht, aber so lange ich auch brauchen würde, dort vorne wartete das Ende meines Lebens auf mich. Erhängt, wie ein lausiger Verbrecher. Das war es, was sie in mir sahen: einen Verbrecher. Meine Botschaft war nicht angekommen, das war mir jetzt auch klar. Es gibt Punkte im Leben, zu denen man gerne zurückkehren möchte, um sich anders zu entscheiden – Ich habe viele davon. Jetzt war es zu spät. Auf dem Podest meines Untergangs vollführte Tyronnimus Tarlin währenddessen eine bühnenreife Vorführung. Wir kannten uns zwar nur kurz, waren aber schon innige Erzfeinde geworden. Er untermalte meinen letzten Gang mit einer inbrünstigen Hassrede. In seiner weiten Robe, versehen mit dem Emblem des Zirkels der Jäger, stürmte der Zauberer hin und her, hob und senkte die Stimme, peitschte seinen flammenden Blick immer wieder über die Menge, die sich bereitwillig anstacheln ließ. Hinrichtungen waren ein Spektakel für Groß und Klein – vor allem bei einer Persönlichkeit wie mir.
Grob wurde ich vorwärtsgeschoben und merkte erst jetzt, dass ich stehen geblieben war. Unzählige Gesichter mit aufgerissenen Mündern und aggressiven Blicken tauchten vor meinem Blickfeld auf. Ich brachte nur noch ein halbherziges Wegdrehen und Kopfeinziehen zustande. Erbärmlich. Die Ordenskrieger hatten gut zu tun, die tobende Menge auf Abstand zu halten, damit ich weitergehen konnte. Dem Volk wurde eine Hinrichtung versprochen, sie wollten mich hängen sehen, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte, manchmal sogar noch mehr. Alle Aspekte von einer Sache zu kennen, kann eine Meinung durchaus ändern. Den Leuten hier, am Ende der Welt, war das jedoch völlig egal, solange nur jemand röchelnd sein Leben aushauchte. Das Stechen in den Rippen wurde stärker, daher war die aufrechte Haltung trotz aller Bemühungen wieder dahin. Ich keuchte und schleppte mich mit gesenktem Blick weiter. Der Tod sei nur ein Neuanfang, sagten die Gläubigen. Ich hatte gehofft, es ohne den Teil mit dem Sterben hinzubekommen.
Mein Name ist Wulferan, und das ist meine Geschichte.
Kapitel 1
Abenteurer. Sie sind zumeist jung, motiviert, mit kräftigem Körper, wachem Geist und fröhlich. Ich hasse diese Leute. Sie sind der Inbegriff eines normalen Lebens, integriert in die Gesellschaft, mit ganz gewöhnlichen Höhen und Tiefen. Sie sind das genaue Gegenteil von mir und mein Neid äußert sich als pure Verachtung.
Ich meide daher solche Kreise tunlichst, aber es bleibt mir wohl in nächster Zeit nicht viel anderes übrig, als mich mit solchen Zeitgenossen herumschlagen zu müssen. »Tapfere Abenteurer für Wüstenexpedition gesucht« hatte der Aushang gelautet. Und ich musste dringend untertauchen, aus Bralogh verschwinden. Für viele Kopfgeldjäger sind eintausend Silberstücke eine nachhaltige Motivationsquelle, ihr Glück zu versuchen. Ihr Pech war, dass sie nicht wussten, wem sie sich da an die Fersen hefteten. Vor zwei Tagen war ein junger Kerl auf mich gestoßen, als er eine Taverne überprüft hatte. Der Glücksritter hatte einen Zufallstreffer, ja, so etwas gibt es. Was dann folgt, läuft immer auf dasselbe hinaus: Für einen von beiden gibt es kein gutes Ende. Ich stand hier, er lag mit zerstochener Kehle im Leichenschauhaus, also war ich einmal mehr davongekommen. Und einmal mehr mit Mord, es war also völlig legitim, dass sich die Schlinge nun enger zog. Die Leiche des Kopfgeldjägers war noch nicht erkaltet, als ich schon in der ganzen Stadt gesucht wurde. Bralogh konnte sich Arasti-Stadtwachen leisten und die waren keine unerfahrenen Schwertschwinger, sondern wirklich gefährlich. Beinahe hätten sie mich stellen können, aber wer so wie ich schon lange auf der Flucht war, entwickelte ungeahnte Fähigkeiten. Ein Kribbeln im Nacken kurz bevor Wachen um die Ecke bogen. Ein flaues Gefühl in der Magengegend bei einer scheinbar leeren Gasse. Zu meiner ansonsten grundsätzlich vorherrschenden Aufmerksamkeit kam eine gute Portion Besorgnis hinzu. Es war dieses Mal verdammt knapp gewesen und noch war ich nicht aus der Stadt gelangt.
Aber daran arbeitete ich. Ich stand in einer Reihe von Interessenten zur Einschreibung für die Entdeckerfahrt ins südliche Ödland und mimte diesmal einen Feldarbeiter, eine eher einfache Tarnung, aber gegen die Sommerhitze wirkten die standestypisch ausladenden Strohhüte wahre Wunder. Und eben nicht nur dagegen. Man konnte diese Kopfbedeckung tief ins Gesicht ziehen und wenn Dutzende Feldarbeiter um einen herumstehen, fällt ein Strohhut mehr oder weniger nicht auf.
Wir befanden uns in einem der unverwechselbaren Hinterhöfe der Stadt: Eine überdachte Einfahrt mündete in ein großes Rund, in dem ein Fuhrwerk gerade noch wenden konnte, ohne die Pferde abspannen zu müssen. Beklemmend, anders konnte man den Hinterhof nicht beschreiben. Die stark überkragenden Geschosse der Fachwerkhäuser leisteten ganze Arbeit, den eigentlich großzügigen Platz wieder einzuengen. Ich rückte in der Warteschlange einen Schritt auf. Braloghs beengende Wirkung begann sofort hinter dem Stadttor, es kam mir vor, als wäre die ganze Stadt ein einziger Hinterhof. Nur die drei Hauptstraßen waren breit angelegt, alles andere drängte sich so dicht wie die Menschen hier. Es war kein Wunder, dass hier kaum Qel’tar lebten. Zauberer! Es war eigentlich kaum zu glauben, dass diese Elb-Mensch-Mischlinge sich vor vielen Hundert Jahren zu den Herrschern des Landes emporgeschwungen hatten. Vielleicht hielt man das damals für eine gute Idee, aber wir durften jetzt die Suppe auslöffeln. Einen Qel’tar erkannte man sofort. Sie kleideten sich in feinen, oft prunkvollen Roben, stolzierten statt normal zu gehen und bedachten jeden gewöhnlichen Bürger mit geringschätzigen Blicken. Das notwendige Übel, das waren wir für sie. Wieder ging es einen Schritt nach vorne, gleich war ich an der Reihe. Andererseits war es auch nicht verwunderlich, dass sich die Leute ihnen so unterordneten. Die Zauberer hatten schließlich viel für die Gesellschaft getan. Die Erschließung des Landes wurde durch sie vorangetrieben und zugegebenermaßen existierten einige geniale Erfindungen, die ohne die Qel’tar vielleicht nie entstanden wären. Ein kelchartiges Gefäß, durch das der sich im Inneren befindende Sand rinnen konnte und so die Zeit bestimmte, bis man es umdrehte, und der Zeitenlauf von Neuem begann. Oder Sonnaeuhren, die auch nachts weiterliefen, wahrscheinlich von den letzten Resten an Magie getrieben, die noch verfügbar waren. Magituren, so nannten sie ihre magischen Geräte, in deren Genuss auch hin und wieder die Magielosen kamen und somit war die Masse weitestgehend ruhiggestellt. Aber zum Glück gab es ja noch Typen wie mich, die genau diese Masse immer wieder daran erinnerten, dass wir im Prinzip alle in einer Tyrannenherrschaft lebten. Eine clevere, wohlgemerkt. Keine knallharte und offensichtliche Diktatur, sondern die Zauberer schafften es mit Schläue und Raffinesse, dass sich die meisten freiwillig unterordneten, ja, es sogar als vorherbestimmt und über jeden Zweifel erhaben akzeptierten. Aber die Zeiten wandeln sich. Und mit der Einigkeit im Königreich war es längst vorbei, jeder Provinzherr will …
»Der Nächste.« Ich war an der Reihe und trat an den ausrangierten Holztisch heran, an dem ein Schreiber mit Feder, Tinte und Pergament saß. Was das Bürschchen mit seinen schwarzen Haaren im Qel’tar-Langhaarschnitt in seiner zweitklassigen beigen Tunika zu schmächtig war, hatte der Kerl neben ihm abbekommen. Wie ein Monument stand dieser lebende Fels mit vor der Brust verschränkten Armen da, die einmal Beine hätten werden sollen. Er war ohne Zweifel kräftig, aber das sagte noch nichts über seine Kampffähigkeiten aus. Nur ein Unerfahrener ließ sich davon beeindrucken und vor allem einschüchtern. Sein grimmiger Blick aus gut zwei Schritt Kopfhöhe verfolgte jede meiner Bewegungen und unwillkürlich verkrampfte ich mich. Der Krummsäbel in seiner Schärpe wirkte wie ein Kinderspielzeug. Vermutlich würde er ihn in einem plötzlichen Handgemenge gar nicht ziehen, sondern seine Pranken zu Fäusten ballen und Leben auslöschen.
»Name?«
»Ranulf.« Glatt gelogen, dennoch schwang der Schreiber die Feder in schwindelerregendem Tempo über das Pergament. Auf der Liste war noch deutlich Platz nach unten.
»Irgendeine Berufsausbildung?« Ich wurde über staubige Brillengläser hochnäsig angeblickt. »Was kannst du?«
Klar, mit so einem Gorilla neben mir würde ich mich auch sicher fühlen. »Dies und das«, sagte ich. Hätte ich morden und Widerstand gegen die Herrschaft der Qel’tar sagen sollen?
Der Schreiber sah nach meiner Antwort zu dem Krummsäbelträger neben ihm hin. Ich bemerkte, dass Gorilla mich immer noch auf eine unangenehme Weise fixierte. Seine Augenbrauen hatten sich zusammengezogen.
»Dies und das«, wiederholte er und machte mit seinem Tonfall deutlich, was er davon hielt.
»Gut aufgepasst.« Ich nickte anerkennend ohne Anerkennung.
Gorillas Augenbrauen näherten sich noch weiter einander, er stampfte einen Schritt auf mich zu. Eine schwere, langsame Bewegung. Ein Gegner, bei dem man gute Karten hatte, wenn man flink mit den Beinen war. Und ich war flink. »Du willst uns doch keinen Ärger machen, oder?«
»Nur wenn es sonst zu langweilig wird …«
Gorilla schnaubte und wirkte, als wollte er mich am liebsten zerquetschen. Eigentlich besaß er die besten Voraussetzungen für ein derartiges Vorhaben, aber dummerweise war ich nicht so leicht zu zerquetschen. Mit einem feinen Lächeln und einem festen Blick zeigte ich ihm das. Ich wollte fair bleiben.
»Verschwinde«, sagte er, nachdem das Blickduell verstrichen war. Viele Auseinandersetzungen wurden bereits an diesem Punkt entschieden. Man kann es sehen, ob jemand erbittert kämpfen wird, oder schon vor dem ersten Schlag oder Schwerthieb unterlegen ist. Man kann sehen, wer sich vor dem Tod fürchtet, und genau deshalb verlieren wird. Schnaubend wandte ich mich ohne Umschweife zum Gehen. Noch mehr Aufsehen als vor zwei Abenden im »Westwind« konnte ich mir nicht leisten, als mich eine Stimme scharf zurückhielt.
»Halt.« Ein groß gewachsener Mann kam nach vorne, er hatte wohl gerade die zwei Kastenwagen inspiziert, die dort hinten standen. Er trug zweckmäßige Reisekleidung, deren Hochwertigkeit auf Wohlstand schließen ließ. Seine Kleidung wie auch seine schulterlangen graublonden Haare waren zudem gepflegt und machten mit seinem herrschaftlichen Auftreten unverhohlen seine Herkunft deutlich: Qel’tar. Ich wartete mit leicht gesenktem Haupt, während Gorilla mich nur ungern aus den Augen ließ.
»Mein Herr, mit dem stimmt etwas nicht.«
Ich spürte einen hoheitsvollen Blick auf mir und senkte unmerklich den Kopf noch ein Stück weiter, um mein Gesicht zu verbergen. »Fürwahr, er scheint ein eigenwilliger zäher Bursche zu sein«, sagte der Qel’tar mit klarer Stimme, »aber solche Leute brauchen wir für unser Unterfangen.«
»Aber ich dachte …«
»Überlass das Denken mir!« Der Karawanenanführer, als solchen stufte ich ihn ein, legte seinen Wachhund an die Leine. Ich lugte unauffällig nach links und rechts. Der Schreiber am Tisch unterdrückte gerade ein Gähnen.
»Hat er seinen Namen genannt?«, fragte der Qel’tar just in dem Moment und der Schreiber zuckte erschrocken zusammen.
»Ja, hat er, werter Herr Tarlin.«
Entgegen aller Vorsicht, wagte ich es, meinen Kopf ein wenig zu heben. Tarlin streckte den Arm aus. Mit winkenden Fingern befahl er das Papier auf dem Tisch nach oben zu sich. Das Schriftstück hob vom Tisch ab und fand den Weg in seine Hand. Der Zauberer prüfte den letzten Eintrag in der Liste. »Nun, Ranulf, die Reise wird lang und hart«, sagte er. »Die Nahrung könnte knapp werden und Gefahren lauern überall.« Ich spürte seinen lauernden Blick, eine Lücke in der Strohhutdeckung suchend, während er das Schriftstück beiläufig über der offenen Handfläche schweben ließ.
Ich nickte knapp. »Soll mir recht sein.« Das Ganze dauerte mir zu lange. Das Risiko, erkannt zu werden, wog für mich viel schwerer als die Aussicht auf eine gefahrvolle Reise. Tarlin hob erstaunt eine Augenbraue und schien einen Moment darüber nachzudenken. Dann dirigierte er das Papier mit den Namen zurück auf den Tisch, nickte Gorilla kurz zu und verschwand wieder nach hinten. Dem Muskelpaket passte es offenbar überhaupt nicht, dass sein Herr mich passieren ließ. »Ich behalte dich im Auge …« Verachtung lag in seiner Stimme.
»Das freut mich aber.« Die Reise hatte noch nicht einmal begonnen und ich hatte schon einen neuen besten Freund. Genau deswegen mochte ich solche Abenteuerfahrten nicht.
»Der Nächste.«
Ich griff mein Bündel und durchquerte den Innenhof, um mich zu den Wartenden zu gesellen. Abenteurer, wie sie im Bilderbuch standen. Eine Gruppe von gut und gerne zehn Männern und Frauen, keiner hatte wohl mehr als dreißig Sommer gesehen. Fast alle waren entweder mit Speeren, Säbeln, aber auch mit Schwertern, deren ausladende Parierstangen im Stil der Itulae-Waffenschmiede gehalten waren, bewaffnet. Sie trugen leichte Rüstungen aus hellem, mehrlagigem Tuch und plauderten ausgelassen. Selbstverständlich war ich schon aufgefallen. Ich wusste um meine beunruhigende Wirkung, die unsichtbare Aura einer Person, die gemordet hatte, deshalb wurde ich stets gemieden, man ging mir instinktiv aus dem Weg. Mein Näherkommen wurde von geringschätzigen Blicken begleitet. Sollten sie nur, ich konnte damit leben, wollte keine Bekanntschaften. Diese Expedition sollte eigentlich nur mein Weg raus aus Utol sein. Die Lage war für mich in der östlich gelegenen Provinz noch heißer als der Sommer geworden. Ein schattiger Platz unweit der Gruppe lockte mich und ich beschloss, dort zu lagern. Zwei alte Holzkisten kamen mir gerade recht: Eine wurde zusammen mit der kühlen Hauswand zu meinem Stuhl, die andere zum Schemel für meine Füße. Ich rückte den Strohhut zurecht, um möglichst viel zu sehen, aber immer noch möglichst wenig von meinem Gesicht preiszugeben. Ohne Unterlass wurde ich wieder und wieder gemustert. Sie tuschelten über mich. Schaut und redet nur, ihr gewöhnlichen Leute mit euren harmlosen Leben. Ihr wisst nicht, wie gut ihr es habt.
Ich kramte in meinem bescheidenen Reisegepäck und trank einen Schluck aus meinem Wasserschlauch. Trotz deutlicher Gebrauchsspuren war er dank seiner exzellenten Verarbeitung immer noch dicht. Gedankenverloren zog ich meinen Dolch aus dem Gürtel, klaubte ein Stück verwittertes Holz vom Boden auf und begann daran herumzuschnitzen. Ich bewunderte Leute, die ein Handwerk erlernt hatten. Holz derart zu bearbeiten, sodass etwas Brauchbares daraus wurde oder aus gehauenen Steinen ein Haus bauen zu können, das faszinierte mich. Hosen, Hemden und Schuhe herzustellen, Schmuck anzufertigen oder Felder zu bestellen. Mit den eigenen Händen etwas erschaffen, das musste ein tolles Gefühl sein. Mit dem Dolch säbelte ich ohne spezielles Vorhaben Späne ab. Mit Holz zu arbeiten, ja, ich denke, das hätte mir gefallen. Das zufriedene Lächeln wurde mir zusammen mit dem angenehmen Gefühl jäh von der Realität entrissen. Mir war ein anderes Schicksal bestimmt. Wenn man einer bettelarmen Familie mit zu vielen hungrigen Mäulern entstammt, war es nicht vorgesehen, auf ordentliche Art ein Handwerk zu erlernen. Wer essen wollte, hatte gefälligst mitzuhelfen, etwas beizubringen, egal wie. Alle von uns Kindern hatten es nicht geschafft, nur wer zäh und stark war, überlebte. Meine Hand schloss sich fester um den Dolchgriff. Zäh und stark, beides hatte ich seit meiner Kindheit sein müssen, nachdem ich plötzlich ohne Familie auskommen musste. Straßenkind, Sklave, Gladiator, geflohener Verbrecher. Ich stand auf der Schattenseite der Gesellschaft. Der Preis für die Härte, die ich mir notgedrungen angeeignet hatte, um zu überleben, war hoch. Ich stockte in der Bewegung und besah meine Hände wie zum ersten Mal. Grobschlächtige Finger, feine weiße Narben am Handrücken, starke Handgelenke. Das waren meine Werkzeuge, damit führte ich Waffen und beendete Leben, bevor meines beendet worden wäre. Das war kein schönes Handwerk. Aber hatte ich je eine Wahl? Energischer schnitzte ich weiter. Ich hatte oft eine Wahl, und die eigentliche Frage lautete, warum ich trotzdem immer weiter gemacht habe, und jetzt von erdrückender Düsternis erfüllt war.
»Wird das ein Pfeil?«, fragte plötzlich eine Kinderstimme neben mir.
Ich zuckte zusammen und mein Blick fuhr nach links. Ein kleines Mädchen, vielleicht gerade einmal zwölf Sommer alt, stand da und sah mich aus großen blauen Augen an. Sie deutete auf mein Schnitzwerk. »Ein Pfeil, wird das ein Pfeil?«, fragte sie lauter, was mir unangenehm war.
»Ja, vielleicht.« Tatsächlich hatte ich eine, wenn auch etwas unregelmäßige Spitze geformt.
»Ich bin Aini. Wie heißt du?«, fragte das Mädchen offenherzig. Mit schrägem Blick musterte ich Aini kritisch. Mit Namen hatte ich meine Schwierigkeiten. Mein eigener stand zu oft auf gesiegelten Aushängen, keine gewöhnlichen Steckbriefe, sondern Siegel und Symbol des Zirkels der Jagd zeigten, dass diese Person ein landesweit gesuchter Schwerverbrecher war. Namen anderer, vor allem netter Personen, wollte ich mir nur ungern merken. Es war dann noch härter, sie zu verlieren.
»Wohnst du hier in Bralogh?«, war daher meine Antwort auf Ainis Frage.
Aini zuckte mit den Schultern und macht eine Geste zum Hof hin. »Das hier ist mein Zuhause.« Sie blickte zu den Abenteurern. »Normalerweise ist hier nicht viel los.«
Ein Straßenkind also. Das passte zu ihrem abgetragenen Kleid und dem Schmutz auf der Haut. Automatisch war mir die Kleine eine ganze Spur sympathischer geworden. Ich bedachte Aini mit einem möglichst freundlichen Blick und einem schiefen Lächeln. »Ich komme aus Artula’dur. Ich habe auch auf der Straße gelebt.«
»Echt?« Aini schien das zu faszinieren. War das so abwegig bei meinem Anblick? Das ist das Wunderbare an Kindern: Sie sind unvoreingenommen und nehmen jeden so, wie er ist.
Ich setzte mich gerade hin und wies auf die zweite Kiste vor mir. »Setz dich.«
»Wo liegt Artula’dur?«, fragte sie, kaum, dass sie Platz genommen hatte.
»In der Provinz Raturia.«
Sie schaute verständnislos.
»Die Provinzen des Königreiches?« Ich war kein Experte, aber ein wenig war ich schon herumgekommen. Aini schien das alles nicht zu verstehen, ihr Blick wurde traurig und sie schüttelte stumm den Kopf. Ich musste langsamer vorgehen.
»Also: Das Königreich der Qel’tar ist in neun Provinzen zerfallen. Zwei werden von Magielosen regiert, Murandor und Zerandor, und von den meisten Qel’tar nicht anerkannt. Die übrigen sind Raturia, Wyria, Al’Raban, Utol, Itulae …« Ich geriet ins Stocken. »Diese zwei letzten vergesse ich immer.«
»Und warst du da schon überall?« Das Leuchten in Ainis Augen war wieder da.
Ich schnitzte nebenbei weiter. »Nein, aber in vielen. Ich war Leibeigener des Zirkels des Handels und musste viele Handelszüge begleiten.«
»Leibeigener.« Aini überlegte. »Ein Sklave?«
Ich nickte, ein wenig überrascht über Ainis schlaue Art. »Ja, ein Sklave.«
»Und woher hast du die lange Narbe in deinem Gesicht?«
Schlagartig wurde ich wieder daran erinnert, wer ich eigentlich war und die Unbeschwertheit des Augenblicks verflog. Ich drehte den Kopf weg, denn ich wollte nicht, dass Aini mir in die Augen sah und die Düsternis in mir erblickte. Ein bitterer Geschmack breitete sich in meinem Mund aus. »Ich denke, du gehst jetzt besser.« Ich besah mein Schnitzwerk. »Hier, ich schenke es dir.«
Aini sprang auf. »Wirklich?« Ich zuckte zusammen, denn sie freute sich einfach zu laut für den Innenhof. »Danke!« Sie strahlte über ihr ganzes ungewaschenes Gesicht, ehe sie mit ihren blanken Füßen davoneilte.
Knirschende Schritte näherten sich. »Welch ein Wohltäter«, sagte eine dunkle Männerstimme in höhnischem Tonfall.
Ich entschloss mich spontan, meinen Dolch auch ohne meine Schnitztätigkeit in der Hand zu behalten. Die eben frei gewordene Kiste, auf der Aini gesessen hatte, blockierte ich demonstrativ wieder mit meinen Füßen.
»Diejenigen, die wenig haben, teilen oft am bereitwilligsten.« Ich hob ein wenig den Blick, sodass ich meine neue Gesellschaft bis auf Gürtelhöhe erfassen konnte. Er trug leichte Lederstiefel und eine weite Pluderhose. An der rechten Seite baumelte die Scheide seines Schwertes.
»Aha. Warum?«
»Sie wissen, wie es ist, nichts zu haben.«
Der Kerl stellte sich neben mich, etwas zu nah für meinen Geschmack, und lehnte sich an die Wand. »Ich habe deinen Namen nicht ganz verstanden.« Der lauernde Unterton missfiel mir, daher nahm ich meine Füße von der Kiste. Ich wollte sprungbereit sein.
»Liegt daran, dass ich ihn nicht genannt habe.«
Ein trockenes kurzes Lachen erklang, dann wurde er ernst. »Du kommst von den Feldern Itulaes, hm?«
Richtig, das war meine derzeitige Verkleidung. »So ist es.«
»Als Erntehelfer, nehme ich an? Du wirst kaum Land dort besitzen, sonst wärst du jetzt nicht hier.«
»Nun, ich …«
»Ich habe gehört, dass es dieses Jahr ganz schön schlecht mit der Ernte aussieht. Regnet ja auch kaum. Also ich meine, wer im Süden Itulaes ansässig ist, braucht sich eigentlich nicht wundern. So nah an der Uhjuny gibt’s halt kaum Wasser. Einige behaupten, dass die Wüste langsam, aber sicher nach Norden wandert, dass immer mehr Boden unbrauchbar wird. Kommst du da aus der Gegend?«
»Eher aus …«
»Ich komme aus Braashan, liegt gleich neben Gorgoi an der Grenze zum Norden.«
Das waren die beiden Namen, die mir vorhin nicht eingefallen waren.
»Es ist toll da zu leben. Da gibt’s immer reichlich Wasser, Seen und Flüsse haben wir auch. Und Herzogin Arlana Miron von Torya ist eine gute Landesherrin. Sie toleriert sogar die von Magielosen geführten Provinzen und ist immer wieder zu Gesprächen bereit. Was hältst du davon?«
Ich schwieg. Sein Geschwafel strengte mich an, und er ahnte nicht, in welch verschiedenen Welten wir lebten. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein, und ich wünschte mir Aini zurück. Jetzt im Vergleich war das Gespräch mit ihr eine echte Erholung, und just in diesem Moment wurde mir klar, dass ich zu viele Sanduhren alleine verbrachte. Das gute Gefühl einer angenehmen Unterhaltung hatte ich beinahe vergessen.
»Dafür hat sie Schwierigkeiten mit Raturia aber, ganz im Vertrauen, dieser Königshof ist doch schon lange nur ein hohles Gebilde«, plauderte der Kerl trotz meines offensichtlichen Desinteresses weiter. »Mit den Arasti muss man sich gut stellen, das ist meine Meinung. Ich bin Hufschmied, aber eigentlich wollte ich mal ein Ordenskrieger werden.«
Ich schnaufte genervt. »Und das hat nicht geklappt?«, fragte ich ohne einen Funken Neugier.
»Ich war sogar schon Rekrut, aber es hat einfach nicht gereicht. Was die alles verlangen, ist unglaublich. Neben Strategie, Taktik und einer fundierten Allgemeinbildung soll man auch noch einen starken und ausdauernden Körper besitzen, von den Kampffertigkeiten ganz zu schweigen.«
Ich drehte den Dolchgriff locker in meiner Hand. »Es kommen nur die Besten weiter«, sagte ich und konnte mir einen bissigen Unterton nicht verkneifen. Wusste der Mann eigentlich, in welcher Gefahr er schwebte? »Der Orden hat einen Ruf zu verlieren.« In dieser Distanz konnte ich ihm ansatzlos in den Bauch …
»Oh ja, das hat er! Arasti-Krieger sind sehr begehrt, vor allem diejenigen im Rang eines Wehrmeisters. Die besitzen mehr als zehn Jahre Erfahrung, also benimm dich, wenn du jemanden mit bronzefarbenen Wappen des Ordens siehst.«
»Weißt du, wohin genau unsere Reise geht?« Wenn ich mich schon mit dem Kerl unterhalten musste, wollte ich wenigstens auch ein paar relevante Informationen.
Eine etwas zu lange Pause verstrich. »Nun, in die Wüste, denke ich.«
Da lag ein Hauch Verunsicherung in seiner Stimme und ich spürte Nervosität in mir aufkommen. Ohne eine verräterische Kopfbewegung sah ich zur Hofeinfahrt. Alles frei. Mein Blick huschte zu der Gruppe Abenteurer. Gerade kam ein Neuer hinzu und wurde begrüßt. Ich wusste noch nicht, was es war, aber irgendetwas stimmte hier nicht.
»Laron, wir brauchen dich«, erschallte plötzlich eine feste Frauenstimme. Meiner Neugier Tribut zollend hob ich den Kopf weit genug, um unter der Strohhutkrempe nach vorne schauen zu können. Eine junge Frau von kleiner, aber kräftiger Statur stand unfraulich breitbeinig da und sah zu uns herüber.
»Was gibt es?«, rief Laron zurück.
»Wir können schon mal den Wagen beladen.«
»In Ordnung.« Während er zu ihr ging, trafen sich unsere Blicke für einen Moment. Schnell wandte sie sich ab, packte Laron am Arm und zerrte ihn regelrecht weg. Nachdenklich atmete ich tief. Wo war der Fehler? Ich suchte die Fenster der Häuser ab. Nichts. Vielleicht wurde ich auch einfach nur paranoid, vielleicht war ich einfach schon zu lange und zu oft auf der Flucht. Eine ganze Weile beobachtete ich die Szenerie, ehe mir selber auffiel, dass ich immer noch den Dolch in der Hand hatte. Das sah sicherlich nicht gerade vertrauenserweckend aus und ich steckte ihn weg. Normalerweise müsste ich jetzt unbedingt meinem Gefühl folgen und unauffällig verschwinden, aber leider gab es für mich keine Alternative. Alleine kam ich nicht aus der Stadt heraus, würde wahrscheinlich sogar einer Patrouille in die Arme laufen, bevor überhaupt ein Stadttor in Sichtweite kam. Ich hätte die Sache in der Taverne anders regeln müssen. Gewalt ist die schlechteste aller Lösungen, und ich verwendete sie viel zu bereitwillig. Seit Monden dachte ich schon darüber nach. Mein Leben, mein Weg. Meine Bestimmung? Es hat Jahre gedauert, bis ich bereit war, mir darüber Gedanken zu machen. Verrück, oder? Es hat womöglich alles einen Grund, folgt einem Plan. Damals, in dieser Burgruine im Weltenwall – die Geschehnisse dort hatten sich für immer in mein Gedächtnis gebrannt.
Unwetter.
Blut.
Tod.
Wahnsinn.
Kampf.
Abgrund.
Finsternis.
Gottgesandte.
Opfer.
Seelenfresser.
Ich schnappte nach Luft und rieb mir mit zitternder Hand über die Augen. Diese Erinnerung hatte all die Jahre überdauert, der Verdrängung getrotzt. Sie hatte es verdient, nun beachtet zu werden. Diese Sache war noch längst nicht ausgestanden, und ich wusste, dass ich eine zentrale Rolle zu spielen hatte. Ob ich wollte oder nicht, stand nicht zur Debatte: Es war mein Schicksal, und ich musste endlich beginnen, mich ihm zu stellen.
Jetzt hieß es für mich, zunächst aus der Stadt zu verschwinden, dann konnte ich mir weitere Gedanken machen. Mit Erstaunen stellte ich fest, dass andere Interessenten für die Entdeckerfahrt auch abgewiesen wurden. Leute, die ich als ehrlich und brauchbar einstufte, also das genaue Gegenteil von mir. Hatte mich mein Gefahreninstinkt etwa getäuscht? Womöglich war die Reise wirklich nichts für Weichlinge, was wiederum bedeutete, dass es nicht alle schaffen würden. Ich hatte tatsächlich eine passende Unternehmung für mich erwischt und es hätte mein Glückstag sein können – war es aber nicht, wie ich bald feststellen musste.
Als die Gruppe fünfundzwanzig Köpfe zählte, brach Tarlin das Anmeldeverfahren ab und Gorilla verscheuchte die restlichen Bewerber. Während der Schreiber zusammenräumte, kam der Qel’tar mit Gorilla an seiner Seite zu uns. Sofort erhoben sich die Expeditionsteilnehmer. Ich wollte nicht noch mehr schlechten Eindruck machen, stand ebenfalls auf. Mit meinem Reisebündel unter dem Arm mischte ich mich unter die Abenteurer. Die Gruppe war groß genug, sodass ich darin untergehen konnte. Perfekt.
Tarlin hob seine Hand und eine erwartungsvolle Stille trat ein. »Werte Damen und Herren Abenteurer«, eröffnete er in typisch wohlformulierter Qel’tar-Ausdrucksweise, die ich als geschwollen und hochnäsig empfand. »Die bevorstehende Reise ist von langer Hand geplant und bis ins kleinste Detail vorbereitet worden. Sie soll uns Ruhm und Ehre einbringen.« Er schritt vor der Gruppe auf und ab. »Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut, damit unser wagemutiges Unterfangen nicht schon im Vorfeld zum Scheitern verurteilt ist. Denn bei dem, was wir vorhaben, sind Fehler unverzeihlich.« Tarlin stoppte und baute sich vor uns auf. »Zu unserer aller Freude kann ich verkünden, dass der erste Teil meiner Planungen erfolgreich verlief. In der Tat war dies eine der größten Herausforderungen bei dem Unterfangen.«
Plötzlich war es wieder da, das ungute Gefühl. Verstohlen sah ich nach links und rechts. Eine gewisse Anspannung war bei manchen zu erkennen und mit einer bösen Vorahnung beobachtete ich, wie sich Hände unauffällig um Waffengriffe schlossen. Tarlins Gesichtszüge wurden hart und sein Blick wanderte über die Gruppe, bis er mich gefunden hatte. »Allerdings geht es für uns nicht nach Süden, sondern nach Norden«, sagte er mit eisiger Stimme.
Ehe ich reagieren konnte, sprangen plötzlich alle wie abgesprochen einen Satz zurück. Jedenfalls alle außer mir. Mit schleifenden Geräuschen wurden Klingen blankgezogen und Speere gesenkt. Ich musste mich nicht umblicken, um zu wissen, dass ich in einem Ring aus Waffenspitzen eingeschlossen war.
»Hm«, entfuhr es mir mit deutlich flauem Gefühl in der Magengegend. Ich hätte auf mein Gefühl hören sollen, es täuschte mich nie. So etwas wäre mir die Jahre vorher nie passiert, aber die seit kurzem vorherrschende innere Unruhe setzte wohlbekannte Mechanismen außer Kraft.
»Überrascht, Wulferan?« Tarlin lächelte siegessicher. Er kannte meinen echten Namen, das war nicht gut. Er wusste also über mich Bescheid.
»Durchaus.« Ich begann zu begreifen. »Ich fühle mich geehrt.« Eine fingierte Expeditionsausschreibung samt täuschend echter Rekrutierung – eine Falle, die meiner würdig ist.
»Genial, nicht wahr?« Der Qel’tar verschränkte mit herrischer Geste seine Arme hinter dem Rücken. »Fühlt Euch nicht geehrt, sondern festgenommen!«
»Wirklich gut, tatsächlich.« Trotz der fatalen Lage konnte ich Anerkennung und Respekt nicht unterdrücken. Welche Mühe sich Leute mit mir mittlerweile gaben, wie viele Gedanken sie mir widmeten, wie viel Kraft und Zeit sie investierten. Alles nur wegen mir.
Tarlin nickte, sein Lächeln würde wohl noch länger in seinem Gesicht hängen bleiben. »Ihr meint doch nicht wirklich, dass Ihr einfach so einen Krieger des Königs von Raturia mitten in einem Schankraum abstechen könnt?«
Die Sache vor zwei Abenden im »Westwind«. Eines Tages, das hatte ich immer geahnt, würde mir so etwas zum Verhängnis werden. »Einen gemütlichen Abend stelle auch ich mir anders vor.« Allmählich wurde mir doch ein wenig mulmig zumute, aber selbstverständlich ließ ich mir nicht das Geringste anmerken.
Tarlins Lächeln nahm weitaus bösartigere Ausmaße an. »Das war ein Mord zu viel, Wulferan. Und dabei wart Ihr so gut darin, Euch zu verbergen. Ohne diese Tat hätte ich Euch vielleicht gar nicht erwischt.«
Meine Augen verengten sich zu Schlitzen. »Du hast doch dem Wirt und seiner Tochter nichts angetan?« Für einen Moment vergaß ich, dass ich in der unterlegenen Position war. Gunnars Taverne mochte ein etwas heruntergekommener Laden sein, dank Eira, der liebreizenden Tochter des Wirts, hatte er dennoch eine angenehme Atmosphäre besessen.
Tarlin lächelte selbstgefällig. »Nun, da nicht klar ist, ob sie dir geholfen haben oder nicht, wird über sie gerichtet werden.«
Ich atmete schwer. »Das war eine Sache zwischen mir und diesem lächerlichen Kopfgeldjäger. Lass sie in Ruhe, Robenträger.«
Der Qel’tar wiegelte mit wedelnder Hand ab. »Mag sein, dass Lorenzo Di Matiore ein, sagen wir mal, sehr unerfahrener Recke war, aber«, Tarlins lodernder Blick durchbohrte mich, »Mord bleibt Mord.«
Da konnte ich ihm nicht widersprechen. Ich blickte langsam nach links und rechts und sah in sehr entschlossene Gesichter. Die Maskerade der blauäugigen Abenteurer war gefallen, jetzt sah ich abgeklärte Männer und Frauen, die wussten, was sie taten. Dieser Di Matiore war nicht von diesem Schlag gewesen. Ich wandte mich wieder an den Qel’tar. »Er hatte seine Chance.« Das stimmte nicht ganz, ich hatte den Burschen überlistet, sodass er nicht einmal mehr sein Schwert ziehen konnte. Wenn man einen Kampf schnell verlieren will, kämpft man am besten ehrlich, daher waren Tücke und Hinterlistigkeit schon lange meine Hauptwaffen. In Tarlins Gesicht sah ich, dass er wusste, was sich tatsächlich in dem Schankraum abgespielt hatte. Vermutlich hatte er Gunnar oder Eira auf unschöne Art und Weise zum Reden bringen lassen.
»Du wirst dafür büßen, Wulferan, dafür und für alle deine bisherigen Vergehen.« Er nahm Haltung an. »Hiermit erkläre ich, Großmeister des Zirkels der Jagd Tyronnimus Tarlin, dich, Wulferan, für festgenommen! Dein schändliches Treiben hat ab jetzt ein Ende. Der Hohn deiner Flucht wird verklingen und die Welt kann wieder aufatmen.« Auf einen Wink hin schob sich jemand durch den Ring aus Waffen hindurch. Es war Gorilla, der entschlossen auf mich zustampfte. Ich hatte recht gehabt, er zog seine Waffe nicht. Ihn interessierte auch nicht, dass ich noch meinen Dolch im Gürtel trug. Ich war schnell mit der kurzen Klinge, hätte ihn vielleicht noch erledigen können, aber dann hätten die anderen einen guten Grund gehabt, mich gleich hier und jetzt in Stücke zu hacken. Und, bei den Göttern, das traute ich ihnen zu. Also empfing ich Gorilla wenigstens mit stoischer Gleichgültigkeit. Noch im Gehen holte er aus und seine Faust hämmerte mich in die Bewusstlosigkeit.
Kapitel 2
Als ich langsam wieder zu mir kam, verzeichnete ich den vierten Nasenbeinbruch in meinem Leben. Mit etwa zehn Sommern hatte mir Maron »Todesfaust«, das Muttersöhnchen einer Qel’tar-Familie, den ersten verpasst. Er hatte Spaß daran, die jüngeren Kinder aus ärmlichen Verhältnissen so oft wie möglich zu schikanieren. Er genoss ihre Angst und seine Überlegenheit in vollen Zügen, Tag für Tag. Seitdem fiel es mir schwer, unvoreingenommen mit den Zauberern umzugehen. Eine Gruppe Bewunderer scharte sich ängstlich um Maron, die lieber an seiner Seite stand als vor ihm. Sie krakeelten eifrig mit, auch wenn sie vielleicht die Dinge nicht gut fanden, die Maron tat. Wenn er einen von uns in die Finger bekam, konnte man sich glücklich schätzen, wenn er es dabei beließ, einem lediglich das mitgeführte Essen abzuknöpfen. Meist jedoch hagelte es noch Hiebe und Tritte. Als er eines Tages meine jüngere Schwester Mirien anging, wagte ich den Widerstand. Das hatte ihn zwar kurz sichtlich irritiert, doch er antwortete prompt und knallte mir seine Faust ins Gesicht. Auch wenn ich wochenlang mit dicker, schmerzender Nase herumlief, war mein Wille zum Kampf geweckt. Kurz vor seinem Fausthieb hatte ich in Marons Augen gesehen, dass auch er nur ein ganz gewöhnlicher Junge war, der Angst und Unsicherheit mit Aggressivität überspielte. Er war längst nicht so übermächtig und souverän, wie er uns glauben ließ. Außerdem sollte ich ihm dankbar sein. Wegen Maron kam ich erst auf die Idee, das Kämpfen zu erlernen. Vikran war ein alter Haudegen und immer wieder für mehrere Wochen in der Stadt. Er mochte uns Straßenkinder, auch wenn er das nie zugab. Mit seiner mürrischen Art brachte er mir das waffenlose Kämpfen bei, aber in seinen Augen sah ich, dass es ihm mehr Spaß machte, als er zeigte. Nach meiner Genesung und vielen Sanduhren des Übens mit Vikran suchte ich die Konfrontation. Ich nahm eine Route durch unser Viertel, bei der ich wusste, dass ich Maron in die Arme laufen würde. Feixend stellte er sich mir in den Weg, freute sich noch über meine Dummheit und die vermeintlich leichte Beute. Noch ehe er mit der üblichen Schikane beginnen konnte, nahm ich all meinen Mut zusammen, sprang ihm entgegen und schlug ihn nach kurzer Rangelei mit nur einem Hieb nieder. Dass sich eines Tages jemand massiv wehren könnte, damit hatte Maron nicht gerechnet. Völlig entsetzt lag er am Boden und heulte. Danach nannte man ihn zum Hohn »Maron, der Standhafte« – der Mythos der Todesfaust war dahin. Die Lektion für mich: Maron hatte mich unterschätzt, das durfte mir nie passieren. Sonst wäre ich es, der eines Tages aus heiterem Himmel niedergestreckt werden würde. Und ich hatte ganz nebenbei festgestellt, dass ich stärker war, als ich von mir gedacht hatte.
Der zweite Nasenbeinbruch ereignete sich etwa vier Jahre später, als wir von Arasti-Kriegern auf Befehl der Qel’tar aus unserer Bleibe gejagt worden waren. Lange hatte uns Waisen- und Straßenkindern das verlassene Haus an der Ecke zur Gerberei als Unterschlupf gedient. Viele Sommer hatte sich niemand für das baufällige Haus mitten im Dunstbereich der Lederverarbeitung interessiert. Hier am Stadtrand wollte sowieso niemand wohnen und die umliegenden Behausungen hatten stets wechselnde Besitzer. Wir liebten unser Haus. Alles, was wir an halbwegs brauchbaren Sachen in der Stadt fanden, brachten wir hierher und füllten die Zimmer damit. Wir organisierten Schlafplätze, formten Sitzgelegenheiten aus alten Decken und Kissen, Gerümpel wurde unser improvisiertes Mobiliar. Wir saßen beisammen, lachten und scherzten, um unsere missliche Lage zu entschärfen. Wer neu war, musste als Aufnahmeprüfung nur mit Lendenschurz bekleidet in den Keller hinunter. Dort war es stellenweise stockfinster, nur durch wenige kleine Luken fiel Licht hinein, und es stank widerwärtig. Wir sagten immer, dass da ein Toter umherliefe, vermutlich lag irgendwo nur ein verwesendes Tier. Aber es sorgte für die nötige Anspannung. Der Anwärter hatte die Aufgabe, aus dem hintersten Raum eine Glasscherbe zu holen. Da lagen sie zu Dutzenden herum, unzählige Flaschen oder andere Glasgegenstände sind vor unserer Zeit zu Bruch gegangen. Wollte man Teil unserer Gemeinschaft werden, galt es ein möglichst schönes großes Bruchstück mit nach oben zu bringen. Wer es geschafft hatte, wurde mit Jubel empfangen und seine Beute bekam einen Platz auf unserem Trophäenbrett. In der ehemaligen Wohnstube des Hauses befand sich ein altes dickes Holzbrett auf Kopfhöhe eines Erwachsenen an der Wand. Dort durfte jeder seine Scherbe ablegen und war ab sofort einer von uns. Auch nach Jahren konnte jeder, ohne zu zögern, seine Scherbe benennen. Wir hielten zusammen, sorgten füreinander und waren wie eine Familie – bis wir verraten wurden. Warum sonst war der strubbelige Olko genau dann nicht da, als die Ordenskrieger die Räume stürmten und uns mit dicken Knüppeln auf die Straße prügelten, direkt vor die Füße eines hochnäsigen Qel’tar aus dem Zirkel der Baumeister? Er palaverte von Neugestaltung und alles würde besser werden, aber so wie er dreinblickte, waren wir einfach nur störend und mussten weg. Jäh wurde ich an den Moment erinnert, wie es gewesen war, eines Tages ohne Eltern dazustehen. Ich hatte gehofft, dieses verstörende und Furcht einflößende Gefühl nie mehr erleben zu müssen, aber wir hatten soeben unser Zuhause wie auch unsere Gemeinschaft verloren. Ich habe heute noch dieses Bild von dem Qel’tar vor Augen, wie er gelangweilt seine Robe zurechtzupfte und unseren Abtransport nicht einmal richtig beobachtete. Mit Tränen in den Augen sahen wir uns an, während wir vorangeschubst wurden. Ich ahnte, dass wir uns nie mehr wiedersehen würden. Seitdem hasste ich zwei Dinge: Qel’tar und Verräter.
Die dritte unsanfte Verformung meiner Nase war der Preis für meine Flucht aus der Gladiatorenarena in Artula’dur gewesen, die eigentlich für mich als Endstation angedacht war. Ich war Teil des »Schlachtviehs«, wie wir liebevoll betitelt wurden, Schwertfutter für die Stammkämpfer der Arena. Es war vorgesehen, dass wir nach ein paar Kämpfen starben, möglichst langsam und qualvoll. Schließlich sollte den Zuschauern etwas geboten werden. Mit Hartholzstöcken und mehrendigen Peitschen wurden wir regelmäßig in die Arena getrieben, in der uns die »echten« Gladiatoren vor gefüllten Zuschauerrängen vorführten, mit uns spielten. Wir bekamen zwar rostige Waffen in die Hand gedrückt, wussten aber damit nicht umzugehen. Die Arena von Artula’dur war nur ein besserer Sandkasten, verglichen mit den Arenen anderer Städte. Aber der Tod machte hier keinen Unterschied, immer wieder lichteten sich unsere Reihen und die Zellen wurden mit neuem »Schlachtvieh« gefüllt. Ich gehörte zu den wenigen, die sich gut genug wehren konnten, um nicht eines Tages achtlos an einem Bein über den staubigen Arenaboden hinausgeschleift zu werden. Schon bald war ich als »Wiesel« bekannt, weil ich mich so schnell und ausdauernd im Kampf bewegte und es so dem Gegner schwer machte, mich zu treffen. In Wirklichkeit hatte ich einfach nur Angst und wusste mit dem Schwert in meiner Hand nicht umzugehen. Das spitze Ende sollte in den Gegner hinein, so weit war es selbsterklärend, aber Schwertfechten bestand aus weit mehr als dem. Irgendwann bekamen wir tatsächlich eine einfache Ausbildung, um bessere Kämpfe liefern zu können. Meine Kampftaktik, immer in Bewegung zu bleiben, behielt ich bei, nur jetzt konnte ich echte Treffer setzen, keine zufälligen, oberflächlichen Kratzer wie bisher. Die Todesangst wurde weniger, jetzt begann es Spaß zu machen. Die Furcht in den Augen der Gegner, wenn sie nach wenigen Atemzügen erkennen mussten, dass ich zu schnell für sie war. Wenn die Verzweiflung sie überkam und ich sie dadurch noch leichter besiegen konnte. Ich nahm mir heraus, selber über Leben und Tod meiner Gegner zu entscheiden, Vorgaben der Arenabetreiber oder hochrangiger Qel’tar-Persönlichkeiten unter den Zuschauern ignorierte ich mit voller Absicht. Diese Unberechenbarkeit war zum einen mein Widerstand gegen das System, zum anderen ein echter Publikumsmagnet. Die Arenabetreiber hassten mich, die Zuschauer liebten mich, daher musste mein Tun geduldet werden. Ich machte das makabre Spielchen eine ganze Weile mit, zu lange, wie mir heute erschien, aber ich war geraume Zeit einfach damit beschäftigt, zu überleben. Ich freundete mich mit Ruku an, einem stämmigen kleinen Mann, der wild und brutal aussah, aber sobald er lachte, war er ein lieber netter Kerl. Ruku war ein zäher Hund und hatte wie ich den Schlachtvieh-Status bereits einige Zeit hinter sich gelassen. Wir saßen in derselben Zelle und führten Gespräche, sprachen uns Mut zu und halfen einander durchzuhalten.
Bei den großen Kämpfen anlässlich der Stadtgründung starb Ruku schließlich, begleitet von frenetischem Jubel und Beifall. Ruku schrie nicht vor Schmerz, nicht ein einziges Mal, er war ein echt harter Kerl, und als ich am Abend auf seine leere Pritsche starrte, wurde mir bewusst, wie sehr ich ihn gemocht und respektiert hatte. Der Verlust war so groß für mich, dass ich es mir seitdem abgewöhnt hatte, mir Namen zu merken und Personen kennenzulernen. Ich wollte das nicht noch einmal durchmachen. Die Monde verstrichen und mit jedem Kampf, mit jedem Blutstropfen, der meinetwegen vergossen wurde, stumpfte ich ab. Meine Hände waren übersät mit Narben von Schnitten entlangschlitternder Klingen, die ich nicht vollständig hatte abwehren können. Ein düsterer Schleier legte sich über meine Seele, die so vernarbt war, wie meine Handrücken. Nie erlitt ich tödliche Verletzungen, denn ich war ein guter Gladiator geworden. Ich kämpfte nicht schön, sondern effektiv. Direkt, schnell, unbarmherzig – ich war der Tod. Und trotzdem ließ ich mich weiterhin einsperren, von Wachen, die nur in der Überzahl und mit dicken Rüstungen stark waren. Lachhaft. Ich beschloss, zu fliehen. Eines Tages wartete ich nicht auf den Kampf in der Arena, sondern eröffnete die Spiele gleich beim Verlassen der Zelle. Kaum war die Tür aufgeschlossen, stürzte ich mich auf die Wachen wie ein von der Leine gelassener Hund. All die Wut über Rukus Tod, den Verlust meiner Freiheit, die heimlichen Ängste und die stille Verzweiflung in den Nächten entlud sich und attackierte die völlig überraschten Wachen mit kalter, schnörkelloser Effizienz. Dennoch fing ich mir einen Ellenbogenhieb mitten ins Gesicht im Handgemenge ein, und verlor die Kontrolle über mich. Ich drehte einem Wärter den Stock aus der Hand, brach ihm dabei sicherlich ein oder zwei Finger, und schlug so lange auf sie ein, bis sich keiner mehr rührte. Ich war fest der Meinung, dass es ihre Schuld war: Die Bestie, die sie erschaffen hatten, war ihnen zum Verhängnis geworden. So einfach machte ich es mir heute nicht mehr, allerdings war damals nur der Tod ein Ausweg aus der Arena für mich. Mein eigener, oder der von den Wärtern. Noch während ich dieses kleine götterlose Drecksloch inmitten einer ach so noblen Welt verließ, versprach ich meiner Nase, dass dies das letzte Mal gewesen sei. Ich hätte mir lieber vornehmen sollen, der Gewaltanwendung zu entsagen. Aber es war das einzige, was ich damals kannte und konnte.
Gorilla hatte ganze Arbeit geleistet, aber es gehörte nicht viel dazu, ein stehendes Ziel zu treffen. Das rumpelnde Geräusch und die holpernden Stöße verrieten mir, dass ich mich fortbewegte. Ein erster schwacher Blick offenbarte, dass ich mich in einem Käfig auf einem Pritschenwagen befand, der von zwei Ochsen gezogen wurde. Ich setzte mich auf und lehnte mich an die dicken Gitterstäbe. Die abklingende Benommenheit ausnützend, tastete ich nach meiner Nase. Sie fühlte sich doppelt so dick an und ich erspürte den verschobenen Knochen. Ich legte meine Finger links und rechts an, atmete tief und rückte meine Nase wieder zurecht. Möglichst gerade. Der durchzuckende Schmerz weckte mich nun vollständig und Tränen schossen mir in die Augen. Ja, so etwas bringt einen wieder auf die Beine. Ich blinzelte mehrmals und orientierte mich mit klarerem Blick: Hinten an den Wagen schlurfte eine ganze Gruppe von Gefangenen, in langer Reihe gekettet. Aus gleißendem Licht bestehende magische Kettenglieder bildeten Fesseln, die sowohl Hände als auch die Füße banden. Verfluchte Qel’tar. Nur mit kleinen Schritten konnten sich die in Lumpen gehüllten Männer und Frauen mühsam und mit apathischem Blick voranschleppen. Tarlin wusste offenbar gut über mich Bescheid, denn nicht ohne Grund saß ich hier in diesem Käfig. Mein Vater war Yborianer, ein sonderbarer Menschenschlag, der von dem Küstenland des Dunklen Ozeans abstammte. Die ersten Siedler an der Küste des schwarzen Wassers ahnten nichts von der Gefährlichkeit der Region, hatten keine Vorstellung, was dort für Kreaturen an Land und im Wasser lauerten, bis es eines Tages zu spät war. Viele starben und die wenigen, die überlebten, waren für immer gezeichnet. Verdorbene, von Dämonen berührte Wesen, und gaben dies an die folgenden Generationen weiter. Bei uns Kindern merkte man bald, welcher Elternteil sich durchgesetzt hatte. Nur ich trug das Yborianer-Erbe in mir, und deshalb wurde auch nur ich zurückgelassen, nachdem Vater gestorben war. Ich passte nicht ins Bild, ich war der Stein des Anstoßes, ich war der Sonderling. Aber eigentlich war ich nur ein Kind, brauchte den Schutz und die Geborgenheit der Familie so wie jeder andere auch. Hätte Mirien unsere Mutter umstimmen können, und sie hätte mich mitgenommen – wie wohl dann mein Leben gelaufen wäre? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ganz anders. Alle Yborianer waren unempfänglich für Magie, kein Zauber in jedweder Form funktionierte bei uns. Wäre dem nicht so, würde ich mich jetzt dort eingereiht wiederfinden.
Diese Lage kannte ich von früher zur Genüge. Unfolgsame Sklaven wurden kurzerhand hinter die Wagen gespannt. Es war eine besondere Gemeinheit, die Füße zu eng zu ketten, sodass Gefangene mit dem Tempo nicht Schritt halten konnten und beständig stürzten. Diese Steigerungsstufe hatte man sich bei den Angebundenen hinter dem Wagen momentan noch offengelassen. Früher, als ich noch jung und unerfahren gewesen war, konnten mich gewöhnliche Ketten halten, aber mit den Jahren fand ich etliche Schwachstellen heraus, was auch daran lag, dass für fast alle Leibeigenen und Gefangenen magische Fesseln verwendet wurden und die echten Metallketten oft genug verrostet und abgenutzt waren. Der Hochmut der Qel’tar hatte sich für mich immer wieder ausgezahlt. Es war jener Handelszug nach Braashan gewesen, bei dem ich das erste Mal geflohen war. Ich betrachtete die Narben in meiner rechten Handfläche. Sie erinnerten mich daran, was ich zu tun gezwungen war, kurz vor meiner ersten Flucht. Damals ging etwas in mir kaputt und vielleicht habe ich nur deshalb die Zeit später in der Arena überstehen können. Durch einen Zufall kam ich frei und mein Weg führte in die Wildnis zu eben jener verlassenen Burg in den Bergen. Ich presste die Augen zu, wollte mich nicht der Erinnerung stellen. Als ich völlig verstört meinen Weg fortsetzte und das Gesehene und Gehörte in mir arbeitete, war mir klar geworden, warum ich mich nie mit dem Dasein als Sklave des Handelszirkels abfinden konnte: Mir war ein anderer Weg bestimmt. Kopflos tappte ich durch die Welt, zwar als freier, aber ahnungsloser Mann. Bei allem, was ich tat, fiel ich auf: Alltägliche Wortwechsel, Wareneinkauf am Markt, allein dafür, wie ich ging, erntete ich skeptische Blicke. Ich war es einfach nicht gewohnt, mich in Freiheit und in der Zivilisation zu bewegen. Es war nur eine Frage der Zeit, ehe ich wieder geschnappt wurde, aber ich hatte von dem süßen Gefühl der Selbstbestimmtheit gekostet und war ihm hemmungslos verfallen. Seitdem hatte ich einen Entschluss gefasst: Niemals würde ich mein ganzes Leben in Gefangenschaft verbringen. Wofür auch? Nur weil ich in arme Verhältnisse hineingeboren worden war? Nur weil ich einer unliebsamen Abstammung angehörte? Nein, das konnte und wollte ich einfach nicht hinnehmen. Aber ich musste es damals zunächst, denn ich wurde freilich eine ganze Zeit lang strenger und schärfer bewacht als je zuvor. Doch das machte mir nichts, ich verhielt mich ruhig und brav – und lernte. Ich versuchte zu verstehen, wie sich freie Menschen verhielten, wie ein normales Leben funktionierte und so oft es ging, sah ich verstohlen nach links und rechts und prägte mir ein, was ich sah. Zwar lag ich stets in Ketten, aber durch die Handelszüge war ich mehr herumgekommen als so mancher freie Bürger. Ich wollte möglichst viel wissen, um dann bei der nächsten Flucht unterzutauchen. Aber es kam anders und ein paar unschöne Stationen folgten, ehe ich mich nun in meiner aktuellen Lage befand.
Rings herum begleiteten uns die vermeintlichen Expeditionsteilnehmer. Nun, in gewisser Weise handelte es sich immer noch um eine Expedition. Die sechs Wachen bei meinem Wagen, drei links und drei rechts, gaben sich mit Wappenröcken als Angehörige der Arasti zu erkennen. Es gab viele Schwertschwinger, Landsknechte und freie Söldner, aber die Ordenskrieger waren eine Klasse für sich. Die Qel’tar waren große Denker und eindrucksvolle Zauberer, aber kämpfen konnten sie nicht. Die Magie können sie, den Göttern sei Dank, nicht zum Kampf nutzen und für bewaffnete und unbewaffnete Auseinandersetzungen hatten sie weder die Statur noch die Bereitschaft zur körperlichen Ertüchtigung. Es war ihnen wohl zu primitiv, zu schwitzen, sich dreckig zu machen oder vielleicht waren sie auch einfach nur wehleidig. Was auch immer die Gründe waren, diese Nische hatten die Magielosen gefüllt und den Orden der Arasti gegründet. Sie ahnten, dass sie als Gegengewicht zu den Qel’tar funktionieren konnten. Böse Stimmen behaupteten hingegen, dass der Arasti-Orden insgeheim auf Veranlassung der Qel’tar gegründet worden war und bis heute hinter den Kulissen auch von ihnen gelenkt wird. So genau weiß das niemand mehr. Die Qel’tar brauchten jedenfalls eine Kämpfertruppe. Jemand, der auch durchsetzt, was sie beschließen, der für Sicherheit sorgt. Eine Stadt, die sich Arasti als Wachsoldaten leisten kann, ist wohlhabend und genießt einen gewissen Ruf. Egal, wer den Orden lenken mochte, die Arasti-Krieger nehmen sich heraus, auf Augenhöhe mit den Zauberern zu sprechen. Sie hatten rechtzeitig erkannt, wie wichtig sie waren und wollten ihre Machtposition keinesfalls aufgeben. Neben den hohen Anforderungen an die Rekruten waren ausschließlich Magielose zugelassen. Man wollte wohl verhindern, dass die Qel’tar den Orden unterwandern oder etwas dergleichen, anders konnte ich es mir nicht erklären. Die Arasti bei meinem Wagen trugen die Wappenröcke in unterschiedlicher Farbe: Jene Frau, die mir bereits aufgefallen war, trug ihn in Silber, ihre Begleiter in Schwarz. Also musste sie die Anführerin sein. Stoisch starrte sie nach vorn und schritt entschlossen voran. Die übrigen Wachleute waren weitaus unspektakulärer in ihrem Erscheinungsbild und Verhalten. Sie unterhielten sich lachend, trieben die Gefangenen unnötig zur Eile an und wirkten ungehobelt. Söldner, das einfache Volk. Unter anderen Voraussetzungen hätten sie mir sogar sympathisch sein können.
So gut es ging, machte ich es mir bequem. Der Käfig war so eng, dass ich zwar knapp aufrecht sitzen, meine Beine aber nicht ganz ausstrecken konnte. Der Wagen fuhr ratternd über eine der wenigen gepflasterten Straßen. Die Qel’tar brauchten dank ihrer Reisezauberfähigkeiten keine Straßen, also beschränkten sie den Straßenbau auf ein Minimum. Reiten oder Wandern, diese Art des Reisens war etwas für Magielose, nicht jedoch für die Qel’tar. Doch mit Gefangenen als Anhängsel blieb ihnen nichts anderes übrig. Dementsprechend übellaunig war Tyronnimus’ Gesichtsausdruck, als er sein Pferd neben meinen Wagen lenkte. Seine schulterlangen blonden Haare waren von Grau durchsetzt und wippten im Takt des Ganges.
»Erwacht, Prinzessin?« Er lenkte sich mit Boshaftigkeiten ab.
»Geht’s in deinen Palast?«, fragte ich.
»Oh ja, ein Palast …« Sein spöttisches Lächeln verriet einen heimtückischen Plan und seine dunkelgrünen Augen blitzten für einen Moment diabolisch auf.
»Ist das nicht erniedrigend für dich, so zu reisen?« Ich bohrte ein wenig in der Wunde und prompt erzielte ich Wirkung. Tyronnimus wurde wieder ernst.
»Dein Anblick im Käfig ist die Plackerei wert.«
»Und wie lange werde ich diese Kutschfahrt noch genießen dürfen?«
Erst sah es so aus, als würde mir Tyronnimus lediglich mit einem verachtenden Blick antworten, doch dann rang er sich noch ein paar Worte ab. »Gute zwei Teleportsprünge, dann werde ich dich mit höchstem Vergnügen übergeben.«
Ich lehnte mich näher an die Gitterstäbe heran. »Jetzt will ich aber wirklich wissen, wo es hingeht.« Eine Vermutung hatte ich bereits, aber ich wollte es von ihm hören.
Tyronnimus grinste ungebührlich breit für einen Qel’tar. »Es wird dir gefallen.«
»Wenn die Betten nicht weich sind, bleibe ich nicht.«
»Es ist so genial wie meine Falle für dich.« Er versuchte nicht einmal, seine Überheblichkeit zu verstecken. »Schließlich habe ich einen Ruf zu verlieren.«
»Tatsächlich?«
»Ja, durchaus«, redete Tyronnimus munter mit dem Tonfall des Überlegenen weiter. »Ich habe lange Jahre dafür gearbeitet und konsequent mein Ziel verfolgt.«
»Der letzte Kopfgeldjäger hat auch sein Ziel konsequent verfolgt, bis er Bekanntschaft mit meinem Dolch gemacht hat.«
Tyronnimus betrachtete mich mit belustigtem Gesichtsausdruck. »Den Eifer der einfachen Leute in Ehren, aber sie haben keine Klasse.« Er wurde ernst. »Wenn ich mich einer Sache annehme, hat selbst ein gewieftes Bürschchen wie du keine Chance. Es sind Fälle wie deiner, die mich zu dem gemacht haben, wer ich bin.«
»Ein arroganter Drecksack?«
Nur ein müdes Lächeln kam als Reaktion. »Großmeister der Jagd wäre die richtige Antwort gewesen, aber was erwarte ich bei deinem Bildungsstand? Die schwierigen Fälle bringen einen weiter, diejenigen, die keiner machen will, an denen alle anderen scheitern.« Er hob erklärend und mit Stolz in der Stimme den Zeigefinger. »Wer nach oben will, muss genau hier ansetzen und Erfolg haben. Du bist nicht der Erste und wirst auch nicht der Letzte sein, den ich für immer aus dem Verkehr gezogen habe. Ich finde jeden, Wulferan, mir entkommt niemand.«
»Du bist also ein richtiges Genie«, sagte ich möglichst abwertend und maß ihn mit geringschätzigem Blick. Dieser Tyronnimus hatte alle verachtenswerten Eigenschaften der Qel’tar in überdeutlicher Form in sich vereint. Da konnte man glatt vergessen, dass es eigentlich auch halbwegs nette Zauberer gab. Dann fiel mir etwas auf.
»Sind das spitze Ohren unter deinem Weiberhaar?«, fragte ich und fixierte die Stelle. Tyronnimus blinzelte und mit rascher Geste bändigte er sein Haar. Die Ohren waren verschwunden, dafür war eine leichte Rötung seiner Wangen erkennbar. Ich hatte doch nicht etwa einen wunden Punkt gefunden?
»Sagt man nicht, dass ihr Qel’tar eine Mischung aus Elben und Menschen seid? Dass ihr lediglich eine wirre Laune der Natur seid und die Elben die eigentlichen Zauberer sind?« Das tiefe Rot der Wangen und der schwere Atem von Tyronnimus zeigten mir, dass ich ins Schwarze getroffen hatte. Ich tat, als müsste ich überlegen. »Wie nennt der Volksmund euch doch gleich? Elblinge? Halbelben?« Ich konnte es nicht verhindern, breit zu grinsen, denn ein um Fassung und Würde ringender Qel’tar war ein Anblick für Götter. »Das seid ihr doch im Grunde genommen. Nichts Ganzes und nichts Halbes – nur Mischlinge.« Jeder wusste, wie sehr es die Qel’tar hassten, auf ihre Herkunft angesprochen zu werden und sie verabscheuten es noch mehr, wenn man die Elben über sie stellte. Auch einen Großmeister des Zirkels der Jagd konnte man damit aus der Ruhe bringen.
»Jetzt werde nicht frech, Abschaum«, brüllte Tarlin mit bösem, beinahe besessenem Blick. »Wir vereinen das Beste von beiden Rassen in uns. Wir haben die Zauberkunst weiterentwickelt, verbessert und perfektioniert.« Er spie mit den Worten auch Spucke aus, so sehr vergaß er sich. »Und was redet da überhaupt einer wie du von diesen Dingen, einer, der davon so weit entfernt ist, wie das Land von den Monden, die nachts über uns stehen? Dein wurmstichiger Verstand ist vollständig mit Atmen, Nahrungsaufnahme und Bewegen ausgelastet, da bleibt nicht mehr viel Kapazität für geistige Leistung, nicht wahr?!« Sein Blick bohrte sich wie ein Schwert in mich. »Du hältst mich nur für einen beliebigen Zauberer, die du so hasst. Einen besseren Kopfgeldjäger, nicht mehr, aber ich sage dir, da irrst du dich. Ich jage nicht nur einfach Leute, ich spüre sie nicht nur einfach auf und ziehe sie aus den Löchern, in die sie sich verkrochen haben. Ich zerstöre sie! Wenn ich will, werde ich jeden finden, der dir jemals lieb und teuer gewesen ist. Deine Eltern, deine Geschwister, deine Freunde? Wenn ich will, werde ich sie alle finden und ihre Leben zerstören, nur damit alle Spuren, mit denen du unsere schöne Welt besudelt hast, genauso verschwinden wie du. Du hast keine Ahnung, zu was ich fähig bin.« Er holte Luft und versuchte seinen Zorn zu zügeln. Sein geringschätziger Blick glitt über mich. »Für wen hältst du dich, Yborianer? Was glaubst du, seid ihr? Einfältige, plumpe Gestalten, die einstmals vom Dunklen Ozean hätten besser verschlungen als ausgespien werden sollen.« Er lehnte sich weit in meine Richtung. »Euch gibt es nur, um uns zu dienen, götterverfluchtes dämonenverseuchtes Pack.«
Das saß. Mit aufgerissenen Augen testete ich unvermittelt, ob ich mit meinen Armen durch die Gitterstäbe kam. Recht gut sogar und um ein Haar hätte ich ihn zu fassen gekriegt. Tyronnimus zuckte zurück und veranlasste sein Pferd zu einem erschrockenen Satz zur Seite. Er lächelte triumphierend, weil er es geschafft hatte, mich ebenso aus der Fassung zu bringen, wie ich ihn. »Netter Versuch, Dämonenabfall. Du wirst deinem Ruf gerecht.«
Ich fixierte ihn und stellte mir vor, wie meine Dolchklinge seine Kehle durchdrang. Mehrmals.
Er begegnete meiner Wut mit herablassender Ignoranz, ehe er seinem Reittier unsanft die Sporen gab und wenig elegant im Sattel sitzend nach vorne preschte. Ich fiel aufgebracht in meine sitzende Haltung zurück und starrte ins Leere. Mein rechtes Bein wippte zornig und meine Kiefer mahlten aufeinander. Er hatte recht, wir Yborianer waren anders. Wir waren auch Mischlinge. Ich beruhigte mich mit dem Versprechen an mich, auch dieses Mal die Freiheit wiederzuerlangen. Es gab immer einen Weg, und ich würde ihn finden. Und dann? Zumindest dieser Tyronnimus Tarlin sollte mir dann besser nicht mehr begegnen.