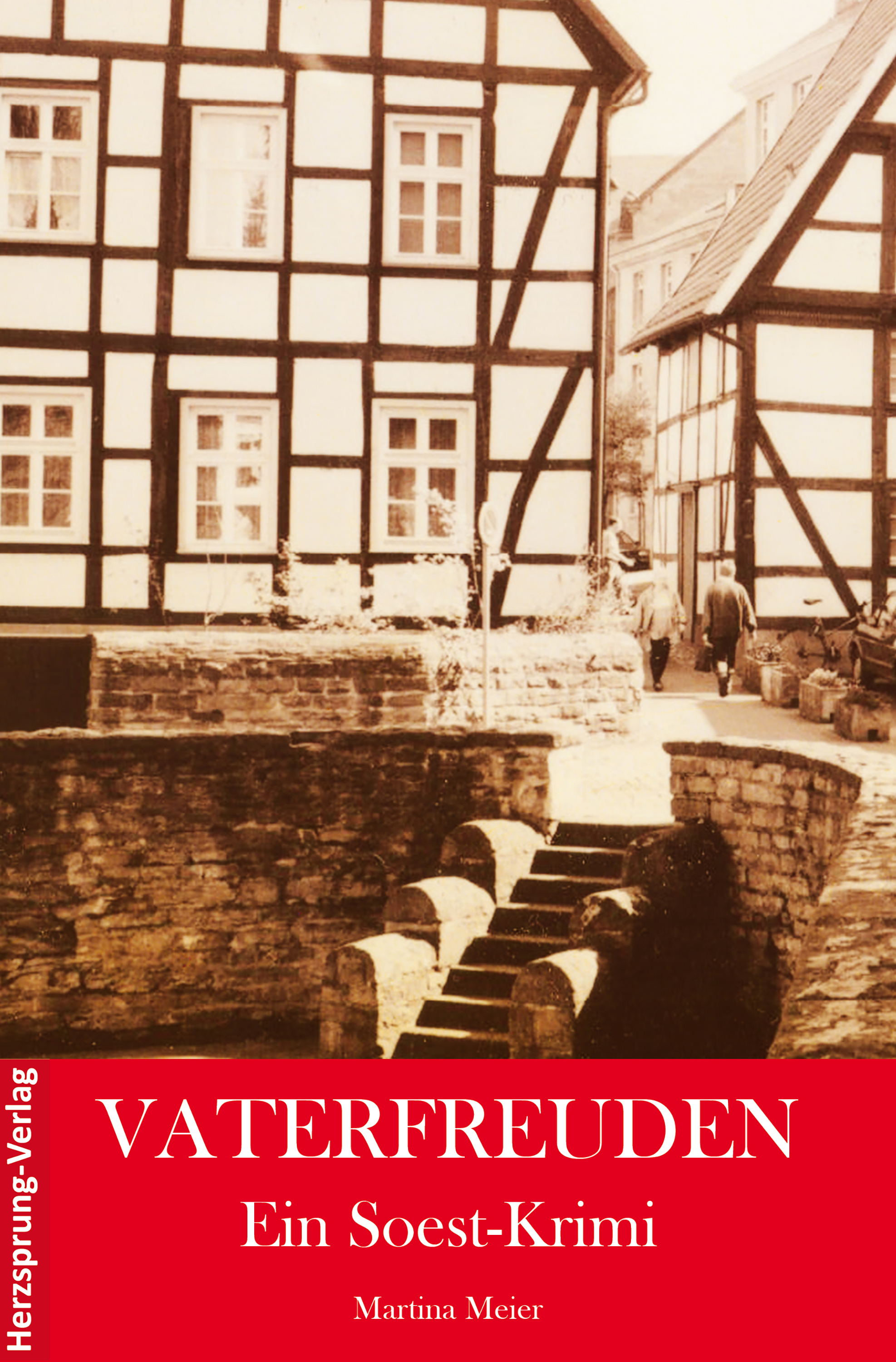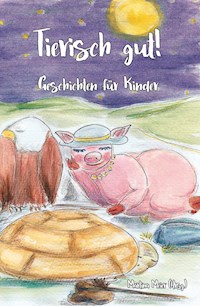9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Papierfresserchens MTM-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Der Untertitel „Märchen für Herz und Seele im Jahresreigen“ zeigt es an: Die Märchen des vierten Bandes der Reihe „Wünsch dich ins Märchen-Wunderland“ entführen ihre Leserinnen und Leser in eine Welt voller Magie und fantastischer Wesen – gefühlvoll und tiefgehend, mit Geschichten rund ums Jahr. Zwölf Monate lang begleiten die Märchen alle, die sich darauf einlassen möchten. Zwölf Monate voller magischer Momente, voller Liebe, Tragik und Mut, Erzählungen für Klein und Groß – eben für alle, die sich auch in unserer hektischen Zeit noch auf das Alte, das Unerklärliche einlassen möchten. Märchen transportieren wichtige Inhalte, die nicht nur die Fantasie anregen, sondern auch die Empathiefähigkeit fördern. In diesem Sinne wünschen wir viel Freude beim Lesen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
o
Wünsch dich ins Märchen-Wunderland
Märchen für Herz und Seele im Jahresreigen
Band 4
Martina Meier (Hrsg.)
o
Impressum
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet - papierfresserchen.de
Herausgegeben von CAT creativ - www.cat-creativ.at
im Auftrag von
© 2023 – Papierfresserchens MTM-Verlag GbR
Mühlstr. 10, 88085 Langenargen
Alle Rechte vorbehalten. Taschenbuchauflage erschienen 2022.
Herstellung und Lektorat: CAT creativ - www.cat-creativ.at
Illustrationen und Cover: © Elena Schweitzer - alle Bilder Adobe Stock lizenziert
ISBN: 978-3-99051-103-9 - Taschenbuch farbig
ISBN: 978-3-99051-104-6 - Taschenbuch schwarz-weiß
ISBN: 978-3-99051-105-3- E-Book
*
Inhalt
Januar
Die drei goldenen Schneeflocken
Grischkas Geschichte
Schneezauber
Februar
Der Stern, der sein Funkeln verlor
180 Grad
Die Tauben der Uhr
Wie der Mond zum Licht in der Nacht wurde
Als Wolf und Mond gemeinsam heulten
März
Der Schönheit beraubt
Ein Herzenswunsch
Der Schrecken des Waldes
Um keine Ausrede verlegen
Der Sohn
April
Hannas Abenteuer
Magier im Schatten
Mai
Die Weggefährtin des jungen Prinzen
Kleine und große Werke
Kiwittchen, die Eule
Mathilda, die gute Fee
Juni
Die Meerjungfrau und der Prinz
Zauberhafte Unterwasserwelt
Vasana und der Regenbogenkristall
Poseidon und die Zeitreisen
Juli
Wolkenschafe
Der magische Spiegel
Oskars Wunderkamera
Tropfs wundersame Reise
August
Die Liebenden der blauen Stunde
Der Nichtsnutz im Wald
Das verschenkte Herz
Violetta und der Lichtelwichtel
Ellas Licht
Das Schloss am Zauberwald
Die gute Fee und das Versprechen
Maja und die Einhörner
Der Herbstreigen
September
Magdalena alleine in der Dunkelheit
Zeit, wie bist du still
Oktober
Kunibert geht auf Weltreise
Mäuschens große Reise
Rasanta
Fast wie im Märchen
November
Der Gärtner mit dem Kürbiskopf
Hinter der Tür
König Spuk und Prinzessin Raji
Erna und Bruder Zorn
Mia und Flederike
Weichei und das Kürbisfest
Meister Petz hat Angst
Dezember
Hurra, es schneit
Ein Wintermärchen im Dezember
Der kleine Wunsch
Es weihnachtet schon wieder sehr
Marie und das Puppenhaus
Weihnachtssterne für Debbi und Lilli
*
Januar
*
Die drei goldenen Schneeflocken
In einem fernen Land, weit hinter den letzten Wäldern, lebte einst eine kleine Prinzessin. Die Prinzessin hörte auf den Namen Benedikta und war seit dem Tage ihrer Geburt ein neugieriges und ein fröhliches Mädchen. Sie liebte den Winter über alles, ganz besonders den funkelnden Schnee. Prinzessin Benedikta hatte einen Gefährten. Schneehase Mo war, bis auf seine schwarze Stupsnase und die hellgrauen Löffelohren, ebenso weiß wie der Schnee im Königreich. Mo begleitete Prinzessin Benedikta auf Schritt und Tritt, sogar sein Hasenbettchen stand neben dem ihren. Sie teilten alles miteinander und hüteten ein großes Geheimnis. Was niemand wusste, war, dass Prinzessin Benedikta die Gabe hatte, sich mit Mo unterhalten zu können. Sie verstand alles, was er ihr sagte. Und er verstand sie.
Prinzessin Benedikta lebte mit ihren Eltern sehr zurückgezogen im Königreich. König Immanuel und Königin Loretta verbrachten ihren Alltag still nebeneinander. Vor allem die Königin war oft traurig, doch niemandem verriet sie, was der Grund für ihre Traurigkeit war.
Prinzessin Benedikta war sehr hartnäckig und fragte mindestens einmal am Tag: „Mutter, warum bist du so traurig?“
Königin Loretta strich dann sanft über das braune, lange Haar der Prinzessin und antwortete: „Hach, wenn ich das nur selbst wüsste.“ Die kleine Prinzessin war schlau und ihr größter Wunsch war es, den wahren Grund herauszufinden, um ihre Mutter eines Tages wieder zum Lachen bringen zu können.
Auch die Mägde und Knechte auf dem Schloss waren vor Prinzessin Benediktas Fragen nicht sicher, nur der grummelige Wärter Bartholomäus, um den machte sie einen großen Bogen. Er war immer schlecht gelaunt, schaute düster unter seiner Haube hervor und sein zotteliger Bart war so lang, dass er bis zum Bauchnabel reichte. Bartholomäus war eine unheimliche Gestalt. „Als Nachtwächter muss er grimmig dreinschauen“, dachte sich die Prinzessin, „damit sich niemand traut, ins Schloss einzubrechen.“
Eines Nachts, der Mond leuchtete hell beim Fenster herein und es schneite in dichten Flocken, konnten Prinzessin Benedikta und Mo nicht einschlafen. Zudem hatte die Prinzessin am nächsten Tag ihren zehnten Geburtstag und war schon etwas aufgeregt. „Komm, lass uns durchs Schloss geistern!“, rief die kleine Prinzessin ihrem Hasen zu und Schwupp machten sich die beiden auf den Weg.
Im Dunkel der Nacht war ein merkwürdiges Geräusch aus dem Schlossgarten zu hören. Neugierig schauten Prinzessin Benedikta und Mo um die Ecke. Sie sahen Bartholomäus, der eine Schaufel in seinen Händen hielt, und eine Holzkiste, die er in ein tiefes Loch vor sich legte und dann hastig alles wieder mit Schnee bedeckte.
Prinzessin Benedikta fragte Mo leise: „Was könnte der Grummelwächter wohl in der Kiste versteckt haben?“
Mo zuckte nur mit seinen großen Hasenlöffeln und sagte: „Wir warten, bis er weg ist, und dann graben wir die Kiste aus.“
Als sich Bartholomäus aus dem Garten zurückzog und seinen nächtlichen Kontrollgang fortsetzte, tapsten die kleine Prinzessin und ihr bester Freund zu jener Stelle, an der die Kiste vergraben war. Mo buddelte eifrig mit seinen Pfoten, sodass der Schnee durch die Luft wirbelte. Sie mussten sich beeilen, denn Bartholomäus brauchte für eine Kontrollrunde um das Schloss nicht allzu lange, denn er machte riesengroße Schritte. Plötzlich hatte Mo die Kiste ausgegraben und Prinzessin Benedikta öffnete aufgeregt den Deckel. In ein Tuch eingehüllt lag eine Schneekugel aus Glas. Sie hatte einen Schraubverschluss zum Aufdrehen, doch die Kugel war leer. Es war noch eine Schriftrolle in der Kiste, mit einer schwarzen Schleife versehen. Prinzessin Benedikta öffnete die Schleife und zog die Schriftrolle auseinander, um die Botschaft zu lesen. In schwungvollen Lettern stand geschrieben:
Für den Finder oder die Finderin
Am zehnten Geburtstag von Prinzessin Benedikta fallen in der Vollmondnacht über dem Schlossgarten drei goldene Schneeflocken vom Himmel. Sie müssen eingefangen werden und vor Sonnenaufgang im Glas versiegelt sein, um das Königsschloss vom Fluch des dunklen Zauberers zu befreien. Wenn es dir gelingt, die goldenen Schneeflocken einzufangen, wird ein Wunder geschehen. Wenn es nicht gelingt, wird der Fluch für immer über dem Schloss und der Königsfamilie bestehen bleiben und der dunkle Zauberer Bartholomäus wird Herrscher über das Königreich sein. Königin Loretta, die sich einst für König Immanuel entschied, wird von jenem Tag an Bartholomäus gehören und König Immanuel wird an einen geheimen Ort verbannt, an dem er niemals wieder gefunden wird.
Wer diese Zeilen liest, muss die drei goldenen Schneeflocken fangen oder möge für immer über das Schicksal des Königreichs schweigen.
Prinzessin Benedikta und Mo sahen einander an und verstanden sich auch ohne Worte. Die Schneekugel fand flugs Schutz unter ihrem Mantel. Plötzlich hörten sie ein lautes Knacken und sahen einen Schatten hinter dem Turm hervorkommen.
„Benedikta, beeil dich, Bartholomäus kommt zurück!“, säuselte Mo aufgeregt. Die Schriftrolle legten sie wieder in die Kiste, diese verstauten sie im Graben und dann häuften sie den Schnee darüber und rannten in den Schuppen, um sich zu verstecken.
Da war ein kleiner Spalt zwischen den Holzlatten. Prinzessin Benedikta und Mo sahen zu, wie Bartholomäus zur geheimen Stelle ging. Sie hielten den Atem an und hofften, dass er die Kiste nicht noch einmal öffnen würde. Das tat er nicht, doch Bartholomäus nahm noch einmal die Schaufel und schöpfte ganz viel Schnee auf die Kiste.
Ein höhnisches Lachen ging durch die Nacht und der mürrische Wächter, der, wie Benedikta und Mo jetzt wussten, eigentlich ein dunkler Zauberer war, glaubte, er sei allein und rief: „Niemand wird die Schneekugel finden! Niemand! Morgen zur Vollmondnacht ist der Spuk zu Ende, dann ich werde Herrscher über das Königreich sein und Königin Loretta wird für immer mir gehören, mir allein!“
Prinzessin Benedikta und Mo konnten nicht glauben, was sie gesehen und gehört hatten. Über dem Königreich lag also ein Fluch. König Immanuel und Bartholomäus waren Konkurrenten, was erklären würde, warum sie sich tagaus, tagein aus dem Weg gingen.
Aber warum war Königin Loretta immer so traurig? Diese Frage stellte sich Prinzessin Benedikta, als sie und Mo sich wieder ins Zimmerchen zurückgeschlichen hatten und mit müden Augen in einen tiefen Schlaf fielen.
Am nächsten Tag weckte der Königsgockel mit seinem Geschrei das ganze Schloss auf. Es war der zehnte Geburtstag der Prinzessin und zur Feier des Tages gab es schon zum Frühstück frisch gebackenen Kuchen, Plätzchen und heiße Schokolade. Alles war schön dekoriert und die kleine Prinzessin freute sich sehr.
„Wie schade, dass keine anderen Kinder auf dem Schloss leben“, dachte sie sich. „Aber zum Glück habe ich dich, lieber Mo!“, sagte Prinzessin Benedikta und küsste seine schwarze Stupsnase.
Königin Loretta bemühte sich an diesem Tag, etwas fröhlicher zu sein, aber wenn niemand hinsah, blickte sie traurig zum Fenster hinaus und schaute den Schneeflocken zu.
Der Geburtstag ging allmählich zu Ende und die Dämmerung setzte ein. Bartholomäus machte sich an diesem Tag schon früher auf den Weg, um seine Runden zu drehen.
Als alles still war, schlichen sich Prinzessin Benedikta und Mo aus dem Schloss und gingen in den Garten. Wie gut, dass es schneite und der Vollmond vom Himmel schien. Mo hielt Wache und Prinzessin Benedikta ließ es sich nicht nehmen, einen ihrer geliebten Schneeengel zu machen, bevor sie Ausschau nach den goldenen Schneeflocken hielt.
Und siehe da, eine große, wunderschöne und funkelnde Schneeflocke in Gold tänzelte langsam herab und Prinzessin Benedikta fing sie mit der geöffneten Schneekugel auf.
„Mo, schau! Ich habe die erste!“ Beide freuten sich ungemein. Wenig später fiel auch schon die zweite auf die kleine Prinzessin. Sie wusste scheinbar genau, wohin sie fliegen sollte, und mit einem Schlag war auch die zweite goldene Schneeflocke eingesammelt. Auf einmal hörten sie, wie Bartholomäus sich räusperte. Sein Räuspern war unverkennbar, er konnte nur mehr wenige Meter entfernt sein.
„Mo, was sollen wir tun? Da oben, schau, da kommt schon die dritte goldene Schneeflocke. Ich muss sie fangen, aber …“
„Was ist da los!“, brüllte Bartholomäus wutentbrannt, als er die kleine Prinzessin sah, die ihre Schneekugel hinter ihrem Rücken versteckte. „Was hast du hinter deinem Rücken verborgen?“
Mo nahm Anlauf und rannte, so schnell er konnte, auf Bartholomäus zu. Er hüpfte über die Beine des Wächters nach oben und krallte sich im stinkigen Grummelbart fest. Bartholomäus wurde fuchsteufelswild und schüttelte den Kopf so lange und schlug mit seinen Armen um sich, bis ihm schwindlig wurde.
Prinzessin Benedikta nutzte die Gelegenheit und fing die letzte goldene Flocke ein, dann verschloss sie die Schneekugel. Die Schneeflocken im Glas glühten und leuchteten hell und wie von Zauberhand wurde die Nacht zum Tage. Im selben Atemzug glitzerten das ganze Schloss und der Schnee so golden wie die Sonne selbst.
Der König und die Königin kamen aus ihrer Kammer in den Garten und sahen dort ihr Kind, welches mit den funkelnden Schneeflocken in der Hand und großen Augen zusah, wie ihr bester Freund Mo auf einmal zitterte, sich schüttelte und seine Löffelohren kleiner und kleiner wurden. Zisch machte es, Paff, und eine große Glitzerrauchwolke war plötzlich über ihnen. Als diese sich auflöste, stand da ein Junge. Er war gleich groß wie Prinzessin Benedikta und schaute vertraut in ihre braunen Augen.
Königin Loretta lief auf den Jungen zu und umarmte ihn: „Endlich, mein Sohn! Der Fluch ist vorüber!“ Die Königin drehte sich zu ihrer Tochter um und sie lachte so fröhlich, dass allen ganz warm wurde ums Herz, dann legte die Königin ihre Hände auf die Schultern der kleinen Prinzessin. „Meine liebe Benedikta, ich danke dir so sehr! Das ist dein Zwillingsbruder Moritz. Der böse Zauberer Bartholomäus hat ihn nach eurer Geburt in einen Hasen verwandelt, aus Rache, weil ich mich damals für euren Vater entschied.“
„Und jetzt weiß ich auch, warum du immer so traurig warst, Mutter. Du hast um Moritz geweint“, sagte Prinzessin Benedikta leise.
In jener Nacht geschah das Wunder. Das ganze Schloss erstrahlte in den Farben des Himmels und alle fielen sich fröhlich in die Arme, alle – außer der dunkle Zauberer Bartholomäus. Dieser hatte seine letzte Wache gehalten und flog in hohem Bogen für immer aus dem Königreich. Bartholomäus wurde an den geheimsten Ort verbannt und zum Opfer seines eigenen Fluches.
Und wenn sie nicht gestorben sind, geistern Prinzessin Benedikta und Prinz Moritz immer noch im Schlossgarten herum und tanzen glücklich mit den Schneeflocken.
Isa Hörmann: „Ich spüre die Worte, die ich schreibe. Berühren möchte ich. Erkennen. Und manchmal auch Eis brechen ...“ Als Kind liebte Isa Hörmann Märchen ganz besonders. Später las sie diese ihren Töchtern über viele Jahre zum Einschlafen vor. Die Autorin schreibt vorwiegend Prosa und Lyrik. Mit dem Märchen „Die drei goldenen Schneeflocken“ hat sich die Österreicherin erstmalig literarisch in dieses Genre gewagt.
*
Grischkas Geschichte
In den unendlichen Weiten Russlands, im westlichen Ural, fernab von der Stadt Perm, wohnte Grischka, der Bär. Da, wo der Wald am dichtesten ist, hatte er seine Höhle. Und die brauchte er auch dringend. Sie war sein Schutz vor allem und jedem, denn wenn er auch ein Bär war, so war er doch leider ein schrecklicher Angsthase.
Es gab wohl kaum etwas, wovor er keine Angst hatte. Er zitterte schon, wenn er den Schnee klatschend von den Bäumen rutschen hörte. Schlimmer war es, wenn er Tiere traf oder gar Menschen. Letztere gab es allerdings zum Glück sehr selten in dieser einsamen Gegend. Ob Mäuschen oder Wolf oder gar Bären – vor allen fürchtete er sich, nahm Reißaus.
Eigentlich hatte er dazu keinen Grund. Noch nie hatte ihm irgendwer etwas getan. Und er war ja groß und stark. Aber es nützte nichts. Für ihn war die Welt einfach zu gefährlich. So war er immer sehr erleichtert, wenn er seine Höhle wieder erreichte und deshalb verließ er sie auch nur im äußersten Notfall.
Doch nun war gerade dieser eingetreten. Grischka musste erkennen, dass seine Essensvorräte zu Ende waren. Wenn er nicht verhungern wollte – und das wollte er natürlich nicht – musste er hinaus, um sich Futter zu besorgen. Hinaus in die böse Welt. Welch ein Unglück!
Er versuchte, zu schlafen und nicht an seinen Hunger zu denken. Doch schon bald war dieser so heftig, dass er Grischka vor die Höhle trieb. Zitternd machte er sich auf den Weg, kam aber schon nach wenigen Stunden mit Vorräten zurück.
„Nur schnell nach Hause!“, dachte er. Als er in die Nähe seiner Höhle kam, stutzte er. Da waren riesige Fußspuren im Schnee. Was bedeutete das? Es waren zweifelsfrei die Spuren eines Bären! Was suchte der denn hier? Ein unsägliches Angstgefühl stieg in ihn hoch. Bibbernd näherte er sich seiner Höhle.
Da schallte ihm eine dröhnende Stimme entgegen: „Nicht weiter! Verschwinde, so schnell du kannst! Hier ist jetzt MEINE Höhle!“
Grischka konnte sich vor Schreck kaum auf den Beinen halten. Mühsam und zitternd brachte er hervor: „Aber das ist meine Höhle!“
Ein böses, dröhnendes Gelächter war die Antwort. „Jetzt nicht mehr. Weg mit dir, du Elender!“
Es hatte angefangen, heftig zu schneien. Der Eingang der Höhle war im dichten Schneegestöber kaum zu erkennen. Grischkas Fell war voller Schneeflocken. Er spürte es nicht. Er stand wie versteinert. Was sollte er tun? Es war doch seine Höhle! Aber die Angst vor dem anderen Bären wuchs ihm buchstäblich über den Kopf. Wieder überkam ihn das Zittern.
Er drehte sich um und lief blindlings in die Nacht. Er lief und lief. Schließlich fühlte er nur noch eine bleierne Müdigkeit. Unter den ausladenden Ästen einer großen Tanne versteckte er sich, kauerte sich zusammen und schlief sogleich vor Erschöpfung ein.
Als er erwachte, war es schon Tag. Große Traurigkeit und Angst erfüllten ihn ganz. Nein, doch nicht ganz. Er fühlte etwas Fremdes an sich. Was war das? Er schüttelte sich und da flog ein kleiner Vogel aus seinem Fell.
„Ptichka“, sagte Grischka, das ist russisch und heißt kleiner Vogel, „was machst du in meinem Fell? Hast du keine Angst vor mir?“
„Ach nein, Grischka. Ich kenne dich doch. Dir hat ein anderer Bär deine Höhle gestohlen.“ Der Vogel machte eine kleine Pause und fuhr dann fort: „Ich glaube, du hast mehr Angst vor mir als ich vor dir.“
Grischka schämte sich.
„Es war so schrecklich kalt heute Nacht. Danke für dein warmes Fell!“
Da freute sich der Bär. „Ptichka“, brummelte er. „Kleiner Vogel!“
Ptichka setzte sich auf einen Ast, und zwar genau so, dass er Grischka in die Augen gucken konnte. Dann piepste er sehr ernst: „Ich kenne deinen Kummer, natürlich möchtest du wieder in deine Höhle. Ich weiß aber auch, dass du immer Angst hast. Darum traust du dich nicht zurück.“ Er machte eine Pause. Dann sagte er: „Ich glaube, ich kann dir helfen.“
Grischka spitzte die Ohren und brummte erwartungsvoll.
Ptichka sagte: „Es gibt eine Stadt Perm. Sie ist ziemlich weit von hier entfernt. Aber ich bin schon dort gewesen – wir Vögel sind ja beweglicher und freier als die meisten Tiere.“
Pause.
„Also, in Perm gibt es einen großen Bären aus Bronze. Er ist sehr stark. Alle bewundern ihn. Wer zu ihm kommt, der wird auch stark, so heißt es.“
„Wirklich?“, fragte Grischka. „Dann muss ich irgendwie da hin!“ Er fühlte sich geradezu schon bei dem Gedanken daran ein kleines bisschen stärker. „Hilfst du mir, Ptichka?“
„Lässt du mich in der Nacht in deinem Fell schlafen?“
„Ehrensache.“
Und so machten sich die beiden auf den Weg. Sie kamen durch tiefe Tannenwälder, Grischka musste über Berge steigen, er musste eiskalte Flüsse durchwaten, immer wieder schneite es. Der kleine Vogel flog meistens vorneweg. Oft musste Grischka rufen: „Ptichka, warte auf mich! Ich kann doch nicht fliegen.“ Dann kam Ptichka zurück, setzte sich auf den breiten Rücken des Bären und sang ihm ein kleines Lied zum Trost. Nur selten sahen sie von ferne mal ein Reh oder ein Eichhörnchen. Eigentlich war um sie nur eine große Stille. Trotzdem wich die Angst nicht von Grischka.
In den Nächten versteckten sich die beiden. Am Morgen suchten sie nach etwas Essbarem, das sie teilten. Es gab nicht immer etwas. Aber sie stapften weiter und weiter, viele, viele Tage. Irgendwann sagte Grischka: „Ich kann nicht mehr, ich mag auch nicht mehr. Ich glaube, dein Perm und seinen Bären gibt es gar nicht. Ich will nach Hause.“
„Nein, nein“, zwitscherte Ptichka ganz entsetzt. „Komm nur, wir sind bald da. Wir haben uns doch diese viele Mühe nicht gemacht, um nun kurz vor dem Ziel aufzugeben. Komm, Grischka, komm. Raff dich auf! Du wirst sehen, es ist nicht mehr weit.“
Und wirklich. Nach weiteren drei Tagen angestrengten Laufens durch den tiefen Schnee sahen sie in der Ferne die Silhouette einer Stadt vor sich. „Das ist Perm“ jubelte der Vogel.
Bald schon kamen ihnen auch Autos entgegen, Autos, in denen Menschen saßen. Grischka fühlte wieder die ganz große Angst in sich aufsteigen. Der kleine Vogel merkte das und sagte zu ihm: „Du solltest keine Angst haben. Wir werden uns verstecken und in der Nacht in die Stadt gehen. Da schlafen die Menschen. Der Perm-Bär aber wird da sein.“
Als es richtig dunkel war, gingen sie los. Zum Glück ging bald der Mond auf. So konnte Grischka am Eingang der Stadt das schöne Stadtwappen erkennen: Auf rotem Grund stand ein weißer Bär, der lächelte. Auf seinem Rücken trug er ein Buch mit einem merkwürdigen Kreuz.
„Sieh nur“, flötete Ptichka, „hier ist eine richtige Bärenstadt!“
Grischka freute sich. „Komm auf meinen Rücken, Ptichka. Ich kann dich tragen wie der weiße Bär sein Buch.“ Er fühlte sich ein bisschen mutig. Als er dann allerdings die leeren, breiten Straßen sah, verließ ihn der Mut sogleich wieder. Er drückte sich ganz an deren Rand und wünschte sich, er wäre unsichtbar.
Aber sie trafen keinen Menschen. Ziemlich plötzlich standen sie dann auf einem großen Platz – und da war er, mitten auf dem Platz! Der große Perm-Bär aus Bronze! Er stand unbeweglich. Seine Nase leuchtete golden im Mondlicht. Grischka hielt den Atem an, der durch die Kälte wie eine feine Wolke vor ihm stand. Er konnte keinen Schritt mehr machen, so groß wuchs die Angst in ihm.
Ptichka aber flog zu dem Perm-Bären und begrüßte ihn ganz ohne Furcht. Dann kam er zu Grischka zurück und rief ihm zu: „Komm, Grischka, der Bär erwartet dich!“ Er flog so lange um Gischkas Kopf herum, bis dieser sich endlich bewegte und vorwärts stolperte. „Du musst seine Nase anfassen“, sang der Vogel.
Da stand Grischka nun vor dem mächtigen Bronze-Bären. Schüchtern und vorsichtig hob er seine Pfote und fasste ihm an die Nase.
Nichts geschah.
Grischka schlotterte vor Angst.
„Du musst ganz fest anfassen“, mahnte Ptichka.
Da faste sich Grischka ein Herz und drückte so fest, wie er konnte. Er war dabei so verzweifelt, dass er die Augen zumachte. Plötzlich fühlte er etwas in sich aufsteigen. Er glaubte, zu wachsen. Er hörte den Perm-Bären schnauben. Er atmete tief durch, öffnete die Augen, der Bronzebär sah ihn freundlich an und er war jetzt ganz stark, so stark wie niemals zuvor in seinem Leben. Die Angst war wie verweht.
„Danke, danke“, sagte er zu dem Perm-Bären und dann „Danke“ zu seinem kleinen Freund Ptichka. Und schon hatte er sich umgedreht, um nach Hause zu laufen.
„Danke“, sang auch Ptichka dem Bronzebären ins Ohr, „dass du meinem Freund geholfen hast.“
Dann flog er hinter Grischka her. Frohen Mutes machten sie sich zusammen auf den weiten Heimweg.
Vor seiner Höhle angekommen, richtete sich Grischka mächtig auf. „Komm heraus, du Bär“, dröhnte er. „Dieses ist MEINE HÖHLE.“
Es rührte sich nichts. Grischka ging näher heran, um erneut schrecklich zu brüllen.
Nichts. Mutig ging er bis zum Eingang der Höhle. Sollte der fremde Bär schon freiwillig gegangen sein?
Aber da stand er plötzlich – knurrend und mächtig groß.
Grischka holte Luft und wollte sich auf ihn stürzen. Da hob der Bär die mächtigen Pranken wie zur Abwehr, verließ den Höhleneingang aber nicht. „Komm kämpfen, du Feigling!“, schrie Grischka aufgeregt.
Ptichka flog während dessen aufgeregt über ihm. „Warte noch“, rief er. Da sah er plötzlich zwei kleine Bären am Eingang der Höhle.
Grischka erstarrte bei deren Anblick. „Jetzt begreife ich“, sagte er leise. „Jetzt verstehe ich auch, woher du den Mut hattest, meine Höhle zu besetzen“, wandte er sich an die Bärin.
„Es war durchaus der Mut der Verzweiflung, denn ich brauchte dringend Schutz für meine Kinder“, antwortete sie. „Meine eigene Höhle hatte mir ein böser Bär streitig gemacht. Was meinst du, wie froh ich war, als du fortgelaufen bist! Meine Kinder waren noch so klein, du hättest sie vielleicht getötet, wenn du um die Höhle gekämpft hättest.“
„Siehst du, Grischka“, sang der kleine Vogel, „da war deine Angst doch für etwas nütze.“
Grischka lächelte wie der weiße Bär auf dem Wappen von Perm und sagte zu der Bärin: „Was meinst du? Ist wohl noch Platz für mich in meiner Höhle?“
Renate (Rana) Welk verbrachte ihre Kindheit in Berlin, ihre Jugend in Duisburg. Sie studierte Sozialpädagogik in Berlin und später noch Soziologie und Volkswirtschaft in Köln. Berufliche Erfahrungen sammelte sie auf verschiedenen Gebieten der Kinder-, Erwachsenen- und Behinderten-Arbeit. Seit Ende der Siebzigerjahre leben ihr Mann und sie in Neuss, wo auch ihre beiden Söhne aufwuchsen. Für ihre vier Enkelkinder begann sie mit dem Schreiben und Illustrieren von Kinderbüchern, was sie auch weiterhin tun wird. Auf diesem Weg fand sie aber auch zum Schreiben von Gedichten, Essays und Kurzgeschichten.
*
Schneezauber
Es war einmal ein Dorf, es hieß Schneezauber, dort war immer was los, besonders im Januar, das ist schon grandios. Endlich wieder Schnee nach langer Zeit, das ließ ein Mädchen, sein Name war Lara, wieder glücklich sein. Das Wetter schön, der Himmel blau, mit Freude ging sie aus der Tür hinaus. An diesem Tage wollte das Mädchen viel erleben und auch sehen und wälzte sich schwungvoll im Schnee. Ein Schneehase sah ihr dabei zu, Lara merkte es nicht, denn sie hatte ihre Augen zugemacht. Ihre schönen Sachen waren gerade neu von Mama gekauft, sie machte sich keineswegs etwas daraus! Mit viel Freud war sie wenig später dabei, einen großen Schneemann zu bauen. Einen blauen Eimer platzierte sie auf dem Kopfe, das war wunderbar, es gab nichts Besseres, das war ihr klar. Zwei schwarze Knöpfe zierten die Augen, waren wunderschön, die schönsten Augen der Welt. Eine große Möhre kam als Nase hinzu!
Der Mund – kleine Äste. Ein roter weißer Schal um den Hals durfte auch nicht fehlen, er machte den Schneemann modern, nicht gelogen.
Der Schneemann sah fabelhaft aus, ein Prachtexemplar durch und durch und mit Stock ein besserer Held. Lara klatschte in die Hände, sprang wieder in den Schnee und tat sich dabei nicht einmal weh.
Der Schneehase war immer noch da, er liebte das Spektakel, keine Frage, einfach wunderbar! Lara wollte nicht fort, der Schnee war ihr Freund in jedem Jahr, sie lachte laut und ging erst viele Stunden später mit einem Lächeln nach Haus. Der Schneehase sah ihr traurig hinterher, vielleicht kam sie morgen wieder, er wusste es nicht, er hoppelte fort. Wohin? Ungewiss.
Kristina Plenter, geboren 1981, lebt im Westmünsterland Deutschlands in der schönen Stadt Gronau, die an der niederländischen Grenze zu Enschede liegt. Sie schreibt leidenschaftliche Kurzgeschichten für Kinder und Gedichte. Andere Hobbys sind das Lesen und Malen am Computer. Nimmt gerne an Anthologien teil.
*
Februar
*
Der Stern, der sein Funkeln verlor
Als der Schöpfer der Welt Himmel und Erde erschuf, schenkte er dem Himmel unzählige Sterne. Am hellen Tag sind diese für die Augen der Menschen unsichtbar. Doch mit Beginn der Dämmerung kann der Mensch zunächst das Licht des Abendsterns – so haben die Menschen die Venus getauft – sehen. Er geht als erster am Himmel auf. Mit der Zeit kann man bei klarem Himmel immer mehr Sterne entdecken, die bei Nacht herrlich funkeln.
Ein kleiner Stern, der seinen Platz mitten in der Milchstraße hat, hatte eines Tages genug vom Funkeln. Er wollte endlich einmal nachts ungestört schlafen, so wie es die Menschen und die meisten Tiere auf der Welt taten. Was er nicht wusste, war, dass er nur, wenn er wach blieb und die ihm übertragene Aufgabe erledigte, sein funkelndes Licht der Welt schicken konnte.
Trotzig, wie der kleine Stern war, begab er sich schon am frühen Abend in sein Sternenbett. Heute jedenfalls hatte er keine Lust zu arbeiten! Zunächst genoss er sichtlich seine Ruhe, während die anderen Sterne, einer nach dem anderen, große und kleine, mit der Zeit zu ihrer nächtlichen Reise aufbrachen. Der kleine Stern lag unbeachtet in seinem bequemen Sternenbettchen und schmollte vor sich hin. Mit der Zeit störte es ihn, dass ihn keiner der Sterne wie sonst grüßte und nach ihm fragte.
„Warum nur ist das so?“, überlegte der kleine Stern. Regelrecht einsam und verlassen fühlte er sich. Ärgerlich darüber brummelte er in sich hinein.
Irgendwann kroch er aus seinem Sternenbettchen heraus, um den Sternen nachzublicken, die funkelnd an ihm vorbeizogen und ihn keines Blickes würdigten. Er erschrak, als er plötzlich bemerkte, dass er sich selber gar nicht mehr sehen konnte. Sein funkelndes Sternenkleid war schwarz wie die Nacht. Der kleine Stern fühlte sich im Meer der funkelnden Sternenlichter jetzt erst recht verloren. Der Mond schien ihn zwar an mit seinem fahlen Licht. Doch das konnte ihn auch nicht zum Funkeln bringen. Der kleine Stern wurde ganz traurig, weil er sein schönes Funkeln verloren hatte. Er war besorgt, nachdem er nicht wusste, ob er es jemals wiederbekommen würde. Hilflos und etwas neidisch beäugte er die anderen Sterne auf ihrer nächtlichen Bahn. Als er sie so strahlen sah, wäre er gerne einer von ihnen gewesen. Er erkannte, dass sein Alleingang nicht das Gelbe vom Ei war und er seine Misere selbst verschuldet hatte.
Der kleine Stern fragte den Mond um Rat, in der Hoffnung, dass dieser wusste, wie er sein Funkeln wiederfinden konnte. Der Mond antwortete nicht sofort. Der kleine Stern sah, dass er sichtlich überlegte.
Dann antwortete ihm der Mond: „Ich denke, dass jeder Stern die Aufgabe vom Schöpfer bekommen hat, mit seinem Funkeln dazu beizutragen, dass selbst die Nacht in ihrer Finsternis schön ist. Du aber hast dich mit deinem Verhalten gesträubt, dieser Aufgabe nachzugehen. Vielleicht ist das der Grund, dass du dein Funkeln verloren hast. Ich würde dir vorschlagen, dich heute Abend wieder in die Sterne der Milchstraße einzureihen, wenn sie auf Wanderschaft gehen durch die Nacht. Wenn keine Wolken das Licht der Sterne verdecken, ist die Milchstraße von der Erde aus ganz deutlich zu sehen, weil sie aus einer ganzen Ballung von Sternen besteht. Du bist einer davon. Sei also stolz und reagiere nicht mehr trotzig!“
Der kleine Stern schämte sich, dass er sich so egoistisch verhalten hatte, was zum Erlöschen seines funkelnden Lichtes geführt hatte. Er beschloss, ab dem nächsten Abend wieder gemeinsam mit den anderen die Nacht zu erhellen, so wie es vom Schöpfer her Aufgabe aller Sterne war. Mit diesem Gedanken schlief er ein und träumte vom Zauber seines Funkelns im Weltall.
Gesagt, getan!
Der kleine Stern konnte es kaum erwarten, bis die Nacht kam. Als es Abend wurde, stand er als erster Stern auf der Lauer, um mit dabei zu sein, wenn die Sterne ihre Reise durch die Dunkelheit der Nacht antreten und sie heller machen würden.
Endlich war es so weit. Es wurde immer finsterer auf der Erde und die Nacht brach herein. Und siehe da – sein Sternenkleidchen fing kräftig an zu funkeln, sodass ihm kurz darauf seine kleine Sternenfreundin zurief : „Los geht’s, komm! Ich habe dich gestern vermisst. Wo warst du denn nur? Ich konnte dich nicht sehen!“ Sie nahm ihn an der Hand und zog ihn mit sich fort.
Der kleine Stern war glücklich und schien fortan jede Nacht am Himmel. Und wenn du die Milchstraße siehst, dann winke ihm einmal zu!
Sieglinde Seilerwurde 1950 in Wolframs-Eschenbach geboren. Sie ist Dipl. Verwaltungswirt (FH) und lebt mit ihrem Ehemann in Crailsheim. Seit ihrer Jugend schreibt sie Gedichte. Später kamen Aphorismen, Märchen und Prosatexte hinzu. Ferner fotografiert sie gerne. Bislang hat sie bereits über 200 Gedichte im Internet und diversen Anthologien veröffentlicht.
*
180 Grad
Es war einmal ein Junge namens Andi – und der war faul. Ja, so richtig stinkefaul. Hausaufgaben konnte er überhaupt nicht leiden.
Haus-auf-gaben … dieses Wort bedeutete für ihn seelische Qualen … und Zeitverschwendung. Am schlimmsten war es, wenn es sich um Mathematik-Hausaufgaben handelte. Denn Mathematik interessierte Andi … nicht die Bohne.
„Was könnte ich stattdessen alles machen?“, dachte er. „Computer spielen, fernsehen oder noch besser – einfach gar nichts. Faulenzen, schlafen. Ja, das wäre schön. Aber nein: Ich muss mich mit Winkeln befassen, mit Geraden und blöden Dreiecken. Furchtbar!“
Er erinnerte sich an Papas Worte: „Im Februar gibt es Zwischenzeugnisse. Denk daran. Fleiß bedeutet gute Noten.“
„Ja, ja. Blabla, bäh!“
Am liebsten hätte Andi das Mathebuch sofort wieder zugeklappt und die Hausaufgaben einfach nicht gemacht. Doch er wusste, dass ihm das nur Ärger und Zusatzarbeit einbringen würde, und dafür war er ebenfalls zu bequem.
„Wenn ich die Aufgaben jetzt nicht mache, schimpfen mich meine Eltern aus und mein Lehrer brummt mir bloß Strafarbeiten auf.“ Kurzum: Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich mit der Aufgabenstellung zu befassen.
Die Innenwinkelsumme eines Dreiecks beträgt stets 180 Grad.
Dieser Satz stand rot umrandet in seinem Mathebuch und je länger Andi ihn betrachtete, desto unsinniger kam er ihm vor.
„Woher soll das Dreieck denn wissen, dass die Innenwinkelsumme 180 Grad ergeben muss? Wieso nicht 200 Grad? Oder von mir aus auch 167,39 Grad?“
Er las weiter: „Beweise dies anhand verschiedener Beispiele.“
„Oh Mann, muss das sein? Das ist mir doch egal!“, dachte er.
Er kaute auf seinem Lineal herum und drehte den Bleistift zwischen den Fingern.
Aufgabe a.
Es kostete ihn viel Überwindung, den verlangten 5 Zentimeter langen Strich zu ziehen. Trotzdem tat er es.
„Je schneller ich es hinter mich bringe, desto schneller kann ich tun und lassen, was ich will“, überlegte er. An einem Ende des Strichs maß er laut Aufgabenstellung 70 Grad ab, am anderen 90 Grad.
„Wie lautet der dritte Winkel?“, fragte er sich. Andi legte sein Geodreieck an. Die gezeichneten Linien trafen sich in einem 20-Grad-Winkel.
„70 plus 90 ist 160“, murmelte Andi. „Plus 20 ist 180. Hm, tatsächlich. Na so was!“
Er wagte sich an Aufgabe b und an Aufgabe c. Jedes Mal mit dem gleichen Ergebnis. Egal, wie lang die Linien waren oder welche Winkel er zeichnen sollte: Die Innenwinkelsumme betrug 180 Grad.
„Alles klar. Das ist bestimmt bloß so, weil jemand wollte, dass dieses Ergebnis herauskommt.“ Andis Ehrgeiz war geweckt. „Aber ich lasse mich nicht veräppeln. Ich finde ein Dreieck, auf das diese Regel nicht zutrifft!“
Aufgabe d: Finde eigene Beispiele, die dieses mathematische Gesetz
beweisen.
Er begann mit zwei Geraden, die sich in einem 45-Grad-Winkel kreuzten. Er markierte einen Punkt auf einer der beiden Linien, maß 30 Grad ab … und ärgerte sich darüber, dass sich das neue Dreieck ebenfalls dieser Regel fügte und mit einem 105-Grad-Winkel auf 180 Grad ergänzte.
„Ich dreh durch! Wer sagt diesem blöden Dreieck, dass es sich so verhalten muss?“, ging es ihm durch den Kopf.
Er probierte es mit einem anderen. Und noch einem. Und noch einem und bemerkte dabei gar nicht, dass er ganz vergessen hatte, faul zu sein und Mathematik-Hausaufgaben zu hassen. Er war sogar so sehr mit dem Zeichnen von Dreiecken beschäftigt, dass er beinahe das Abendessen versäumte.
Übrigens: Wenn Andi etwas ähnlich gerne mochte wie Faulenzen, so was das essen.
„Nanu? So viel Ehrgeiz bei Mathe?“ Papa klopfte seinem Sohn auf die Schulter. „Bin stolz auf dich. Weiter so!“
Das ließ sich Andi nicht zweimal sagen. Kaum hatte er seinen Teller leer, hetzte er in sein Zimmer und fuhr munter fort. Immer wieder kam er auf dasselbe Ergebnis: Innenwinkelsumme ist gleich 180 Grad.
„Das darf nicht wahr sein! Warum halten sich alle Dreiecke an diese beknackte Regel? Alle gleich. Alle langweilig. Haben die überhaupt keine Lust, anders zu sein? Besonders zu sein? Wir Menschen sehen doch auch nicht alle gleich aus oder haben die gleichen Vorlieben!“, dachte er.
„Mach nicht mehr so lange, Schatz.“ Seine Mutter hatte gegen neun Uhr nach ihm geschaut.
„Ja, Mama. Ich bin gleich fertig. Gute Nacht.“
„Gute Nacht, mein Junge.“
Andi hatte nur kurz von seinem Zettel aufgeblickt. Irgendwann war er so erschöpft, dass ihm die Augen zufielen und sein Kopf auf das Papier sank. Von einem Piken wurde er geweckt. Mitten in der Nacht. Andi brauchte eine Weile, bis er kapierte, dass er wohl an seinem Schreibtisch eingeschlafen sein musste. Erneut spürte er ein Stechen an seiner Wange. „Aua! Was ist das?“ Er richtete sich auf und rieb die prickelnde Stelle in seinem Gesicht. Dabei fiel sein Blick auf das letzte Dreieck, das er gezeichnet hatte. Zu seiner Überraschung poppte es aus dem Zettel heraus und stellte sich auf. „Hä?“
Der obere spitze Winkel von … was hatte Andi gezeichnet? 15 Grad? Der musste es gewesen sein, der ihn in die Backe gepikt hatte. Nun war dessen Spitze abgeknickt, doch das Dreieck schüttelte sich, beugte sich, streckte sich und war dann wieder ein perfektes Gebilde, dessen Innenwinkelsumme sicherlich ganz genau – nicht mehr und nicht weniger – 180 Grad betrug. Als würde es Andi verhöhnen, schwebte in seinem Inneren … die Zahl 180.
Die Ziffern sortierten sich neu. Während die 8 nach oben rückte, sich waagrecht drehte und augengleich blinzelte, wanderte die 1 unter die umgedrehte 8 und nahm die Position einer Nase ein. Und die 0?
Ja, die wurde zu einem gähnenden Mund, der – Schock lass nach! – tatsächlich mit Andi redete: „Hallo, Andi! Gehe ich recht in der Annahme, dass dich eine gewisse Regelmäßigkeit an uns Dreiecken stört?“
„Öhm.“ Eigentlich störte ihn in diesem Moment bereits die Tatsache, dass überhaupt eine geometrische Figur zu ihm sprach. Das hatte sie gefälligst bleiben zu lassen! Sie sollte sich aufs Blatt zurücklegen und Ruhe geben! Aber Andi war so baff, dass er keinen Ton herausbekam.
„Unsere Innenwinkelsumme ergibt immer 180 Grad. Ja. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, Andi, mit den Füßen wackeln und dir die Haare ausrupfen, wir bleiben trotzdem so. Langweilig nennst du uns? Du hast gesehen: Diese Regel hindert uns nicht daran, groß zu sein oder klein, gleiche Winkel zu haben oder ungleiche. Genauso wie ihr Menschen unterschiedlich seid: im Hinblick auf Haarfarbe, Augenfarbe und Körpergröße. Nichtsdestotrotz seid ihr alle dasselbe: Ihr habt einen Kopf auf euren Schultern sitzen. Ihr atmet, habt einen Blutkreislauf und einen Stoffwechsel. Seid ihr daher alle gleich und langweilig, so wie wir Dreiecke es angeblich sind? Denk darüber nach!“ Das Dreieck legte sich aufs Papier. Es rückte seine Winkel und Linien zurecht und gab sich zufrieden mit sich und seinem verschieden-gleichen Dasein in der Welt.
Und Andi? Der schlüpfte unter die Bettdecke und dachte lange, laaange über die Worte des Dreiecks nach, bis er schließlich einschlief und von Menschen mit dreieckigen Köpfen träumte. Oder von Dreiecken mit Armen und Beinen?
Auf jeden Fall wusste Andi seither, dass Mathematik überhaupt nicht langweilig war und dass es sich lohnte, ab und zu mal nicht faul zu sein. Er wurde Mathematiklehrer.
Und wenn er nicht gestorben ist, so zeichnet er bestimmt noch heute mit seinen Schülern Dreiecke mit einer Innenwinkelsumme von exakt 180 Grad.
Daniela Gessleinwurde 1981 in Oberfranken geboren, wo sie auch heute noch lebt. Sie arbeitet im Hauptberuf als Fremdsprachenkorrespondentin und Exportleiterin. In ihrer Freizeit geht sie gerne mit ihrem Hund spazieren oder schreibt Gedichte, Kurzgeschichten und Romane. Am liebsten Tierisches, Historisches oder Fantasy, gemixt mit viel Gefühl und oft mit einer Prise Humor. Als freie Autorin hat sie via Kindle Direct Publishing (Amazon) zwei Fantasy-Romane veröffentlicht. Einige ihrer Kurzgeschichten sind in diversen Anthologien erschienen.
*
Die Tauben der Uhr
Es waren einmal fünf Tauben aus Bronze, die um die angestrahlte Uhr des Rathauses angebracht waren. Jede volle Stunde nach Mitternacht erwachte eine von ihnen zum Leben, bis um 5 Uhr jede Nacht alle von ihnen um das Rathaus, den Rathausplatz und seine Uhr flogen. Um 6 Uhr, wenn der neue Tag erwachte und die Sonne aufging, kehrten sie flügelschlagend neben die Uhr zurück.
Tauben waren für einen Rathausplatz und seine Umgebung nichts Ungewöhnliches und so interessierte es keinen und dieses Treiben fiel lange Zeit niemandem auf. Bis zu jenem Tag, an dem eines Morgens eine tote, auf dem Rücken liegende Bronzetaube vor dem Rathaus lag. Niemand konnte sich erklären, woher sie stammte oder stammen konnte ...
Die einen hielten das Ganze für einen makaberen Scherz, die anderen glaubten felsenfest, es sei eine der Tauben der Uhr. Doch wieso sollte eine der dort hängenden Tauben, eine tote, auf dem Rücken verendete Taube darstellen oder gewesen sein? Keiner wusste sich Rat oder auf diese Frage eine Antwort. Schon gar nicht der Bürgermeister, dem die tote Taube gar nicht gefiel und sehr sauer aufstieß, weil die nächsten Wahlen in greifbare Nähe gerückt waren ...
Es war eine ältere Frau, die regelmäßig auf dem Wochenmarkt des Rathausplatzes stand und ihre Waren feilbot. Als sie von der Sache hörte, kam ihr die Idee, den Künstler, der die Tauben entworfen und gegossen hatte, nach seiner Meinung zu fragen. Wer außer ihm wusste wohl besser als irgendein anderer, wie die Tauben der Uhr ausgesehen hatten und wie viele es einst gewesen waren. Der Vorschlag wurde umgesetzt.
Tage später kam der inzwischen alte und gebrechliche Künstler, um sich vor Ort ein Bild von der Sache zu machen. Dem alten Mann wurde die Situation erklärt und die tote Bronzetaube gezeigt. Der Künstler ging mit ihnen, vom Haus- und dem Bürgermeister gestützt, vor das Rathaus, um sich seine Tauben anzusehen. Der Künstler wusste wohl, wie viele und welche Tauben er geschaffen hatte, doch bat er darum, sich die Uhr, wie sie jetzt war, ansehen zu dürfen.
„Nun, was meinen Sie? Ist das eine Ihrer Tauben“, wollte der ungeduldige Bürgermeister von dem Künstler wissen.
„Nein, das glaube ich nicht“, antwortete dieser kurz, nachdem er seine Tauben gezählt hatte. „Aber es fehlt trotzdem eine fünfte, das ist mir damals gar nicht aufgefallen. Sehen Sie, dort“, sagte der alte, einfach gekleidete Mann und deutete auf die freiliegende Stelle, an der die Taube einst befestigt gewesen war.
„Tatsächlich“, antwortete der Bürgermeister und der Hausmeister stimmte ihm fast gleichzeitig mit denselben Worten zu.
„Wie wäre es, wenn ich Ihnen diese tote, bronzene Taube einschmelze und daraus die fehlende fünfte für die Uhr machen würde?“, fragte der Künstler den noch amtierenden Bürgermeister.
Dieser fand die Idee gut, ja, er war regelrecht begeistert. Die mysteriöse tote Taube musste wohl doch ein übler Scherz gewesen sein. Er gab die Herstellung einer neuen Taube in Auftrag. Er dachte mit Freuden an seine dadurch entstehende und bald zu erntende positive Publicity.
Der Künstler nahm den Auftrag ebenfalls mit Freuden an, seine Aufträge waren mit zunehmendem Alter immer knapper und schlechter geworden. Er nahm die tote, bronzene Taube mit, um sie in seiner inzwischen heruntergekommenen Werkstatt einzuschmelzen.
Er hatte lang nichts mehr aus Bronze gegossen und so brauchte es viele Stunden, bis er seinen alten Ofen auf Temperatur geheizt und zuvor die passende Form modelliert hatte.
Es war fast schon 3 Uhr nachts, als er die tote Taube vom Tisch nahm und in den Schmelzlöffel legte. Er legte sie eben hinein, als die nah gelegene Kirchturmuhr drei schlug. Aus der bronzenen Taube wurde wieder eine Taube aus Fleisch und Blut. Der Künstler erschrak erst, ehe er verstand. Er wollte alles tun, um nur nicht dem Jüngsten Gericht oder gar dem Teufel vorzeitig ausgeliefert zu werden, weil er dem Bürgermeister in seiner Not eine, wie ihm wohl bewusst gewesen war, verloren gegangene Taube nochmals als Auftrag angeboten hatte.
Er nahm die tote Taube aus dem Gusslöffel, setzte sie auf den Tisch und breitete ihre Flügel mit seinen Händen aus, dann stieß er die Bitte an alle ihm bekannten guten Geister aus. Sie sollten die Taube doch bitte wieder zu sich nehmen, davonfliegen lassen und ihm das vermeintlich bevorstehende Höllenfeuer ersparen.
Er war der Verzweiflung nahe und erschöpft eingeschlafen, als es 6 Uhr schlug. Später erwachte er kniend neben dem Arbeitstisch mit der, wie er natürlich meinte, selbst gefertigten Taube in seiner Hand. Ein Albtraum war es für ihn natürlich gewesen und er hoffte, diesen nie mehr erleben zu müssen. So lieferte er die Taube schnellstmöglich an seine Auftraggeber aus und half ohne zusätzlichen Lohn, sie an der richtigen Stelle anzubringen. Er bestand sogar darauf, sie kostenfrei auf eine sehr aufwendige Art und Weise neben der Uhr zu befestigen. Er wurde daraufhin, nachdem man seinen vermeintlichen Einsatz und Fleiß bewundert und gesehen hatte, für viele weitere Aufträge gewünscht und herangezogen. Von da an blieb der Fleiß und Einsatz neben der wiedergefundenen, nun durch nichts zu erschütternden Ehrlichkeit ein Teil von ihm, bis er starb.
Was können wir, Künstler oder nicht, aus dieser Geschichte Ermutigendes lernen? Wenn nichts mehr geht, die Auftragslage einen verzweifeln lässt, Gott wahrscheinlich schon mal eine bronzene Taube für die Künstler und Tüchtigen dieser Erde vom Himmel fallen lässt.
Simon Käßheimer wurde 1983 in Friedrichshafen am Bodensee geboren, wo er bis heute seine Wurzeln hat. In nähe des Bodensees lebt er inspiriert durch die schöne Landschaft glücklich vor sich hin.
*
Wie der Mond zum Licht in der Nacht wurde
Es war einmal zu einer Zeit, an die sich kein Mensch mehr erinnern kann, da war die Erde noch ganz jung. Sonne und Mond teilten sich den Himmel und standen tagsüber hoch über dem Horizont. Die Menschen freuten sich des Lichts, das die Begleiter am Tag verbreiteten. Sie bauten Altäre und brachten ihnen Opfer dar, auf dass sie nie verschwinden würden. Die Himmelsregenten freuten sich über die Ehrerbietung, die ihnen die Menschen darbrachten.
Doch der Mond bemerkte, dass die Menschen die Sonne mehr verehrten als ihn. „Die Sonne bringt uns Helligkeit und Wärme. Wozu ist eigentlich der Mond gut? Er spendet keine Wärme, lässt keine Pflanzen wachsen. Sein Licht ist so schwach, dass man ihn kaum sieht, seine Gefährtin überstrahlt alles. Lasst uns auf die Ehrerbietung für den Mond verzichten. Er ist zu nichts nütze“, hörte man die Menschen sprechen. Als der Mond das vernahm, wurde er traurig. Es stimmte, wozu war er eigentlich gut?
„Du musst heller leuchten und so warm sein wie ich, dann werden die Menschen dich auch schätzen“, ermunterte die Sonne ihren Gefährten. „Du bist zu blass! Sieh dir meine Pracht an“, meinte sie stolz. Die Sonne hatte recht. Vielleicht war das die Lösung. Er würde es versuchen.
Am nächsten Tag strengte sich der Mond richtig an. Er wurde groß und rund. Er leuchtete, bis er vor lauter Anstrengung ganz rot wurde. Doch was immer er auch tat, die Sonne überstrahlte ihn einfach. Schließlich konnte er nicht mehr. Leise weinte er über die Ungerechtigkeit der Welt.
„Sei nicht traurig, Mond. Nicht jeder kann so golden glänzen wie ich“, tröstete die Sonne ihren Gefährten.
Doch der Mond schluchzte laut. Er fühlte sich so nutzlos. Niemand brauchte ihn. Es wäre besser, er würde verschwinden. Traurig wandte er sich von der Erde ab, um in die Tiefe des Himmels zu ziehen. Vielleicht fände er eine neue Aufgabe.
Staunend blickte sich der Mond um. Überall leuchteten die Sterne, im Hintergrund blinkte das glitzernde Band der Milchstraße. Auf der Erde hatte er nur zu den Menschen am Boden geblickt. Hier im Himmel war es wunderschön. Warum war er nicht schon früher hier hinaus gereist? Wenn man immer nur in eine Richtung blickte, sah man nicht, welche Schönheit es anderswo gab. Würde er hier eine neue Aufgabe finden? Wohin sollte er sich wenden? Am besten begab er sich zum nächsten Stern.
Proxima war ein seltsamer Stern. Er war klein und rot, überhaupt nicht wie die Sonne. „Oh, ein Besucher. Es ist lange her, dass ich jemanden Neues sah. Willkommen, woher kommst du?“, wollte er neugierig wissen.
„Ich bin der Mond der Erde und auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Auf der Erde mögen mich die Menschen nicht. Sie verehren nur die Sonne“, stellte sich der Mond erwartungsvoll vor.
Proxima sah den Mond verwirrt an. „Ich bin Proxima. Hier wird der Himmel als Ganzes verehrt. Bist du wirklich ein Mond? Du bist so groß“, erwiderte der Stern überrascht.
Der Mond nickte. „Meinst du, deine Welt braucht einen Mond?“, wollte er hoffnungsvoll wissen.
Proxima blickte seinen Besucher nachdenklich an. „Die Proxima sind Pflanzen. Sie verehren alles Licht, es gibt ihnen Kraft. Wenn du für sie leuchten kannst, so werden sie auch dich ehren. Ich freue mich über Gesellschaft“, erklärte er umgänglich.
„Vielen Dank, Proxima, vielleicht können wir ja Freunde werden“, erwiderte der Mond glücklich. Zufrieden gesellte sich der Mond zu seinem neuen Freund. Er leuchtete genauso hell wie dieser, wenn er selbst auch weiß strahlte und nicht so mattrot wie Proxima. Neugierig blickte er zu seinem neuen Volk hinab. Erfreut sah er, wie sich die Blätter des Pflanzenvolkes ihm entgegenreckten, sein weißes Licht zu empfangen. Endlich war er mit einem gleichberechtigten Partner zusammen und nicht nur Anhängsel des helleren Sterns. Bestimmt konnten sie gute Freunde werden und gemeinsam für die Proxima sorgen.
„Oh nein, nicht schon wieder!“, murmelte der Stern auf einmal. Mit einem Mal blähte er sich hell strahlend auf. „Hatschi!“, nieste er und stieß eine Glutfontäne aus, die den Planeten und den Mond trafen.
„Aua!“, rief der Mond, als die Sternenmaterie ihn traf.
Proxima blickte seinen neuen Begleiter schuldbewusst an. „Tut mir leid, das ist das Alter. Ich habe immer wieder Niesanfälle. Oh nein, da kommt noch einer!“, näselte der Stern, während er versuchte, das Niesen zu unterdrücken.
Der Mond hatte nicht vor, eine weitere glühend heiße Ladung abzubekommen, und floh auf die Nachtseite des Planeten. Diesmal hatte er mehr Glück. Jetzt traf Proximas Ausstoß nicht ihn, sondern nur den Planeten. Doch eins war für den Mond jetzt auch klar. Er konnte hier nicht bleiben. Nicht, dass Proxima nicht nett war, und bestimmt konnte er sich mit dem alten Stern befreunden, aber der war krank und konnte seine Materieausstöße nicht kontrollieren. Selbst wenn er nichts Böses wollte, würde er den Mond doch verletzen. Ratlos blickte er auf den Planeten hinunter.
Doch was war das? Die Pflanzen auf der Nachtseite streckten sich ihm trotzdem entgegen, als wäre er der Stern und nicht Proxima. Offenbar begehrten sie sein Licht. Der Mond blickte sie staunend an. „Wieso reckt ihr euch so nach mir?“, wollte er wissen.
„Wir brauchen Licht. Du bist ein Lichtbringer, wie es auch Proxima einer ist. Doch du verbrennst uns nicht wie Proxima. Bleibe bei uns und segne uns mit deinem Licht“, baten die Pflanzen.
„Das täte ich gern, doch Proxima verbrennt auch mich mit seiner Glut. Er ist alt und krank“, entgegnete der Angesprochene entschuldigend.
Der Feuersturm war vorüber. Vorsichtig ging der Mond wieder auf die Vorderseite.
„Ich hoffe, du verzeihst mir. Das ist meine Krankheit und passiert mir immer wieder. Den Proximapflanzen macht das nichts aus, sie ernähren sich von meiner Strahlung. Ich hoffe, ich habe dich nicht verletzt“, bat der Stern unglücklich.
Der Mond hatte Mitleid mit ihm. Doch er konnte ihm keine Gesellschaft leisten. „Tut mir sehr leid, Proxima, ich mag dich wirklich, aber du tust mir weh. Ich würde wirklich gern bei dir bleiben, aber ich kann nicht. Ich hoffe, du verzeihst mir“, erklärte der Mond traurig.
Der Stern blickte seinen neuen Begleiter betreten an. „Ich verstehe dich gut. Ich hoffe, du findest eine neue Heimat. Mach’s gut und vergiss mich nicht“, verabschiedete er sich.
„Niemals“, versprach der Mond. Er wandte sich ab und verließ das Proxima Centauri-System.
Der Mond glitt durch die Weite des Alls. Wohin sollte er? Doch nach Hause? Aber was sollte er dort? Niemand brauchte ihn. Also blieb ihm nur eins: tiefer in das Sternenmeer hinein, weiter zum nächsten Stern. Irgendwo musste man ihn doch benötigen!
Doch was war das? Der Mond hatte einen Schatten gesehen, der ihm folgte. Wer sollte ihn hier draußen suchen? Er würde einfach warten. Da war der Schatten wieder. Er flog direkt auf ihn zu. Offenbar war es wirklich jemand, der zu ihm wollte. Der Mond wandte sich dem Schatten zu und flog ihm entgegen.
„Mond!“, rief der Fremde.
Der Mond wunderte sich. Er hatte diesen seltsamen Gesellen noch nie gesehen. Er war wie einer der kleinen Asteroiden, sah aber ganz anders aus und er war hier viel zu weit weg. Die meisten Meteore und Asteroiden waren Kindsköpfe. Wann immer der Mond versucht hatte, mit ihnen zu reden, kamen nur Streiche, Späße und Witze dabei heraus. Irgendwann hatte der Mond es aufgegeben. Dieser Bursche war anders. Doch woher kannte er ihn?
„Mond, endlich habe ich dich eingeholt. Ich bin Oumuamua und Wanderer zwischen den Sternen. Ich komme von weither und habe euer Sonnensystem besucht, weil ich neugierig war. Auf eurem bewohnten Planeten herrscht Chaos“, rief er eindringlich.
„Was habe ich damit zu tun?“, wunderte sich der Mond.
Oumuamua blickte ihn nachdenklich an. „Ich bin nicht ganz sicher. Die Sonne hat mir erzählt, kurz nachdem du verschwunden bist, wäre die Erde aus dem Gleichgewicht geraten. Ihre Rotation ist unberechenbar, die Erdachse hat sich verschoben und nun herrscht totales Wetterchaos, die Menschen stehen vor dem Untergang. Die Sonne konnte das nicht aufhalten“, erläuterte der Asteroid.
Sollte das etwa heißen, man brauchte ihn doch? Die Menschen würden ihn bestimmt auch dann nicht verehren, wenn er zurückkehrte.
„Denke nicht schlecht über die Menschen. Die Sonne überstrahlt dich eben. Wie wäre es, wenn du dich auf der Nachtseite aufhalten würdest? Kein Stern leuchtet heller, als du“, schlug der interstellare Wanderer vor.
Erstaunt blickte der Mond den Besucher an. Das war die Idee! Die Menschen lebten nachts im Dunkeln, doch er konnte das ändern. Seine Leuchtkraft würde bei Nacht alles überstrahlen. „Ich danke dir, Oumuamua. Du hast mir gezeigt, dass ich nicht nutzlos bin. Ich werde den Menschen bei Nacht leuchten. Bestimmt werden sie das zu schätzen wissen“, bemerkte der Mond erfreut. Jetzt musste er nur noch nach Hause.
Bald war der Mond in das Sonnensystem zurückgekehrt. Voller Sorge sah er, wie die Erde hin und her schwankte. Entschlossen näherte er sich der Nachtseite und begann, die Erde festzuhalten. Bald schon war der Globus wieder im Gleichgewicht. Der Mond blickte zufrieden auf die nächtliche Erde hinab. Er hatte doch eine Aufgabe, der Erde Stabilität zu geben. Das konnte die Sonne nun wirklich nicht. Jetzt konnte er den Menschen in jeder Nacht ein Licht sein.
Mit Freude blickte der Mond auf die Erde hinab. Die Menschen hatten erkannt, was er für sie tat, und Mondaltäre gebaut. Nachts blickten sie zu ihm auf und dankten ihm für sein Licht und dafür, dass er die Erde stabil hielt. Der Mond war so glücklich wie nie zuvor. Endlich hatte er eine Aufgabe. Auch seine Freundin, die Sonne, besuchte er noch manchmal. Inzwischen behandelte sie ihn nicht mehr von oben herab, sondern bewunderte ihn.
So leuchtete der Mond des Nachts und die Sonne am Tag und beide hatten ihre Aufgabe. Und da sie nicht gestorben sind, leuchten sie noch heute.
Florian Geigerwohnt in Lörrach im Wiesental und wurde 1982 in Heidelberg geboren. Er schreibt schon seit seiner Kindheit gerne Geschichten, besonders in den Bereichen Science-Fiction und Fantasy. Bisher konnte er Kurzgeschichten in verschiedenen Verlagen veröffentlichen. Website: floriantobiasgeiger.jimdofree.com/
*
Als Wolf und Mond gemeinsam heulten
Die Wölfin war alt und grau. Um ihre Schnauze rankten sich helle Haare – im Mondschein wirkten sie manchmal, als hätten sie dieselbe Farbe wie die silbernen Strahlen. Und dann zog die Sonne auf und das Haar an ihrer Schnauze bekam die matte Farbe von Gestein, das schon seit hundert Jahren unter dem Himmel wartete.
Es gab Tage, da schleppte die alte Wölfin sich zu einem See und wartete auf die Nacht. Wie die Berge warteten. Ewiges Warten. Und wenn die Nacht endlich kam, war sie zu erschöpft, um den Kopf zu heben, und konnte nur die Spiegelung des Himmels sehen. Verschwommene Sterne, vernebelter Mondschein, Wellen, die jede Klarheit raubten.
Zwischen den Bergen lebten Menschen. Seit Generationen lebten sie dort. Manchmal flüsterten die Bäume von einer Zeit, in denen die Menschen noch von Ort zu Ort gezogen waren. Manchmal erzählten die Steine von einer Zeit, in denen es noch keine Menschen gegeben hatte.
Die Wölfin erinnerte sich nicht an diese Zeit. Sie erinnerte sich an Feuer und Hörner, die durch die Nacht klangen. Sie erinnerte sich an laute Musik, die sie und ihre Welpen verscheuchte, und lautes Wehklagen, wenn einer von ihnen sich zum Sterben hinlegte. Die Wölfin bewegte sich nicht mehr vom See weg. Sie lag dort, den Kopf auf den Pfoten, die graue Schnauze dem Wasser zugeneigt und wartete. Rehe, auf ihren dünnen Beinen, stakten grazil auf den See zu und tranken. Von der Wölfin ging keine Gefahr aus. Sie war zu alt. Und die Wölfin sog den Duft der Rehe ein und nährte sich von ihren Erinnerungen.
Eines Abends drang ein neuer Geruch an ihre Nase. Er war ungewöhnlich genug, dass die Wölfin den Kopf hob. Er war so sehr mit Gefahr verbunden, dass die Wölfin die Lefzen hochzog und ihr tiefes Knurren sich mit der Musik der Nacht verband.
Am Rand ihres Sees, gerade außerhalb des Lichtscheins, stand eine Menschenfrau. Und sie zuckte zurück, als fürchte sie, von dem Mondschein verbrannt zu werden. Die Wölfin zog die Lefzen noch etwas höher, doch ihr Knurren wurde leiser. Es war nur ein einziger Mensch. Und dieser hatte dasselbe Recht wie sie, sich an diesem See aufzuhalten.
Die Frau beugte sich über die Wasseroberfläche und schöpfte die tintenschwarze Flüssigkeit, um von ihr zu trinken. Dabei verließen ihre Augen nie die alte Wölfin, die im Mondlicht auf sie wartete. Schließlich richtete sich die Frau wieder auf und trat vor. Mondschein prasselte auf sie hinab, hüllte sie in ein Gewand aus silbernem Licht und brachte ihr Haar zum Leuchten. An ihrem Gürtel hing ein rostiges Schwert, um ihren Hals ein Glücksbringer aus Eichenholz und ihr Umhang hatte die Fähigkeit, sie vor bösen Augen zu schützen. Doch die Wölfin konnte er nicht täuschen.
Sie streckte sich aus und legte den Kopf wieder auf den kalten Boden, ein Auge auf die Sterne gerichtet, die sie so lange nur als Spiegelung gesehen hatte.
„Du bist alt, oder?“, fragte die in Mondschein gebadete Frau. „Ich tu dir nichts, wenn du mir nichts tust.“ Und sie setzte sich in einer Entfernung ans Ufer und hob den Blick zum Mond.
So saßen sie in langer Stille, bis die Frau wieder sprach. Sie war noch jung, wie die Wölfin an ihrem Geruch erkannte. Fast noch zu jung.
„Glaubst du, der Mond kann uns retten?“
Die Wölfin antwortete nicht.
„Ich habe Angst“, sagte die Frau. „Warum heult ihr Wölfe den Mond an? Werdet ihr weinen, wenn ich sterbe?“
Die Wölfin hätte beinahe gelacht. „Du bist jung“, dachte sie. „Ich warte seit Monaten auf meinen Tod und du sinnierst über etwas, das noch lange nicht sein wird.“
„Ich werde sterben!“ Die Frau blickte sie empört an. Fast so, als hätte sie die Gedanken der Wölfin vernommen. Ihre Finger spielten mit dem Anhänger aus Eichenholz. „Ich bin auf dem Weg, gegen einen Tyrannen zu kämpfen.“
Die Wölfin reagierte nicht.
„Ich weiß, dass es dir egal ist. Dass du noch nicht einmal zuhörst. Dass du mich in Stück reißen würdest, wenn du nicht so alt wärst.“
Die Wölfin hob den Kopf, ihre Ohren zuckten und ihre alten Gelenke, die sich so lange nicht mehr bewegt hatten, richteten sich auf. Die Frau blieb sitzen und beobachtete, wie das alte Tier mit dem zottigen Fell auf sie zu humpelte und ihren schweren Kopf auf den Schoß der Menschenfrau legte. Fünf Finger strichen durch schwarz-graues Fell. Ein Gesicht legte sich auf ihren Rücken und im nächsten Moment flossen Tränen hinab und benetzten den Wolfsrücken mit funkelnden Tropfen. Jeder muss einmal weinen. Und die Frau, die auf dem Weg war, einen Mann in den Tod zu treiben, der ihren Bruder entführt hatte, weinte sich in den Zotteln einer alten Wölfin aus.
Als sie genug geweint hatte, legte sie sich neben die Wölfin und vergrub ihr Gesicht im weichen Bauchfell. Als wäre sie ein hungriger Welpe, der von seiner Mutter getröstet werden musste.
Die Wölfin hatte in ihrem Leben viele Welpen geboren und noch mehr großgezogen. Sie vergrub eine ihrer Pfoten in dem Haar der Frau und begann, liebevoll über ihr Gesicht zu schlecken, bis sie die Tränen nicht mehr schmecken konnte.
Die Frau schlief neben der Wölfin ein und erwachte, als der Mond sich gerade zurückzog, um der Sonne Platz zu machen. Die Wölfin schlief. Sie war alt und erwachte nicht, als die Frau sich aus ihrer Umklammerung befreite. Auch dass die Frau ihr einen Kuss zwischen die spitzen Ohren drückte und sich dann davonstahl, bekam die Wölfin nicht mit. Ihre Ohren zuckten, doch die gelben Augen blieben geschlossen.
Die Wölfin erwachte erst gegen Mittag und sie sah die junge Frau nie wieder. Diese hingegen wanderte lange und länger, bis sie zu dem Palast des Tyrannen kam und ihn zu einem Duell herausforderte. Dort machte sie den Fehler, ihr rostiges Schwert gegen ein Besseres einzutauschen.
Wochen später lag die Wölfin noch immer an ihrem See. Sie hatte kaum gegessen und fragte sich manchmal, wie es sein konnte, dass ihre Seele noch immer an diesen Körper gefesselt war.
In dieser Nacht kam der Mond zu ihr. Aus den Strahlen des leuchtenden Vollmonds materialisierte sich eine Frau, deren fürsorglicher Blick auf die alte Wölfin fiel. „Sie ist tot“, sagte der Mond.
In den Zügen zeichnete sich Trauer ab. Die Trauer einer Mutter, die wusste, dass ihre Tochter nie zurückkehren würde. „Tot“, wiederholte die alte Wölfin und senkte den Blick auf ihre Pfoten. „Mein letzter Welpe.“
„Dein Welpe?“, fragte der Mond überrascht.
„Ein Wesen, das ich geliebt und um das ich mich gekümmert habe“, erklärte die Wölfin. „Und wenn auch nur für eine Nacht. Ich muss das Mädchen nicht geboren haben, um es meinen Welpen zu nennen. Ich muss es nur als solchen akzeptieren.“ Eine Träne aus flüssigem Licht löste sich aus dem Augenwinkel des Mondes und hinterließ eine leuchtende Spur auf ihrem Antlitz.
„Wie?“, fragte die Wölfin.
„Sie haben die Schwerter getauscht. Der Tyrann war von ihrem Mut begeistert und hat ihr sein eigenes Schwert zum Kampf angeboten. Und er hat ihr rostiges Messer genommen.“ Der Mond verbarg das Gesicht hinter den Händen. „Es war verzaubert, nie einen Kampf zu verlieren, und verflucht, nie einem Gegner das Leben zu lassen.“
Die Wölfin starrte hinab in das tintenschwarze Wasser.
Werdet ihr weinen, wenn ich sterbe?