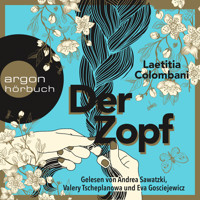18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Als Catherine und James sich kennenlernen, ist es Seelenverwandtschaft von Anfang an. Beide sind sie aus der irischen Provinz in die aufregende und liberale Stadt Dublin gekommen, Catherine als Studentin der Literaturwissenschaft, James, um Fotograf zu werden, und beide stürzen sich mit derselben Neugier und Leidenschaft ins Leben. Doch während Catherine in ihrer neuen Umgebung aufblüht, ist es für James selbst im vermeintlich offenen Klima der Großstadt unmöglich, zu seiner Homosexualität zu stehen. Sein Geheimnis schweißt die beiden noch enger zusammen, aber dann verliebt sich Catherine in James, auch wenn sie ahnt, dass ihre Liebe aussichtslos. Beide verstricken sich immer haltloser in eine von widersprüchlichen Gefühlen geprägte obsessive Beziehung und steuern sehenden Auges auf eine emotionale Katastrophe zu. Ein kluger, herzzerreißender Roman über die Untiefen im schwer kartographierbaren Gebiet zwischen Freundschaft und Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Als Catherine und James sich kennen- lernen, ist es Seelenverwandtschaft von Anfang an. Beide sind sie aus der irischen Provinz in die aufregende und liberale Stadt Dublin gekommen, Catherine als Studentin der Literaturwissenschaft, James, um Fotograf zu werden, und beide stürzen sich mit derselben Neugier und Leidenschaft ins Leben. Doch während Catherine in ihrer neuen Umgebung aufblüht, ist es für James selbst im vermeintlich offenen Klima der Großstadt unmöglich, zu seiner Homosexualität zu stehen. Sein Geheimnis schweißt die beiden noch enger zusammen, aber dann verliebt sich Catherine in James, auch wenn sie ahnt, dass ihre Liebe aussichtslos sein wird. »Es gibt einfach keinen falschen Ton in Zärtlich… ein Werk voller Weisheit, Wahrheit und Schönheit.« The Irish Times
Die Autorin
Belinda McKeon, Jahrgang 1979, wuchs im ländlichen Irland auf, studierte Engli- sche Literatur und Philosophie am Trinity College und University College in Dublin und lebt heute in New York. Ihre Essays und Reportagen erschienen u.a. in der Paris Review, der New York Times und dem Guardian, sie schreibt außerdem fürs Theater und hat Stücke in Dublin und New York produziert. Sie unterrichtet derzeit kreatives Schreiben an der Rutgers University, New Jersey.
Die Übersetzerin
Belinda McKeon
Zärtlich
Roman
Aus dem Englischen von Eva Bonné
Ullstein
Die englische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Tender bei Picador, London.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweise zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1434-1
© 2015 © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagmotiv: © Shutterstock
E-Book: L42 AG, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
»Er war der Freund meines Lebens. Weißt du, so ein Freund ist einzigartig; den findet man kein zweites Mal.«
WACH(1997)
Fliehende Träume, es ging um ein Schlafzimmer und um einen Garten, den man durch ein geöffnetes Fenster betrachtet … und eine Windbö, es ging um eine Windbö; der Vers ließ Catherine Äpfel sehen, die schrumpelnd und fleckig und faulend im Gras lagen. Fallobstsüße Erde, das war’s. Und da war noch etwas, die Flanke eines Tieres, das sich an der Schlafzimmerwand scheuert – aber das konnte nicht sein, oder? Und doch war es da, irgendwo vergraben, erst in diesem Moment war es wieder in ihr Bewusstsein aufgestiegen. Catherine lag auf dem Rasen vor James’ Elternhaus, auf einer Wolldecke, und hatte sich als Ersatz für die vergessene Sonnenbrille einen Arm über die Augen gelegt.
Die Terrassentüren standen offen. Sie befanden sich an der Vorderseite des Hauses, links vom Eingang, was ein bisschen merkwürdig war und irgendwie sinnlos – da war doch bereits eine Tür, um hinauszugehen? Aber sie waren hübsch – apart, das waren sie, und modern, und jetzt in diesem Moment standen sie offen, so dass James und seine Eltern zu hören waren. Sie unterhielten sich laut und aufgeregt, typisch für diese Familie. James sagte etwas, seine Mutter reagierte mit einem spitzen Schrei, woraufhin James zu schimpfen anfing, aber auf eine liebevolle und fröhliche Weise. Alle hier schimpften so. Catherine konnte es immer noch nicht so richtig fassen. Wahrscheinlich redeten sie über die Dorfhochzeit, zu der James’ Eltern an diesem Nachmittag eingeladen waren; James sollte sie eigentlich begleiten, doch James würde Catherines Besuch als Ausrede vorschieben und zu Hause bleiben. Catherine wusste nicht genau, wie sie das finden sollte; sie lag in einem alten Bikini von James’ Schwester draußen auf der Decke und fühlte sich überfordert und schuldig und auch ein bisschen geschmeichelt, was zu entspannen quasi unmöglich machte; nicht, dass es leicht gewesen wäre, im Bikini zu entspannen. Wenn ihre Eltern nur wüssten. Aber ihre Eltern wussten nichts, damit beruhigte sie sich abermals, und dann verdrängte sie den Gedanken schnell wieder.
Aaaach, verdammt noch mal, Mammy, brüllte James, und dann war wieder Peggy zu hören, die ihre Worte mit kräftigem Cavan-Akzent auf den Tisch knallte wie Spielkarten: Ich sag es dir, Jem, ich sag es dir! Eben hatte sie noch behauptet, James sei ein frecher kleiner Hosenscheißer; bei der Erinnerung musste Catherine wieder schmunzeln. Frecher kleiner Hosenscheißer; mit diesen Worten hatte Peggy ihn bei der Ankunft begrüßt. Sie würden sich auch diese Wendung aneignen. Schon hatten sie sich auf eine eigene Ausdrucksweise geeinigt, auf eigene Witze, eine eigene Sprache, dabei kannten sie sich erst seit jenem Morgen im Juni; es schien so viel länger her zu sein, dabei waren erst sechs Wochen verstrichen, seit James in der Wohnung in der Baggot Street aufgetaucht war, die Catherine sich mit seinen beiden alten Schulfreundinnen Amy und Lorraine teilte. Er hatte eigentlich die beiden besuchen wollen, natürlich, als er an jenem Morgen aus Berlin zurückgekommen war, aber stattdessen hatte er nur Catherine angetroffen, sie war in das Zimmer eingezogen, das er im Oktober geräumt hatte. Er hatte dort für einen Starfotografen gearbeitet, Catherine hatte den Namen nie zuvor gehört, aber der Mann war wichtig, und James hatte es geschafft, sein Assistent zu werden, dabei war er nicht einmal zur Uni gegangen – es war so typisch für James, einfach loszugehen und seinen Willen durchzusetzen, das Ganze wäre für Catherine unvorstellbar gewesen, ihr hätte der Mumm gefehlt, wenigstens in der Zeit vor James …
Jetzt hörte sie James’ Vater, ein lustiger und liebenswerter und unendlich geduldiger Mann, der James gerade fragte, ob er nicht bitte wieder in den Garten gehen und seine Eltern in Ruhe lassen könne. Die Kleine, sagte er – Catherine war entzückt zu hören, dass über sie gesprochen wurde –, die Kleine würde doch bestimmt gleich umkommen vor Durst. Dann fügte er mit leiser Stimme noch etwas hinzu, unhörbar für Catherine; Peggy rief empört seinen Namen, und James sagte ihm, er sei sehr clever, verdammt clever, und Da!, sagte James, und Catherine wusste, er hatte irgendetwas angestellt – seinen Vater ins Ohr gekniffen vielleicht oder so getan oder sich die letzte Scheibe Schinken vom Teller geschnappt. Irgendetwas in der Art. Ein kurzer Moment der Innigkeit. Am Vorabend hatte Catherine gesehen, wie James sich vorgebeugt und seinem Vater einen schnellen, festen Kuss auf die Stirn gedrückt hatte, wie man ein Kind küssen würde; einfach so, im Vorbeigehen, als bedeute es nichts. Kaum zu glauben, aber Catherine war rot geworden. Sie hatte das Gefühl bekommen, sich aufzudrängen und etwas falsch zu machen, allein durch ihre Anwesenheit. Diese Familie war einfach so … so unglaublich. Sie war fantastisch. Das war befremdlich, denn eigentlich unterschied James’ Familie sich kaum von Catherines, in kaum einer Hinsicht – auch Catherines Eltern waren Landwirte und besaßen ein Haus auf einem Hügel, das Essen daheim roch so ähnlich wie das Essen hier, und selbst die Bettwäsche im Gästezimmer kam Catherine bekannt vor, ihre Eltern besaßen die gleiche. Und doch, diese Leute waren irgendwie …
Außergewöhnlich. Das waren sie. Das Wort gehörte eigentlich James, es war eines der Wörter, die sie im Laufe des Sommers von ihm übernommen hatte. Sie hatten so viel geredet, erst in Dublin, wo sie nach seiner Rückkehr aus Berlin ein paar sehr intensive Tage verbracht hatten, und später – Catherine verbrachte den Sommer daheim bei ihren Eltern in Longford, James nahm sein Zimmer in der Baggot Street wieder in Beschlag – am Telefon. So viele neue Ausdrucksweisen hatte sie von ihm gelernt und dass es einen anderen, genaueren, schärferen, kritischeren Blick auf die Welt gab. Fast jeden Abend hatten sie telefoniert; Catherine rief das Münztelefon im Hausflur in der Baggot Street an, und James wartete schon, er begrüßte sie mit einem fröhlichen hallo, und dann ging es los, stundenlang manchmal. So viele neue Gedanken, die man sich machen konnte – oder nein, nichts davon war wirklich neu, Catherine hatte sich einfach bloß nie damit auseinandergesetzt. So gesehen wusste sie, nun ja, fast nichts. Geahnt hatte sie das schon im letzten Jahr, das College hatte es ans Licht gebracht, aber erst James und die Gespräche mit James hatten sie dazu angeregt, genauer hinzusehen. Es gab ja so viel zu lernen. James hatte das nicht direkt ausgesprochen – das hätte nicht zu ihm gepasst, er war nicht taktlos, ganz im Gegensatz zu Conor, der sie im College regelmäßig aufgezogen hatte, bis sie sich klein und wertlos fühlte. Es war eher so, dass ihr nach jeder Unterhaltung mit James klarer wurde, dass es unendlich viel zu lernen gab. Dass sie so vieles nicht wusste. Durch die Unterhaltungen mit ihm, durch das Zuhören war Catherine zu der Einsicht gekommen, dass sie alles viel genauer überdenken sollte: ihr Leben und was sie damit anfangen wollte, ihr Studium, ihre Pläne für die Sommerferien, die Beziehungen, die sie nicht geführt hatte. Sie war nicht mit Conor zusammen, egal, wie James es nannte oder wie oft er sich darüber lustig machte. Sie konnte gar nicht genug bekommen, wenn James über das Drama ihres Lebens redete, als wäre es tatsächlich interessant, als würde da tatsächlich etwas passieren. Was nicht der Fall war. Sie mochte es sogar, wenn er sich an ihrem Verhältnis zu ihren Eltern abarbeitete, ein Thema, über das sie sich von allein niemals Gedanken gemacht hätte. Sie müsse, sagte James, endlich anfangen, ihre Eltern als Menschen zu betrachten und nicht bloß als Eltern; sie müsse das Verhältnis dieser Menschen zueinander bedenken und wie es Catherines Handeln beeinflusste. Psychologie – wäre James aufs College gegangen, er hätte Psychologie studiert, zumindest behauptete er das. Oder Theologie, hatte er gesagt, woraufhin Catherine gelacht hatte, weil sie es für einen seiner Scherze hielt. Aber James war ernst geblieben; er wolle verstehen, sagte er, woran genau die Leute eigentlich glaubten. Woraus der Glaube gemacht war.
Aber James hatte ein Studium gar nicht nötig, er kannte sich auch so mit allem aus. Mit Kunst natürlich auch; seit einem Jahr studierte Catherine nun Kunstgeschichte, trotzdem wusste er zehnmal mehr als sie. Auch von ihrem zweiten Fach, Englische Literatur, schien er mehr Ahnung zu haben als sie selbst; höchstens auf dem Gebiet der Lyrik sah sie sich ganz leicht im Vorteil. Immerhin. Aber über die Menschen und ihr Verhalten konnte James stundenlang Vorträge halten, und über alle anderen Themen auch. Über Politik zum Beispiel. Vor zwei Wochen hatte Catherine die halbe Nacht wach gelegen und sich Gedanken über Nordirland gemacht, oder vielmehr über die Frage, ob ein Telefonat, in dem das Wort Nordirland fiel – sie und James hatten über Nordirland geredet, besser gesagt hatte James darüber geredet, an einem jener Abende mit besonders schweren Krawallen –, abgehört oder aufgezeichnet würde, zusammen mit Namen und Adresse der Beteiligten, als Verdachtsfall sozusagen, den man zu Protokoll nehmen und im Auge behalten musste. James behauptete, das sei die Regel; gegen Ende des Telefonats hatte er beiläufig erwähnt, er und Catherine stünden jetzt höchstwahrscheinlich auch auf der Liste, sie beide, denn im Zuge der Fahndung würden landauf, landab Gespräche abgehört.
Catherine wollte so schnell wie möglich auflegen, sie erfand eine Ausrede und behauptete, sie würde im Nebenzimmer gebraucht; aber dann war sie noch lange Zeit sitzen geblieben und hatte das Telefon beobachtet, die straff gespannte Schnur aus dem Flur, die freundlichen Ziffern auf den klobigen Wahltasten, und das Pochen in ihren Schläfen hatte sich abwechselnd wirklich und unwirklich angefühlt. Irgendwann war sie ins Wohnzimmer hinübergegangen, wo ihre Mutter mit Anna, Catherines sechsjähriger Schwester, vor dem Fernseher saß. Sie war unfähig gewesen, die beiden anzusehen; auf einmal war sie in Sorge, den beiden könnte etwas zustoßen, nur weil sie und James unvorsichtig gewesen waren. So zu denken war natürlich paranoid, aber auch darauf wusste James am nächsten Abend, als sie ihm von ihren Befürchtungen erzählte, eine Antwort: Er habe trotzdem recht. Das Ganze sei nicht weniger real, bloß weil Catherine sich für paranoid hielt. An jenem zweiten Abend hatte Catherine es versäumt, schnell genug das Gesprächsthema zu wechseln. Eigentlich hatte sie über etwas anderes sprechen wollen, etwas Unverfängliches. Sie wollte jetzt nicht mehr daran denken. Sie wollte nie wieder daran denken. Sie wollte Limonade, nur deswegen war James ins Haus gegangen, er wollte zwei Gläser kalte Limonade holen, jeden Moment würde er damit aus dem Haus kommen, dachte sie und blinzelte in die Sonne. Jeden Moment. Die Gläser würden wunderbar kühl sein, die Eiswürfel würden in der Sonne funkeln, Catherine würde sich aufsetzen und zuschauen, wie James durch die Terrassentüren trat und über die Wiese kam, dufrecher kleiner Hosenscheißer, würde sie ihm zurufen, und er würde unter dem Metallbogen innehalten, den seine Mutter am Ende des Rasens aufgestellt hatte, und den Gekränkten spielen. An dem Bogen wucherten Rosen in die Höhe, oder Blumen, die Catherine für Rosen hielt; knallrot hoben sich die Blüten vom lackierten Gestänge ab, und endlich hörte sie ihn. Sie hörte Schritte am Haus und dann das Knirschen von Kies, er war es, und jetzt hörte sie auch die Eiswürfel klirren. Catherine spannte alle Muskeln in Armen und Schultern und Beinen an, einfach so, zum Vergnügen, allein wegen des angenehmen Gefühls, das sich einstellte, sobald sie wieder losließ. Sie streckte sich auf der Decke aus, bis Finger und Zehen das Gras berührten und in das kühle, dichte Polster stießen. Sie seufzte, die Sonne ließ die Welt hinter den geschlossenen Augenlidern weißlich glühen, und wieder versuchte sie, ihren Blick – war es noch ein Blick, wenn man dabei die Augen geschlossen hielt? – auf einen der winzigen dunklen Fäden zu richten, die auf ihren Augäpfeln hin und her schwammen. Doch sie ließen sich nicht fixieren, flatterten hin und her wie Vögel.
Es war ihr zweiter Tag in Carrigfinn.
*
Im Laufe des Sommer war James’ Haar gewachsen, über seiner Stirn türmte sich inzwischen eine widerspenstige Tolle auf. Noch nie hatte Catherine einen Jungen mit so roten Haaren gesehen, was vermutlich daran lag, dass sie vor ihrer Bekanntschaft mit James rothaarige Jungen konsequent gemieden hatte. Sie hatte sie nicht ansehen, geschweige denn mit ihnen reden können. Aus unbekanntem Grund assoziierte sie mit der Haarfarbe großes Elend; enge Behausungen und Pullover mit V-Ausschnitt und eine namenlose Verzweiflung, wie sie Grundschüler überfällt, die vor der ganzen Klasse gedemütigt werden und sich nicht gegen den Lehrer zur Wehr setzen können, weder mit Worten noch mit Taten. Sie hatte James nie davon erzählt, aber als sie nun sah, wie er sich unter dem Torbogen mit den Rosen hinwegduckte, fiel ihr ein, dass sie ihm unbedingt davon erzählen musste, sicher würde er es faszinierend finden, wahrscheinlich sogar ziemlich interessant, ziemlich lustig. In der Analyse, die er ihr unterbreiten würde, würde die Lächerlichkeit ihrer Abneigung noch deutlicher hervortreten. Und was hast du eigentlich gegen Pullover mit V-Ausschnitt?, hörte sie ihn jetzt schon sagen, vor lauter Vorfreude musste sie kichern, sich den Bauch halten, so dass James, der jetzt endlich vor ihr stand, ein misstrauisches Gesicht zog und die Lippen schürzte, was sie nur noch mehr zum Lachen brachte. James war einfach zu komisch, das war wohl das Wunderbarste an ihm. Er war komischer als alle Menschen, die Catherine je kennengelernt hatte. Sein wunderbarer, funkelnder Humor ließ ihn von innen heraus strahlen. Er war schlagfertig und ein begabter Parodist – so begabt, dass seine Darbietungen manchmal fast verstörend waren – und sehr geschickt darin, den Charakter einer Person in einer einzigen, scheinbar beiläufigen Bemerkung zusammenzufassen. Und er war laut und kümmerte sich kein bisschen darum, was die Leute über ihn dachten. In jenen ersten Tagen in Dublin hatte Catherine sich mehr als einmal innerlich gekrümmt, wenn James auf dem Bürgersteig neben ihr ging und sich so lautstark über das ausließ, was seine Aufmerksamkeit in dem Moment band, geradezu fesselte, dass die Leute sich umdrehten. Alte Passanten musterten ihn flüchtig oder glotzten oder zogen eine welke Augenbraue in die Höhe, aber James schien es nie zu bemerken; es sprudelte einfach weiter aus ihm heraus. Sogar gestern Abend war es so gewesen, in Carrick, als sie vom Bahnhof zur Straße nach Carrigfinn gelaufen waren. Er fragte sich nie, wer ihn sonst noch hörte. Es kümmerte ihn nicht, ob man ihn eine Nervensäge nannte, einen Schwachkopf, den jungen Flynn mit dem Gestrüpp aus roten Haaren auf dem Kopf. Als sie an der Straße gewartet hatten, war Catherine krank vor Angst, jemand könnte sie sehen und ihren Eltern davon erzählen, trotzdem lachte sie sich halbtot über seine Witze. Als sie endlich von zwei älteren Damen mitgenommen wurden – Nachbarinnen von James’ Eltern, die Catherine von oben bis unten musterten, so sah also das Mädchen aus, das James Flynn nach Hause mitbrachte? –, bekam sie von dem Versuch, sich zusammenzureißen, sogar Bauchschmerzen. Während der Fahrt unterhielt James sich heiter und ohne eine Miene zu verziehen mit den beiden alten Damen, er tratschte über andere Nachbarn, hörte sich mit ernstem Nicken ihre Meinungen und Sorgen an, und währenddessen trat er Catherine immer wieder gegen den Fuß, um sie auf seine Doppeldeutigkeiten hinzuweisen und zum Lachen zu bringen. Als sie am Fuß der Einfahrt aus dem Auto gestiegen waren, hatte Catherine kaum noch Luft bekommen.
Catherine würde auch deswegen bis Oktober in Longford bleiben, weil sie einen Ferienjob bei der Zeitung hatte. Ihre Aufgabe war es, die Meldungen der Presseagenturen umzuformulieren, bis sie sich wie richtige Artikel lasen. Aber der Hauptgrund war eigentlich, dass ihre Eltern wollten, dass sie den Sommer daheim verbrachte; ihre Eltern sahen gar nicht ein, warum sie in Dublin wohnen sollte, wenn sie nicht zum Unterricht oder in die Bibliothek gehen musste. Als sie zum Studium nach Dublin gezogen war, hatten ihre Eltern gewollt, dass Catherine bei der Schwester ihres Vaters in Rathmines wohnt, anstatt sich zusammen mit Schulfreundinnen eine Wohnung zu suchen; und als der Traum von der WG schon in der Orientierungswoche geplatzt war, erschien es Catherine unvermeidlich, das Jahr bei ihrer Tante zu verbringen. Aber dann hatte sie an einem Schwarzen Brett eine Anzeige für ein freies Zimmer in der Baggot Street gesehen und sich die Nummer notiert, die sie zu Amy und Lorraine führte. Beide hatten ebenfalls gerade erst ihr Studium am Trinity College begonnen, studierten aber an der naturwissenschaftlichen Fakultät. Ihr Mitbewohner James war nach Berlin gegangen, kurz bevor die Oktobermiete fällig war, und nun brauchten sie jemanden, der sein Zimmer übernahm, und zwar dringend. Ob Catherine Interesse hätte? Ja, sagte sie mit klopfendem Herzen und zog noch am selben Abend ein. Die Mädchen stammten aus Leitrim; damit konnte sie ihrer Mutter den Umzug schmackhaft machen, es war wie eine Sicherheitsgarantie; immerhin war Leitrim ein Nachbarcounty von Longford, es war praktisch so, als wohnte sie mit Leuten aus der Heimat zusammen, nicht, als würde sie bei Dublinern einziehen oder bei Engländern – oder bei Jungs. Zu Catherines Erstaunen hatte ihre Mutter zugestimmt, wenn auch zögerlich, sie hatte sogar gesagt, sie würde dem Vater die Sache irgendwie verkaufen. Catherine hatte ein glückliches Jahr mit den Mädchen verbracht, sie waren lustig und entspannt und betrachteten die Wohnung als ihr Zuhause, nicht bloß als eine Notunterkunft, der sie am Wochenende den Rücken kehrten. Natürlich würden sie auch den Sommer in der Stadt verbringen, Catherine beneidete sie unendlich um die Zeit mit James, sie beneidete sie um die Zeit, in der sie vor Catherines Auftauchen mit James zusammengewohnt hatten, sogar um die gemeinsamen Schuljahre. Wie konnte man eifersüchtig auf eine Zeit sein, an der man ohnehin nicht hätte teilhaben können? Und doch war es so. Jetzt betrachtete sie James, der sich neben sie auf die Decke kniete. Er reichte ihr ein Glas, es fühlte sich kalt und schwer an.
»Du wirst verbrennen«, sagte sie mit einem Blick auf seine nackten Arme.
»Wir werden alle verbrennen«, antwortete er ernst. »Sieh dir nur deine Aufmachung an, hier draußen, wo alle anständigen Leute dich sehen können, dich und deinen nackten, zur Schau gestellten Körper.« Er schüttelte den Kopf. »Pat Burke kann dich sehen, Catherine. Pat Burke ist empört, das kann ich dir sagen.«
»Ach, hör mit dem alten Knacker auf«, sagte Catherine und trank einen großen Schluck Limonade.
»Prost«, sagte James, was fast wie eine Warnung klang, und stieß sein Glas an ihres. Er trank in großen Schlucken und ließ den Blick bergab schweifen, zum Kanal. Ein kleines Kajütboot war gerade dabei, die Schleuse zu verlassen; Catherine konnte hören, wie die Tore sich wieder schlossen.
»Jawohl«, rief James zu dem Boot hinunter, obwohl die Leute ihn natürlich nicht hören konnten und er sie abgesehen davon gar nicht kannte, »haut ab, ihr Penner! Ihr seid hier nicht willkommen!«
»Du bist unmöglich, Muriel!«, zitierte Catherine einen der Sprüche, die in den vergangenen Wochen in ihr gemeinsames Repertoire eingegangen waren. Er stammte aus einem Film, den sie beide mochten, gleich an ihrem ersten gemeinsamen Abend in Dublin hatten sie die Übereinstimmung bemerkt. Du bist unmöglich, Muriel; am besten sagte man es mit australischem Akzent und vor Empörung weit aufgerissenen Augen; aber Catherine war zu träge und zu verschwitzt, um sich die Mühe zu machen, außerdem hörte James, der sich gerade neben sie auf die Decke zwängte, sowieso nicht richtig zu.
»Rutsch rüber, Reilly«, sagte er. Nun lagen sie Schulter an Schulter, Hüfte an Hüfte. Die Berührung durchfuhr Catherine wie ein kleiner Stromstoß; sie suchte fieberhaft nach einer Möglichkeit, die Anspannung, die ihrer Meinung nach ganz plötzlich entstanden war, wieder aufzulösen. Aber auf ihren Verstand war kein Verlass; den Befehl, alle Aufmerksamkeit von James’ Körper wegzulenken, quittierte er mit gesteigerter, plump zur Schau gestellter Aufmerksamkeit. Catherine hätte genauso gut die Hand ausstrecken und James von Kopf bis Fuß abtasten können.
»Deine Haut«, sagte sie mit seltsam fremder, verzerrter Stimme. »Deine Haut wird in dieser Sonne verbrennen. Du brauchst Sonnenmilch. Du solltest die Creme benutzen, die deine Mutter dir gegeben hat.«
»Ach, verdammt«, grunzte James. »Das Zeug ist uralt. Da kann man sich genauso gut mit Marmelade einschmieren.«
»Na ja, ich habe es benutzt, und ich verbrenne nicht.«
Das zu sagen war ein Fehler, denn nun stützte James sich auf einen Ellenbogen und nahm ihren Körper seelenruhig in Augenschein: die nackten Schenkel, den Bauch, das Dekolleté, oder was in diesem lächerlichen Achtziger-Jahre-Bikini davon übrig war. Am liebsten hätte sie sich in die Wolldecke eingewickelt. James begaffte sie ungeniert; sie versuchte zu lachen, brachte aber nur ein Keuchen heraus.
»Catherine, du wirst blau«, sagte James und legte sich wieder hin, als wäre nichts. »Die siehst aus, als hättest du die Cholera. Muss an der Creme liegen.«
»Was?«, keuchte Catherine wieder, setzte sich ruckartig auf und streckte die Arme aus. Sie merkte schnell, dass er es nicht ernst gemeint hatte, er hatte wieder mal einen Witz gemacht, schon krümmte er sich vor Lachen, aber Catherine hörte trotzdem nicht auf, sich demonstrativ abzusuchen – Bauch, Oberschenkel, Waden, und dann hob sie eine Hüfte an, um den sichtbaren Teil ihrer Pobacken zu überprüfen, nur für alle Fälle. Keine Spur von Blau, nirgends; ihre sommersprossige Haut war von einem glänzenden Fettfilm überzogen und starrte zurück, die zarten, hellen Härchen glitzerten in der Sonne.
»Arschloch«, sagte sie und stieß James in die Seite.
»Ha-ha«, sagte er in einem Singsang, zwei aufeinanderfolgende Töne in Moll, und schlug dazu nicht einmal die Augen auf. Sie spielte mit dem Gedanken, ihm etwas anzutun, sich zu rächen; plötzlich merkte sie, dass sie sich unbedingt wieder in Erinnerung bringen wollte, obwohl sie sich doch eben noch gewünscht hatte, seiner Aufmerksamkeit zu entgehen. Vielleicht sollte sie ihm die kalte Limonade auf das T-Shirt und die Jeans mit den umgekrempelten Hosenbeinen gießen, auf die langen, dünnen Beine und die knochigen Füße, weiß und nackt und ganz ohne Hornhaut. Oder ein paar Eiswürfel aus dem Glas fischen und auf seinen Hals klatschen; sie würden in sein T-Shirt rutschen, noch bevor er merkte, was sie da in der Hand hielt.
»Reilly«, sagte James schläfrig, ließ seine Hand rücklings auf ihren Bauch fallen und zog sie wieder weg, »geh mir aus der Sonne.«
*
Pat Burke: kaum zu glauben, dass der rotgesichtige, schreckliche, alte Pat Burke aus Catherines Dorf zu einem ihrer Running Gags geworden war, aber genau so war es gekommen. Pat Burke hier und Pat Burke da. Pat Burke schaut zu; Oh, das würde Pat Burke gefallen; Mein Gott, Catherine, was würde Pat Burke dazu sagen? Sein Name stand für die geheuchelte Empörung der Moralapostel, und Catherine liebte den Geheimcode, auch wenn ihr Herz, wann immer sie ihn benutzte, ein bisschen schneller schlug vor lauter Schuldgefühl. Ihre Eltern wären entsetzt gewesen. Burke hatte sich immer noch nicht ganz von dem Herzinfarkt erholt, den er im vergangenen Sommer erlitten hatte, bis heute musste er jeden ersten Freitag im Monat mit dem Zug zur Kontrolluntersuchung nach Dublin. Jedes Mal kam er mit Informationen über seine Mitpassagiere aus Longford zurück; abends im Leahy’s plauderte Burke dann in allen unappetitlichen Details aus, was er auf der Zugfahrt gesehen und gehört hatte; die Shopper, die Urlauber, die Geschwisterbesucher, die aschfahlen Patienten auf dem Weg zur nächsten Untersuchung, zur Diagnose, zu einem Schlauch, einer Maschine; die Kaputten, die Geschwätzigen, die Glücksritter. Und auch am Bahnhof von Dublin gab es viel zu sehen, am ersten Freitag im Juni sogar die junge Reilly, Catherine, oder wie immer sie hieß, Charlie Reillys älteste Tochter, die am helllichten Tag mit einem jungen Kerl – Haare wie ein roter Heuhaufen! – auf einer Bank saß und Händchen hielt, kackfrech und ohne sich darum zu kümmern, ob sie dabei beobachtet wurde.
Dabei hatten sie nicht einmal Händchen gehalten. Sie hatten in der dunklen Bahnhofshalle auf einer Holzbank gesessen, die Köpfe zusammengesteckt und auf die Gleise gestarrt. Ja, dachte Catherine später, möglicherweise hatten sich ihre Hände ganz leicht berührt, immerhin hatten sie sich Catherines Kopfhörer geteilt. James sollte unbedingt einen Song von Radiohead hören, der Catherine zutiefst berührte, ein traurig-schönes Stück von OK Computer. Sie hatten ein paar gemeinsame Tage in Dublin verbracht, und nun war Catherine auf dem Weg zu ihren Eltern in Longford, wo sie den Sommer verbringen würde; James hatte darauf bestanden, sie zum Bahnhof zu bringen. Beim Gedanken an die bevorstehende Trennung wurde sie traurig und benommen, kein Wunder bei dem schwindelerregenden Tempo, in dem ihre Freundschaft sich entwickelt hatte – vor drei Tagen hatte sie ihn noch nicht einmal gekannt. Diese Gefühle verwirrten und beschämten sie sehr, schlimmer noch, sie wusste, dass James über den Abschied genauso traurig war, er hatte es ihr nämlich gesagt, mehr als ein Mal sogar. Catherine wusste nicht, wie sie damit umgehen sollte, mit seiner Offenheit, mit seiner unbekümmerten Ehrlichkeit, die so freigebig auszuteilen ihn kein bisschen Überwindung zu kosten schien – weder wurde er rot, noch zuckten Augen oder Lippen –, und ja, ihre Hände hatten sich berührt, besser gesagt ihre Handgelenke, sein Handgelenk hatte sich gegen ihres gedrückt und ihres an seins, Haut an Haut, Knochen an Knochen, eigentlich doch ein ziemlich langweiliger Körperteil, der aber auf so intensive, so überwältigende Weise James war. Die düstere Wehklage von Exit Music verschmolz mit Catherines Gefühl der Innigkeit, bis sie sich plötzlich schämte, ihm das Lied vorgespielt zu haben, gerade so, als hätte es gefährlich viel zu bedeuten; dass er beim Zuhören nickte und die Augen schloss, machte es nicht besser, es beruhigte sie kein bisschen, und dann der klagende Gesang von Thom Yorke, der jemanden beschwor weiterzuatmen; und in dem Augenblick hob Catherine den Kopf, und da, direkt vor ihr, stand Pat Burke, der alte Spinner, in einem schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte, als käme er gerade von einer Beerdigung. An seinem rechten Revers funkelte eine Ansammlung von kleinen, silbernen Abzeichen, er zwinkerte Catherine langsam und genüsslich zu.
»Hallo, Mr Burke«, sagte Catherine und setzte sich ruckartig auf, was James dazu brachte, sich ebenfalls aufzusetzen und ihrem Blick zu folgen.
»Miss Reilly«, sagte Burke mit Nachdruck, als wäre er ein Butler in einem Roman von Jane Austen und müsste einer größeren Gesellschaft Catherines Ankunft ankündigen; nach einer angedeuteten Verbeugung und einem langen Blick auf James – gar nicht so lang, dachte Catherine, eher lüstern – ging er weiter.
»Wer zur Hölle war das denn?«, fragte James, ließ den Kopfhörer sinken und schaute Burke nach, der in den Zug nach Sligo einstieg.
»Ein Nachbar«, sagte Catherine. Ihr Herz hämmerte. Die Röte brannte auf ihren Wangen.
»Er hat ausgesehen, als wollte er deine Seele holen.«
»Nicht hingucken!«
»We hope – that you choke – that you cho-o-oke«, sang er mit leiser, heiserer Stimme.
»Hör auf«, sagte Catherine und rammte ihm einen Ellenbogen in die Seite. »Es ist schlimm genug.«
James schnaubte. »Was ist schlimm genug? Seine Hose? Hast du die gesehen? Er hat einen Arsch wie ein Torfsack.«
»Es ist schlimm genug«, wiederholte Catherine und ließ den Kopf hängen, um ihn wissen zu lassen, dass sie wieder voll und ganz bei dem Song war.
Und natürlich, keine zwei Tage später, an Catherines erstem Sommersonntag zu Hause, warf ihre Mutter ihr schiefe Blicke zu, als wollte sie etwas fragen. Catherine machte sich innerlich gefasst. Sie setzte sich an den Küchentisch und mischte Cornflakes und Coco Pops in einer Schüssel, ihr Lieblingsfrühstück, das sie manchmal so hastig verschlang, dass die Milch keine Gelegenheit hatte, braun zu werden. Es war schon nach elf, und weil sie es nicht früher aus dem Bett geschafft hatte, würde sie ihren Vater zur Ein-Uhr-Messe begleiten müssen. Die anderen waren längst in der Kirche gewesen. Am Vorabend war Catherine zusammen mit ein paar ehemaligen Schulfreundinnen ausgegangen, erst ins Fallon’s und dann ins Blazer’s, aber es war immer derselbe Mist: Sie traf Leute wieder, die sie ewig nicht gesehen hatte, ließ sich in stockende Gespräche verwickeln und fragte sich die ganze Zeit, ob sie sich mit ihrem gefälschten Studentenausweis Zutritt zum Club würde verschaffen können – ihr Pech, dass alle Läden der Stadt ausgerechnet jetzt, wo sie endlich achtzehn war, neunzehn als Mindestalter eingeführt hatten. Es kam allein darauf an, ob man den Türsteher kannte, ob der Türsteher einen mochte oder ob er sich auf eine Diskussion einließ, so wie gestern Abend, als Catherine argumentiert hatte, dass sie nicht einmal betrunken war und sich in einem Dorf wie Longford niemals würde betrinken können, weil ihr Vater grundsätzlich darauf bestand, sie mit dem Auto abzuholen, egal, wie spät es wurde – manchmal parkte er sogar direkt vor dem Eingang. Wahrscheinlich hatte sie dem Türsteher einfach nur leidgetan, nur deswegen hatte er sie eingelassen. Sie war überzeugt, das Mitleid in seinen Augen gesehen zu haben, als er sie durchwinkte.
Und dann war es im Blazer’s so öde gewesen wie immer. Peinliches Tanzen zum Trainspotting-Soundtrack, und die Mädchen, die Catherine noch von früher kannte, aus dem Biologie- oder Geographieunterricht, taten so, als würden sie auf E durchdrehen, wo sie doch höchstens acht Flaschen Mugshot getrunken hatten. Bauerntölpel mit Spuckeblasen in den Mundwinkeln, die einen fragten, ob man rummachen wollte. Wer halbwegs gut aussah, stand bald in irgendeiner dunklen Ecke und ließ sich das Gesicht ablecken, und David Donaghy, der Catherine von September 1991 bis Juni 1996 auf unendlich vielen Schulbusfahrten ignoriert hatte, ignorierte sie weiterhin, nur um später mit Lisa Mulligan zu knutschen, die doch eigentlich, Catherine war sich sicher, seine Cousine zweiten Grades war. Jenny, in der fünften Klasse Catherines beste Freundin, brüllte immer wieder: »Lass dich volllaufen!«, um schließlich an der verspiegelten Wand zusammenzusacken und mit David Donaghy zu knutschen, der inzwischen mit seiner Cousine fertig war. Es konnte gar nicht schnell genug zwei Uhr werden. Catherine war fast erleichtert, als sie den Ford Sierra ihres Vaters unmittelbar vor dem Eingang entdeckte.
Doch während der Heimfahrt war er ungewöhnlich schweigsam gewesen, daher wusste Catherine, dass Burke mit ihm gesprochen hatte. Die Gefahr, er könnte sie direkt auf das Thema ansprechen, bestand nicht – zwar stellte ihr Vater die Regeln auf, aber das bedeutete noch lange nicht, dass er sie durchsetzte, schon gar nicht, wenn es um Catherines und Ellens Verhältnis zu irgendwelchen Jungs ging –, doch Catherine war klar, dass ihre Mutter am nächsten Morgen am Küchentresen innehalten würde, genau so, wie sie es nun tat, und zum Auftakt einen Blick und ein kurzes, entschuldigendes Räuspern in Catherines Richtung schicken würde.
Catherine hob den Kopf, ihre Mutter schlug die Augen nieder und faltete säuberlich ein Geschirrtuch. Im Radio erklärte ein Moderator des Lokalsenders Shannonside die Handharmonika. Scheiß auf die Handharmonika, dachte Catherine.
»Hast du vor, dich im Sommer mit deinen Freunden vom College zu treffen?«, fragte sie.
»Eher nicht«, sagte Catherine achselzuckend. »Die meisten fliegen zum Arbeiten nach Deutschland und Amerika und so.« Das stimmte nicht, zeigte aber, was Catherine ihrer Mutter auf einmal unbedingt beweisen wollte: dass ihre Freunde ein richtiges Leben hatten. Dass Menschen in ihrem Alter da draußen unterwegs waren und etwas für sich taten, frei und unabhängig lebten. Auch das stimmte genau genommen nicht, es war die Ausnahme, die meisten ihrer Collegefreunde hielten es wie sie und jobbten den Sommer über in der alten Heimat, auch sie lebten vorübergehend wieder bei ihren Eltern, aber dieses Detail beschloss Catherine zu unterschlagen. Die anderen hätten reisen können, allein darauf kam es an. Wenn sie es gewollt hätten, wären sie verreist. Man hätte es ihnen erlaubt. Und ein paar waren tatsächlich weg. Zoe, ein Mädchen aus Catherines kunsthistorischem Seminar, hielt sich gerade in Italien auf. Zoe war eine junge Frau, die sich nichts dabei dachte, einen ganzen Sommer allein in Italien zu verbringen. Und Conor hatte mit seinem Kneipenjob in Chicago herumgeprahlt, auch wenn er letztendlich nicht hingeflogen war, aus Geldmangel. Aber er wollte, er hatte einen Plan. Und James, James hatte ein ganzes Jahr in Deutschland gelebt! Ihre Mutter sollte das ruhig erfahren. Sie sollte erfahren, was für Freunde Catherine hatte. Dann wiederum brauchte sie nicht alles zu erfahren, nicht bis ins letzte Detail, zumindest wenn es um James und Conor ging, denn das hätte Fragen aufgeworfen. Im selben Moment wurde Catherine klar, dass genau das jetzt passieren würde. Sie seufzte schwer.
»Was ist denn?«, fragte ihre Mutter misstrauisch.
»Nichts.«
»Meine Güte, ich versuche bloß, ein bisschen mit dir zu reden!«
»Ich kann dich nicht davon abhalten.«
Ihre Mutter holte tief Luft, als müsste sie sich zusammenreißen. »Ich habe mich gefragt«, sagte sie zögerlich, »ob du vielleicht einen Freund hast? Einen ganz besonderen?«
»Einen besonderen Freund?«, äffte Catherine sie nach. Es ging nicht anders. Sobald sie nach Hause kam, verwandelte sie sich in eine Fünfzehnjährige. Es war lächerlich, sie sollte sich das wirklich abgewöhnen. Sie räusperte sich. »Wie meinst du das, einen besonderen Freund?«, fragte sie ruhig.
Ihre Mutter zuckte die Achseln. Sie trug das blau-weiß gestreifte Shirt, das Catherine so gern an ihr mochte. Das leuchtende Weiß, die dunkelblauen Streifen. Die Ärmel waren hochgeschoben, die Unterarme ihrer Mutter schon leicht gebräunt. Catherine wünschte, sie hätte den Teint ihrer Mutter geerbt statt der Sonnenbrand-Gene ihres Vaters. Ihre Mutter trug die Swatch, die Catherine und die anderen ihr zum Geburtstag geschenkt hatten, zum fünfundvierzigsten, das Armband war bunt gemustert und das kleine Uhrenglas reflektierte das Licht, während sie das Geschirrtuch drehte und wendete, auseinanderschlug und neu faltete. Fünfundvierzig, ihre Mutter war fünfundvierzig. Es schien unmöglich, war aber nichts gemessen an der Vorstellung, dass sie in ein paar Jahren fünfzig sein würde. Fünfzig. Ihre schlanke, sonnengebräunte Mutter mit den braunen Haaren; ihre Mutter, die immer nur Jeans und Turnschuhe trug und die sich neulich eine Sonnenbrille gekauft hatte, weil sie die angeblich zum Autofahren brauchte. Wie konnte sie fast fünfzig sein? Und wenn Catherine an ihren Vater dachte, wurde es hanebüchen – er war noch einmal zehn Jahre älter als ihre Mutter, aber sechzig war eine Zahl, die man unmöglich mit den eigenen Eltern in Verbindung bringen konnte. Sechzig war doch das Alter, ab dem sie nicht mehr bemerken würden, ob Catherine etwas zugestoßen, ob sie eines Morgens oder eines Abends einfach nicht mehr da war. Was zum Teufel sollte sie tun, wenn ihre Eltern dieses Alter erreichten? Der Gedanke versetzte sie in Panik, manchmal lag sie sogar nachts wach deswegen und starrte die Wand an. Natürlich hatte sie James davon erzählt, aber diese Angst konnte er kein bisschen nachvollziehen; er hatte sie für verrückt erklärt. Besser gesagt hatte er ihr nicht ihre Verrücktheit vorgeworfen, sondern etwas anderes – sie hatte vergessen, was es war, sie hatte das Wort nie zuvor gehört, es hatte irgendwas mit Abhängigkeit zu tun; angeblich war sie von ihren Eltern so abhängig wie ihre Eltern von ihr, jedenfalls hatte er ihr noch an dem Abend am Telefon einen Vortrag darüber gehalten. Er hatte gesagt, er kenne das Alter seiner Eltern nicht einmal genau, knapp über sechzig vielleicht? Oder Ende fünfzig? Catherine hatte sich gewundert. Weil seine Eltern so alt waren und weil ihm die Tatsache, dass auch sie sterblich waren, dass auch ihre Uhr tickte, ganz offensichtlich keine Angst machte. Wie konnte er darüber hinwegsehen? Wie konnte er gelassen bleiben und sich einfach nach Berlin absetzen? Ach verdammt, Catherine, hatte er verständnislos gerufen, woraufhin Catherine schnell das Thema gewechselt hatte. Sie wollte nicht mehr darüber reden. Sie und James waren einander so ähnlich, in fast jeder Hinsicht – und doch erkannte sie in manchen Augenblicken sehr genau, wo die Unterschiede lagen. Diese Erkenntnis gefiel ihr gar nicht. Sie bemühte sich dann, sie schnell wieder zu vergessen.
»Und?«, sagte ihre Mutter mit etwas mehr Nachdruck. Catherine hatte ihre Frage nicht beantwortet. »Gibt es da irgendwas, das du mir sagen möchtest? Gibt es jemanden, den du …«
»Nein«, sagte Catherine und rückte vom Tisch ab.
»Sicher?«
»Ja, ganz sicher«, sagte Catherine. »Und ich glaube, das Geschirrtuch ist jetzt fertig gefaltet.«
»Sei nicht so vorwitzig!«
»Ich bin nicht vorwitzig.«
»Ich wollte doch einfach nur mit dir reden.«
»Über den blöden Pat Burke«, spuckte Catherine aus.
»Catherine!« Nervös warf ihre Mutter einen Blick zur geöffneten Küchentür. »Hüte deine Zunge!«
»Was denn? Darum geht es hier doch, oder?«, fragte Catherine wütend. Sie trat an die Spüle. »Er hat mich mit einem Freund am Bahnhof gesehen, und dann hat er es Daddy erzählt, und jetzt kriege ich Ärger, obwohl ich nichts getan habe!« Nein, nicht fünfzehn, jetzt klang sie wie eine Zehnjährige, und sie war verzweifelt darüber, wie schnell es passierte, wie reflexhaft ihre Stimme in ein kindisches Weinen umschlug. Doch schon im nächsten Moment fiel ihr ein, dass sie in diesem Haus das Recht hatte zu weinen. Nun könnte sie es ebenso gut bis zum bitteren Ende durchziehen; sie knallte die Schüssel in die Spüle. »Das ist ungerecht!«, rief sie und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Catherine, es reicht«, sagte ihre Mutter streng. Sie legte eine Hand auf den Küchentresen und die andere auf den Tisch, um Catherine den Weg zur Tür abzuschneiden. »Ich möchte einfach nur mit dir reden.«
»Ich habe nichts getan«, wiederholte Catherine und machte Anstalten, verächtlich zu lachen und ihre Gefühle zu zeigen, aber dann merkte sie, dass sie nur ein Schluchzen herausbringen würde, und hielt lieber den Mund. »Pat Burke ist gruselig. Keiner kann ihn leiden, und trotzdem glaubt ihr ihm immer noch jedes Wort!«
Ihre Mutter zog eine Augenbraue hoch, wie um Catherine zu verstehen zu geben, dass sie das nicht abstreiten, der Tochter aber genauso wenig offen zustimmen konnte. »Er hat gesagt, er hätte dich mit deinem Freund gesehen.«
»Er ist nicht mein Freund.«
»Na ja, wer immer er auch ist, du hast mit ihm Händchen gehalten.«
»Wir haben uns Musik auf meinem Walkman angehört, verdammt noch mal!«
»Tja, wenn du das in aller Öffentlichkeit tust, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn die Leute reden.«
»O mein Gott. O mein Gott. Wir haben nichts gemacht! Er ist ein Bekannter von mir! Er ist mit meinen Freundinnen befreundet, zufälligerweise musste er auch zum Bahnhof, und ich wollte ihm diesen Song vorspielen, diesen Song, den ich so mag …«
Sie unterbrach sich. Sie hörte selbst, wie lächerlich das klang. Außerdem hatte sie sich jetzt schon verhaspelt, sie war erschrocken darüber, eine Unwahrheit in die Geschichte eingeflochten zu haben. James hatte nicht zum Bahnhof gemusst. Er war nur ihr zuliebe dort gewesen. Um mit ihr zu warten. Um sie zum Abschied zu umarmen. Um winkend auf dem Bahnsteig zu stehen, mit rudernden Armen, weil ihm völlig egal war, ob jemand ihn sah oder ihn auslachte. Er hatte so fröhlich und ausgelassen gewinkt, dass Catherine sich im Zug am liebsten vor ihm versteckt hätte. Aber das konnte sie ihrer Mutter nicht sagen, sie konnte nichts davon sagen. Ihre Mutter würde es nicht verstehen. Sicher hatten ihre Eltern diese Art von Freundschaft niemals erlebt, eine Freundschaft, in der es keine Minute zu verschenken gibt, weil jede Minute eine Gelegenheit ist, über etwas Wichtiges zu –
»Hör mal, Catherine«, sagte ihre Mutter kopfschüttelnd. »Wir wollen dir gar nicht verbieten, einen Freund zu haben. Du bist jetzt alt genug. Du brauchst mich nicht anzulügen.«
»Oh, vielen Dank auch«, sagte Catherine säuerlich. »Wie nett von dir.«
»Ich habe dir gesagt, du sollst nicht so verdammt vorwitzig sein!«
»Ich bin nicht vorwitzig«, sagte Catherine und klatschte ihre Hände auf den Spülenrand. Es musste doch einen Ausweg geben; es musste doch möglich sein, besser zu argumentieren, sich zu wehren und für die eigenen Bedürfnisse einzustehen? Auf eine würdige, auf eine erwachsene Art. Sie überlegte sich, James beim nächsten Treffen danach zu fragen; er würde eine Lösung wissen. James würde wissen, wie man in solchen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt, wie man selbstbewusst klingt und nach ein paar sorgfältig gewählten Worten siegreich aus jedem Streit hervorgeht.
»Ich hasse dieses blöde Arschloch!«, rief sie plötzlich und brach in heftiges Schluchzen aus. Ihre Mutter verdrehte die Augen.
»Du meine Güte, Catherine. Reiß dich zusammen. Du bist achtzehn Jahre alt.«
»Ich weiß!«, heulte Catherine. »Darum geht es doch! James ist ein Freund! Er ist mit meinen Freundinnen befreundet, wir hören Musik zusammen, und er war ein ganzes Jahr in Deutschland, und ich habe ihm im Bahnhof nur auf Wiedersehen gesagt, und ich habe die Schnauze voll, nie darf ich machen, was ich will!«
»Catherine«, sagte ihre Mutter und fing tatsächlich zu lachen an. »Hör auf, das ist doch lächerlich. Natürlich kannst du« – sie schnitt eine Grimasse – »Musik hören, mit wem du willst. Oder auf Wiedersehen sagen oder wie immer man das heutzutage nennt. Daddy hat sich lediglich darüber aufgeregt, dass er es von Pat Burke erfahren hat. Dass Pat Burke ihm etwas über seine eigene Tochter erzählt hat, was er noch nicht wusste. Und ich auch nicht.«
»O mein Gott«, sagte Catherine und schlug sich die Hände an den Kopf. »O mein Gott. Ich halte das nicht mehr aus. Ich …«
»Tja«, sagte ihre Mutter, breitete das Geschirrtuch auf dem Tisch aus und strich es glatt wie eine Landkarte, die sie jetzt unbedingt lesen wollte, »dafür, dass das Ganze nichts zu bedeuten hat, regst du dich ganz schön auf.«
James war nicht ihr Freund. Sie hatte keine Beziehung. Sie hatte weder in der Schule einen Freund gehabt noch in dem langen Sommer nach dem Schulabschluss und auch nicht während des ersten Jahres im College, bis heute nicht. Wie sollte sie auch einen Freund haben, wenn sie wieder zu Hause wohnte? Wobei das für ihre Schwester Ellen kein Hindernis war; Ellen war erst sechzehn und lebte folglich ständig zu Hause, was sie aber kein bisschen davon abhielt, einen Freund zu haben, im Gegenteil, sie hatte Freunde, so viele sie wollte. Nicht, dass ihre Eltern mit Ellen weniger streng gewesen wären als mit Catherine, aber Ellen ignorierte die Verbote, besser gesagt umging sie sie mit der Umsicht und der Geschicklichkeit eines Bombenentschärfers. Ganz besonders jetzt, wo das letzte Schuljahr anstehe, habe sie nicht vor, auf wichtige Erfahrungen zu verzichten, hatte sie Catherine erklärt. Wenn sie also in den Pub gehen wollte, wo die Jugendlichen sich zum Trinken trafen, behauptete sie, bei einer Freundin Mathe zu üben, und wenn ihr Vater sie vier oder fünf Stunden später abholte, stand sie wartend vor dem Haus und kaute Kaugummi, um den Geruch des Cider zu überdecken; und auch dafür, dass ihre Kleidung fürchterlich nach Zigarettenqualm stank, hatte sie stets eine überzeugende Erklärung parat. Die sie niemals vorbringen musste. Denn ihr Vater, hatte Ellen Catherine erklärt, wolle unbedingt daran glauben, dass sie so etwas niemals tun würde, dass sie nie im Leben saufen und rauchen und in dunklen Gassen mit irgendwelchen Typen rummachen würde, und aus diesem Grund hielt er durch und glaubte weiter fest an sie. Ihre Mutter hingegen wisse Bescheid, sagte Ellen; ihre Mutter sei mehr als einmal am Morgen danach in ihr Zimmer gekommen und habe sie ausgeschimpft. Ellen stritt alles ab und machte weiterhin, was sie wollte; sie vermutete sogar, dass ihre Mutter ihr dafür insgeheim eine gewisse Achtung zollte.
»Wenn sie Shane Keegan kennen würde, würde sie darauf bestehen, dass ich mit ihm knutsche«, hatte sie Catherine Anfang des Jahres erklärt. »Er ist ein echtes Sahneschnittchen. So was darf man sich nicht entgehen lassen.«
»Ja, genau«, hatte Catherine geschnaubt. »Wenn sie herausfinden, dass du was mit einem Keegan hattest, kriegst du Hausarrest, bis du fünfundzwanzig bist.«
»Sollen sie es doch versuchen«, hatte Ellen gesagt und einen Tennisball gegen die Kinderzimmerwand geworfen. »Wie dem auch sei, ist doch schön, wenn wenigstens eine von uns ihren Spaß hat. Ist doch reine Zeitverschwendung, die Collegezeit nicht dafür zu nutzen, Erfahrungen zu sammeln. Ich an deiner Stelle hätte mir längst diesen Conor geschnappt.«
»Nein, hättest du nicht.«
»Und ob! Scheint ein lustiger Typ zu sein.«
»Na ja«, sagte Catherine matt, »es ist nicht so einfach, wenn man zusammen studiert.«
»Natürlich ist es das«, sagte Ellen und fing den Ball wieder auf. »Du weißt bloß nicht, wie es geht.«
Dabei bist du nicht einmal hässlich; das hatte Ellen gesagt, als sie wieder einmal laut über Catherines fortdauernde Enthaltsamkeit nachgedacht hatte. Na ja, vielleicht nicht gerade Enthaltsamkeit – wenn sie ausging, kam es regelmäßig vor, dass sie einen Jungen küsste beziehungsweise dem Drängen eines Jungen nachgab, der sie küssen wollte, sie ließ sich eine fremde Zunge in den Mund schieben und an den Hintern fassen –, aber so ähnlich. Ein Leben als Single. Nein, ein Leben als Trottel, sagte Ellen, als Catherine ihr die Lage schilderte. Sie sei groß und trage halbwegs modische Klamotten und habe langes Haar, und ihre Haut sei auch ganz in Ordnung. Woran lag es also? Was hielt sie zurück? Sie müsse einfach nur, erklärte Ellen, mit jemandem ins Kino gehen oder in den Pub, zum Knutschen und zum Reden, und wenn sie genug von ihm hätte, könnte sie einfach Schluss machen. So lief das. Es sei denn, man war hässlich.
Nicht einmal hässlich; Catherine fand das seltsamerweise ausreichend. Spätestens im College hatte sie gemerkt, dass die Jungs sie attraktiv fanden – Jungs schauten ihr hinterher, flirteten mit ihr, erzählten ihr, wo die nächste Party stattfinden würde. Und das Zusammenleben mit Amy und Lorraine bedeutete ebenfalls, dass sie viele Jungs kennenlernte. Die Sache mit Conor lehnten die beiden entschieden ab. Conor, der in einem von Catherines Englischtutorien war und den sie das ganze Jahr lang angeschmachtet hatte, mit dem sie eine Freundschaft unterhielt, die hauptsächlich darin bestand, dass er sie aufzog und ihr eine halbe Stunde später die passende Antwort darauf einfiel.
Das Problem, wobei Catherine selbst es nicht als Problem empfand, war, dass sie gar nichts Richtiges wollte. Mit jemandem knutschen, den sie kannte, konnte sie sich nicht vorstellen. Wie sollte man dem anderen danach noch unter die Augen treten? Da waren einfach zu viele Körperflüssigkeiten im Spiel. Schleim, so nannte sie es in ihrer Vorstellung; wenn man nicht aufpasste, drängte sich der Schleim zwischen zwei Menschen. Es war widerlich. Unwürdig. Es war undenkbar. Und Sex: nein. Einfach nein. So weit würde es niemals kommen; nicht, solange sie keine Möglichkeit gefunden hatte, mit der Scham danach zu leben. Was natürlich ein sexuelles Erlebnis voraussetzte, oder zumindest den Versuch; aber das war ein Denkfehler, den Catherine sich, wie sie meinte, getrost erlauben konnte.
Catherine hatte James am Morgen nach dem Streit mit Conor kennengelernt. Sie war im Pavilion gewesen, einer Bar für Kricketspieler am hinteren Ende des Campus, wo sich alle nach den Prüfungen trafen, oder auch davor, wie im Falle von Amy und Lorraine. Catherines Hausarbeit in Kunstgeschichte war eine Katastrophe gewesen, und sie hatte sich absichtlich volllaufen lassen, um die Erinnerung auszulöschen – keine gute Idee, wenn Conor in der Nähe war. Es war erst halb zehn, Catherine saß zusammengesackt neben ihm auf der Bank und versuchte es mit ihrem ältesten Trick, einem Trick, den sie schon in der Schulzeit – vergeblich – angewandt hatte: Sie ließ sich an seine Schulter sinken und stellte sich schlafend in der Hoffnung, er würde es bemerken, seinen Arm um sie legen und sie an sich ziehen.
Conor legte keinen Arm um sie. Conor rückte ab, so unvermittelt, dass ihr Kopf beinahe gegen die Kante der Holzbank geschlagen wäre. Er machte sich vor allen Anwesenden über Catherine lustig; er stupste sie an – sie stellte sich, starr vor Scham, immer noch schlafend und ließ den Kopf hängen, weil ihr nichts Besseres einfiel – und sagte ihr, sie müsse jetzt aufwachen und nach Hause gehen. Und dann rief er nach Amy, was das Allerletzte war, was Catherine wollte; Amy würde sie für dieses erbärmliche Theater erschlagen, und tatsächlich, als Catherine die Augen öffnete, stand Amy schon vor ihr. Ihre Miene war finster wie ein Gewitter, schon legten sich ihre starken, wütenden Hände an Catherines Ellenbogen.
»Nimm die Kleine mit in die Baggot Street, Ames«, rief Conor, »oder setz sie in den nächsten Bus oder sonst was.«
Catherine zog eine Schnute, ein weiterer alter Trick mit ähnlich niedriger Erfolgsrate. »Ich will nicht nach Hause.«
»Ich bringe sie nicht nach Hause«, sagte Amy, »es ist noch nicht mal zehn.« Sie zog Catherine auf die Beine und schob sie vor sich her, zu der winzigen Damentoilette neben dem Eingang. »Und ich heiße nicht Ames«, schrie sie Conor noch zu.
»Wie du meinst, Schätzchen«, sagte Conor.
»Arschloch«, sagte Amy und gab Catherine einen Stups. »Los jetzt, weiter.«
»Wohin?«
»Du gehst jetzt kotzen, und danach wasche ich dir dein dummes kleines Gesicht mit kaltem Wasser«, sagte Amy. »Trägst du Wimperntusche?«
»Du weißt doch, dass ich mir nie die Augen schminke.«
»Ja, darüber müssen wir auch mal dringend reden«, sagte Amy. Sie hatten die Damentoilette erreicht, Amy schob Catherine in eine Kabine. »Vorbeugen«, befahl sie. »Denk an was Ekliges.«
»Conor ist eklig.«
»Jetzt hör doch mal mit Conor auf«, sagte Amy, »denk an Ungeziefer oder so was. An Würmer.«
»Mit Würmern habe ich kein Problem«, sagte Catherine. »Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen.«
»Jetzt hör doch mal mit deinem blöden Bauernhof auf«, sagte Amy. »Das interessiert doch wirklich niemanden. Wenn man dich so hört, könnte man glatt meinen, du hättest dich vor einer Hungersnot ins College gerettet. Kühe und Traktoren, verdammt. Na und? Mein Dad hat einen Aufsitzrasenmäher. Hast du mich jemals jammern hören deswegen? Also. Komm mal her.« Sie drückte Catherines Kopf über die Toilettenschüssel. »Mund auf.«
»Warum?«, jammerte Catherine.
»Mund auf«, wiederholte Amy. Catherine gehorchte, Amy schob ihr schnell zwei Finger in den Hals, bis das Mittagessen und ein Schwall Cider in die Höhe schossen.
»Geht doch«, sagte Amy und tätschelte Catherines Hinterkopf. »Braves Mädchen.«
»Ich hasse Conor«, sagte Catherine. Sie hustete, wischte sich über die Lippen. »Ich hasse ihn.«
»Dann verhalte dich entsprechend«, sagte Amy und drehte das Wasser auf. »So, und jetzt besaufen wir uns noch mal von vorn, und morgen kommt James aus Berlin zurück, und wir werden einen ganzen Tag mit ihm verbringen und weitersaufen, und du wirst keine weitere Minute deines herrlichen Suffs mehr an Conor Moran verschwenden. Du wirst nicht mal an ihn denken. Und jetzt wasch dich.« Sie zeigte auf das Becken, verschwand in einer Kabine, schob ihren Rock in die Höhe und ihren Schlüpfer nach unten.
»Soll ich rausgehen?«, fragte Catherine beschämt.
»Wasch dich, Catherine, und mach ein freundliches Gesicht«, sagte Amy, und dann legte sie den Kopf in den Nacken und lauschte auf ihren lauten, mühelosen Strahl.
*
Das ganze Jahr hindurch hatte James in der Baggot Street weiterexistiert, als Fotografie, die jemand mit Tesafilm an den Spiegel über dem Kamin geklebt hatte. Auf dem Bild waren vor allem seine Beine zu sehen, er saß vor dem Sofa auf dem Teppich und wurde rücklings von Amy umarmt, deren lachendes Gesicht aus seinen Haaren herausschaute, einem Gewirr aus roten Locken und Wellen und Wirbeln. Er selbst blickte mit Leidensmiene in die Kamera, aber auf eine ironische, zufriedene Weise.
James war auch eine Reihe von Zeichnungen, die Catherine im Schlaf bewachte und dabei plattdrückte wie getrocknete Blüten, auch wenn sie davon in den ersten Monaten nichts ahnte. Wenn sie kurz vor Weihnachten nicht den Film über einen Künstler gesehen hätten, dessen Zeichnungen die Mädchen an James’ Bilder erinnerte, hätte Catherine niemals erfahren, worauf sie schlief; aber so war Amy in Catherines Zimmer gegangen und hatte die große Mappe von unter der Matratze herausgezogen. Lorraine räumte den Teppich frei und schob Teebecher und Zigarettenschachteln und den Evening Herald beiseite, der seit zwei Wochen dort lag. Amy legte die Mappe auf den Boden und klappte sie auf.
Keiner der Porträtierten sah ihn direkt an, das war Catherine als Erstes aufgefallen. Er arbeitete mit Kohle, sie konnte sich gut genug an ihren Kunstunterricht erinnern, um das zu erkennen. Sein Strich wirkte überlegt, er schien nichts dem Zufall zu überlassen und achtete auf jedes Detail – den Ring am Finger, die Falte im Stoff, die verhornte Haut am Ellenbogen –, als müsste es eingefangen und vor einer drohenden Gefahr bewahrt werden. Aber es war nicht seine Akribie, sondern der Ausdruck auf den Gesichtern, die darin gespiegelten Launen und Gedanken, die unter der Haut dahinzufließen schienen wie unsichtbare Strömungen, die die aus einem Block ausgerissenen Seiten am meisten auszeichneten. Catherine schaute betroffen zu, wie Amy in der Mappe blätterte, und auf einmal fühlte sie eine unerklärliche Unruhe.
»Keiner merkt es«, sagte sie, ohne nachzudenken, »keiner merkt, dass er gezeichnet wird.«
Amy neben ihr nickte. »Ja, so macht er das. Er beobachtet die Leute heimlich.«
»Der kleine Stalker«, sagte Lorraine, »der kleine Paparazzo-Arsch.«
»Sieh mal, das ist Lorraine«, sagte Amy, und Lorraine heulte auf.
»Ich habe ein Doppelkinn!«
»Doch, das bist du«, sagte Catherine und nahm die Zeichnung in die Hand, »nur mit Doppelkinn.«
»Der hinterfotzige Arsch«, sagte Lorraine und griff nach ihren Zigaretten. »Das habe ich ihm nicht erlaubt.«
Catherine sah Amy an. »Hat er dich auch gezeichnet?«
Sie nickte. »Es ist irgendwo da drin. Während des Irischunterrichts letztes Jahr.«
»Sie hat aus dem Fenster gestarrt und überlegt, ob sie Robbie Fox einen runterholen soll oder nicht«, sagte Lorraine.
»Halt die Klappe«, lachte Amy. Sie blätterte jetzt schneller, hob jedes Blatt an der rechten unteren Ecke an und trennte es vorsichtig vom darunter liegenden. Nach ungefähr fünfzehn Bildern hielt sie inne. »Da bin ich«, sagte sie und zog das Blatt langsam aus dem Stapel.
»Das ist wunderschön«, sagte Catherine leise.
»Findet Robbie auch«, schnaufte Lorraine.
»Nein, im Ernst«, sagte Catherine in das Lachen der anderen hinein. Sie beugte sich vor. Amy trug einen Schulpullunder, die Krawatte über dem weißen Hemd war gelockert, ihr Kinn auf beide Fäuste gestützt. Lorraine hatte sich richtig erinnert; Amy schaute aus dem Fenster. James hatte einen hölzernen Rahmen gezeichnet, darin die Silhouetten der gegenüberliegenden Gebäude, und die kleine Kreole in Amys rechtem Ohrläppchen und den Kuli in ihrer Hand. Und wie in den anderen Porträts auch hatte er einen bestimmten Blick eingefangen, einen Zug um den Mund, der Catherine ein unbestimmtes Gefühl von Sorge bereitete, von Unbehagen. Dabei wirkte die Schulabschluss-Amy auf der Kohlezeichnung kein bisschen besorgt, ganz im Gegenteil, sie machte einen recht zufriedenen Eindruck, war in Gedanken ganz woanders, tief versunken; sie war wunderschön, zart und rehäugig, aber Catherine beschlich bei ihrem Anblick das Gefühl, etwas Verbotenes zu betrachten. Und dann merkte sie, woran es lag: am Winkel. Um Amy aus dieser Perspektive zeichnen zu können, hätte James dicht vor ihr sitzen müssen, leicht nach rechts versetzt; er hätte sich vor sie setzen und dem Lehrer den Rücken zukehren müssen.
»Und du hast wirklich nichts gemerkt?«, fragte sie, aber Amy zuckte nur die Schultern.
»So ist das eben. Man bekommt nichts mit, es ist, als wäre er unsichtbar. Ich weiß auch nicht, wie er es macht.«
Aber am Morgen seiner Ankunft hatte Catherine James fast schon wieder vergessen beziehungsweise war Catherine mit anderen Dingen zu beschäftigt gewesen, um an seine Heimkehr zu denken. Hauptsächlich mit ihrer Erinnerung an den Vorabend, der kurz vor dem Morgengrauen in der Grafton Street geendet war, wo Conor sie bei den Schultern gepackt und auf sie eingeredet hatte. Sie sei ein tolles Mädchen, ein tolles Mädchen, immer wieder sagte er das, obwohl er es skandalöserweise immer noch nicht geschafft hatte, sie in den Arm zu nehmen; eine Geste, die sie sich nun schon so lange und so verzweifelt wünschte, dass sie fürchtete, sich hier vor seinen Augen in Luft aufzulösen, als er seine gleichgültigen Finger an ihre Haut legte, oder ihm alternativ in die Eier zu treten, was sie, wenn sie genauer nachdachte, dann wohl auch versucht hatte – wieder hörte sie Amy O Gott, Catherine! rufen. Aber nicht einmal das war ihr gelungen, Conor hatte sich zu schnell wieder aufgerichtet, er war sehr zufrieden, das hatte sie gesehen, und jetzt war er weg und würde den ganzen Sommer in Wexford verbringen, wo sein Onkel einen Pub betrieb, sie würde ihn nicht vor Oktober wiedersehen. Catherine fühlte sich ebenso elend wie erleichtert; keine hämischen Kommentare mehr, kein Spott, keine Launen. Bevor sie vom Pav zum Club gegangen waren, hatte sie ihn gefragt – trotz Amys Ansprache in der Toilette hatte sie es nicht geschafft, sich von ihm fernzuhalten, nicht länger als zwanzig Minuten –, was sie seiner Meinung nach tun sollte in ihrer Lage beziehungsweise Nicht-Lage. Es ging um ihren Ferienjob in der Lokalredaktion von Longfords Tageszeitung. Seit Januar hatte sie den Chefredakteur anrufen und ihn daran erinnern wollen, dass er ihr angeboten hatte wiederzukommen, sobald sie im College war. Aber sie hatte ihn noch nicht angerufen, aus verschiedenen Gründen.
»Aus einem Grund, Citóg«, hatte Conor geschnaubt, »aus einem einzigen Grund. Lähmende Angst.«
»Ich habe keine Angst vor ihm«, hatte Catherine geantwortet, wie immer entzückt darüber, dass er sie mit dem ihr zugeteilten Spitznamen angesprochen hatte. Der Name ergab keinen Sinn, es handelte sich um das irische Wort für Linkshänder, wo Catherine doch Rechtshänderin war. Sie liebte ihren Spitznamen trotzdem und erschauderte vor Glück, wann immer sie ihn hörte. »Wie soll ich Angst vor ihm haben, wenn ich ihn nicht einmal kenne?«
»Genau. Als hätte dich das jemals davon abgehalten, dich zu fürchten.«
»Schnauze.«
Dann hatte Conor einen Dritten ins Gespräch verwickelt, er hatte Catherine – sie beschloss auf der Stelle, es ihm übelzunehmen – vor einer praktisch fremden Person gedemütigt: Emmet Doyle, einem schüchternen Jungen aus Dublin, den Catherine von den Redaktionssitzungen der Trinity News flüchtig kannte. Er schrieb hauptsächlich über langweilige Themen, über Politik und die Studentenvertretung, und trug meistens eine leicht eigenwillige Kombination aus gebügelten Hemden und abgewetzten Cordhosen. Weiche braune Locken umrahmten sein Gesicht, und er wurde rot, wenn man ihn ansprach. Das hätte ihn in Catherines Augen sympathisch machen müssen, litt sie doch unter der gleichen Schüchternheit; aber stattdessen irritierte die Gemeinsamkeit sie nur. Sie wünschte sich Männer, deren Gesicht nichts preisgab, nicht erahnen ließ, was im Kopf passierte. Aber da stand Emmet Doyle nun, mit rotem Kopf und bestürztem Ausdruck, während Conor ihm Catherines lächerliche Unfähigkeit darlegte, die Telefonnummer des Longford Leader zu wählen. Obwohl Catherine an Conors Arm zog und ihn boxte und ihn bat, die Sache nicht so aufzubauschen, ließ Emmet es sich nicht nehmen, in höflicher, tadelloser, gepflegter South-County-Manier auf Catherines Problem einzugehen. Er schlug ihr vor, wie die Sache anzugehen wäre, was sie dem Chefredakteur sagen, welche Erklärungen sie vorbringen könnte.
»Ich meine, sag ihm doch einfach, du hättest, äh, Erfahrung. Du hast Nachrichten geschrieben, und du kennst dich mit dem Layout aus und weißt, was ein Feature ist und so weiter. Ich meine, du hast doch für die Trinity News geschrieben, oder? Ich habe deinen Namen gelesen.«
Sie zuckte die Achseln. »Hin und wieder …«
»Sag ihm einfach, du hättest das letzte Interview mit Jeff Buckley geführt«, ging Conor dazwischen.
»Mit wem?«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.