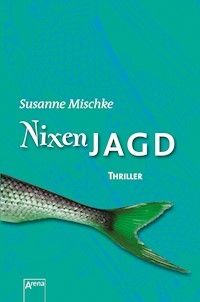10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hauptkommissar Bodo Völxen hatte keine Ahnung, dass es im Leben seiner altgedienten Sekretärin, Edeltraut Cebulla, einen Mann gibt. Oder vielmehr: gab. Denn der Herr ist seit ein paar Tagen spurlos verschwunden – mitsamt ihrem Geld. Die Indizien weisen auf einen Profi-Heiratsschwindler hin. Die Ereignisse überschlagen sich, als eine seiner Verflossenen tot aufgefunden wird. Ist Frau Cebulla womöglich auch in Gefahr? Band 8 der Hannover-Krimis von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Susanne Mischke »Susanne Mischke versteht es, ihrem Ermittlerensemble auf unterhaltsame Art Charakter zu verleihen.« NDR 1 Kulturspiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
Samstag, 28. April
Montag, 30. April
Dienstag, 1. Mai
Mittwoch, 2. Mai
Donnerstag, 3. Mai
Freitag, 4. Mai
Samstag, 5. Mai
Sonntag, 6. Mai
Montag, 7. Mai
Dienstag, 8. Mai
Montag, 14. Mai
Montag, 30. April
»Du hättest nicht extra aufstehen müssen, einen Kaffee kann ich mir gerade noch selber kochen.« Hauptkommissar Bodo Völxen platziert einen Kuss auf die vom Kopfkissen leicht zerknitterte Wange seiner Frau.
»Du hättest dir den Brückentag ruhig freinehmen können, so wie andere Leute auch.« Schmollend und etwas unsanft stellt Sabine Völxen die Butterdose auf den Frühstückstisch.
»Wollte ich ja, aber die anderen waren schneller.«
»Wer ist noch gleich der Chef bei euch?«
»Das frage ich mich auch manchmal.«
»Lüg mich nicht an, Bodo, und hör auf, Oscar vom Tisch zu füttern.«
Der Terriermischling spitzt die Ohren, als er seinen Namen hört. Zwei dünne Speichelfäden ziehen sich von seiner Schnauze bis zum Fußboden.
»Okay, ich gestehe. Ich wollte mir nicht freinehmen. An solchen Tagen ist es immer so wunderbar ruhig im Büro, da kann man einen Haufen Verwaltungskram abarbeiten. Nicht mal die Cebulla ist da und nervt mich mit ihren Kräutertees, es ist das reinste Paradies.«
»Beneidenswert, wie du dich auf die Arbeit freust«, spöttelt Sabine. »Hier gibt es auch eine Menge zu tun, falls dir das entgangen sein sollte. Die hintere Dachrinne ist seit Wochen verstopft, und du wolltest mit Köpcke zusammen den Hof pflastern. Die Steine dafür liegen seit zwei Jahren hinter der Garage. Außerdem ist es allerhöchste Zeit, die Schafe zu scheren. Die armen Dinger …«
»Dass du dich neuerdings so um das Wohl der Schafe sorgst.« Völxen lächelt vielsagend und verspricht, die Tiere am nächsten Tag zu scheren. »Wo wir schon davon sprechen …« Er leert seine Kaffeetasse und streicht über sein stoppeliges Kinn. »Ich bin ja auch noch nicht rasiert.«
»Wozu, wenn dich heute eh keiner sieht?«, murmelt Sabine.
»Man weiß nie.«
Sabine Völxen sieht ihrem Mann nach, der in Pantoffeln und seinem zerschlissenen gestreiften Bademantel die Treppe hinaufschlappt. Oscar nimmt derweil auf dem gerade frei gewordenen Küchenstuhl Platz und leckt ein paar Brötchenkrümel und Eigelbreste vom Teller seines Herrchens.
»Oscar, runter vom Stuhl! Was fällt dir ein? Sind das die Manieren, die sie dir bei der Polizei beibringen?«
Der Hund gehorcht widerstrebend, und Sabine macht es sich mit der Zeitung bequem. Weil der erste Mai dieses Jahr auf einen Dienstag fällt, hat ihr Arbeitgeber, die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, den Montag zum unterrichtsfreien Tag erklärt. Und sie weiß auch schon, womit sie ihn ausfüllen wird.
»SABINE!«
Sie legt die Zeitung weg und eilt die Treppe hinauf, dem Gebrüll ihres Ehemannes hinterher.
Völxen steht im Bad und deutet anklagend auf eine braune, haarige Masse in einer mit Wasser gefüllten Plastikwanne, die in der Badewanne steht. »Was, zum Teufel, ist das? Es stinkt erbärmlich!«
»Hab ich vergessen, dir zu sagen. Die Tierärztin hat doch zwei Briards …«
»Was sind Briards?«, fällt Völxen seiner Frau ins Wort.
»Hütehunde. So groß wie Zwergponys und sehr, sehr haarig.«
»Was macht ein toter Hund in unserer Badewanne?«
»Sei nicht albern. Sie hat sie geschoren, und ich soll ihr die Wolle verspinnen, für einen Pullover.«
»Einen Pullover aus … Hund?« Seine Kinnlade fällt herunter.
»Für mich ist das eine tolle Herausforderung, und da du mit der Schafschur ja nicht in die Gänge kommst …«, verteidigt sich Sabine. »Aber weil die Haare wirklich ein bisschen müffeln, dachte ich, ich wasche sie lieber mal.«
»Alles, was recht ist, Sabine, aber deine Spinnerei nimmt langsam bedenkliche Formen an.«
Angefangen hatte es mit einem Mitbringsel ihrer Tochter Wanda, das sich als das reinste Danaergeschenk erwies. Damit ihr eure Schafwolle selbst verspinnen könnt, das ist voll im Trend, hat Wanda erklärt, als sie mit einer einfachen Handspindel von irgendeinem Kunsthandwerkermarkt ankam. Ihre Mutter fand sofort Gefallen an der Idee, und nachdem Familie und Freunde mit dicken, kratzigen Socken aus heimischer Schafwolle versorgt worden waren, erwähnte die Nachbarin Hanne Köpcke ein altes Spinnrad, das auf ihrem Dachboden stünde und das Sabine ihr sofort abschwatzte. Seither gab es kein Halten mehr. Wandas ehemaliges Kinderzimmer wurde kurzerhand zur Spinnerei umfunktioniert, und sogar andere Frauen aus dem Dorf ließen sich vom Spinnfieber anstecken, sodass ein regelrechter Wettbewerb ausgebrochen war. Den Winter über hat Sabine mit dem Wollvlies von der letzten Schafschur geübt, jetzt wartet sie ungeduldig auf Nachschub.
»Sei froh, so haben deine Schafe endlich mal einen Nutzen«, meint Sabine.
»Sie mähen seit Jahren die Obstwiese.«
»Teilweise. Was ihnen halt so schmeckt.«
Völxen muss zugeben, dass die heiklen Biester wirklich sehr selektiv fressen und er regelmäßig mit der Sense nachmähen muss.
»Trotzdem, Hundehaare in der Wanne … Was kommt als Nächstes? Nur, dass ich mich nicht wieder so erschrecke.«
»Wir könnten uns Alpakas anschaffen«, antwortet Sabine prompt. »Die sind niedlich, und die Wolle ist sehr kostbar. Wir könnten sogar Geld damit verdienen.«
Nein, er wird ihr nicht auf den Leim gehen, garantiert will sie ihn nur veräppeln. Aber ganz sicher kann man nicht sein, erkennt Völxen mit einem misstrauischen Blick auf die Hundehaare, während Sabine wieder hinabgeht, um ihr Frühstück zu beenden.
Hundehaarpullover! Die Welt wird immer verrückter, und nun ist der Irrsinn auch in sein trautes Heim eingezogen.
Noch während er diesem Gedanken nachhängt, dringt von unten Gezeter an sein Ohr, bei dem es um Oscar und ein verschwundenes Brötchen geht.
*
»Heiliger Strohsack!«, bemerkt Sabine Völxen eine halbe Stunde später, als ihr Gatte die Treppe wieder herunterkommt. Er ist sorgfältig rasiert, eine Wolke aus Rasierwasser eilt ihm voraus, und er trägt den neuen Anzug, den er sich kürzlich für die Hochzeit von Jule Wedekin und Fernando Rodriguez zugelegt hat. Sein Resthaar ist nach hinten gekämmt wie bei einem Gigolo. Hat er sich an dem Haargel vergriffen, das Wanda hier noch herumstehen hat?
»Wie sehe ich aus?«
»George Clooney kann einpacken.« Sabine runzelt die Stirn. »Hast du ein Rendezvous?«
»So was Ähnliches. Der Vizepräsident der Polizeidirektion himself hat mich zum Mittagessen eingeladen.«
»Oha.«
»Ich will’s nicht verschreien, aber ich denke, es geht um meine längst überfällige Beförderung zum EKHK.«
»Was immer das heißt …«
»Erster Kriminalhauptkommissar. Besoldungsgruppe A13 – mehr Gehalt und mehr Rente.«
»Was musst du dafür tun?«
»Nur ein bisschen schleimen und arschkriechen.«
»So siehst du auch aus«, bemerkt Sabine. »Und was kommt dann, noch mehr Überstunden?«
»Mein Job bleibt derselbe.«
»Wirklich? Beamter müsste man sein.«
»Noch besser: Beamtenehefrau. Die haben es doch von allen Geschöpfen dieser Erde am besten getroffen, nicht wahr, mein Schatz?«, flötet Völxen.
»Ja, mein Gönner.«
»Ich verspreche dir, wenn die Beförderung durch ist, dann lasse ich den Hof von richtigen Profis pflastern. Für mein Kreuz wäre das sowieso Gift.«
»Kann ich das schriftlich haben?«
»Du hast mein Ehrenwort, das ist viel mehr wert. – Nein, Oscar, du bleibst hier, du musst Frau und Schafe bewachen.«
Oscar, der schon aufgesprungen war, legt sich wieder in seinen Korb. Wenn Sabine ebenfalls arbeiten ist, muss sein Herrchen ihn mit zum Dienst nehmen, da der Hund bei längerer Abwesenheit seiner Besitzer dazu neigt, aus Langeweile, Frust oder blankem Übermut Einrichtungsgegenstände zu beschädigen.
»Meinst du, du schaffst es, dass der tote Hund bis heute Abend aus der Wanne verschwindet?«, fragt Völxen im Hinausgehen.
»Mal sehen, was sich machen lässt«, entgegnet Sabine. »Denk daran, heute Abend ist Tanz in den Mai von der Freiwilligen Feuerwehr im Dorfgemeinschaftshaus.«
Völxen dreht sich auf der Türschwelle um und verzieht das Gesicht. »Müssen wir da hin?«
»Wenn man mit Frau und Schafen auf dem Land lebt, ist das Pflicht.«
Obgleich sie nun schon seit dreißig Jahren in einem ehemaligen Bauernhof am Dorfrand wohnen, kann Sabine es dennoch nicht lassen, ihn gelegentlich darauf hinzuweisen, dass er es war, der aufs Land ziehen wollte, während sie lieber in der Stadt geblieben wäre. Dabei ist sie im Gegensatz zu ihm selbst geradezu ein Paradebeispiel gelungener Integration. Sie ist in zig Vereinen aktiv, etliche ihrer privaten Klarinettenschüler kommen aus dem Neubaugebiet, und jetzt hat sie auch noch den Spinnkreis ins Leben gerufen.
»Du kannst den Anzug dann gleich anlassen!«, ruft sie ihm nach. »Oder lieber doch nicht. Sonst erkennt dich keiner, und es gibt am Ende noch Gerüchte, ich hätte einen Lover.«
*
Auf den Fluren der Dienststelle herrscht tatsächlich Stille wie sonst nur an den Wochenenden. Lediglich die Tür zu Erwin Raukels Büro steht ein Stück offen. Völxen späht hinein.
Offensichtlich steht der Kollege Raukel kurz vorm Burn-out. Sein Kopf ruht auf dem Polster seines Doppelkinns, die Augen sind geschlossen, die Arme hat er über seiner Bauchkugel verschränkt. Zwischen seinen Lippen, die aussehen wie ein fettes Herz, entweicht in rhythmischen Ph-Lauten die Luft. Vorsichtig macht Völxen die Tür zu. Hoffentlich kann er Raukel heute aus dem Weg gehen, es hagelt sonst nur saudumme Bemerkungen wegen seines Anzugs.
In seinem eigenen Reich angekommen hängt der Hauptkommissar das Jackett über die Lehne seines Schreibtischsessels und fährt den Computer hoch. Die Sonne scheint durch die Jalousien und wirft ein Streifenmuster auf den Boden. Viel Lust hat er wirklich nicht, sich dem Wust an lästigen Aufgaben zu widmen, der sich seit Längerem aufgestaut hat. Eigentlich gar keine. Der Hundekorb unter dem Gummibaum erinnert ihn an sein daheimgebliebenes Haustier, das er im Stillen nun doch beneidet, von der Ehefrau ganz zu schweigen. Wer konnte auch ahnen, dass der letzte Apriltag so strahlend schön sein würde?
Statistiken, Reports, idiotische Umfragen und Erlasse des Ministeriums … mit der fortschreitenden Digitalisierung nimmt all der Ballast überhand, der mit Ermittlungsarbeit nicht das Geringste zu tun hat. Es grenzt an ein Wunder, dass neben der ganzen Bürokratie überhaupt noch Zeit bleibt, um Delikte aufzuklären. Zudem drängt sich Völxen der leise Verdacht auf, dass das nach seiner Beförderung zum EKHK nicht besser werden wird. Nichts im Leben bekommt man geschenkt. Diese Lektion hat er längst gelernt. Andererseits ist es bis zur Pensionierung nicht mehr gar so lang hin. Zwei, drei Jährchen etwa, da kann ein kleiner Karrierekick nicht schaden.
Vielleicht sollte er sich erst einmal einen Kaffee machen.
Er öffnet die Tür und fährt zusammen, denn vor ihm auf dem Flur steht, wie aus dem Boden gewachsen, Frau Cebulla, die Sekretärin des Dezernats für Tötungsdelikte, und blickt ihn ebenso entgeistert an wie er sie.
»Himmel! Haben Sie mir einen Schrecken eingejagt!«, keucht der Hauptkommissar.
»Ich wollte gerade anklopfen.«
»Und ich wollte gerade in Ihr Büro gehen und mir einen Kaffee machen. Aber wo Sie schon einmal da sind … Dürfte ich Sie darum bitten? Ich komme mit dieser neuen Maschine nämlich immer noch nicht zurecht.«
Frau Cebullas Mund klappt auf und wieder zu, dann dreht sie sich auf dem Absatz um und verschwindet in ihrem Büro.
Völxen blickt ihr verwundert nach. Warum schaut sie ihn an, als hätte er von ihr verlangt, durch einen brennenden Reifen zu springen? Sie ist sich doch sonst auch nicht zu fein dazu, sich um sein leibliches Wohl zu kümmern. Oder liegt es an seiner blendenden Erscheinung? Er sollte wirklich öfter mal im Anzug hier auflaufen, damit sich das Personal daran gewöhnt und nicht gleich in Schockstarre verfällt.
»Ich dachte, Sie hätten den Brückentag frei, aber anscheinend habe ich da etwas durcheinandergebracht«, sagt er wenig später zu Frau Cebulla, als diese mit der Schafstasse voll Kaffee in sein Büro kommt.
»Es stimmt schon, ich habe heute eigentlich Urlaub.«
»Oje. Entschuldigen Sie bitte, warum haben Sie denn nichts gesagt?«
Sie winkt müde ab. »Das macht doch nichts.«
Warum ist sie dann hier, wenn sie frei hat? Er will sie schon fragen, ob sie sich gar nicht von ihm losreißen kann, aber etwas Angespanntes in ihrer Miene hält ihn davon ab.
»Herr Hauptkommissar, kann ich kurz mit Ihnen sprechen?«
Was ist denn jetzt? Will sie eine Gehaltserhöhung?
»Natürlich«, sagt er, innerlich widerstrebend. »Möchten Sie sich setzen?«
Sie sinkt auf einen der zwei Besucherstühle, als hätte man ihr die Luft rausgelassen. Ihr Gesicht ist bleich, aber auf den Wangen zeichnen sich unregelmäßige rote Flecken ab. Das Weiß ihrer Augen sieht entzündet aus, und die Tränensäcke sind angeschwollen. Ist Frau Cebulla krank? Was macht sie dann hier? Hoffentlich ist es nichts Ansteckendes! Unwillkürlich rollt Völxen in seinem orthopädischen Stuhl ein paar Zentimeter zurück.
»Ich möchte eine Person als vermisst melden«, sagt Frau Cebulla mit aufgesetzter Förmlichkeit und verknotet dabei nervös ihre Finger. Ihre Nägel sind lackiert, was wiederum Völxen aus der Fassung bringt. Frau Cebulla und ferrarirote Fingernägel, das ist ein Novum und geht in seinem Kopf nur schwer zusammen.
»Und wen?«, fragt er.
»Sein Name ist Viktor Füssli. Er ist mein …«, sie scheint nach dem passenden Wort zu suchen, »… mein Freund. Wir wollten am Samstagnachmittag zusammen wegfahren, aber er ist nicht gekommen, und wenn ich ihn anrufe, meldet sich nur die Mailbox. Und ehe Sie fragen: Nein, wir hatten keinen Streit. Alles war in bester Ordnung.«
Plötzlich ist es für einige Sekunden mucksmäuschenstill im Büro.
Die Cebulla hat einen Liebhaber! Wer hätte das gedacht?
»Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrem … äh … Freund gesprochen?«, fragt der Hauptkommissar, nachdem er sich geräuspert und seiner Verblüffung wieder einigermaßen Herr geworden ist.
»Am Donnerstag haben wir telefoniert, etwa um die Mittagszeit. Er wollte mich am Samstag um drei Uhr abholen für ein verlängertes Wochenende im Kempinski Heiligendamm. Aber er kam nicht.« Sie nestelt am Ärmel ihrer Strickjacke, über die sich Wildrosen ranken, zieht ein zerknülltes Taschentuch heraus und tupft sich damit eine Träne weg.
Kempinski Heiligendamm. Geht’s noch?
Völxen weiß beim besten Willen nicht, wie er darauf reagieren soll. Davon abgesehen drängt ihn aber auch die Neugier: »Seit wann kennen Sie den Herrn …«
»Füssli, Viktor Füssli. Er ist Schweizer, lebt aber seit Kurzem in Hamburg. Wir kennen uns seit drei Monaten. Wir waren … wir wollten …« Ein Ruck geht durch ihre Gestalt, sie reckt das Kinn und sagt: »Wir hatten gemeinsame Zukunftspläne.«
Völxen kippt zum zweiten Mal an diesem Tag die Kinnlade runter.
Zukunftspläne. Nach drei Monaten!
Er überlegt, ob es in letzter Zeit eine Veränderung an seiner Sekretärin gegeben hat, die ihm hätte auffallen müssen. Irgendein inneres Leuchten oder etwas in der Art. Er kann es beim besten Willen nicht sagen, aber er hat ja auch viel um die Ohren. Jedenfalls trug sie im Dienst bisher keine roten Fingernägel, da ist er sicher. Sie war meistens recht gut gelaunt, aber Frau Cebulla ist ohnehin selten verstimmt, und wenn, dann nicht ihm gegenüber. Ihr Haar ist ein bisschen kürzer und ein bisschen blonder, das bemerkt er jetzt. Aber sonst … Doch, da ist noch etwas: die Schuhe. Jahraus, jahrein quietschten die Sohlen ihrer Birkenstocks über den Flur, seit Kurzem aber hört man stattdessen ein Tack-tack-tack. Sie hat ihre Gesundheitsschlappen gegen halbhohe Pumps getauscht. Aber deswegen denkt man doch nicht gleich an so was.
Völxen ist die Situation höchst unangenehm. Was geht ihn Frau Cebullas Privatleben an? Nicht das Geringste! Dabei hätte er es nur allzu gern belassen. Allein die Vorstellung, dass seine langjährige Sekretärin, eine Frau im gesetzten Alter von … wie alt ist sie eigentlich? Mitte fünfzig in etwa. Dass sich diese Frau Hals über Kopf verliebt wie ein Teenager, bereitet ihm Unbehagen und setzt ein Kopfkino in Gang, auf das er gern verzichtet hätte.
Am liebsten würde er Frau Cebulla mit ihrem Anliegen zur Vermisstenstelle schicken, aber er ahnt, wie man dort mit der Sache umgehen würde: Ein erwachsener Mann, der von einer Dame, die keine Angehörige ist, als vermisst gemeldet wird … Da denken die sich bloß ihren Teil und machen ein paar anzügliche Witze, sobald Frau Cebulla zur Tür hinausgegangen ist. Und danach passiert erst mal gar nichts.
Also wird er sich wohl oder übel der Sache annehmen müssen. In all den Jahren hat sie ihn nie um etwas gebeten, er kann sie jetzt unmöglich einfach abbügeln. Doch das Ganze ist ihm ziemlich peinlich, und sollte dieser besagte Herr in den nächsten Tagen doch wieder auftauchen – wovon der Hauptkommissar aufgrund einschlägiger Erfahrungen ausgeht –, dann wird es Frau Cebulla noch viel peinlicher sein als ihm, so viel steht fest.
Darum ist nun Fingerspitzengefühl gefragt, damit alle Beteiligten ohne größere Blessuren wieder aus dieser heiklen Situation herauskommen.
»Hat der Herr Füssli denn auch ein Festnetztelefon?«, fragt Völxen.
Sie verneint. »Er ist Weinhändler und viel unterwegs, daher hat er nur das Handy. Ich habe bereits sämtliche Krankenhäuser in der Nähe seiner Wohnung angerufen, aber er ist nirgendwo eingeliefert worden«, berichtet Frau Cebulla. »Es gab am Samstag keinen schweren Unfall auf der Strecke Hamburg–Hannover, das habe ich ebenfalls recherchiert.«
»Was ist, wenn er von woanders hergekommen ist? Sie sagten, er sei viel unterwegs …«
»Nein, er wollte von Hamburg aus zu mir kommen, er sagte, er hätte am Freitag noch dort in der Nähe zu tun.«
»Sein Wohnsitz …«, beginnt Völxen.
»Ich war schon einmal dort«, unterbricht ihn Frau Cebulla. »Vor zwei Wochen, wir waren zusammen in einem Musical und danach bei ihm zu Hause. Es ist das Dachgeschoss eines wunderschönen älteren Hauses, es liegt nur eine Straße hinter der Elbchaussee.«
Für einen Moment blitzt so etwas wie Stolz in ihren Augen auf, und Völxen hängt unweigerlich dem Macho-Gedanken nach, dass Frau Cebulla auf ihre alten Tage noch einen ganz schön fetten Fang gemacht hat. Aber Völxen ist auch Realist. Deshalb beginnt in seinem Hirn eine kleine Alarmglocke zu schrillen.
»Um ehrlich zu sein, war ich sogar gestern noch einmal dort«, hört er Frau Cebulla sagen.
»In Hamburg?«, fragt er erstaunt zurück. »Und?«
»Es war keiner da. Im ganzen Haus war nur eine alte Dame, und die erschien mir ein bisschen wirr, sie konnte mir keine vernünftige Auskunft geben.«
»War wirklich keiner da, oder hat nur keiner aufgemacht?«
»Wie meinen Sie das?«, fragt Frau Cebulla entrüstet.
Und schon wieder wird’s peinlich …
Völxen gibt sich einen Ruck. »Nun … Männer sind ja manchmal richtige Feiglinge, wenn es darum geht, eine Beziehung zu beenden. Manche sind sogar nicht mal so fair, wenigstens anzurufen oder eine SMS zu schicken, die tauchen einfach ab.«
»Aber ich sagte doch schon, dass wir keinen Streit hatten!«
»Manchmal braucht es den gar nicht für einen … äh … Meinungsumschwung«, gibt Völxen zu bedenken.
»Sein Wagen war auch nirgends zu sehen, ich bin alle Seitenstraßen abgegangen«, trumpft Frau Cebulla auf.
»Tiefgarage?«, kontert Völxen.
»Wie? Nein. Ich weiß nicht …« Sie gerät ins Stocken.
»Können Sie Angaben zu seinem Fahrzeug machen?«, fragt Völxen, froh, erst einmal auf dieses sachliche Terrain ausweichen zu können.
»Ein Mercedes.«
»Typ?«
Frau Cebulla sieht ihn verzweifelt an. »Silbergrau und eher flach, also ich meine, niedrig, mehr so wie ein Sportwagen.«
»Ein Coupé.«
»Ja, ich glaube. Er roch ziemlich neu und hatte helle Ledersitze mit einer Massagefunktion.«
Völxen stöhnt innerlich auf. »Kennzeichen?«
»Hamburg … mehr weiß ich nicht.«
»Ist Ihr … Freund eigentlich ledig?«
»Was?« Sie schaut ihn verblüfft an.
»Ist er ledig oder geschieden? Oder könnte es sein, dass er Ihnen verschwiegen hat, dass er verheiratet ist? Seine Frau hat möglicherweise etwas gemerkt, und er hat kalte Füße bekommen …«
»Nein«, schnaubt Frau Cebulla erbost. »Das glaube ich nicht. In seiner Wohnung sieht nichts nach einer Frau aus, das ist eine typische Junggesellenwohnung.«
»Was verstehen Sie darunter?«
»Im Bad waren nur Pflegeartikel für Männer. Die Wohnung ist sehr schön eingerichtet, aber etwas nüchtern. Es fehlen zum Beispiel Pflanzen und die kleinen Accessoires, die ein Zimmer wohnlich machen. Die meisten Männer haben dafür wenig Sinn.«
Völxens Gefühl, dass da etwas ganz und gar nicht stimmt, verdichtet sich. »Könnte es sein, dass es sich dabei um eine Zweitwohnung handelt?«
»Das ist schon möglich. Er sagte, er hätte noch eine Wohnung in Zürich. Ich habe ihn nicht gefragt, wo er seinen Erst- oder Zweitwohnsitz angemeldet hat.« Frau Cebulla klingt nun etwas ungehalten. »Aber er ist ganz bestimmt nicht verheiratet. Er wollte ein Weingut in Südfrankreich kaufen und sich in Kürze dort zur Ruhe setzen.«
»Zusammen mit Ihnen?« Völxen lauscht seinen eigenen Worten nach und hofft, dass er das Ihnen nicht allzu zweifelnd hervorgehoben hat.
Sie nickt. Ihr Lächeln ist eine Mischung aus Stolz und Verunsicherung.
Sie war also drauf und dran, ihn, Völxen, schmählich im Stich zu lassen! Nach all den Jahren. Das schmerzt. Aber dann ermahnt er sich, sich zusammenzureißen. Schließlich geht es jetzt nicht um ihn.
»Wie alt ist Herr Füssli, wenn ich fragen darf?«
»Vierundfünfzig.«
»Bisschen früh, um sich zur Ruhe zu setzen.«
»Ein Weingut zu haben bedeutet ja nicht, dass man gar nichts mehr tut. Aber er wollte nicht mehr die ganze Woche beruflich unterwegs sein.«
»Verstehe«, behauptet Völxen, dem die ganze Geschichte immer spanischer vorkommt. »Sagen Sie, Frau Cebulla, wie haben Sie Herrn Füssli eigentlich kennengelernt?«
Sie senkt verlegen den Blick.
»Schon gut, Sie müssen nicht antworten, wenn Ihnen die Frage zu persönlich ist.«
»Nein, nein, es ist ja keine Schande. Über eine Kontaktanzeige in der Hannoverschen Allgemeinen.«
»Hat er eine aufgegeben?«
Sie schüttelt den Kopf. »Nein, ich. Eine Chiffre-Anzeige. Meine Freundin hat vor einem Jahr auf diesem Weg jemanden kennengelernt, und sie hat mich gedrängt, es auch zu versuchen, und da habe ich es schließlich getan. Kostet ja nicht viel, habe ich mir gedacht. Er hat einen sehr netten Brief geschrieben … Wir haben uns getroffen und uns sofort gut verstanden.«
Völxen schielt auf die Zeitangabe auf seinem Bildschirm. Schon halb zwölf, er muss zusehen, dass er Frau Cebulla los wird.
»Gut, Frau Cebulla, ich lasse mir die Polizeiberichte vom Samstag kommen. Mal sehen, ob es irgendwo einen Unfall mit einem Mercedes gab«, sagt er, um ihr sein Entgegenkommen zu signalisieren. »Für eine offizielle Vermisstenmeldung scheint es mir noch etwas früh.«
»Herr Hauptkommissar, können Sie bitte dafür sorgen, dass eine Streife zu seiner Wohnung fährt und die Tür öffnen lässt? Ich mache mir wirklich große Sorgen.«
Völxen ist klar, dass sie keine Ruhe geben wird. Wer weiß, vielleicht liegt der Mann ja wirklich tot oder hilflos in seiner Wohnung. Das soll ja schon vorgekommen sein, auch wenn sein Gefühl ihm etwas anderes sagt.
»Ich werde sehen, was ich tun kann.«
»Danke, Herr Hauptkommissar, vielen Dank«, sagt sie und erhebt sich vom Stuhl.
»Ach, eine Frage noch, Frau Cebulla. Sie haben diesem Herrn Füssli nicht etwa aus irgendeinem Grund Geld gegeben?«
*
Das Mittagessen beim Nobelitaliener in der List ist köstlich, aber es zieht sich. Völxen hat Mühe, sich auf das Gespräch mit seinem Vorgesetzten zu konzentrieren, weil ihm noch immer Frau Cebulla im Kopf herumgeistert. Seine Sekretärin und ihr Liebhaber. Völxen hat Frau Cebulla bisher mehr oder weniger als ein geschlechtsloses Wesen wahrgenommen. Sie hat schon immer in etwa so ausgesehen wie jetzt; ein bisschen bieder und tantenhaft, und so mancher hat zuweilen einen Witz gerissen, wenn sie sich nach Dienstschluss auf ihr Hollandrad schwang, auf dessen Rahmen Gazelle steht.
Zu seiner Schande muss Völxen gestehen, dass er von jedem seiner langjährigen Mitarbeiter etwas über dessen Privatleben weiß – von einigen sogar mehr, als ihm lieb ist –, nur nicht von Frau Cebulla. Wie heißt sie noch gleich mit Vornamen? Edelgard … nein Edeltraut! Selten hat ein Name so gut zu einer Person gepasst, findet der Hauptkommissar. Edeltraut Cebulla war einfach immer da, ein treues Faktotum, das seine Launen ertragen, seine Diätpläne überwacht und ihm gnadenlos gesunde Kräutertees zubereitet hat. Wie verbringt sie ihre Freizeit, was sind ihre Hobbys, was macht sie im Urlaub? Vor zwei Jahren hat sie eine Kreuzfahrt gemacht, aber er hat recht ungnädig reagiert, als sie ihm die Fotos zeigen wollte.
Auch jetzt muss er Frau Cebulla im Geist beiseiteschieben, denn es ist höchste Vorsicht angesagt, sonst findet er sich binnen Kurzem als Sesselfurzer im Innenministerium wieder. Der Vize versucht nämlich gerade, ihm dort einen Job schönzureden.
Immer wieder mal kommt von dort ein Jobangebot, was Völxen als höchst lästig empfindet. Er scheint dort Fans zu besitzen, die ihn unbedingt haben wollen. Oder jemand versucht, ihn von seinem jetzigen Posten wegzuloben, weil er oder sie selbst scharf darauf ist. Wer könnte dahinterstecken?
Oda Kristensen? Sie wäre im Grunde seine natürliche Nachfolgerin als Dezernatsleiterin, aber er schätzt Oda so ein, dass sie die paar Jährchen bis zu seiner Pensionierung gelassen abwartet. Fernando Rodriguez? Der ist durchschaubar, das hätte Völxen gemerkt, und für einen so perfiden Plan fehlt ihm schlichtweg die Raffinesse. Erwin Raukel? Raukel, das Enfant terrible des Dezernats, hat zwar selbst eine sehr hohe Meinung von sich, aber er hat aufgrund seiner lebhaften Vergangenheit so viel auf dem Kerbholz, dass er froh sein darf, dass Völxen ihn vor zwei Jahren in sein Dezernat geholt hat, obwohl das seinerzeit keiner verstanden hat. Nein, Raukel wird bis zu seiner Pensionierung brav in seinem Büro sitzen und seine Sudokus lösen, und ab und zu mal einen Fall, weil er trotz zahlreicher Macken doch auch einen guten Riecher hat. Elena Rifkin ist klug und ehrgeizig, aber mit nicht einmal dreißig Jahren noch viel zu jung für derlei Ambitionen. Jule Wedekin hat nach ihrer Heirat mit Fernando Rodriguez zu Völxens Bedauern eine Stelle beim LKA angenommen. Sie musste das tun, denn eine Vorschrift lautet, dass Ehepaare nicht in derselben Dienststelle arbeiten dürfen. Was nicht heißt, dass sie nicht für einen Führungsposten in die Polizeidirektion zurückkommen würde. Sie müsste dann halt ihren Ehemann in eine andere Abteilung versetzen, aber wie er Jule kennt, würde sie ihm das schon irgendwie beibringen. Oder … Jule möchte ihrem Fernando zum Aufstieg verhelfen und zieht im Hintergrund die Fäden. Traut er ihr das zu? Intellektuell durchaus, moralisch eigentlich nicht. Aber wer weiß?
»… Sie hätten dann zwar weniger Personalverantwortung als jetzt, aber dafür ein beachtliches Budget, mit dem sich eine Menge bewirken lässt, wenn man es klug einsetzt, was ich bei Ihnen, einem Mann der Praxis, absolut nicht bezweifle«, dringt die Stimme seines Vorgesetzten an sein Ohr.
Mist, verdammter! Völxen hat wirklich gedacht, seine Beförderung zum EKHK wäre ein Selbstläufer.
Der Kellner serviert den Espresso, und Völxen nutzt das kurze Innehalten des Vizepräsidenten und fragt geradeheraus: »Sagen Sie mir bitte ehrlich: Sägt jemand an meinem Stuhl?«
»Wie meinen Sie das?«
»Will mich jemand wegloben? Hat es jemand auf meinen Posten abgesehen, möchte der Polizeipräsident einen Jüngeren als Leiter des Dezernats für Todesermittlungen und Delikte?«
Der Vize schüttelt den Kopf. »Aber nein, durchaus nicht!«
»Und Sie? Sind Sie zufrieden mit der Aufklärungsquote meines Teams und mit meinen Qualitäten als Führungskraft?«
»Aber absolut, Herr Völxen, absolut. Ihre Quote ist exzellent, und Ihre Mitarbeiter sind hochzufrieden, wie mir zu Ohren gekommen ist. Ich dachte nur, dass Sie vielleicht nach all den Jahren genug Leichen gesehen haben und nichts gegen einen geregelten Feierabend einzuwenden hätten.«
»Das allerdings schon«, räumt Völxen ein und fährt fort: »Wissen Sie, ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich Ihnen das diplomatisch vermitteln soll: Für manchen mag ein bequemer Posten im Innenministerium für die letzten Dienstjahre erstrebenswert sein, und ich fühle mich auch sehr geschmeichelt, dass Sie mich als Kandidaten ins Spiel bringen möchten, aber eigentlich würde ich meinen jetzigen Posten gerne behalten. Ich bin nun mal ein Mann der Praxis, wie Sie schon festgestellt haben. Notfalls verzichte ich lieber auf A13. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner auf den Schlips getreten, respektive Sie nicht, aber selbst wenn es so ist, kann ich es nicht ändern.«
So, jetzt ist es raus.
Der Vizepräsident blinzelt, als hätte er etwas im Auge, dann winkt er dem Kellner. »Zwei Grappa, bitte!«
Völxen wartet gespannt und mit wachsendem Unbehagen auf die Antwort seines Vorgesetzten. Ihm fällt ein, dass er vor ein paar Jahren schon mal einen Ministeriumsposten abgelehnt hat. Zu seiner Verwunderung hat man es ihm ohne Konsequenzen durchgehen lassen. Aber noch einmal?
Der Vize macht es spannend, lässt erst den Grappa kommen, riecht daran und fragt dann: »Und das ist wirklich Ihr letztes Wort, Herr Hauptkommissar?«
»Ist es«, sagt Völxen im Brustton der Überzeugung und denkt: Scheiße, das war’s, als Nächstes werde ich verräumt auf eine Koordinationsstelle für Hirnfürze und Schnapsideen, irgendeinen wohlklingenden Posten, den sie extra für mich einrichten, denn was das angeht, sind sie kreativ. Ein Pöstchen, bequem und stressfrei, vielleicht mit einer knackigen Assistentin, bei dem ich nichts zu melden habe und keinen Schaden anrichten kann und niemand es merkt, wenn ich hinter dem Schreibtisch langsam vermodere.
Der Vize hebt sein Glas gegen das Licht. Der Grappa ist leicht gelblich, weil im Fass gelagert, wie der Kellner erklärt hat.
»Ach, Völxen, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass Sie das so sehen. Das ist nämlich auch meine Meinung, und ehrlich gesagt, genau so habe ich Sie auch eingeschätzt. Also, Herr Hauptkommissar, Sie bleiben wo Sie sind, und ich sorge dafür, dass Sie in Zukunft vom Ministeriumsposten und derlei Ungemach verschont bleiben.«
»Danke«, stößt Völxen hervor. Ihm fällt eine ganze Felswand vom Herzen.
»Und das mit der Beförderung winke ich durch. Salute!«
»Zum Wohl.«
*
Oda Kristensen wühlt sich durch einen Kleiderständer im Kaufhaus, als ihr Handy klingelt. »Merde«, murmelt sie, denn sie hat Bereitschaft, und tatsächlich, der Schafbock auf dem Display verheißt nichts Gutes.
»Sag bloß, ich muss mir jetzt irgendwo eine halb vergammelte Leiche ansehen«, begrüßt Oda ihren Chef, während sie amüsiert beobachtet, wie die Kundin neben ihr auf Abstand geht.
»Nein, nein, keine Sorge …«
»Eine frische also?«
»Sag mal, was machst du gerade?«
»Shoppen, wie man heute so sagt.«
»Noch mehr schwarze Klamotten? Probier’s doch mal mit ein bisschen Farbe!«
»Bist du jetzt mein neuer Stilberater, Völxen? Was gibt’s?«
»Du bist also in der Stadt …«
»Ja-a?«
»Das trifft sich gut, ich bin in der List. Sag mal, könnten wir uns auf einen Kaffee treffen?«
»Scheiße, ja, du warst mit dem Vize essen«, dämmert es Oda.
»Woher weißt du denn das schon wieder? Na, egal …«
»Völxen, falls du vorhast, dich auf deine alten Tage ins Ministerium zu verdrücken, dann kannst du mir das auch am Telefon sagen, denn in dem Fall will ich dich lieber gar nicht sehen, jedenfalls nicht, bevor ich mich abreagiert habe.«
»Darum geht es nicht. Ich brauche deine Hilfe in einer wirklich heiklen Angelegenheit.«
»Hat Raukel im Suff wieder was angestellt?«
»Nein. Wo bist du denn?«
»Bei Kaufhof. Die Luisenpassage kann ich mir nicht leisten.«
»In zehn Minuten im Mövenpick am Kröpcke?«
»Bin ich eingeladen?«
»Sicher.«
»Jetzt bin ich aber wirklich neugierig.«
*
Völxen lässt seine Blicke suchend über die Tische vor dem Mövenpick schweifen. Oda wird sicher draußen sitzen wollen, damit sie eine Zigarette nach der anderen qualmen kann. Allerdings sind schon alle Tische besetzt. Die Sonnenstrahlen sind anscheinend zu verlockend, auch wenn noch ein frischer Wind über den Platz fegt. Der Deutsche an sich, philosophiert Völxen vor sich hin, ist ein notorischer Draußen-Sitzer, es nimmt zuweilen schon groteske Züge an. Heute kauern sie wenigstens nicht schlotternd und in Decken eingehüllt vor dem Lokal.
Wie ein Geier umkreist er ein älteres Paar, das der Bedienung schon signalisiert hat, dass sie zahlen wollen, als ihn ein dezenter Pfiff herumfahren lässt.
»Oda! Beinahe hätte ich dich nicht erkannt, so verkleidet!«
Ausnahmsweise trägt Oda heute mal keine schwarzen Klamotten, wie sonst immer im Dienst, sondern ein grün gemustertes Kleid, das gut zu ihren halblangen hellblonden Haaren passt.