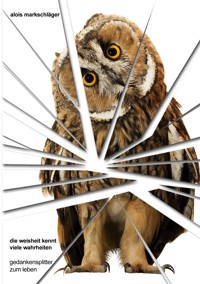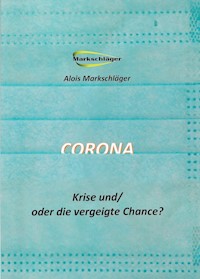Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Meine Mutter, Cäcilia Markschläger, hat viele ihrer Lebensgeschichten aufgeschrieben. Diese geben deutlich Aufschluss über die Zustände in der Gesellschaft der letzten 100 Jahre. Da die "heutige" Jugend zu dem Leben von damals kaum einen Bezug hat, werden die genaueren Um- und Zustände von damals näher erläutert und es wird versucht, einen Zusammenhang zur Gegenwart herzustellen. Insofern ist das Buch ein Geschichtsunterricht für die letzten 100 Jahre (1925 bis 2025) anhand der Geschichten von Cäcilia Markschläger.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum 100. Geburtstag von Cäcilia Markschläger
1 Cäcilia Markschläger 1925 - 2012
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Originalberichte von Mama
Einleitung und Kindheit
Die Donau
Flöße und Zillen – vom Fluss und von Menschen bewegte Wasserfahrzeuge
Die Strombauleitung
Die Schule
Die Wurzeln meiner Mutter
Die Einwohner von Inzell
Die Armut in der Kindheit
Das Zillenfahren
Bilder zu Zillen (Zillenmuseum Wesenufer)
Unser eigenes Haus
Vom Fischen
Arbeiten in der Kindheit
Sonstiges in Inzell
Meine Anstellung im Kindesalter
Die Bedeutung der Schulbildung
Erinnerungen an Weihnachten
Die politische Entwicklung
Der Arbeitsplatz in der Jugend
Die Arbeitsplatztreue
Krieg war auch daheim
Als die große Liebe kam
Das „Liebesdrama“ meiner Schwester
Heirat und der erste Sohn: Helmut
„Die Flucht“: Übersiedlung nach Inzell
Der erste wirkliche gemeinsame Haushalt
Die Wohnorte meiner Mutter
Einige Bilder von Aschach
Die unmittelbaren Nachbarn
Die Familie wird komplett
Einige Bilder unserer Familie
Wie sich die Kinder entwickelten
Der Tod meines Vaters
Unsere Aufmerksamkeit in der Jugend und im Alter
Die Geschichten „danach“
Geschichten rund um uns Kinder
Ereignisse in Aschach
Hochwasser 1954
Kraftwerksbau 1960
Die sozialen Kontakte in Aschach
Freunde und Freizeit
Unser Leben mit Tieren und in Vereinen
Geschichten zur Mama
Zillenfahren, ohne schwimmen zu können
Arbeiten, um zu überleben
Reisen und Urlaube
Die Geborgenheit in der Hausgemeinschaft
Die Art des Einkaufens
Der Rest des Buches von Mama
Die Sicherheit und das Glück der Kinder
Ein harmonisches Familienleben
Die Schwiegertöchter
Die Rolle der Frau
Die Bedeutung der Religion
Die Interessen im Alter
Das Altenheim
Die Achtsamkeit im Alter
Anhang: Alles auf der und über die Donau
Überfuhren und Brücken
Die Motorschiffe auf der Donau
Frachtschiffe
Personenschiffe
Das Leben der Cäcilia Markschläger
Schlussbetrachtung
Bildnachweis
Vorwort
Meine Mutter hat gerne aus ihrem Leben erzählt. Damit ihre Geschichten erhalten bleiben, hat ihr mein Bruder ein Buch mit der Widmung geschenkt:
„Schreib bitte in dieses Buch die Geschichten von Anno dazumal, damit deine Kinder, die Enkelkinder und die Urenkel auch noch an deinen Erzählungen teilhaben können.“
Und irgendwann hat sich Mama dazu entschlossen, ihre Lebensgeschichte, ihre Lebensg’schicht‘n, aufzuschreiben. Aus einigen ihrer Bemerkungen in dem Buch sieht man, dass ihr das nicht ganz leicht gefallen ist. Aber sie hat es durchgezogen. Dafür herzlichen Dank.
Ihre Aufzeichnungen1 sind Zeugnisse einer Zeit, die für viele heute – 100 Jahre später – kaum vorstellbar sind. Als Kind, später als Jugendlicher und heranwachsender Mann, habe ich die Geschichten von Mama persönlich gehört. Ihr Gesichtsausdruck, ihre Mimik, der Tonfall in ihrer Stimme und ihre ganze Person machten ihre Erzählungen zu einem Erlebnis.
Meine Mutter lebte, bis sie dreizehn war, in Inzell, einem kleinen Dorf in der Nähe der Schlögener Schlinge. Dann arbeitete sie etwa zehn Jahre in Wesenufer, das fünfzehn Kilometer donauaufwärts liegt. Den Rest ihres Lebens verbrachte sie in Aschach. Ihr Leben wurde von der Donau begleitet. Die Liebe und die Beziehung zur Donau habe ich von ihr geerbt.
Obwohl sich ihr Leben in einem eng begrenzten Teil Österreichs abspielte, glaube ich, dass ihre Lebensgeschichte und ihre G’schicht‘n auch in anderen Regionen in ganz Österreich ähnlich wären.
Mit meinen Kommentaren meiner Mutter möchte ich eine Brücke zur Gegenwart schlagen. Die Geschichten erzählen, wie es damals war. Warum dies so war und wie sich Vieles seither entwickelt hat, versuche ich herauszuarbeiten. Ich möchte eine Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart schlagen und zeigen, woher wir kommen und warum wir heute so sind, wie wir sind. Aufbauend auf den Geschichten der Mama kann ein anschaulicher Zeitunterricht entstehen: Geschichte anhand von Geschichten.
Ich habe versucht, in den Worten und in den Aufzeichnungen meiner Mutter den Zeitgeist von damals nachzufühlen. Ich hoffe, ihn richtig erfasst zu haben.
Wenn es mir mit meinen Anmerkungen gelungen ist, etwas von dem Ton und von der Mimik meiner Mutter bei ihren Erzählungen zu übertragen, würde mich das besonders freuen.
Hinweise zum Lesen:
Die Aufzeichnungen meiner Mutter sind in normaler Schrift.
Meine Anmerkungen erscheinen kursiv.
Meine Mutter hat auch das Tagesgeschehen festgehalten, das mit den Geschichten selbst nichts zu tun hat. Um ihr Leben und ihre Gedanken der Zeit zu zeigen, als sie die Aufzeichnungen verfasste, habe ich einen Teil der Nebenbemerkungen belassen. Diese erscheinen in einer kleineren Schrift.
Die Aufzeichnungen von Mama habe ich mit Ausnahme von Belanglosem und zu persönlichen Darstellungen ungekürzt übernommen. Die Texte habe ich im Original belassen, um ihre Sprache zu verwenden. Auch Rechtschreibfehler habe ich nicht korrigiert, um die Inhalte möglichst authentisch zu übermitteln.
Eigennamen habe ich weggelassen, um den Forderungen des Datenschutzes nachzukommen. Satzzeichen habe ich ergänzt, soweit es zu einem besseren Verständnis sinnvoll war.
Mama hat ihre Geschichten so aufgeschrieben, wie sie sie erzählt hat. Dadurch entstehen manchmal eigenartige Satzstellungen, Satzzeichen und Füllwörter. Stell dir beim Lesen einfach vor, dass du neben einer älteren Frau sitzt, die dir Geschichten erzählt.
Obwohl meine Mutter nur sieben Klassen Volkschule besucht hat und später eher selten schreiben musste, sind ihre Wortwahl und ihr Wortschatz bemerkenswert.
2 Die Handschrift meiner Mutter
Fasziniert hat mich ihre Handschrift, die trotz geringer Übung bestechend klar, gleichmäßig und immer zu hundert Prozent leserlich ist.
Einen Teil ihrer Erinnerungen hat mein Bruder Helmut für sie und mit ihr aufgeschrieben. Dies habe ich bei der Einteilung dieses Buches berücksichtigt und darauf hingewiesen.
Apell an dich!
Hast du bereits Kinder oder Enkelkinder? Wenn ja, denke daran, dass diese dein Leben und unsere Welt nur verstehen können und verstehen werden, wenn du ihnen möglichst viel von deinem Leben erzählst oder wenn du deine G’schicht‘n aufschreibst.
Danke, dass du zu diesem Buch gegriffen hast! Ich wünsche dir eine interessante, vielleicht auch eine lehrreiche Unterhaltung.
1 Es ist nicht die Lebensgeschichte (Biographie) meine Mutter, es sind Geschichten aus ihrem Leben.
Die Donau
Das einzige gefährliche war halt die Donau. Immer wieder wurde uns eingeschärft: „Geht ja nicht zu weit hinein. Da kommt der Wassermann und holt euch!“
Ein Drohen mit etwas Schrecklichem (Wassermann) war früher in der Kindererziehung gebräuchlich – ein Horror für heutige Kinderpsychologen.
Aber es war so schön zum spielen bei der Donau; was wir da alles gebaut haben mit dem feinen Sand.
Jeden Tag sind wir da gegangen – das hieß: „Sachen suchen!“. Was wir da alles fanden: Puppen, Schachterl - war ein Ring drinnen - und so viele Taschentücher, wie sie von den Schleppern hinunter gefallen sind. Mutter hat sie ein paar Mal ausgekocht. Da hat man sich nicht fürchten müssen, dass man krank wird.
Die schweren Lasten wurden mit Schleppschiffen („Schleppern“) transportiert: Ein Zugschiff zog mehrere Schlepper. Schlepp und Zugschiff waren mit Seilen verbunden. Der Schlepp hatte einen eigenen Steuermann. Sehr oft hat eine ganze Familie mit Hund und sonstigem Haustier auf einem Schlepp gewohnt.
8 Schleppverband
Die Schifffahrt war die wirtschaftliche Basis für die großen Donaugemeinden. Auf jedem Schiff lebten viele Menschen, die ihren täglichen Bedarf in den Donauorten abdeckten. Die „Schiffer“ (So nannten wir die Belegschaft der Schiffe.) gingen mit riesigen Taschen in den Orten einkaufen. Eine Bevorratung war wegen fehlender Kühlmöglichkeiten nur beschränkt möglich. Also musste vor Ort eingekauft werden.
Von den Schiffen fielen auch viele Gegenstände in die Donau und wurden auf Schotterbänken (Schotterhaufen) angeschwemmt.
Wir haben auch fast immer von dem Holz, welches am Schotterhaufen angeschwemmt wurde, geheizt.
Auch wenn Hochwasser war, da hat man so viel auffangen können mit der Zille - aber auch gefährlich. Die Donau war da so ein reißender Strom. Wenn dann das Wasser wieder zurück ging, dann mußten wir wieder die ganze Schotterbank absuchen, auf Haufen zusammen legen und dann mit der Zille holen.
Das vergiß ich auch nicht: Bin einmal mit dem Vater gefahren, als wir Holz zusammen eingeladen haben, wir hatten die Zille ganz voll, kam ein Sturm, der Vater sagte: „Knie dich fest auf die Seite wo der Wind kommt und bete!“
Ja, er war ein braver Vater. Er hat mich so gelobt, wenn ich was gemacht hab.
Eine Zille wurde aus Holz gebaut, war zwischen 5 m und 7 m lang (Extremkonstruktionen bis zu 15 m) und zwischen 0,9m und 2m breit und läuft an ihren Enden spitz zusammen.
Zillen waren Wasserfahrzeuge des täglichen Lebens und wurden vielfältig eingesetzt: Transport von Menschen und Gütern, Fischen, Ausflüge ….) Stromaufwärts wurden sie mit Stangen geschoben („stangeln“ oder „stechen“), stromabwärts wurde gerudert. Bundesheer und Feuerwehren verwenden heute Zillen bei Wassereinsätzen (meist mit Außenbordmotoren). Inzwischen sind Zillen auch als Sport- oder Freizeitboote beliebt.
Die Donau war in Österreich ein reißender und gefährlicher Strom mit einem beachtlichen Gefälle. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde sie durch Kraftwerke „gezähmt“. Heute erinnern nur noch wenige Strecken - zum Beispiel die Wachau - an die Urkraft des Flusses. Um zu erleben, wie mächtig die Donau war, musst du in der Wachau über die Donau schwimmen (Aber bitte nur gute Schwimmer).
Flöße und Zillen – vom Fluss und von Menschen bewegte Wasserfahrzeuge
Flöße wurden für Transporte flussabwärts eingesetzt. In erster Linie waren sie für den Holztransport vorgesehen. Ein Floß zu lenken, erforderte hohe Geschicklichkeit und großen Mut. Viele Männer verloren dabei ihr Leben.
9 Eine Floßfahrt
10 Wenn der Vater mit den Söhnen
11 Floßfahrt mit Rädern für die Heimfahrt
12 Eine moderne Motorzille
13 Ausflug mit der Zille
14 Den Sonnenaufgang in der Zille zu genießen, ist ein besonderes Erlebnis.
Die Strombauleitung
Fast 200 Jahre hat sich die Strombauleitung (Vorgängerin der Via Donau) „um die Donau gekümmert“. Ihre Aufgaben waren die Flussregulierung und teilweise die Vertiefung, die Ufersicherung und der Hochwasserschutz, die Schaffung und die Pflege von Flussbauwerken zur Lenkung und Stabilisierung des Flusslaufs. Dafür betrieb die Strombauleitung auch Steinbrüche und baute Transportschiffe.
„Ordentliche“ Donauufer waren vor allem in der Zeit wichtig, als die Schiffe donauaufwärts noch gezogen wurden. Pferde – bei kleineren Schiffen auch Menschen - zogen auf den Treppelwegen die Schiffe. Dies nannte man „Treideln“.
Unterhalb des Treppelwegs nach der Uferböschung gibt es noch einen Schwemmpfad (Unterwasserweg), der bei normalem Wasserstand überflutet ist. Diesen schätzen und nutzen Zillenfahrer, wenn sie stromaufwärts fahren (stangeln).
15 Uferbefestigung
16 Im Steinbruch
17 Der Trauner
18 Trauner und Steinbruch
19 Trauner im Einsatz
20 Steinbruch in Aschach
Die Schule
Inzell hatte nur 6 Hausnummern, aber Kinder gab es viele. Aber als ich zum Schulgehn anfing, da waren noch nicht viele. Das erste Jahr mußte ich bis Kobling zur Überfuhr gehen, immer neben dem Wald und neben der Donau.
21 Obermühl, der Schulort meiner Mutter
Da hatte ich schon so manche Erlebnisse: Einmal lag so eine große Schlange über den Weg, war ja auch ein schmaler Weg. Und die ging nicht weg, weiß wie lange nicht.
Einmal - ich mußte immer über den „Schopperplatz-Zillenbau“ gehen und das war ein großer. Der gehörte dem B., der machte sogar einmal 2 Schlepp aus Holz und so viel Trauner, Plätten, Zillen und was weiß ich noch so vieles. Da verwenden sie so Klampferl - spitze für die Zillen. Da waren natürlich so viele Holzscharten, das man nicht sah, was unten lag. Ich hab mir ein solches in den Fuß hinein gerannt. Wir mussten immer barfuß gehen - kein Geld für Schuhe.
22 Schopperwerkzeug und Klampferl
Ja daß ich weiter erzähle: ich gehe einfach weiter und weine weil es so weh tat. Ich glaub damals hatte ich bestimmt einen Schutzengel. Ich hatte nämlich die Jause vergessen. Die Mutter rannte mir nach und schrie immer, aber ich ging weiter, ich wäre mit dieser Verletzung in die Schule gegangen. Die Mutter rannte und schrie, endlich hörte ich sie, sie trug mich dann heim. Wenn das nicht ein Glück war.
Zillen und Plätten (große Transportzillen) wurden auf Schopperplätzen gebaut. Der Ausdruck kam daher, dass die Zwischenräume zwischen den Holzbrettern mit Moos „ausgeschoppt“ wurden. Die Bretter wurden mit Eisenklampfen zusammengehalten.
23 Schopper bei der Arbeit
Auch wir sind als Kinder im Sommer barfuß gegangen. Je mehr die Straßen asphaltiert wurden, umso seltener gingen wir barfuß. Das könnte daran gelegen sein, dass Asphalt als ungesund galt, eher war es aber der steigende Wohlstand, der plötzlich sogar für Schuhe reichte.
Wie bei den Schuhen gespart wurde, habe ich aus einer Geschichte meines Großvaters erfahren. Der war Schuster in Wesenufer und hatte Kunden in Linz. Wenn er mehrere Schuhe fertig hatte, hat er diese selbst zugestellt. Nach Linz (ca. 50 km) fuhr er teilweise mit dem Schiff, teilweise war er zu Fuß unterwegs. Da hat er die Schuhe ausgezogen, um zu sparen.
Ich mußte ja um 10 h schon fort gehen, um 12h fing die Schule an, bis 4h am Nachmittag. Wir hatten ja nur einen Lehrer. Die Großen hatten Vormittag Schule und die Kleinen Nachmittag.
Wenn ich am Schulweg vorbei ging bei der Großmutter und sie sah mich, hat sie mich immer hineingeholt und mir was zum Essen gegeben. Im Winter war es dann schon ganz finster beim Heimgehn von der Schule.
Für uns ist es unvorstellbar, dass der Schulweg so lange dauert wie der Unterricht und dass Kinder täglich vier Stunden auf dem Schulweg unterwegs sind. Allen beschwerlichen Bedingungen zum Trotz war es vielleicht auch eine „gesunde“ Zeit.
Aber damals waren ganz andere Zeiten, da hat es nicht so viele schlechte Leute gegeben, ich weiß nicht wie - man kann auch nicht sagen, dass die Menschen anders waren, aber fürchten hat man sich nicht müssen.
Warum musste sich ein kleines Mädchen, das stundenlang allein zwischen Wald und Donau, teilweise in der Dämmerung oder in der Dunkelheit in die Schule und nach Hause ging, nicht fürchtet? Sicher waren die Menschen damals nicht besser als heute. Aber in einem abgeschiedenen Ort wie Inzell gab es kaum Informationen über die Schlechtigkeiten der Welt.
Es gab weder Fernsehen, noch Rundfunk. Und Zeitungen waren nicht nur teuer, sie waren nicht für Kinder bestimmt. Mein Großvater ließ meine Mutter keine Zeitung lesen: „Die ist nichts für Kinder.“ Viele Schlechtigkeiten der Welt erfuhren die Kinder gar nicht. Sie mussten keine Kriege, keine Umweltkatastrophen, keine Morde, keine Unfälle, keine Brände … in ihren Köpfen und in ihren Seelen verarbeiten.
War es so falsch, sie vor negativen Informationen zu schützen? Sie durften in einer „heilen“ Welt aufwachsen. Die „örtlichen“ Schlechtigkeiten des täglichen Lebens haben sie ohnehin mitbekommen.
Heute überschütten wir schon Kinder und Jugendliche mit unvorstellbaren Mengen von Informationen – nicht nur positiven – und erwarten, dass sie diese ohne Schaden verarbeiten und wegstecken. Nicht alle schaffen das.
Dann hören wir den Ruf nach mehr Kinderpsychologen, die unsere Kinder heilen sollen, nachdem wir es zugelassen haben, dass sie krank werden. Vielleicht sollten wir über die Ursachen vieler seelischer Probleme mehr nachdenken als über die Beseitigung der negativen Folgen. – Einfach zum Nachdenken.
Ja dann hatte die Mutter das fahren mit der Zille lernen müssen, das wir nicht immer zur Überfuhr gehen mußten, den das wird auch was gekostet haben.
Es ist heute unvorstellbar, dass Kinder eine Überfuhr (Schiff zum Überqueren der Donau) aus Geldmangel nicht benutzen konnten. Heute fahren Schulkinder mit öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos oder werden von den Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht.