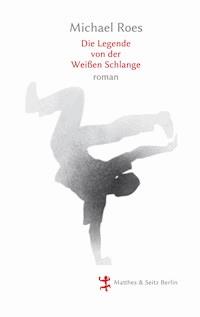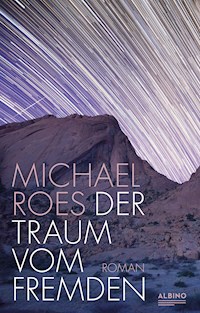16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Eines der erschütterndsten Dramen der deutschen Geschichte ereignete sich im 18. Jahrhundert in Zeithain. Es handelt von Friedrich dem Großen, der als junger Kronprinz unter dem Regime seines Vaters unvorstellbar leidet. In seiner Not wendet sich Fritz an seinen einzigen Freund, Hans Hermann von Katte. Er soll ihm helfen, ins Ausland zu fliehen, während sein Vater von der Militärparade in Zeithain abgelenkt ist. Katte, ein Offizier des Königs, gerät in einen tiefen Zwiespalt, doch er kann der Zuspitzung der Ereignisse nicht entrinnen. Als die Pläne auffliegen, ist es Katte, an dem ein Exempel statuiert wird - und der Kronprinz muss bei seiner Hinrichtung zusehen.Wer war dieser Katte? Wie konnte er, der selbst mit einem strengen, distanzierten Vater aufwuchs, sich verhalten? Philip Stanhope, ein entfernter Nachfahre, sucht an den Orten von Kattes Leben nach Antworten. Er fühlt sich ein in die Welt des pietistischen Preußen und zeigt, wie stark die Gefühle und Werte der damaligen Zeit uns immer noch prägen. Michael Roes" Roman ist eine gewaltige literarische Recherche und zugleich ein faszinierendes Abenteuer deutscher Geistesgeschichte."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1171
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Motto
WUST
GLAUCHA
KÖNIGSBERG
KAVALIERSREISE
GENS D’ARMES
ZEITHAIN
KÜSTRIN
STAMMTAFELN
PERSONENREGISTER
Autorenporträt
Über das Buch
Impressum
[Leseprobe – Die Sintflut in Sachsen]
ZEITHAIN
Es gibt kaum einen Abschnitt in unserer Historie, der öfter behandelt worden wäre als die Katte-Tragödie. Aber so viele Schilderungen mir vorschweben, das Ereignis selbst ist bisher immer nur auf den Kronprinzen Friedrich hin angesehen worden. Oder wenigstens vorzugsweise. Und doch ist der eigentliche Mittelpunkt dieser Tragödie nicht Friedrich, sondern Katte. Er ist der Held, und er bezahlt die Schuld.
Theodor Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg
Ich heiße Philip Stanhope, wie mein Großvater, der letzte Graf von Chesterfield, mein Ururgroßvater, Admiral der Royal Navy, und mein Ururururgroßvater, jener junge missratene Philip Stanhope, unehelicher Sohn des gleichnamigen Vaters, Vierter Graf von Chesterfield, der seine berühmten, doch letztendlich vergeblichen Briefe an seinen Sohn über die anstrengende Kunst, ein Gentleman zu werden an ebendiesen Philip Stanhope adressiert hat. Nicht nur die Namensgleichheit, auch die unehelichen Verhältnisse durchziehen meine Genealogie wie ein misstönendes Leitmotiv. Der berühmte Vater meines ihn letztlich enttäuschenden Ururururgroßvaters war mit Petronella Melusina von der Schulenburg, der unehelichen Tochter von König Georg I. und seiner Mätresse, Ehrengard Melusine von der Schulenburg, vermählt. Diese Ehe aber blieb kinderlos, sonst hätte ich mich nun einer königlichen, wenngleich illegitimen Abstammung rühmen können. Indessen nahm auch der Vierte Graf von Chesterfield es mit der ehelichen Treue nicht so genau und zeugte meinen Ahnen mit einer dubiosen Mademoiselle Elisabeth du Bouchet, deren genaue Herkunft in den Familienarchiven dunkel bleibt. Und der aus dieser Liaison entsprungene Philip Stanhope hatte ebenfalls nichts Besseres zu tun, als der Mode seiner Zeit zu folgen und auf seiner Grand Tour in Rom den von einem Zeitgenossen als »plain almost to ugliness« beschriebenen Reizen meiner Ururururgroßmutter Eugenia Peters zu verfallen. Er war gerade mal achtzehn Jahre alt, sie zwanzig. Ihrem Schoße entsprangen Charles und der nächste Philip Stanhope, geheiratet haben die beiden aber erst Jahre nach der illegitimen Geburt ihrer Söhne 1730, im Jahr von Kattes Hinrichtung, in Dresden, und von der Existenz seiner Enkel erfuhr der Vierte Graf von Chesterfield erst nach dem frühen Tod seines Sohnes.
Diese mehr illustre als ehrenvolle Ahnengalerie hilft mir nicht einmal in grundlosen Phasen der Schwermut, meine von Selbstmitleid und Minderwertigkeitsgefühlen gemarterte Seele aufzurichten. Obwohl durch die Heirat des Vierten Grafen von Chesterfield mit Petronella Melusina von der Schulenburg, der illegitimen Tochter König Georg I. rechtmäßig mit dem Königshaus verwandt – illegitim ist König Georg I. ja der legitime Großvater meines illegitimen Vorfahren Philip –, bin ich nie zu einer Feier, sei es Taufe, Hochzeit oder auch nur einer Scheidung, meiner erstaunlicherweise immer noch über England herrschenden Verwandtschaft eingeladen worden. Vielleicht ist auch das, neben den bekannten Vorkommnissen im letzten Jahrhundert, ein Grund dafür, dass die deutschen Zweige und Verästelungen unserer Familiengeschichte bis zur Nichtexistenz verschwiegen wurden. Und das wäre zweifellos auch so geblieben, wären diese sieben Briefe nicht in meine Hände geraten.
Lord Chesterfields Rat an seinen unglücklichen Sohn könnte wortwörtlich auch aus dem Mund meines Vaters stammen: »Ich wünschte nichts herzlicher, als Dich so oft wie möglich lächeln zu sehen, aber niemals will ich Dich in Deinem Leben lachen hören. Regelmäßiges und lautes Gelächter ist eine Eigenschaft närrischer und schlecht erzogener Charaktere, mit dem der Pöbel seine dumme Freude über dumme Dinge äußert. Und sie nennen es auch noch Glücklichsein. Meiner Meinung nach ist nichts so unfrei und so krankhaft wie lautes Gelächter. Ich bin weder schwermütigen noch zynischen Gemüts, und ich bin offen für Amüsement wie jedermann, aber ich bin sicher, niemand hat mich, seit ich Herr meiner Vernunft bin, je lachen gehört!«
Würde man meinen Vater, einen schmallippigen Tory-Abgeordneten und ehemaligen Wirtschaftsanwalt, nach seiner Meinung über seinen erstgeborenen Sohn Philip, also mich, befragen, würde sein ernüchterndes Urteil in etwa folgendermaßen lauten: »Bitte fragen Sie nicht! Er hat sein Studium abgebrochen und ist zu Hause ausgezogen. Zum Militär will er nicht. Und eine anständige Arbeit findet er nicht, so wie er aussieht und sich benimmt. Sein Geld holt er sich vom Sozialamt ab, das es sich bei mir zurückholt. Von mir bekommt er keinen Cent!
Keine Ahnung, wo er sich im Augenblick herumtreibt. Die Adresse seiner Absteige hat er mir nicht mitgeteilt. Im Übrigen interessiert es mich auch nicht. Das letzte Mal habe ich ihn ohne Helm auf einem teuren Motorrad eine rote Ampel überfahren sehen. Ich weiß nicht, ob er diese Ordnungswidrigkeiten nur deswegen begangen hat, weil er mich an der Straßenkreuzung in meinem Dienstwagen erkannt hat. Wir haben uns nicht gegrüßt. Woher er das Geld für ein teures Motorrad hat? Ich vermute mal, aus Drogengeschäften oder anderen zweifelhaften Quellen. Er raucht Marihuana, schnupft Kokain, schluckt Ecstasy, das alles kostet viel Geld, und sicher bezahlt ihm das nicht das Sozialamt. Vielleicht hat er es auch irgendwo gestohlen. Schon als er noch bei mir wohnte, hat er gedealt und geklaut. Immer wieder standen merkwürdige Typen vor unserer Tür, offensichtlich Junkies, wenn Sie mich fragen. Und es gab gehäuft Wohnungseinbrüche und Diebstähle in der Nachbarschaft. Fast hätte ich selbst die Polizei auf ihn aufmerksam gemacht! Doch dann ist er endlich ausgezogen, und die Diebstähle hörten auf. Oder haben sich in andere, weniger gut beleumundete Quartiere der Stadt verlagert. Womöglich wäre es von nicht geringem erzieherischen Wert, wenn er tatsächlich mal erwischt würde und die Justiz ihm einen ordentlichen Denkzettel verpasste! Natürlich, kaum je ist mal ein junger Mann in einer Strafvollzugsanstalt zu einem besseren Menschen geworden. Wenn Sie mich fragen, ich habe ihn abgeschrieben! Aber besser, Sie fragen mich nicht!«
Diese fiktiven, aber durchaus realistisch wiedergegebenen Auskünfte meines Vaters sind nicht vollkommen unberechtigt oder falsch, aber, wie alle väterlichen Urteile über ihre heranwachsenden Söhne, ziemlich einseitig. Nun, ich will erst gar nicht versuchen, mich zu rechtfertigen, denn die andere, unberücksichtigte Seite geht meinen Vater überhaupt nichts an. Nicht er hat sie einfach ignoriert, sondern ich habe sie, zunächst mit kindlicher Verschlagenheit und später mit jugendlichem Missmut, vor ihm verborgen gehalten. Er weiß ohnehin schon mehr von mir, als mir (und ihm) lieb sein kann, doch in frühen Lebensjahren ist es einem Schutzbefohlenen ja noch nicht gegeben, alles vor den Erziehungsberechtigten geheim zu halten.
Bei einem jener von ihm zu Recht so missbilligten Streif- und Beutezüge durch die väterliche Wohnung, die eher Unzufriedenheit und Langeweile als tatsächlicher Bedürftigkeit geschuldet waren, stieß ich im Walnusssekretär meines Vaters, einem alten Familienerbstück und absolutem Tabu für meine pubertären, von exzessiver Selbstbefriedigung befleckten Kifferfinger, auf diese besagten Briefe an meine Urururururgroßmutter, säuberlich und gut lesbar in einem altmodischen Französisch mit Tusche auf inzwischen ein wenig vergilbtem Büttenpapier verfasst. Sofort steht mir der Wert dieser Briefe, an deren Authentizität ich keinen Augenblick zweifle, vor Augen, und ich gehe im Geiste schon die Liste jener Hehler durch, die mir Höchstsummen für derlei Kuriosa zu bezahlen versprechen. Doch dann entscheide ich, eher aus einer mich selbst überraschenden Laune heraus, diese Briefe doch erst einmal zu lesen, bevor ich sie an den Meistbietenden verhökere.
Ich begreife schnell, dass sie nicht vollständig sein können, da immer wieder auf Briefe verwiesen wird, die in dem kleinen Bündel fehlen. Trotzdem ergibt sich ein recht geschlossenes und mich, aller jugendlichen Abgebrühtheit zum Trotz, tief berührendes Bild des Briefschreibers. Mit ihnen beginnt in gewissem Sinn auch meine Geschichte. Nicht, dass der Fund mich zu einem besseren Menschen gemacht hätte. Aber ich behielt die Briefe, bis heute hat mein Vater ihren Diebstahl nicht entdeckt (oder mir von der Entdeckung keine Mitteilung machen wollen). Ich habe sie zunächst nach bestem Wissen und Gutdünken aus dem barocken und nicht immer ganz korrekten Französisch des märkischen Junkers ins Deutsche übertragen. Das hat mir unerwartet große Freude bereitet. Ich möchte nicht von Seelenverwandtschaft mit dem unbekannten Cousin sprechen. Vielleicht genügt schon der Umstand, dass ich nun fast in dem Alter bin, in dem Lieutenant Hans Hermann von Katte seinen Tod fand.
Wer war die Adressatin, diese Tante und mütterliche Freundin Kattes, Schwiegermutter meines Vorfahren Philip Dormer Stanhope, Vierter Graf von Chesterfield? Auf jeden Fall eine der mächtigsten Frauen ihrer Zeit, eine britische Madame de Pompadour, auf die meine Familie, trotz ihres ein wenig anrüchigen Standes einer königlichen Mätresse, bis heute mit einem gewissen Stolz blickt.
Dabei fing doch alles eher provinziell und bescheiden an: Sie diente als Ehrendame am Hof der Prinzessin Sophia von Hannover, Enkelin von König James von England, bis der Sohn Sophias, Kronprinz Georg Ludwig, sie zu seiner Bettdame erwählte. Als Georg nach dem Tod von Königin Ann im Alter von vierundfünfzig Jahren zum britischen Thronfolger, dem ersten aus dem Haus Hannover, ernannt wird, nimmt er Ehrengard Melusine von der Schulenburg, inzwischen mit ihren siebenundvierzig Jahren auch nicht mehr die Jüngste, dem zukünftigen König von England aber ans Herz gewachsen, mit nach London.
Obwohl mehr als fünfzig Verwandte Königin Anns ihr näher standen, kamen sie als Thronfolger nicht infrage. Ein Gesetz aus dem Jahr 1701 verbot Katholiken den britischen Königsthron. Und Georg Ludwig von Hannover war schlicht der nächste noch lebende protestantische Verwandte.
In England schafft er für seine Mätresse das Herzogtum Munster, die Grafschaft Dungannon und die Baronie Dundalk in Irland, und wenige Jahre später ernennt er sie zur Herzogin von Kendal, Gräfin von Feversham und Baronin Glastonbury.
Zeitgenossen beschreiben die Herzogin von Kendal als eine auffallend dürre Person, die respektlosen Londoner nennen sie einfach »die Nebelkrähe«. Doch fraglos ist sie die wahre Königin von England.
Das ursprünglich altmärkische, dann vor allem im Magdeburgischen begüterte Geschlecht derer von der Schulenburg steht Anfang des achtzehnten Jahrhunderts zum Teil in preußischen, vor allem aber in hannoverschen Diensten. Über seine Großmutter väterlicherseits, Eva Auguste von Stammer, ist Katte mit dieser altadeligen Familie verwandt, denn deren Schwester Anna Elisabeth, Kattes Großtante, hatte den brandenburgischen Kammerpräsidenten Gustav Adolf von der Schulenburg geheiratet. Von dessen Kindern war insbesondere Matthias Johann von der Schulenburg, ein Cousin seines Vaters, in venezianischen Diensten als Verteidiger gegen die Türken im Jahr 1716 berühmt geworden; nicht minder berühmt sollte Matthias Johanns Schwester, Ehrengard Melusine von der Schulenburg, als Herzogin von Kendal werden, die Katte nach seinem Besuch in London schlicht »Tante Melusine« nennt.
Die Tochter Georgs aus seiner legitimen Ehe mit Sophie Dorothea von Celle, Sophie Dorothea von Hannover, heiratet 1706 Friedrich Wilhelm, Markgraf von Brandenburg, später König in Preußen. Damit ist Georg I. von England der Großvater Friedrich des Großen.
Als Friedrich mit Katte in England Zuflucht suchen will, ist dort bereits sein Onkel Georg II. an der Macht. Während er noch Prinz von Wales war, hat Georg II. die Sommer stets in Hannover verbracht, vor allem um dem eigenen Vater fern zu sein. Georg II. ist dreiundvierzig Jahre alt, als er 1727 seinem Vater als britischer König nachfolgt. Er nimmt nicht an der Beerdigung seines Vaters in Hannover teil.
Den größten Teil seines Lebens steht Georg II. in politischer Opposition zu seinem Vater. Nun wiederholt sich im eigenen Sohn Friedrich, Cousin des preußischen Thronfolgers, das Drama, der Kronprinz stellt sich gegen seinen Vater und neuen König von England.
Georg II. ist der Schwager Friedrich Wilhelms von Preußen, aber wie sein ungeliebter Vater pflegt er ein eher ambivalentes Verhältnis zum preußischen Königshaus. Eine Verheiratung von Friedrich Wilhelms Tochter Wilhelmine mit ihrem Cousin, Georgs Sohn Friedrich, wird jahrelang verhandelt, ebenso wie die Heirat des preußischen Kronprinzen Friedrich mit Georgs Tochter Amelia. Am Ende scheitert die englisch-preußische Doppelhochzeit aber vor allem am Intrigenspiel Österreichs gegen diese unerwünschte, weil zu mächtige Allianz, wobei der jähzornige Soldatenkönig und sein voreingenommener englischer Schwager es den kaiserlichen Agenten auch nicht eben schwer machen.
Nach Georgs Tod hält Tante Melusine einen Raben, von dem sie glaubt, in ihm sei die Seele des toten Königs zu ihr zurückgekehrt.
Sie stirbt mit sechsundsiebzig Jahren, unverheiratet, es sei denn, König Georg habe sie, wie ernst zu nehmende Gerüchte behaupten, heimlich geheiratet, nachdem er sich von seiner rechtmäßigen Gattin Sophie Dorothea hat scheiden lassen und sie für den Rest ihrer Tage in ihrer Heimatstadt Celle gefangen hielt. Sie starb dreißig Jahre später, ohne ihre Kinder je wiederzusehen.
Von den drei Töchtern Melusines kehrten zwei nach Deutschland zurück und heirateten trotz ihrer illegitimen Herkunft standesgemäß in den preußischen Kleinadel ein. Petronella Melusina, Comtesse von Walsingham, die Zweitgeborene, ehelichte meinen Urahn Philip Dormer Stanhope, den Vierten Grafen von Chesterfield.
Glücklich kann die Ehe Chesterfields mit der unehelichen Tochter des englischen Königs nicht gewesen sein, aber sie eröffnet dem Grafen eine lange und erfolgreiche politische Karriere. Petronella sucht denn auch ihr Liebesglück rasch außerhalb der ehelichen Bande und gilt als Mutter von Benedict Swingate Calvert, dem legitimen Sohn von Charles Calvert, dem Fünften Baron von Baltimore. Lord Chesterfield indes zeugt den ersehnten Sohn und Erben mit jener schon erwähnten dubiosen Mademoiselle Elizabeth du Bouchet, die mich um mein königliches Blut bringt. Sonst hätte ich nicht nur den König von England zu meinen leiblichen Vorfahren zählen können, sondern wäre auch in zwar illegitimer, aber leiblicher Weise mit Friedrich dem Großen und seinem entfernten Cousin Katte verwandt.
Hätte sich von dieser Freiheit des Adels (oder diesem Adel der Freiheit) doch nur ein Bruchteil in die Generation meines graublütigen Vaters gerettet! Doch nun ist es offenbar an mir, ihr zu neuem Ruhm und Glanz zu verhelfen.
»Während Du in Deutschland bist«, schreibt Chesterfield an seinen Sohn, »beschränke alle Deine Untersuchungen auf Deutschland, nicht nur auf die allgemeine Reichsgeschichte, sondern auch auf die Geschichte der einzelnen Kurfürstentümer, Fürstentümer und Städte, desgleichen auf die Stammtafeln der angesehensten Häuser. Das Geschlechtsregister ist in Deutschland keine Kleinigkeit. Lieber würden die Deutschen ihre zweiunddreißig Ahnen nachweisen als zweiunddreißig Haupttugenden, wenn es denn so viele gäbe. Sie denken nicht wie Odysseus, der sehr richtig sagt: ›Herkunft und Vorfahren und was wir selbst nicht getan haben, das nenne ich kaum unser.‹«
Ich habe einige Jahre an der Universität von Aberystwyth studiert. Aberystwyth hat elftausendsechshundert Einwohner und siebentausendeinhundert Studenten. Schlägt man die Grund- und Oberschüler noch den Hochschülern zu, kommt auf jeden Einwohner dieses idyllischen walisischen Seebades ein Student. Das ist zweifellos der hauptsächliche, wenn nicht einzige Grund, warum Prinz Charles sein Studium hier absolvierte, vielleicht auch der hauptsächliche und einzige Grund, warum er sein Leben lang der Prinz von Wales zu bleiben verdammt ist.
Ich habe an dieser derart ausgezeichneten Universität Deutsche Literatur studiert. Warum eigentlich?, habe ich mich schließlich gefragt, wo doch selbst mit einem Master in Englischer Literatur in ganz Großbritannien keine Stelle zu finden ist!
Doch nun scheint sich alles zu fügen. Und es bewahrheitet sich das, was Cicero über die Gelehrsamkeit geschrieben hat: Die Kenntnis der Wissenschaften nähre die jugendlichen Jahre, ergötze das Alter, verschönere das Glück, sei Zuflucht und Trost im Unglück, vergnüge daheim, falle auswärts nicht zur Last, vertreibe uns die Nächte, die Zeit auf Reisen, das Leben in der Fremde.
Mein illustrer Vorfahre gleichen Namens begab sich bereits mit achtzehn Jahren auf Grand Tour. Und Hans Hermann von Katte ist neunzehn Jahre alt, als er zu seiner Bildungsreise nach England, Frankreich und Italien aufbricht. Zu seiner Zeit nennt man sie »Kavaliersreise«. Welch ein schönes Wort, auch wenn man damals unter einem »Kavalier« wohl noch etwas anderes verstand als heutzutage.
Also wird es auch für mich endlich Zeit, mich zu meiner Grand Tour aufzuraffen, in die entgegengesetzte Richtung, ins Herz des Kontinents, ins spröde, untergegangene Preußen, meiner Gemütsstimmung und finanziellen Lage gerade angemessen. Vielleicht schenkt sie mir sogar Abstand und Muße, über mich selbst nachzudenken, die notwendigen, zumindest unausweichlichen Schritte im Anschluss dieser Reise. Aber nun lass die Welt Welt sein und sich nach Paris und Venedig sehnen, für dich liegt Arkadien in Wust, in Glaucha und Küstrin!
In einem Nebengebäude des Doms der Freien Hansestadt Bremen, so lese ich auf meiner äußerst komfortablen Fahrt entlang extraterrestrischer Tagebaugruben und stillgelegter Zechen im Bahnmagazin, finde sich eine Attraktion absonderlicher Art: die mumifizierten Leichen in der Stadt verstorbener unbekannter oder nicht reklamierter Reisender, darunter auch die einer englischen Abenteurerin mit orangefarbenen Fingernägeln und bitterschokoladendunklem Teint, in der Stadt allgemein als »Lady Stanhope« bekannt. Es wird sich doch nicht etwa um eine entfernte Verwandte von mir handeln? Habe ich mit meinen Recherchen zu meinem Großcousin nicht genug zu schaffen, um mich auch noch um eine möglicherweise verschollene und nun auf wundersame Weise in der Bremer Dom-Morgue wieder aufgetauchte Großtante zu kümmern?
Der Lady fehle dem vor mir liegenden Artikel zufolge die Nase, anderen Mumien seien Haare und Finger abgetrennt worden, die Besucher abgeschnitten oder ausgerissen und als Erinnerungsstücke mitgenommen hätten. Einer dieser Finger und eine ganze Kinderhand befänden sich heute im Goethehaus zu Weimar. Der Bremer Arzt Dr. Nicolaus Meyer, ein Bekannter Goethes, habe sie dem Dichterfürsten übersandt, um ihn so zu einem Besuch Bremens zu verführen. Goethe nahm die Einladung jedoch nicht an und schenkte Finger und Hand seinem Sohn August.
Die Stadt ist relativ jung, verglichen mit anderen europäischen Metropolen wie Athen, Rom, London oder Aberystwyth. Den Römern ist es nie gelungen, östlich der Elbe Fuß zu fassen. Hier verlief die Grenze zu einem Reich, das noch von Stämmen beherrscht wurde.
Berlin war nicht viel mehr als ein Transitort, eine Furt oder ein Damm an der Spree, wo Kaufleute, die aus dem Westen oder dem Osten kamen, ihre Waren umladen mussten, ehe sie ihre Reise auf dem Landweg oder auf den Flüssen und Seen Richtung Norden fortsetzen konnten.
Transitort scheint die Metropole immer noch zu sein. Die meisten Berliner, die ich treffe, sind nicht hier geboren, sondern Zugereiste. Sie wollen auch nicht für immer bleiben, sondern sind noch auf der Suche.
In der U-Bahn sitze ich einem jungen Mann von achtzehn oder neunzehn Jahren gegenüber, schlicht und ungehobelt in seiner Rede, augenscheinlich ohne tiefere Bildung. Doch dann spricht er mich direkt an, mit so viel unerwarteter Feinfühligkeit und Überzeugungskraft, dass alles, was ich bisher gehört und gelesen habe, verblasst im Vergleich zu dem, was er mir mitteilt.
Er ist nicht der Erste, der mich, obgleich er mich nicht kennt, einfach anspricht. Die Stadt ist voller Sprachen, die durch ihre Sprecher verwundet sind. Es gibt eine spürbare Unruhe zwischen den Wörtern, ohne dass ich den Grund dafür erkennen könnte. Sie wühlt auf, peinigt mich, hat aber keinen anderen Namen als diese Leerstelle. Vielleicht ist es eine Geste, eine Operation anstelle eines Namens.
Ich bleibe in der U-Bahn sitzen, um so lange wie möglich mit dem beseelten Redner zusammen zu sein und ihm zuhören zu können. Zunächst klingen seine Worte wie eine Predigt. Als er bemerkt, dass endlich einmal einer seinen Worten lauscht, sagt er, ich dürfe ihm nicht glauben, denn er sei der größte Sünder auf der Welt!
Beim Zuhören darf ich mich weder an dem festhalten, was die Einheimischen sagen, in der Regel ist es widersprüchlich, noch an dem, wie sie es sagen, meistens ist es zu grob. Was bleibt, ist eine dunkle, gestaltlose Unähnlichkeit mit dem, was gemeint ist. Ich bin durchaus dankbar für diese Freiheiten der Deutung. Sie entlasten mich, sie eröffnen heilige Fiktionen. Wörter werden von ihrem Sinn losgerissen, sie liefern dem Verstand keinen Halt mehr, sondern bringen ihn, nein, zwingen ihn zur Bewegung.
Bis zum Betriebsschluss pendeln wir zwischen den Endstationen der Linie 2, während er mir von seiner vollkommenen Vereinigung mit Gott berichtet, Vereinigung im Sinne von Verkehr. Als er genauere Einzelheiten preisgibt, glaube ich ihm die besondere Vertrautheit sofort. Die Voraussetzung dieser unbegreiflichen Intimität sei die absolute Reinheit der Seele, sagt er mit großem Ernst. Und im tieferen Sinne sei sie es, die ergriffen werde, auch wenn zuallererst der Körper es spüre.
Ich frage den jungen Mann, wie diese absolute Reinheit der Seele erlangt werden könne.
Er erwidert, vor allem müsse man beharrlich sich selbst besiegen, die Sorge um die eigene körperliche und seelische Gesundheit, die Schmerzen, den Rausch.
Ich teile ihm ganz offen meine Angst vor Schmerzen mit. Er nickt verständnisvoll und verspricht, für mich beten zu wollen. Dann rät er mir, den Heiligen Josef zum Vorbild zu wählen.
»Den Heiligen Josef?«
»Ja, den Vater Jesu.«
»Ich habe bisher angenommen, Jesus habe keinen Vater gehabt.«
»Das ist in der Tat ein ungelöstes Mysterium. Seit meinem zehnten Lebensjahr verehre ich ihn als meinen ersten und einzigen Beschützer und vertraue nur ihm.«
»Dem Heiligen Josef und nicht Gott?«
»Der Heilige Josef ist Gott! Er ist der Vater in der Heiligen Dreieinigkeit.«
»Das habe ich nicht gewusst.«
»Er ist ein sehr verschwiegener Mann. Im Hause unseres Herrn hat er sehr wenig gesprochen, weniger als Unsere Liebe Frau, die auch nicht gerade ein redseliges Weib genannt werden kann.«
O Stadt der letzten Gott suchenden Mystiker, barfüßigen Bettelmönche, gepiercten Geißler, gefledderten Engel! Dunkle Tage, helle Nächte. Ungestüme Ruhe, schulterklopfende Grausamkeit. Vertraute Fremde, fremde Vertrautheit. Ja, ich rauche noch einen Joint mit.
Von der ersten Begegnung an mag ich es, wie diese Stadt ihre Unvollkommenheit mit einer Rhetorik des Exzesses und der Übertreibung verteidigt. Diese Schamlosigkeit scheint ihr vorherrschender Stil. Ich bewege mich durch eine Topographie, wo die Fallhöhe hoch und der Absturz die Regel ist. Mein Gegenüber würde es vielleicht den verstetigten Sündenfall nennen. Andere, nüchternere wie ich erkennen darin natürlich auch die schlichten Symptome eines ständigen Missbrauchs.
Tief in der Nacht steige ich endlich aus der U-Bahn aus. Doch es ist nicht die Station, zu der ich wollte, zumindest finde ich dort nicht die vertraute Umgebung, die ich erwartet habe, sondern eine Wüste.
Ich bin mir nicht sicher, ob es der äußere Verfall ist, der dieses tiefe Gefühl von Trostlosigkeit in mir hervorruft. Verfall, Verwahrlosung, Freudlosigkeit, Finsternis. Es dämmert bereits, als ich endlich zu meinem bescheidenen Hotel am Bahnhof Zoo zurückgefunden habe.
Kaum bin ich in einen schweren, traumlosen Schlaf gefallen, da fasst mich jemand an die Schulter. Vor mir steht ein bärtiger Mann in einer traditionellen Zimmermannskluft, wie ich sie nur aus alten Schwarzweißfilmen kenne, und spricht: »Was bist du stolz auf deine Gottlosigkeit und dein untugendhaftes Leben! Willst du einen wirklichen Heiligen sehen, so gehe in den Waschraum. Dort findest du einen Mann, der einen Lumpen um den Kopf gebunden hat. Niemals hat er sein Herz von Gott abgewendet, während deine Gedanken unentwegt in den Sündenpfuhlen der Weltgeschichte herumscharwenzeln!«
Als ich mich einfach umdrehen und weiterschlafen will, hebt er zornig den Eichenknüppel, den er wohl nur zu diesem Zweck bei sich trägt, da er zu rüstig ist, um sich darauf stützen zu müssen. Seufzend stehe ich auf und begebe mich in den Waschraum. Außer zwei kotzenden Landsleuten ist er leer. Dann gehe ich hinunter zum Empfang und frage den Nachtportier nach einem Angestellten oder Gast, der mit einem um den Kopf geknoteten Scheuertuch herumläuft. Der sichtlich müde Nachtportier blickt mich an, als sei ich nur ein weiterer betrunkener Brite, der gleich seinen Empfangsraum vollkotzen wird. Ich versuche, seine Bedenken zu zerstreuen, und erkläre ihm, ich hätte eine Vision gehabt, ein bärtiger Mann mit einem Knüppel in der Hand, seines Zeichens Tischler oder Sargschreiner, habe mir befohlen, besagten Heiligen mit dem Scheuertuch aufzusuchen.
Der Herbergsangestellte, jung noch, vermutlich ein Student, aber in derlei herausfordernden Situationen nicht unerfahren, nickt mit ausdruckloser Miene. Im Augenblick, sagt er, sei er der einzige Angestellte hier und, soviel er wisse, alles, nur kein Heiliger. Ich solle mich erst mal ausschlafen und am Morgen mit dem Geschäftsführer sprechen. Der kenne sich mit derlei Visionen besser aus, er habe immerhin ein abgebrochenes Theologiestudium hinter sich, während er, der Nachtportier, erst im dritten Semester Betriebswirtschaft studiere.
Ich falle ihm zu Füßen und sage: »Vergib mir und segne mich. Auch ohne Scheuerlappen bist du in meinen Augen ein Heiliger, Kurt!«
Nun blickt der Student doch ein wenig irritiert: »Woher kennen Sie meinen Namen?«
»Steht auf deinem Namensschild, Bruder.«
»Sorry, junger Mann, Sie müssen mich verwechseln! Besser, Sie gehen jetzt auf Ihr Zimmer zurück!«
»Haben sie dich nicht angepisst, als du noch ein sommersprossiger Junge warst, haben sie dir nicht Senf auf die Eichel und in die Arschritze gerieben, damals im Jugendlager, und später, auf dem Kinderspielplatz hinter deinem Wohnblock, sind sie da nicht über dich hergefallen, haben dir dein Handy und deine Sportschuhe geklaut, sodass du barfuss nach Hause humpeln musstest, und haben sie dir, nachdem dein Vater Anzeige erstattet hat, nicht nach der Schule aufgelauert und dich mit ihren Schlagringen und Springerstiefeln so zugerichtet, dass du zwei Wochen im Koma lagst?«
»Wer hat Ihnen denn diesen Unsinn erzählt?«
»Ich habe es doch gesagt, ich hatte eine Vision!«
»Gehen Sie schlafen, Mister!«
»Nicht, ehe du mir verziehen und mich gesegnet hast!«
»Ich bin kein Seelsorger, ich mache hier nur den Nachtdienst!«
»Dann bete für mich Sünder, Kurt!« Bevor seine Verlegenheit in heiligen Zorn umschlägt, trete ich den Rückzug an. Vielleicht habe ich es ja wirklich ein wenig übertrieben, noch ganz am Anfang meiner Reise.
»Bald hätte ich etwas vergessen, das ich Dir zum Augenmerk deiner Neugier und Erkundigung während Deines Aufenthaltes in Deutschland anpreisen wollte«, schreibt Chesterfield an den fernen siebzehnjährigen Sohn, »und das ist die Verwaltung der Gerechtigkeit.« – Ja, auch deswegen bin ich hier.
An Baroness Melusine von der Schulenburg, Herzogin von Kendal, St. James Palace, London
Wust, den 5ten April 1724
Endlich, teure Tante, bin ich nach Wust auf das väterliche Gut zurückgekehrt, wohlbehalten und gesund, und will den Dank nicht vergessen, den ich Ihnen für die gastfreundliche Aufnahme in London schulde. Überdies habe ich auch auf dem Heimwege so viel erlebt, daß mir auf diesem Papier kaum genug Raum bleibt, darüber zu schreiben. Ich wollte, ich könnte es Ihnen von Angesicht zu Angesicht erzählen, denn schon diese wenigen Zeilen, liebe Tante, müssen Sie enttäuschen, ich schreibe eben anders, als ich rede, schlimmer noch, ich rede anders, als ich denke, und ich denke anders, als ich denken sollte. Verzeihen Sie mir, daß ich mich an dieser Stelle kürzer fasse, als Sie es in den redseligen und selbstvergessenen Teestunden, die ich in Ihrer Gesellschaft verbringen durfte, von mir gewohnt sind. In aller Kürze also nur soviel: Vom Rheine aus bin ich schon in den Frühling hineingeritten, aber in den letzten Tagen, an den gefürchteten Hängen des Harzes, hat mich der Winter noch einmal eingeholt, und in Sturm und Wildnis und in eiskalter Nacht, die geladene Pistole neben mir im Strohbette, habe ich gar manches Gebet geseufzt zum verlorenen Gotte meiner Kindheit.
Aber es war am Ende kein tollwütiger Wolfshund, kein Wegelagerer oder Mordbube, der mir fast den Leib von der Seele getrennt hätte, sondern die blinde, unbarmherzige Natur. Zunächst betraf es nur die Zehen und Füße, die ich nach und nach nicht mehr spürte. Doch als die Taubheit die Beine hinaufzukriechen begann und ich schließlich nicht einmal mehr die schon steifen Finger spürte, wurde ich mir der Gefahr bewußt und bettete mich in guter Soldatenmanier dicht an meiner treuen Stute Rücken, die ich zu mir ins Stroh sich zu legen zwang, und nahm sie gleichsam zu mir unter die viel zu dürftige Decke. So lagen wir, Roß und Reiter, behaartes Fell an unbehaartem, in der zugigen Scheune und wärmten einander.
Und nun, da ich trotz aller Unbill ohne größere Blessuren an Leib und Seele heimgekehrt bin, fühle ich mich wie neugeboren.
Wie Sie sich zweifellos erinnern, ist unsere Gegend nicht reich an landschaftlichen Schönheiten, und was sie bietet, ist der Wildnis mit Fleiß und harter Arbeit abgerungen. Aber unansehnlich ist sie – dem Namen Wust zum Trotze – eben auch nicht. Die Güter liegen von Eichengeäst überragt im Grünen zwischen Wiesen und Hainen. Es ist stiller hier und weniger staubig als in London oder Berlin. Auch wenn ich an diesem Orte weniger Zeit verbracht habe als in der Residenzstadt, so ist doch jeder Baum im Garten und jeder Platz im Dorfe mit Erinnerungen verbunden, glücklichen und unglücklichen.
Als ich mein altes Kinderzimmer mit Blick zum großen Hofplatz hinter dem Hause bezog, kam eine Krähe ans Fenster geflogen, und obgleich ich ihr nichts zu essen geben konnte, blieb sie sitzen, aber schalt gewaltig mit mir. Erst als ich sie anzufassen versuchte, flog sie fort.
Seit dem Morgen regnet es recht stark, was sage ich, der Regen ergießt sich mit der Gewalt einer alttestamentarischen Plage auf Wust. Das gibt mir immerhin die Zeit und Muße für diesen Brief. Überhaupt führe ich gerade das Leben eines Einsiedlers, da mein Vater in Berlin und meine Stiefmutter mit den Kindern in Königsberg weilen und nur wenig Gesinde das Haus hütet. Bei trockenem Wetter spaziere ich über die Felder und Auen bis zum Elbufer. Kehre ich zurück, musiziere ich oder vergnüge mich in Gesellschaft eines Buches. Der Umgang mit Büchern verlangt von uns ja ein gewisses Maß an Seßhaftigkeit. Dafür entschädigen sie uns mit der Bewegtheit und Unbegrenztheit des imaginären Reisens.
Von den Verwandten und Bekannten auf den Nachbargütern habe ich kaum jemanden besucht. Doch ist in der vergangenen Woche hochbetagt Großtante Luise von Bismarck gestorben, gestern fand die Beisetzung statt, an der ich wohl oder übel teilnehmen mußte. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das zarte, zerbrechliche Fräulein. Sie hat nie geheiratet und allein mit ihren Bediensteten auf einem Nachbargute bei Jerichow gewohnt. Sie war ihr Leben lang verschlossen, unwirsch und schwermütig. Erst in den letzten Lebensjahren, als sie kaum noch gehen und das Haus verlassen konnte, ist sie noch einmal zu neuer Lebensfreude aufgeblüht. Den Grund für diese wundersame Wandlung haben wir erst nach ihrem Tode erfahren.
Ein junger schwedischer Offizier, Herr von Boltenstern, lag während des letzten Krieges, als die Schweden plündernd und brandschatzend durch die Mark zogen, im Haus ihrer Eltern im Quartier. Es war damals noch ihre ältere, unverheiratete Schwester Elisabeth im Hause, und beide mögen sich wohl um den stattlichen jungen Mann bemüht haben. Aber der schwedische Edelmann hatte zum Leid und Argwohn der Älteren nur Augen für die Jüngere, Luise. Als dem jungen Offizier weiterzuziehen befohlen ward, versprach er Luise beim Abschied, sich gleich nach seiner Rückkehr in die Heimat mit seiner Familie zu beraten und dann bei Luisens Vater um ihre Hand zu werben. Auch wenn der Edelmann ein Schwede war, stammte er doch aus einer vornehmen und begüterten Familie, so daß einer Einwilligung des Vaters wohl nichts entgegengestanden hätte.
So zog der junge Offizier ab, und Luise wartete. Sie wartete geduldig und mit Zuversicht. Es verging ein Jahr und ein weiteres, und keine Nachricht aus Schweden erreichte sie. Doch sie glaubte weiterhin mit unerschütterlichem Vertrauen, daß der ersehnte Brief kommen müsse und kommen werde. Sie wies alle Bewerber, auch gegen die ausdrückliche und scharfe Mißbilligung der Eltern, ab, was man ihrem sanften Charakter gar nicht zugetraut hätte, und blieb ledig.
Erst Jahrzehnte später, nach dem Tode ihrer Schwester Elisabeth, klärte sich das Geheimnis auf. Unter den Papieren der Verstorbenen fand sich jener lang ersehnte Brief, von der eigenen Schwester aus Eifersucht und Mißgunst unterschlagen. Inzwischen war Großtante Luise selbst schon eine Greisin von über siebzig Jahren. Dennoch begann sie, Erkundigungen über jenen jungen Offizier einzuziehen. Er lebte noch, unverheiratet wie sie, ein rüstiger Greis. Und Luise begann im hohen Alter eine Correspondance mit ihm, ein Briefwechsel nicht ohne Bitterkeit über das verratene und vorenthaltene Glück. Sie schrieben einander, solange Herr von Boltenstern noch lebte, und meine Tante gewann ein wenig von ihrer Lebensfreude zurück, doch wiedersehen wollten die beiden betrogenen Alten einander nicht.
Und nun hat auch Tante Luise ihre letzte Ruhe gefunden und in ihrem Letzten Willen bestimmt, man möge die Briefe des Herrn von Boltenstern zu ihr ins Grab legen. Ihr jüngster, einzig noch lebender Bruder, Großonkel Christoph, hat dafür Sorge getragen, daß kein fremdes Auge noch einen Blick hineinwerfen konnte, was ich äußerst ehrenwert, aber auch bedauerlich finde.
Angesichts unserer Natur und unseres Loses bin ich ein hoffnungsfroher Pessimist. Nicht immer sind die Menschen in der Lage, dem rechten Maße und der erwarteten Tugend zu folgen. Und ich gebe offen zu, ich selbst bin einer von ihnen. Aber das kommt meinem Dafürhalten nach daher, daß wir uns nicht alle dieselbe Vorstellung vom Glücke machen und unterschiedliche Leidenschaften uns zu unterschiedlichem Verhalten bestimmen. In dieser Hinsicht bekenne ich mich zum Ideal größtmöglicher Freiheit. Aber dieses Geständnis behalten Sie bitte für sich, teure Tante.
Es grüßt Sie mit höchster Ehrerbietung, Ihr ergebener Neffe
Hans Hermann von Katte
WUST
Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen.
Theodor Fontane
Der Großstadtlärm verstummt, die große Orgel des Verkehrs. Stadtbrachen. Und plötzlich bin ich hinaus aus Stein und Schutt. Ein Dom aus Kiefern, Fichten, Birken, ein karger märkischer Säulenwald, mehr Burg als Bethaus, protestantisch bis ins Kasernenhafte, gerade Baumstämme in Reih und Glied, die einen grauen schmucklosen Himmel tragen.
Ich sitze im Zug, und die märkischen Kiefern-Birken-Mischwälder ziehen vorbei wie ein monotoner Film in Schwarz-weiß, und statt der Schweißnähte der Vorortschienen höre ich meinen eigenen Puls stampfen. Rehe auf den überschwemmten Wiesen. Die Flüsschen und Seen randvoll, dabei hat die Frühjahrsschmelze noch gar nicht begonnen. Die Stationen heißen Kirchmöser, Wusterwitz, Genthin. Möchte nicht die Ortsnamen kennen, an denen der Zug nicht hält. Lese flüchtig den Namen GÖTZ auf einem verwitterten Bahnhofsschild.
Der pickelige Junge auf der Bank gegenüber blättert in einem Skateboardmagazin. Wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Waren Skateboarder nicht einmal Jugendliche, die das Blättern in jeder Art von Hochglanzmagazinen verschmähten? – Theodor Fontane gibt Ratschläge für das Reisen in der Mark Brandenburg, die zwar über hundertfünfzig Jahre alt sind, aber womöglich mehr denn je ihre Bedeutung haben. Wer in der Mark reisen wolle, schreibt er, müsse zunächst Liebe zu Land und Leuten mitbringen, zumindest keine Voreingenommenheit. Er müsse den guten Willen haben, das Gute gut zu finden, anstatt es durch kritische Vergleiche tot zu machen. Ferner müsse der Reisende sich mit einer feinen Art von Natur- und Landschaftssinn ausgerüstet wissen.
Nun denn, mit dieser Unvoreingenommenheit und dem geschärften Sinn für die Schönheiten in oder hinter der Armut habe ich mich auf den Weg gemacht. Da es keine direkte Zug- oder Busverbindung von Berlin nach Wust gibt, sitze ich nun im Regionalexpress 8114 nach Genthin. Ich hätte mir auch einen Wagen mieten können, doch zum einen habe ich keinen Führerschein, zum anderen sind die Unfalltoten auf den Brandenburger Alleen ja auch ohne meinen tatkräftigen Beitrag bereits Legion.
In Genthin muss ich den Zug verlassen und eine gute halbe Stunde unter dem Bahnhofsvordach auf den Bus nach Tangermünde warten. Seit Kirchmöser regnet es leicht, aber hartnäckig, sodass ich mich fast wie zu Hause fühlen kann. Nun geht die Fahrt mit dem Bus weiter, entlang der Straße der Romantik bis zur dem Flecken Wust nächstgelegenen Stadt Tangermünde, die vor siebenhundert Jahren für kurze Zeit den stolzen Titel einer Kaiserpfalz trug und schon zur Hauptstadt eines ostelbischen Reiches, in dem allerdings noch die unbesiegten Wenden hausten, ausersehen war. Indessen starb Kaiser Karl IV., bevor er die Hauptstadtfrage abschließend unter Dach und Fach bringen konnte, sodass seit diesen sieben Jahrhunderten das traurige Tangermünde von allen Zeitläuften unberührt weiter von seiner Auserwähltheit träumt.
Zunächst bin ich der einzige Fahrgast in dem Regionalbus und habe viel Raum und Stille zu schauen, auch wenn es nicht viel zu sehen gibt: flaches Ackerland, aus dem sich ein Heer riesenhafter Windräder erhebt. Träge bewegen sie ihre Flügel, eher mechanisch als lebendig, weil lautlos für meine Ohren. Weil sie mich mit der Frage, was der Tod denn sei, allein lassen. Jedenfalls ist er nicht einfach Bewegungslosigkeit.
In Jerichow steigt eine ganze Klasse junger Schwesternschülerinnen zu. Lärm und Gelächter erfüllt nun den Bus, und binnen weniger Minuten sind alle Fenster beschlagen, sodass meine Einfahrt ins stolze Tangermünde aussichtslos hinter dunstblinden Scheiben stattfindet.
Hier werde ich übernachten, bevor ich mich morgen um die Weiterfahrt nach Wust kümmere. Wust – ist das nicht ein großes, grobes Durcheinander, eine unübersichtliche Menge, eine chaotische Anhäufung, ein Berg, eine Flut unzähliger Dinge? Und klingt darin nicht Wüste an, Ödnis, einsamer, leerer Raum, Unmaß, Unrat, Halden, Schutt?
Fontane warnte bereits, nicht allzu sehr durch den Komfort der Großen Touren verwöhnt und korrumpiert zu sein. Es werde einem auf einer Reise durch die Mark zwar selten das Schlimmste zugemutet, aber es komme doch vor, und keine Reiseerfahrung reiche aus, uns im Voraus wissen zu lassen, wo und wann es den Reisenden treffe.
Bereits jetzt, am frühen Abend, sind die Gassen Tangermündes verlassen. Im einzigen noch geöffneten Café beeindruckt mich ein junger Gast mit wilden, kunstlosen Tätowierungen. Als habe er sie sich mit einem einfachen, angespitzten Schulfüller selber beigebracht. Vielleicht bleibt einem hier aus schierer Langeweile nichts anderes übrig, als sich selbst zum Kunstwerk zu machen, ehe man sich das Leben nimmt oder gar noch Schlimmeres antut.
Je finsterer die Nacht, umso heller die Sterne, sollte man denken. Aber hier ist der Himmel ein schwarzes Loch. Und sollte nur eine geschlossene Wolkendecke an der Sternenlosigkeit schuld sein, so gibt es nicht einmal genügend irdische Leuchtkörper, deren Lichtsmog die Kondensglocke sichtbar machen würde. Auch habe ich gelesen, dass hier, siebzig Kilometer westlich von der strahlenden Hauptstadt Berlin, der dunkelste Flecken Deutschlands liegen soll. Das habe ich mir nicht ausgedacht, ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist. Ein deutscher Hobbyastronom mit weißem Bart und brauner Cordhose ist mit seinem Lichtmessgerät auf dem Autodach kreuz und quer durch seine Heimat gereist, um nach dem dunkelsten Ort im lichtverschmutzten Lande zu suchen, und hat ihn nicht an den Stränden der Ostsee oder auf den Gipfeln des Schwarzwaldes gefunden, sondern hier im Jerichower Land.
Ein grauer kalter Januartag. Auf den Feldern, Wiesen und Wegen stehen Wasserlachen. Für neun Uhr habe ich einen Rufbus bestellt, nun fährt er nur für mich und mich ganz allein die sieben Kilometer nach Wust. Bis auf den Schulbus um 7.15 Uhr und 14.15 Uhr gibt es keine Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln mehr zwischen Wust und Tangermünde.
Der Busfahrer lässt mich an der Haltestelle vor der Dorfkirche aussteigen. Ein Fachwerkturm mit grünbemoosten Balken, gegenüber das ehemalige Gutshaus derer von Katte. Heute beherbergt es die Grundschule des kleinen märkischen Fleckens. Doch die wenigen Kinder in Wust füllen gerade noch eine Klasse.
Hinter dem Gutshaus eine Andeutung von Park, der übergangslos in wildwachsende Fichtenhaine, Wiesen und Brachen übergeht. Auf einer kleinen sumpfigen Insel inmitten des Parks drei Gräber der Familie von Pilgrim und einer geborenen von Katte.
Zu Zeiten des jungen Kattes gibt es nur einen Garten hinter dem Herrenhaus und noch keinen großen Park mit künstlichen Teichen und seltenen Bäumen, die man erst aus England hierher bringen wird. Der kleine Hans hätte sich in einem Park wohl auch weniger zu Hause gefühlt als in einem sandigen Garten.
Hans Hermann von Katte kommt am 21. Februar 1704 im Domizil seines Großvaters mütterlicherseits, Alexander Hermann Graf von Wartensleben, zur Welt, der als Berliner Gouverneur damals noch das Hohe Haus in der Klosterstraße im Pfarrsprengel von St. Nikolai bewohnt.
Zwei Jahre darauf, wohl bei seiner Ernennung zum Generalfeldmarschall, erhält von Wartensleben das Palais Marlitz-Schomberg auf dem Friedrichswerder, wo auch sein Enkel Hans aufwächst. Es liegt dem Zeughaus gegenüber. Östlich vom Palais des Gouverneurs steht das Memhardtsche Haus, das einige Jahre später der Stadtkommandant als Dienstsitz erhält und von da an das Kommandantenhaus genannt wird. Und direkt hinter dem Palais Marlitz-Schomberg erstreckt sich das Kriegs-, Hof- und Kriminalgericht, Neue Hausvogteigenannt, dessen Generalauditor, Leutnant Christian Otto Mylius, in Kattes Prozess von 1730 eine bedeutende Rolle spielt.
Auf dem Familiengut Wust wird bald nach der Geburt im dortigen Kirchenbuch Folgendes vermerkt: »Anno 1704 den 21. Februar ist des Herrn Obrist-Wachtmeister Hans Heinrich von Kattes Söhnlein zu Berlin geboren und den 22. getauft und mit dem Namen Hans Hermann benennet worden. Dessen Pathen waren der Hoch-Gräfliche Herr Feldmarschall von Wartensleben, dessen Frau und Sohn.«
Kattes Mutter, Dorothea Sophie von Wartensleben, stirbt im Alter von dreiundzwanzig Jahren, als Hans drei Jahre zählt. Fünf Jahre nach dem Tod seiner ersten Frau heiratet Kattes Vater die siebzehnjährige Katharina Elisabeth, geborene von Bredow, Tochter des Leutnants Ludwig von Bredow und einer Tante Kattes. Sie, die Siebzehnjährige, wird Stiefmutter des achtjährigen Hans Hermann. Fünf Kindheitsjahre verbringt Katte mutterlos, vor allem in Obhut der Großeltern von Wartensleben in Berlin. Nur wenige Sommer verlebt er mit seinem Vater auf dem Gut in Wust.
Kattes Mutter stirbt in Brüssel, wohin sie ihrem Mann gefolgt ist. Hans Heinrich von Katte, Kürassieroberst und ein Liebling des Königs, kämpft in den Niederlanden, nimmt an den Schlachten gegen den Marschall Villeroy teil und erobert bei Ramillies mit seinem Regiment fünfzehn feindliche Geschütze.
Dieses Jahr des Ruhms nimmt Oberst Katte aber auch das Liebste, seine Gemahlin. Nicht einmal an ihrer Beisetzung kann er teilnehmen. Als der Oberst endlich aus dem Krieg zurückkehrt, erkennt Hans ihn kaum. Und als er den Fremden Vater zu nennen beginnt, ist dieser schon wieder auf dem Weg zu seinem Regiment im ostpreußischen Angerburg.
Im Park, Lange Straße und Gartenstraße, das ist Wust. Das einzige Gasthaus, Zum Schwarzen Adler, hat nun auch geschlossen. Es gibt keine Gaststätte, keinen Lebensmittelladen, keine Bäckerei, keine Post, keine Arztpraxis, keine Apotheke in Wust. Außer der sterbenden Grundschule gibt es gar nichts, nicht einmal Gottesdienste in der winzigen romanischen Dorfkirche. Man wohnt und stirbt hier. Doch geboren und selbst begraben wird man inzwischen andernorts.
In der Wuster Kirche befindet sich unweit der Kanzel ein in die Hallenwand eingelassenes Reliefbild, das einen Reiter in der Tracht des Dreißigjährigen Krieges zeigt, Hans von Katte, Hans’ Großvater väterlicherseits. Daneben steht ein zweiter Stein, hineingemeißelt ein Knabe, der auf die Göttin Minerva zugeht und ihr einen Apfel überreicht. Der Junge mit dem Apfel stellt den Bruder des Vaters dar, der schon im Alter von vierzehn Jahren stirbt. Und der Großvater mit demselben Namen ist bereits zwanzig Jahre tot, als Katte geboren wird.
Hinter der Kirche, im selben rostroten Backstein errichtet, die Ruhestätte derer von Katte, eine schlichte mannshohe Gruft mit quadratischem Grundriss und einer kleinen Apsis, der »Ecke«, in der Hans Hermann von Kattes Sarg steht. Die Gruft ist vollgestellt mit Sandstein- und Eichensärgen, Kattes Vater Hans Heinrich liegt rechter Hand, neben ihm seine zweite Frau, Katharina Elisabeth von Bredow, linker Hand Kattes Mutter und die beiden Halbbrüder, die sich als junge Männer, zehn Jahre nach Hans Hermanns Tod, bei einem Duell gegenseitig umbringen, aus Eifersucht, aus verletztem Ehrgefühl, man weiß es nicht. Hans Heinrich von Katte überlebt alle seine Söhne. Keiner der drei wird älter als siebenundzwanzig Jahre, keiner heiratet, gründet eine eigene Familie und wird selbst Vater.
In der Gruftmauer befinden sich drei kleine kreuzförmige Löcher, welche die Grabkammer ständig belüften und dafür gesorgt haben, dass alle hier Beigesetzten ordentlich mumifiziert worden sind. Nur Leutnant von Katte ist in seinem Holzsarg, der ja zunächst auf dem Armenfriedhof zu Küstrin verscharrt worden ist, vermodert, da es in seiner »Ecke« der Gruft wegen mangelnder Regenrinnen am Kirchen- und Grabhaus über drei Jahrhunderte lang trotz Windscharten elendig feucht war.
Nun ist es aber auch der einzige Sarg, auf dem ständig ein frisches Blumengebinde liegt und an dem, trotz fortgeschrittener Verwesung, Jahr für Jahr am 6. November eine Gedenkandacht abgehalten wird.
Von meiner Informantin aus dem Wuster Geschichtskreis erfahre ich, dass die Angehörigen von Hingerichteten in den vergangenen Jahrhunderten bis zu den Attentätern des 20. Juli, die ja zu einem großen Teil ebenfalls dem märkischen Landadel entstammten, die Rechnungen für Henker, Henkersmahlzeit und Entsorgung des Leichnams zur Bezahlung vorgelegt bekamen. Im Falle Kattes zeigte der Soldatenkönig späte Milde und ersparte dem verzweifelten Vater die Begleichung wenigstens dieser Rechnung.
Hinter der Kirche beginnt nun ein »Katte-Radwanderweg«, wohin auch immer er führen mag (nach Küstrin?). Aus der Waldlichtung tritt ein junger Mann mit je einem großen Plastikohrring in beiden Ohrläppchen, an der Leine ein biberbrauner Dobermann, der ihm bis zur Hüfte reicht. Er könnte der jüngere Bruder meines Tätowierten in Tangermünde sein. Ich würde ihn gerne ansprechen und fragen, was er den ganzen Tag so macht, aber sein kalbsgroßer Begleiter hält mich von derart anthropologischer Aufdringlichkeit ab. – Später erfahre ich von meiner Informantin, die während dieser morgendlichen Begegnung noch die Wuster Schulklasse in Heimat- oder Naturkunde unterrichtet, dass es sich um eins der beiden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr von Wust gehandelt haben müsse und der Tätowierte tatsächlich der ältere Bruder und nun Schwiegersohn des Besitzers meiner Tangermünder Herberge sei. Kleine märkische Welt!
Gab es damals schon ein vergleichbares Fernweh, wie es die Menschen heute umtreibt? Kam der Jugend die Begrenztheit eines Dorfes Wust genauso eng und bedrückend vor wie den Heranwachsenden der Gegenwart? Wollte sie hinaus in die Welt und Abenteuer erleben, wofür die unter jungen Adeligen üblichen »Kavaliersreisen« womöglich ein Symptom sind?
Wenn eine Zeitmaschine mich in Kattes Jahrhundert zurückkatapultierte, würde ich, nehme ich an, eher durch die unterschiedliche geografische als zeitliche Herkunft auffallen. Es ist zumindest kein seltenes Gefühl, sich in seiner eigenen Zeit fremd und einer anderen Epoche zugehörig zu fühlen.
Fontane schreibt, in der Kronprinzentragödie zwischen Friedrich und seinem Vater sei es am Ende Katte, der die Schuld bezahle. Von welcher Schuld spricht Fontane? – Es ist nicht leicht, in dieser Geschichte gerecht zu bleiben, da wir ja alle Söhne mehr oder weniger enttäuschter (und enttäuschender) Väter sind. Also will ich es auch gar nicht erst versuchen. Ein Roman muss nicht, ja darf nicht gerecht sein! Natürlich darf er auch nicht ganz und gar die Partei seines Helden ergreifen. Aber diese parteiischen Romane bereiten nun einmal das größere Lesevergnügen! Und die Wahrheit, der wir nahekommen sollten oder auch nur wollten, gibt es ohnehin nicht. Es genügt doch, dass ich, Philip Stanhope aus Aberystwyth, die Geschichte erzähle, um zu wissen, dass hier nicht Geschichte erzählt wird, sondern eine – ja, was? Eine märkische Passionsgeschichte? Ein preußischer Liebesroman?
Auf der von alten Ebereschen gesäumten Straße, die in späteren Zeiten vielleicht nur noch als ein elender Karrenweg angesehen wird, nähert sich, von Jerichow kommend, ein junger Mann auf seinem Schimmel dem stillen Weiler. Er mag es nicht sein Zuhause nennen, das kleine märkische Dorf, nur einige Kindheitssommer hat er hier verbracht, und nicht immer die glücklichsten.
Sobald das Gutshaus in Sicht kommt, zügelt er das Pferd. Das Gebäude ist eingerüstet, der Blick auf die Fassade von Fichtenbohlen verstellt. Ist es noch das Haus seiner Kindheit? Er sieht sich auf der Leiter, das Gesicht im unteren blattarmen Geäst des Kirschbaums. Ich bin die einzige Farbe hier im grünen Schatten, erinnert er sich. Angriffslustig beäugen mich die Elstern. Eine Sprosse weiter, und ihre schwarzen Schnäbel werden mir die kirschroten Augen aushacken. Ich lese es in ihrem gesträubten Gefieder, während ihre Augen kalt und leblos blicken. Ich bin vier oder fünf Jahre alt. Langsam hebe ich meine Steinschleuder, ihr Gezeter schwillt an, Wage es!, warnen sie mich, und wir werden dir deine kindlichen Knochen brechen!, dann das Baumbeben, die Sonnenfinsternis, der Aufruhr im schwarzen Geäst, und plötzlich sitze ich im Gras, winzig, von haushohen Halmen umgeben, als wäre ich ein plumpes, flügellahmes Insekt. Und ich denke, mitten im Leben geschieht es, daß der Tod uns holt. Wie lange habe ich nicht mehr an diesen Absturz, diesen Fall gedacht! Gut, das Leben ging weiter. Doch warum fällt es mir gerade jetzt wieder ein?
Damals konnte ich mir unter »Tod« noch nichts Rechtes vorstellen. Er bedeutete mir kaum mehr als eine andauernde Abwesenheit. Meine Mutter ist tot, wußte ich, und das hieß: Sie ist fort, weit fort, und findet nicht den Weg zurück. Am Anfang warte ich noch auf ihre Rückkehr, und viel später erst begreife ich die Tiefe dieses Wortes: nie, wenn auch nicht das Warum.
Es ist mein Kindermädchen Agnes, das mir, sanft das Haar und die Wangen streichelnd, begreiflich zu machen sucht, meine Mutter sei gestorben. Ich verstehe ihre Worte nicht, aber ich verstehe den Ernst und die Dringlichkeit ihres Tons. Ich rufe nach meiner Mutter, die ich liebe wie sonst niemanden auf der Welt, ihre Umarmung, ihr Lächeln, ihre Haut, ihren Geruch, dann denke ich an den Vater, wie er uns bei unseren Umarmungen und Liebkosungen unterbricht, sei es mit Worten, sei es mit Blicken, ich verstehe noch nicht, daß ihm dazu jedes Recht als mein Vater und ihr Gatte zusteht, und frage mich, ob er womöglich Anteil hat an dem, was die Amme mir mitzuteilen versucht.
Als sie spürt, daß ich noch zu jung bin, um zu begreifen, führt sie mich zu ihm, dem Vater, der mich steif und wortlos umarmt. Ich beginne zu weinen und nach meiner Mutter zu rufen, damit sie selbst mir erkläre, was geschehen sei, und mich tröstend in den Arm nehme.
Am nächsten Tag sehe ich den schwarz ausgeschlagenen Sarg und begreife immer noch nicht. Der Vater schickt uns zurück zum heimatlichen Gute, er will seine Frau nicht in der Fremde begraben, aber ihn selbst hält noch die Pflicht jenseits der Grenzen fest, so daß die Trauerfeier für meine Mutter erst Monate nach ihrem Tod stattfinden kann und ich mich kaum noch entsinne, um wen wir da trauern. Es ist auf jeden Fall nicht die abwesende Mutter, auf deren Rückkehr ich immer noch warte, auch wenn ihr Bild langsam verblaßt. Sie war nicht schön, aber ihre Züge waren sanft und ihre Haut rein und weiß. Ihr Haar war dunkelbraun und ihre Gestalt schlank, ja für den Geschmack der Zeit gar hager. Ihre Haltung löste eher Anteilnahme denn Ehrerbietung aus. Aber ihre Lebenszeit war zu kurz, als daß sie schon mit Geistesgaben oder Weltgewandtheit hätte glänzen können. Alle, die sie kannten, priesen indes ihr großmütiges und mildreiches Herz. Sie liebte die Musik, ohne sich allzu sehr mit ihr befaßt zu haben. Nur von ihr kann ich meine Neigung zu den Schönen Künsten ererbt haben, denn meinem Vater liegt nichts ferner als Flötenspiel und Poesie. – Manchmal, wenn eine gewisse Mischung aus frischer Milch und einer besonderen Art von harzigem Holze mir in die Nase steigt, erinnere ich mich an ihren Geruch, und dann steht sie einen Augenblick lang wieder ganz lebendig vor mir.
Bevor ich mich zum Gutshof wende, gehe ich zur kleinen Kirche. Als ich geboren werde, ist der schlichte Backsteinbau bereits fünfhundert Jahre alt. Er steht in etwa so lange fest auf dieser kargen Erde, wie unser Geschlecht derer von Katte hier im Jerichower Land ansässig ist. Die Kassettendecke hat mein Großvater anläßlich seiner Eheschließung mit meiner Großmutter, einer geborenen von Witzleben, von einem flämischen Meister ausmalen lassen. Das Hauptbild zeigt Vater und Sohn zusammen, entspannt in den Lehnstühlen des himmlischen Salons. Sie reden nicht miteinander, beide halten den Blick gesenkt und jeder scheint in Gedanken ganz bei sich. Sind sie einander überhaupt zugeneigt? Die Taube, die über ihnen schwebt, Sinnbild des Heiligen Geistes, scheint sie mit ihrem sonnenhellen Feuer eher zu trennen als zu vereinen, zwei schwermütige Grübler, der Vater müde, der Sohn verzweifelt.
Auch die Kanzel stammt aus jener Zeit. Sie ist aus Eschenholz und mit Blattgold überzogen. Vier Engelsköpfe zieren sie, und mit Goldschrift sind auf blauem Grund vier Bibelverse aufgemalt. Wie oft habe ich sie als Knabe in den ewig währenden Gottesdiensten Buchstabe für Buchstabe entziffert, ohne daß sie mich je getröstet hätten:
Euch aber / die ir meinen Namen fürchtet / sol auffgehen die Sonn der Gerechtigkeit / und Heil unter desselbigen Flügeln.
Maleachi IIII
Mein Kind / Vergiss meins Gesetzes nicht / und dein Hertz behalte meine Gebot.
Die Sprüche Salomo III
Wie lieblich sind deine Wohnunge / HERR Zebaoth / Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Vorhöfen des HERRN.
Der Psalter LXXXIIII
HERR sey mir gnedig / heile meine Seele / Denn ich habe an dir gesündiget.
Der Psalter XLI
Dort, nur hundert Schritte von unserem Gut entfernt, hat der Vater ihr ein eigenes Haus gebaut, direkt hinter dem Kirchlein, Mauer an Mauer mit ihr, ein schlichter, rechteckiger Ziegelbau, fast zu groß für den einsamen Steinsarg, der darin steht. Ich kann mir meine Mutter in dieser steinernen Umarmung nicht vorstellen. Wenn ich die Gruft betrete, denke ich an nichts. Es riecht nach Stein und Erde in diesem Haus, nicht nach irgend etwas Lebendigem oder Totem. Und es herrscht noch viel Leere darin, Platz für die ganze Familie. Wer wird der nächste sein, der dem Sarg der Mutter Gesellschaft leistet? Der Vater wohl, der Älteste, und dann vielleicht die neue Frau, Tante Katharina, eher Schwester mir als Stiefmutter.
Obwohl ich nichts empfinde, suche ich diesen Ort auf, wann immer ich in Wust bin. Als Kind habe ich die Gruft eher gemieden. Weiß ich heute mehr vom Tod? Haben diese Besuche mit meinem Eintritt ins Regiment Gens d’armes zu tun? Nein, es bedarf keiner zukünftigen Schlachten, den Tod als meinen Bruder zu betrachten. Nur gewöhnliche Leute neigen dazu, sich selbst als Universum oder zumindest als sein Zentrum anzusehen. Doch mein Bruder sagt mir, das alles sei nur Theater, trete in die Kulissen und schau dir die Acteure an: Sie sind nicht die Welt, allenfalls sind sie in der Welt, kleine Statisten im Großen Welttheater. Am Rande zu stehen bedeutet keinen Verlust, sondern einen Gewinn an Einsicht. Wer im Mittelpunkt zu stehen glaubt, kann das Theater nicht durchschauen!
Ich kenne den Kirchturm, wie auch mein Vaterhaus, nur zerschossen von den Schwedischen Truppen im Dreißigjährigen Krieg. Jetzt erst sehe ich zum ersten Mal den neuen Turm aus Fachwerk mit einem Dache aus Schiefer und einem Schwerte in Form eines Kreuzes auf seiner Spitze. Die Wetterfahne zeigt eine Katze, das Wappentier unserer Familie.
Der Turm ist erneuert, doch nun steht das Herrenhaus in Bohlenrüstung da. Vater will es nicht nur instandsetzen, sondern auch durch zwei Seitenflügel erweitern. Wenn man von einer längeren Reise zurückkehrt, wirken das Dorf und das Gut, selbst in den Augen eines Kindes, äußerst bescheiden, ja ärmlich. Das Herrenhaus ist nur einstöckig und in Holzfachwerk errichtet. Jeder äußere Schmuck fehlt. Und selbst der nun geplante Neubau wird zwar größer und solider, aber nicht schmuckreicher ausfallen.
Als ich, das Pferd am Zügel, den kurzen Weg von der Kirche zum Gutshaus zu Fuß zurücklege, steht bereits Sigmund Patzer, der Gutsverwalter, in verschossener Livree am Portal, um mir den Gaul abzunehmen und ihn Eugen, dem Pferdeknecht, zu übergeben. Während er mich, den Gepflogenheiten der Gegend entsprechend, ohne jeden Überschwang und eher maulfaul, wenn nicht gar mürrisch begrüßt, humpelt unser alter Hühnerhund mit dem ehemals braunen, doch während meiner langen Abwesenheit inzwischen ergrauten Felle mir mit größter ihm noch möglicher Wiedersehensfreude entgegen, denn sogleich erkennt er in dem wohl nun erwachsenen Manne den ehemaligen jungen Spielkameraden wieder.
Durch die Haustür trete ich in die große, kühle Diele, von der eine Treppe zum Dachboden und den Giebelzimmern aufsteigt. Sonst ist die mit abgetretenen Ziegelsteinen gepflasterte Eingangshalle leer.
Eine Tür neben der Treppe führt in die Küche und die Dienstbotenzimmer, eine andere rechter Hand in die Gesellschaftsräume, die ich als Kind aber nur selten und stets mit großer Scheu zu betreten wage. Aber sie werden auch nur selten geöffnet, zum Geburtstage meines Vaters oder bei einem Besuche meines Großvaters versammelt sich die Familie dann ausnahmsweise dort zum Mittag- oder Abendessen. Zuerst kommt ein größerer Saal, der durch die ganze Tiefe des Hauses geht. Die Wände sind im Stil der Zeit mit Holzwerk bekleidet, weiß lackiert und mit wenigen goldenen Verzierungen versehen, ebenso die Möbel. In den freien Feldern des Holzwerks ist roter chinesischer Seidendamast eingelassen, und von demselben Stoff sind Vorhänge und Polster.
Hinter diesem Saale befindet sich die Bibliothek, die einmal auf hohen Bücherregalen aufgestellt war. Auch hingen hier alte Familienportraits. Da im Raume aber nur notdürftig und unzureichend die Kriegsschäden behoben worden sind, befinden sich Bücher und Gemälde dort seit Jahrzehnten in Kisten verpackt.
Im Herrenhaus gibt es noch ein anderes Zimmer, das ich nur selten und nicht ohne Ehrfurcht betrete, das Wohn- und Arbeitszimmer meines Vaters. Auch jetzt spüre ich eine gewisse Scheu, obgleich mein Vater doch gerade viele Meilen weit fort in Berlin weilt und ich gegenwärtig der alleinige Herr auf Wust bin. Neben der Eingangstür stehen ein Tisch und mehrere Stühle mit hohen Lehnen, dann folgt der mächtige Kachelofen, vor dem die zwei Jagdhunde zu liegen pflegen, denen mein Vater, im Gegensatze zu uns Kindern, beständig Zugang zu seiner Stube gewährt.
An der zweiten Wand steht meines alten Herrn Schreibschrank, kunstvoll mit verschiedenen Holzmustern ausgelegt. Auf demselben tickt die Uhr unter einem hölzernen Sturz mit Glasscheiben. Zu beiden Seiten des Gehäuses befinden sich vortrefflich ins Holz geschnitzte Figuren, linker Hand die Zeit, ein Greis mit einer Sense, rechter Hand eine weibliche Gestalt, die einem Genius ein aufgeschlagenes Buch zeigt, das auf ihrem Schoße ruht und vielleicht die Geschichte vorstellt, und auf der Uhr zwei Kindergestalten, die sich eng umschlingen. Das Gehäuse ist weiß, die Figuren glänzen in mattem Gold. Von dieser Uhr geht ein geheimnisvoller Zauber aus, der mich als Kind allen Verboten zum Trotze immer wieder in dieses Zimmer lockte.
Dann gibt es noch ein Sofa und in den beiden Fenstern der letzten Wand Stühle, zwischen ihnen eine hohe Kommode, darüber der Spiegel mit vergoldetem Rahmen. Hier schreibt und liest und ruht mein Vater, wenn er auf Wust weilt, hier empfängt er den privaten Besuch, hier sucht er Zuflucht vor den häuslichen und familiären Angelegenheiten, die sich vor allem in der großen Küche abspielen.
Alles atmet, obwohl er abwesend ist, seine Gegenwart. Mag er auch ein eher kleiner, zerbrechlich wirkender Mann sein – ohne Uniform und Degen würde ihn niemand für einen Offizier oder auch nur für einen Gutsherrn halten –, so liegt in seinem Auftreten doch etwas Achtunggebietendes und Einschüchterndes.
Wir Söhne müssen ihn mit »Sie« anreden. Er allein führt die Unterhaltung, unangesprochen darf niemand das Wort an ihn richten. Alles Flüstern oder gar Lachen ist uns streng untersagt. Deswegen sind wir nicht unglücklich, wenn er gewöhnlich allein in seinem Wohnzimmer speist.
Es ist still, nur das Ticken der Uhr und mein Atem erfüllen das Zimmer, und doch höre ich seine Stimme, leise, ein wenig schnarrend. Er spricht ein Gemisch aus Platt- und Hochdeutsch und eher schlecht als recht Französisch, ganz anders als mein Großvater von Wartensleben in Berlin, der beide Sprachen glänzend beherrscht.
Die Dienerschaft redet mein Vater mit »du« an, für uns Kinder sind sie natürlich auch »du«, aber es ist ein anderes »du«, verbringen wir mit Käthe, unserer Köchin, mit der Küchenmagd Martha, dem Stallburschen Eugen oder dem Kutscher doch mehr Zeit als mit unserem Vater. Es ist ein »du« ohne jede Herablassung, ein »du« des Vertrauens, der Nähe und derselben Augenhöhe. – Ich verlasse dieses gespenstige Zimmer und gehe in die Küche, wo Käthe bereits mit der Zubereitung einer Willkommensmahlzeit beschäftigt ist. Sie umarmt und herzt mich mit Tränen in den Augen, wie es nur ihr allein unter allen Bediensteten erlaubt ist.
Nachdem sie sich wie üblich über meine Magerkeit und meine kränkliche Gesichtsfarbe ausgelassen hat, gehe ich hinaus. Im Hause ist es kälter als draußen in der frühen Aprilsonne.
Vor dem Gutsgebäude, zur Dorfstraße hin, liegt ein Ziergarten mit Blumenbeeten und Orangenbäumen, der nun aber von den Maurern und Zimmermännern zertrampelt ist. Wir Kinder durften ihn nicht betreten. Sollten wir es trotzdem wagen, bekamen wir es mit unserem alten und inzwischen verstorbenen Gärtner zu tun, der noch strenger als unser Vater auftrat, denn für jede Verwüstung hatte vor allem er Kopf und Rücken hinzuhalten. Wollten wir im Freien spielen, dann im hinteren Garten oder auf der Dorfstraße.
Wenn mir das Herrenhaus nach langer Abwesenheit schmucklos und bescheiden vorkommt, so tritt es doch geradezu bedeutend vor den anderen Häusern des Ortes hervor, die sich ärmlich entlang der Dorfstraße aufreihen, eher Katen als Häuser, sämtlich mit Stroh oder Rohr gedeckt. Kein Schornstein überragt das Dach, der Rauch aus den Herdstellen quillt einfach durch die Haustür oder unter dem Dache heraus, das krumm und schief jederzeit vom Einsturz bedroht scheint. Das Innere ist ebenso sehr vom Mangel an jedem Schmuck und jeder Annehmlichkeit bestimmt, ein roher Tisch, ein paar Schemel, höchstens ein Armstuhl am nackten Backsteinofen. In der Schlafkammer eine Bettstelle und die Truhe. In der Küche der gewaltige Herd, ohne Schornstein, an den eisernen Haken der kupferne Kessel, alles geschwärzt vom ständigen Rauch.
Außen werden die ärmlichen Hütten von Obstbäumen beschattet, auf denen hier und da ein Storchennest sitzt. Hinter den Gehöften liegt ein kleiner Garten für Gemüse und mit einigen Beerensträuchern, dann folgt eine kleine Wiese, auf der oft kräftige, breitwipflige Eichen wachsen.
Nur die alte Kirche aus rotem Stein und unser Gutshaus mit seinem steilen Ziegeldache ragen über die Schilfdächer des Dorfes hinaus. Trotzdem ist das Dorf eines der größten der Umgebung, auch wenn nur eine sandige Landstraße dorthin führt, über die sich die wenigen Kutschen mühevoll und langsam quälen.
Im hinteren Garten, jenseits der Obstbäume, befindet sich das Lusthaus. Obgleich es uns wie der Ziergarten verboten ist und wir nur durch die Spalten der geschlossenen Läden hineinlugen können, löst es in uns verwirrende Gedanken aus. Dabei dient es doch, obwohl es zu anderen Zwecken errichtet wurde, seit langem nur noch der Aufbewahrung von Gartengeräten.