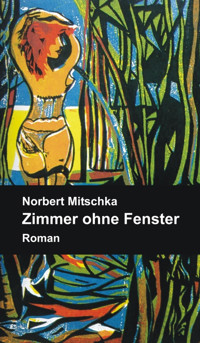
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Journalist Robert Heller befindet sich auf einer Dienstreise, um die Geschichte eines Justizverbrechens zu recherchieren. Nach Hause zurückgekehrt, erfährt er vom Tod Katrinas, der Frau, die seinem unsteten Leben Halt gegeben hat. Katrina hinterlässt Heller einen Brief, in dem sie ihm ein Geheimnis aus ihrer brasilianischen Heimat anvertraut. Sie bittet ihn, nach den Spuren ihres ehemaligen Lebensgefährten, eines berühmten Malers und dessen Hinterlassenschaft zu forschen. Doch das wahre Geheimnis verschweigt sie ihm Heller macht sich auf eine abenteuerliche und lebensbedrohliche Reise, doch schon bald stellt sich heraus, dass der von Xavanté hinterlassene Kunstschatz millionenschwer ist und einstweilen unauffindbar. In Rio de Janeiro bekommt er einen Vorgeschmack dessen, vorauf er sich eingelassen hat: er wird ausgeraubt, verliebt sich in eine junge Frau, die er aber in der Metropole schnell aus den Augen verliert und lässt sich in seiner Not mit einem Ganoven ein, ohne die Regeln auf der anderen Seite des Gesetzes zu beherrschen. Schnell gerät er immer tiefer in einen Sumpf aus Verbrechen und Leidenschaft ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Norbert Mitschka
Zimmer ohne Fenster
Abenteuer- und Kriminalroman, gewürzt mit einer Prise brasilianischer Erotik, getragen von dem Spannungsbogen zwischen zwei Kulturen: Deutschland und Brasilien.
Der Held begibt sich auf ein unbekanntes, gefährliches Terrain und wird — gewissermaßen aus brasilianisch-heißblütigem Hinterhalt — vom Leben überfallen, seiner Welt und seiner Existenz beraubt.
Copyright: © 2014 Norbert Mitschka
Titelbild:
Hansen Bahia: „Dimensóes“, Katalog Mulheres
Umschlaggestaltung & Satz:
Sabine Abels - www.e-book-erstellung.de
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Ist alles eins,
Was liegt daran,
Der hat sein Glück,
Der seinen Wahn,
Was liegt daran!
Ist alles eins,
Der fand sein Glück!
Und ich fand keins.
Jakob Haringer
Norbert Mitschka, geboren in Breslau, wuchs in verschiedenen Städten auf. Er studierte in Frankfurt Literatur-, Theater-, Film- u. Fernsehwissenschaft und Sozialpsychologie. Danach arbeitete er viele Jahre als Redakteur für einen Fernsehsender. Ab den 90er-Jahren ist er freier Journalist und Filmautor Durch zahlreiche Recherche- und Drehreisen, u.a. nach Brasilien, hat er das riesige Land und seine Menschen bestens kennen gelernt. Parallel zu seiner Filmarbeit wendete er sich der Schriftstellerei zu. So gab eine Filmarbeit in Brasilien Anstoß zu diesem, seinem ersten Roman.
Vorbemerkung
Oh Brasil! Diese Proklamation könnte erstmalig vor mehr als einem halben Jahrtausend zu hören gewesen sein, als der Entdecker Brasiliens, Pedro Alvares Cabral, an einem Apriltag im Jahre 1500 den namenlosen und unbekannten Kontinent, zufällig mit seiner portugiesischen Flotte erreichte. Und wie der Schriftsteller Stefan Zweig, der 1936 Brasilien bereiste, mag ein weiterer Portugiese, Amerigo Vespucci, der ein Jahr nach Cabral das Land voller Papageien, unberührter Natur und nackter Eingeborener betrat, in Begeisterung ausgerufen haben: „Wenn irgendwo auf Erden das irdische Paradies existiert, so kann es nicht weit von hier gelegen sein!“
In der über vier Jahrhunderte dauernden Kolonialzeit unter portugiesischer Krone, mit Sklavenhandel, Revolten und Bürgerkrieg, erlebten die Brasilianer tief greifende Veränderungen. Mit Abschaffung der Monarchie und Gründung der ersten Republik im Jahr 1891, erlebte das Land nochmals einen blutigen Bürgerkrieg, der als Schande und Versagen aller politischen Kräfte in die brasilianische Geschichte eingegangen ist.
Ein selbsternannter Messias und Wanderprediger, dem der Zugang in die offizielle Kirchenwelt versagt bleibt, zieht mit den Ärmsten der Armen, Rat gebend, durch das von Armut und Hungersnöten betroffene Ödland. Mehr und mehr aus der Gesellschaft Ausgestoßene schließen sich diesem seltsamen Messias an. Im kargen glühend heißen Hinterland Brasiliens, im unfruchtbaren Sertáo, gründet die immer größer werdende Schar Ausgestoßener unter der Anleitung des so genannten ‚Ratgebers’ eine Siedlung mit dem Namen Canudos. Um den wahren Glauben gegen den Antichristen zu verteidigen, den sie im Republikaner vermuten, entwickelt sich Canudos zugleich als ein Bollwerk gegen alles republikanische, in dem sie den Antichristen sehen.
Die neue republikanische Regierung, weitab von der selbst geschaffenen Welt der christlichen Fundamentalisten, machte kurzen Prozess mit den wehrbereiten, aber unzureichend bewaffneten Anhängern; man entschloss sich, die religiöse Sonderbündelei mit einer robusten Militärmaßnahme aus der Welt zu schaffen.
In vier militärischen Expeditionen in die Höllenglut des Sertáo, zuletzt mit Kruppkanonen und Dynamitgranaten bestückt, wurde die Siedlung Canudos mit fast dreißigtausend Menschen, überwiegend ausgemergelte Gestalten, dem Erdboden gleich gemacht.
„Und da war auch der atemberaubende Gestank, der ihnen den Magen umdrehte. ‚Aber erst, als sie den graubraunen, steinigen Hang bei Poco Trabubú hinuntergingen und ihnen zu Füßen lag, was nun aufgehört hatte, Canudos zu sein, und nur noch das war, was sie sahen, begriffen sie, dass dieses Rauschen das Flügelschlagen und die Schnabelhiebe Tausender von Aasgeiern waren, eines endlosen Meeres grauer, schwarzer, schlingender, übersättigter Wellen, das alles zudeckte und zugleich, während es sich sättigte, Zeugnis ablegte von allem, was noch nicht hatte pulverisiert werden können vom Dynamit, von Kugeln, von Bränden: all diese Körperteile, Gliedmaßen, Köpfe, Wirbelsäulen,, Gedärme, Häute, die das Feuer verschont oder nur halb verkohlt hatte und die nun von den gierigen Vögeln weichgehackt, zerstückelt, geschluckt und verschlungen wurden.“
Vargas Llosa, Der Krieg am Ende der Welt
Der unbegreifliche Vernichtungsfeldzug gegen ein Völkchen in die Irre geführter Fundamentalisten, obschon vor einem guten Jahrhundert geschehen, wird bis heute in der brasilianischen Gesellschaft mit Theaterstücken, Symposien und Gottesdiensten abgearbeitet.
Das Brasilien, in das der Protagonist des Romans Robert Heller erstmals 1990 seinen Fuß setzt, hat gerade eine fast dreißig Jahre andauernde Militärdiktatur hinter sich gelassen. Brasilien hat erneut einen demokratisch gewählten Präsidenten, was für den Spurensucher Robert Heller kaum von Bedeutung sein wird. Das Zusammenprallen zweier Kulturen indes, sollte ihm nicht erspart bleiben. Wie jeder Brasilien bereisende wird er, wie Stefan Zweig, zunächst einmal begeistert sein von der Fülle an neuen Eindrücken, die den Besucher, ob an der Copacabana oder an den scheinbar unendlichen weißen Stränden Bahias, erwarten. Wenn Heller schließlich den Nordosten Brasiliens erreicht, wo afrobrasilianischer Zauber ihn umfängt, wird er zu Ohren bekommen, dass Gott ein Afrikaner sei und man hört trotz aller Alltagssorgen ein unerschütterliches tudo bem!
Der Glanz und das Elend, hinter dem sich unverhofft ein Abgrund auftut, werden dem Helden der Geschichte indes nicht erspart bleiben.
Norbert Mitschka
1. Turbulenzen
Robert Heller sah von seinem Schreibtisch auf und lauschte; außer dem Rauschen der Klimaanlage und gedämpften Geräuschen von der Straße war nichts zu hören. Er spürte, wie das Blut in seinen Schläfen pulsierte, und obwohl es angenehm kühl war in seinem Hotelzimmer, begann er zu schwitzen.
Man kann weder unverwandt in die Sonne schauen noch in den Tod. Der Satz ging ihm einfach nicht mehr aus dem Sinn. Warum zum Teufel verfolgte ihn dieser Gedanke wie ein drohender Schatten? Als säßen ihm die ungleichen Komplizen Sonne und Tod im Nacken, sprang er von seinem Stuhl auf, trat so nah an das Fenster, dass seine Nasenspitze die Scheibe berührte. Er starrte hinaus, als hoffte er, dort die Ursache seiner quälenden Einflüsterungen zu finden. Auf dem Roxas Boulevard wälzte sich träge der Verkehrsstrom. Ein Mann ohne Beine ruderte unter flirrendem Hitzeschild auf einem Rollbrett zwischen unzähligen Stoßstangen umher. Beklommen ließ Heller seinen Blick über ein ausgetrocknetes, absterbendes Rasenstück hinauf in das tiefe Blau des Himmels schweifen, als könne er dort oben Erhellendes entdecken. Er wandte sich ab, und eine heraufdämmernde Ahnung zeichnete sich auf seinem Gesicht ab. Er ging ins Bad, drückte sich flüchtig ein Handtuch aufs Gesicht, betrachtete sein Spiegelbild, versuchte es anzulächeln, doch es war nicht mehr als ein mattes Zucken um den Mund. Sonne und Tod! Sonne und Tod!
Heller nahm sich aus der Minibar eine Dose Mangosaft, kehrte zu seinem mit Papieren und Büchern überfrachteten Schreibtisch zurück, zog den Stuhl heran und versuchte, sich wieder auf seine Arbeit zu konzentrieren: ein Drehbuch für eine Fernsehdokumentation über ein verabscheuungswürdiges Justizverbrechen. Er ordnete einen Stapel beschriebener Blätter, nahm den Füller zur Hand und ging seine Story erneut Satz für Satz durch.
Der Morgen graute, am Horizont kündigte ein zarter Schleier von Rot und Violett den Tag an, als eine herausgeputzte Gesellschaft – es waren mehr als hundert Personen – sich um eine Hinrichtung zusammenfand, als handele es sich um die Eröffnung der Fiestas von Valencia. Einige riefen: Viva España!
Ein Arzt untersuchte gewissenhaft Puls und Blutdruck des Verurteilten. Dessen Gesicht war von der Kerkerhaft grau und eingefallen. Ein Soldat band dem Mann im dunklen Paletot ein schwarzes Tuch um die von Trauer und Schmerz erfüllten, aber immer noch glühenden Augen. Sein Wunsch, mit dem Gesicht Richtung aufgehende Sonne stehen zu dürfen, wurde erfüllt – die Gewehre des Exekutionskommandos zielten auf seinen Rücken: Es war sieben Uhr und drei Minuten, als eine Gewehrsalve krachte und der Mann auf der Stelle in sich zusammensackte; seine Hoffnung, im Sterben der Sonne entgegenzufallen, erfüllte sich nicht.
Die Presse, fügte Robert Heller mit königsblauer Tinte hinzu, war über die geistige Größe des Hingerichteten ungebührlich lautlos hinweggegangen. An den Rand des Textes notierte er: weitere Nachforschungen wegen des ungesühnten Justizverbrechens à la Volksgerichtshof. Das Schicksal des Freiheitskämpfers José Rizal mag einem ungerecht erscheinen, rekapitulierte er, es gehört dennoch unverbrüchlich zur Geschichte der Philippinen.
Von seinem Fenster aus konnte Heller die Turmspitze sehen, unter der sich die Hinrichtungsstätte befunden hatte. Das Unglück, trifft die meisten auf leisen Sohlen, dachte Heller mit dem vagen Gefühl, selbst einem Fiasko entgegenzugehen. Vergeblich hatte er in seinen Aufzeichnungen nach der Ursache seiner bedrohlichen Schatten gesucht.
Vom altehrwürdigen Manila Hotel aus hatte Heller einen freien Blick zum weitläufigen Park und zum Rizal-Monument, das sich, von einer Ehrengarde umstanden, vor der gewaltigen Festungsmauer erhob. Die Wachtürme schauten noch immer Furcht einflößend auf die Müßiggänger herab. Wochenlang war er durch Manila und die Hauptinsel Luzon gestreift, hatte mit Akribie die Spuren von José Rizal, Nationalheld und berühmtester Mann seines Landes, für seine Filmvorlage verfolgt: José Rizal, Doktor der Medizin, Schriftsteller und Revolutionär, war mit vierunddreißig Jahren ermordet worden, weil er die verbrecherischen Taten katholischer Bruderorden entlarvt hatte. José Rizal hatte zum Ende einer Epoche beigetragen, in der im Namen Jesu Christi auch Mord und Totschlag ungestraft geschehen konnten. José Rizal, ein Zeitgenosse Gandhis, war ein Mann des geschriebenen Wortes gewesen, nicht der Gewalt.
Heller würde hervorheben, dass Rizal, beeindruckt vom europäischen Geist der Aufklärung, während eines längeren Aufenthaltes in Heidelberg den aufsehenerregenden Roman „Rühr mich nicht an“ geschrieben hatte. Er hatte sich dazu notiert: Das Buch traf seine Feinde empfindlicher als Gewehre und Kanonen, schnitt wie ein Skalpell in das eitrige Geschwür, als das der Autor die spanische Tyrannei in seiner philippinischen Heimat ansah. Für die Reportage hatte Heller sich eine sarkastische Titelzeile einfallen lassen: Ergreift den Dichter und tötet ihn – Amen!
Er sah die Szene schon vor sich: Ein Mestize niederer Herkunft steigt die Stufen der San-Augustin-Kirche in Manila hinauf und betritt den Beichtstuhl, um Rizal an seine Todfeinde, die ihrer Scheinheiligkeit entlarvten Mönche, zu verraten.
Da riss das Rasseln des Telefons, es war siebzehn Uhr, Heller aus seiner Arbeit. Die Augen noch auf seine Aufzeichnungen gerichtet, tastete er nach dem Hörer und hob ab.
„Ja, Heller!“
„Guten Morgen, Herr Kollege, sag mal, wo steckst du und was treibst du eigentlich, hast du meine Nachricht nicht bekommen?“, legte die Stimme im Stakkato los.
„Hallo Sandra, was ist los?“, unterbrach Heller den Wortschwall seiner Kollegin, mit der er sich ein Büro in Frankfurt teilte.
„Es geht um deine Bekannte, zuweilen spricht sie Portugiesisch – sie sucht dich ziemlich verzweifelt. Warte – wie heißt sie noch mal?“
„Katrina, das ist Katrina, die hab ich völlig vergessen.“ Heller fuhr sich durch die struppigen Haare. „Mist, so ein Mist“, redete er mit sich selbst und rieb sich den Nacken.
„Bist du noch dran?“
„Ja, ja, ich … entschuldige. Ich bringe das in Ordnung, ich bringe das gleich in Ordnung. Morgen haue ich sowieso hier ab, für meine Story habe ich alles – ich fliege morgen zurück.“
Für einen Moment sah er Katrinas Augen auf sich gerichtet; es war der Augenblick, als sie sich anschickte ihm etwas anzuvertrauen, das sein Leben untrennbar mit dem ihren verbinden sollte.
Er hatte Katrina über eine Anzeige kennengelernt, in der sie Portugiesischunterricht angeboten hatte. Sie war Brasilianerin und lebte damals, von ihrem deutschen Ehemann geschieden, seit einigen Jahren allein in Deutschland. Aus dem Lehrer-Schüler-Verhältnis hatte sich eine seltsame Beziehung entwickelt. In einer Art Seelenverwandtschaft waren sie innig miteinander verbunden; obgleich voller zärtlicher Gefühle füreinander, war nie die Intimität einer Liebesbeziehung entstanden. Heller hatte der Gedanke immer gefallen, dass ohne seine Zurückhaltung mehr möglich gewesen wäre.
Katrina litt an heftigen Depressionen, und wenn ein Schub kam, brauchte sie seine Hilfe. In äußerster Not, das wusste sie, konnte sie sich auf ihn verlassen. Wenn ihr die Decke ihrer auf den Kopf fiel und sie ihn anrief, holte er sie meist ab und sie gingen spazieren.
Heller erinnerte sich noch ziemlich genau an ihren letzten Spaziergang. Es war kurz vor seiner Abreise. Sie wollte ihm ein Geheimnis aus ihrer Zeit in Brasilien anvertrauen. Sie sprach von einem sehr wichtigen Auftrag, den er für sie ausführen solle. Und er erinnerte sich, wie angespannt ihr Gesicht und wie bittend ihre Augen auf ihn gerichtet waren. Es ging um Xavanté, einen mysteriösen Künstler, mit dem sie offenbar ein Verhältnis gehabt hatte, und dessen Nachlass. Xavanté sei ein Pseudonym, seinen deutschen Familiennamen habe sie nie erfahren. Doch etwas schien plötzlich wie ein Gespenst hinter ihrer Stirn herumzugeistern. Sie brach das Gespräch ab und erklärte, dass sie ihm die ganze Geschichte verrate, wenn er von seiner Reise zurückgekehrt sei.
Hellers Hand lag noch immer auf dem Hörer; seine Blicke wanderten durch das Zimmer, über das gepflegte Rattanmobiliar, den taubenblauen Veloursteppich; an zwei Schwarz-Weiß-Fotos, die am Boden lagen, blieb sein Blick hängen: Das eine zeigte einen waffenstarrenden NPA-Kämpfer, das andere das verhungernde Kind eines Zuckerarbeiters, von dem er wusste, dass es gestorben war.
Er registrierte das alles, als sei er gerade aus einer Trance erwacht, als sei er an einem Ort, an dem er gar nicht sein wollte. Mechanisch nahm er sein Notizbuch, blätterte die Seiten durch. Ja, er hatte seinen Aufenthalt in Manila um etliche Tage überzogen und dabei einen festen Termin mit Katrina völlig übersehen. Das war jetzt schon eine Woche her.
Was hatte Sandra gesagt? Sie habe ihm eine Nachricht geschickt. Heller rannte zum Fahrstuhl, doch der hing irgendwo fest, und er nahm die Treppe. An der Rezeption hing eine Traube von Menschen, und Heller drängelte sich durch.
„Excuse me, there must be a message for me, have a look, please!“
Der Portier entdeckte tatsächlich eine Mitteilung für Heller, sie war aus Versehen im falschen Fach gelandet und bereits zwei Tage alt.
„Hallo Robert, ich habe schlechte Nachrichten. Deine Bekannte, Katrina, hat sich x-mal bei mir gemeldet. Sie machte einen verzweifelten – einen sehr verzweifelten Eindruck. Sie sagte etwas, worauf ich mir keinen Reim machen kann: Vergiss Bahia nicht! Also pack deine Koffer und mach dich auf den Weg. Sandra.“
Vergiss Bahia nicht!
Heller lief vor seinem Schreibtisch auf und ab, auf dem sich die Bücher für seine Recherche stapelten. Beinahe vorwurfsvoll betrachtete er das großformatige, handgeschriebene Exemplar „Noli me tangere“ von Rizal, das aufgeschlagen wie eine Bibel vor ihm lag, und klappte es entschlossen zu, als könne er mit der Geste etwas rückgängig machen, könne für sein Versäumnis Abbitte leisten.
Er erinnerte sich an einen Besuch bei Katrina, als er sich angeschickt hatte aufzubrechen und sich verabschiedete; sie hielt ihn an der Tür mit aller Kraft fest, und er sah die Angst in ihren Augen, Angst, allein in ihrer Wohnung zu bleiben. Ein andermal hatte sie gedroht, vom Balkon zu springen.
Egal was du ihr vorlügst, du musst sofort anrufen, dachte Heller. Jetzt, auf der Stelle. Nach dem dritten Rufzeichen schaltete sich ihr Anrufbeantworter ein, und als er ihre warme, rauchige Stimme vom Band hörte, klopfte sein Herz, als habe man ihn bei einer unverzeihlichen Sünde ertappt. „… por favor deixe um recado depois do siñal.“
„Hallo Katrina, schön, deine Stimme zu hören, wenn du zu Haus bist, bitte nimm ab. Geht’s dir gut? Ich weiß, ich hab dich verdammt lange warten lassen, muito desculpa. Also dann, ich versuche es später noch mal – ciao.“
Sicher war sie zu Hause und nahm nicht ab, weil sie wütend auf ihn war. Er kannte das. Beunruhigt fuhr sich Heller durch die zerzausten Haare. So lässig, wie er sich kleidete, Jeans, weißes bequemes Hemd und offener Kragen, so ungezwungen gestaltete er auch meist seine Amouren. Hellers jungenhafte Erscheinung ließ auf den ersten Blick nicht erkennen, dass er jenseits der vierzig war, und auch nicht, dass er unterdessen mit seinem ungebundenen Singleleben haderte. Zweisamkeit, hatte er gehört, sei erstrebenswert für Geist und Körper und für die Gesundheit. Um die Abkehr von seinen Eskapaden nicht aus den Augen zu verlieren, schrieb er sie als Vorsatz, als eine Art wiederkehrenden Psalm zwischen seine täglichen Notizen.
In diesem Moment aber dachte er nur an Katrina. Sie war die beste Freundin, ohne die er sich sein umtriebiges Leben nicht vorstellen konnte. Sonne und Tod! Sonne und Tod!
Heller machte sich daran, die Bücher und einige Devotionalien, die er als Filmrequisiten besorgt hatte, einzupacken. Sie füllten eine ganze Reisetasche.
Wie wichtig ihm Katrina war, schien er ausgerechnet jetzt zu begreifen, jetzt, da er beinahe zwanzig Flugstunden von ihr entfernt war. Heller sah alle Telefonnummern von Leuten durch, die nach Katrina schauen könnten. Aber die, denen er sich anvertrauen konnte, waren nicht zu erreichen. Er rief Katrina immer wieder an, vergeblich.
Es war Abend geworden. Er war ohne Ziel die nahe Manila-Bay entlanggeschlendert und in eine der Seitenstraßen eingebogen, die nach Ermita, in Manilas Nachtleben führte. Er zog von Bar zu Bar, versuchte mit Bier und Tandoney-Rum seine Unruhe zu betäuben. Als er dem müden, routinierten Tanz der Gogo-Girls nicht mehr zusehen mochte und sich auch Nenas „Neunundneunzig Luftballons“ in seinen Ohren stauten, kehrte er ins Hotel zurück. Es war nach Mitternacht, als er Katrinas Nummer abermals anwählte, er vernahm schon das Knacken des Hörers, den Klang ihrer rauchig warmen Stimme. Doch da war nichts. Er lief zur Rezeption hinunter und schickte ein Blitztelegramm.
„hallo Katrina, warum versteckst du dich / ich hätte mich früher melden sollen, aber in dieser verdammten hitze, da tickt alles ein bisschen anders, desculpa / übrigens, ich bin gespannt, ob du mir den rest deines bahia-geheimnisses verrätst / und jetzt bitte calma meu amor / in einigen stunden bin ich zurück / um beijo robert.“
Im Flughafen herrschte chaotisches Gedränge, einige Flüge hatten Verspätung. Die Klimaanlage war ausgefallen, und die Ausdünstungen der Fluggäste verwandelten die Wartehalle in ein Treibhaus. Die Menschen starrten durch die blinden Scheiben, an denen die kondensierte Feuchtigkeit in Rinnsalen herunterlief. Heller war froh, als sein Flug aufgerufen wurde. Als er das Flugticket aus der Brieftasche nahm, fiel sein Blick auf ein Foto, das er seit Jahren bei sich trug. Es musste ein glücklicher Moment gewesen sein, Katrina strahlt ihn an, während sie ihn mit aller Kraft umarmte. Sie gab ihm stets gute Wünsche mit auf die Reise und rief ihm „Cuidado!“ hinterher. Ja, er sollte auf sich aufpassen und sie nie vergessen. Heller biss sich auf die Lippen.
Obwohl inzwischen ein Unwetter über der Manila-Bay aufgezogen war, rollte die voll besetzte Boeing 747 nach Frankfurt planmäßig zu ihrer Startposition. Regen peitschte gegen die Kabinenfenster, nur die gelben Markierungsleuchten waren zu sehen, zerliefen in Rinnsalen auf der Fensterfläche ins Nichts. Die Triebwerke sirrten schrill, eine schier endlose Startphase, dann hörte das harte Schlagen des Fahrwerks auf. Mit einem heftigen Zittern, als ob er die Last verweigere, hob der Jet endlich ab. Heller starrte durch das Kabinenfenster, die Reihe der Orientierungslichter riss ab. Es war Nachmittag, aber draußen schien es Nacht zu sein. Ein Blitz traf die Tragfläche, es war, als fahre eine riesige Kralle über das Metall, immer wieder warf eine Bö die Maschine wie ein Blatt im Wind hin und her, sie sackte ab und wurde von einer Faust wieder nach oben gedrückt. Sein Nachbar hatte die Augen geschlossen, als wünsche er keine Unterhaltung. Heller schaute auf die andere Seite, in stumme, unbewegte Gesichter. Ausgeliefert, dachte er, der verrinnenden Zeit ausgeliefert. Zwei Reihen vor ihm, auf einem Klappsitz vor dem Notausgang saß eine der Stewardessen. Sie hatte nach buddhistischem Ritual demutsvoll ihre Hände aneinandergelegt, als befände sie sich im Gebet, und sie lächelte. Sicherlich bittet sie Buddha um einen guten Flug, dachte Heller. Er ließ seine Blicke durch die schaukelnde Kabine wandern, an der Leuchtschrift Emergency Exit blieb er hängen; für einen Moment glaubte er, es gehöre zu einem Bild, das er längst vergessen hatte. Er war am Morgen in Schweiß gebadet aufgewacht und glaubte, ins Bodenlose zu stürzen. Er hatte geträumt, er schwebe in einem gähnend leeren Raum, mit weit geöffneten Fenstern durch das Universum und werde von einem erbarmungslosen Sog hinausgezogen. Er zog seinen Gurt fester.
Sandras alarmierende Nachricht wegen Katrina, dachte er, war nun schon drei Tage alt. Katrina war nicht sein Leben, aber sie gehörte dazu – wie zur Balance des Glücks. Heller spürte einen Stich im Magen, als er daran dachte, dass sie – seine gute Fee – mit einem Mal nicht mehr da sein könnte. Sie, die immer tröstend zur Stelle war, wenn er sich in seiner Rolle als Prinz auf der Suche nach einer Prinzessin geirrt hatte.
Dong, dong, dong, dong! Ein Passagier betätigte unablässig die Ruftaste in seiner Armlehne, es nervte. Über dem Kopf der Stewardess leuchtete das Telefon auf, mit einem Ratsch zog sie den Hörer aus der Wandhalterung. Hellers Herz schlug, er wollte aufspringen und sie um das Telefon bitten; in der ersten Klasse musste es möglich sein. Er wollte mit Katrina reden, jetzt und keinen Moment später.
2. Katrinas Vermächtnis
Erschöpft landete Heller am frühen Morgen in Frankfurt und fuhr auf dem schnellsten Weg nach Hause. Ohne nach der Post und sonstigen Dingen zu schauen, duschte er schnell, zog sich frisch an und machte sich auf den Weg zu Katrina. Aus dem Gepäck nahm er einen Seestern, den sie sich gewünscht hatte, weil er Glück bringen sollte. Unterwegs kaufte er einen Strauß Feldblumen, die sie liebte.
Während er sich dem Haus bis auf einige Schritte näherte und an der grauweißen Mauer hinaufsah, bemerkte er, dass das Fenster neben dem Balkon gekippt war wie immer, wenn sie zu Hause war. Er glaubte, dass die Gardine sich bewegt hatte, und verharrte einen Augenblick. Seit sie, aus dem Kreis ihres wohlhabenden Familienclans verstoßen, mittellos und auf eine Sozialwohnung angewiesen war, ging sie kaum noch aus dem Haus. Eine Ausnahme waren ihre Spaziergänge mit ihm. Als er das letzte Mal bei ihr geklingelt hatte, war sie auf dem Balkon erschienen und hatte hinunter gerufen „Bleib unten, wir laufen etwas, ich brauche frische Luft – und außerdem – ich muss dir was erzählen. Es ist wichtig. Tudo bem?“ Mit lauten, klackenden Schritten rannte Katrina die Treppen hinunter, zog die Tür hinter sich zu und folgte Hellers Blick, der auf die Fenster der Nachbarn gerichtet war.
„Ich bin die Einzige in diesem Haus, die lüftet“, sagte sie leise. „Wenn ich Besuch bekomme, spüre ich ihre Ohren an den dünnen Wänden. Ich ersticke noch mal in diesem Haus. Eine Hütte in Brasilien, selbst in einer Favela, wäre mir lieber.“ Und dann sagte sie wie immer „moço“, gab ihm einen Kuss links und einen rechts, ergriff seinen Arm und lachte. „Vamos“, flüsterte sie und zog ihn weg.
Heller ging die letzten Schritte auf den gesichtslosen Zweckbau zu, entfernte das Papier des Blumenstraußes, atmete tief durch und klingelte zweimal kurz, wie ausgemacht. Auf dem Balkon erschien Katrina nicht, er klingelte noch mehrmals, ehe die Haustür geöffnet wurde.
Katrinas Wohnungstür im ersten Stock war eine Handbreit geöffnet, einen Moment lauschte er, es war still in der Wohnung. Langsam drückte er die Tür auf und betrat den Korridor. Aus dem Wohnzimmer kam ihm ein Mann entgegen, er mochte in seinem Alter sein. Heller glaubte, ihn schon einmal gesehen zu haben. Ein Liebhaber? Der Mann machte keine Anstalten, ihm die Hand zu geben. Am liebsten hätte Heller die Blumen hinter seinem Rücken versteckt, sein Gegenüber schien ebenso unsicher zu sein. „Guten Tag?“, sagte er in fragendem Ton.
„Guten Tag, ich bin Robert Heller, ich wollte eigentlich nur etwas abgeben.“ Er blickte zur Seite, auf dem Wohnzimmertisch stand eine Glaskanne mit Früchtetee, wie ihn Katrina täglich trank, neben dem Sofa ein Stapel Veja- und Manchete-Magazine, auf dem Fußboden das Radio, Zeitungen, alles war so wie immer. Er sah wieder zu dem Mann, der, eine schwarze Mappe in der Hand, ihn fragend ansah.
„Wo ist Katrina?“, fragte Heller. „Ich meine, wo ist Frau Schulte-Borges?“
„Ich muss Ihnen eine unangenehme Mitteilung machen“, der Mann blickte mit einem Ausdruck des Bedauerns auf seine Mappe. „Sie kommen zu spät.“
Heller stand da mit den Blumen und dem Seestern und überlegte, wie er die Äußerung verstehen sollte.
„Wieso zu spät?“, fragte er tonlos.
„Frau Schulte-Borges ist vor drei Tagen verstorben“, sagte der andere unbeteiligt. Er sei für das Sozialamt hier, um die Räumung der Wohnung vorzubereiten. Sofern Heller mit der Verstorbenen nicht verwandt sei noch einen rechtlichen Anspruch auf bestimmte Gegenstände habe, möge er die Wohnung bitte verlassen. Über die näheren Umstände ihres Todes, nein, darüber könne er nichts sagen.
Heller spürte, wie das Blut aus seinem Kopf wich, der Mann vor ihm schien zu verschwimmen, Katrina schien sich hinter ihm, wo sie immer saß, zu verbergen. Heller stand in der Nähe der Tür, fasste nach dem Rahmen, als suchte er einen Halt. Einen Moment standen sich beide Männer schweigend gegenüber. Heller hätte am liebsten einen Schluck von dem rot schillernden Früchtetee getrunken, seine Kehle war trocken. Er sah sich im Zimmer um. Vielleicht gab es einen Brief an ihn oder irgendeine Nachricht? Heller fragte danach, aber der Mann winkte unwillig ab. Er ging jetzt einen Schritt auf Heller zu, er müsse nun wieder an seine Arbeit, und ehe Heller sich versah, schloss sich die Tür hinter ihm. Als er im Erdgeschoss ankam, ging eine Wohnungstür auf, eine Nachbarin steckte ihren Kopf heraus. Heller kannte sie, er blieb einen Moment stehen. Die Frau sagte mit leiser Stimme, die Polizei habe erklärt, es sei wahrscheinlich Selbstmord gewesen. Man habe auf ihrem Nachttisch eine Menge Tabletten gefunden und den Rest einer Flasche Sekt. Heller nickte nur stumm. Er schenkte der Frau den Blumenstrauß und verließ das Haus.
Katrina würde nie wieder auf seine unzähligen Anrufe antworten.
Jetzt spürte Heller, wie sehr er sie geliebt hatte, und dass sein Verlangen, sie in die Arme zu nehmen, unerfüllt bleiben würde. Er dachte daran, wie sie zusammengesessen und Musik von Maria Bethânia gehört hatten, sie zwischendurch unruhig in der Wohnung herumgelaufen war. Katrina hüstelte andauernd, es war eher ein nervöses Räuspern, ihre Nase zuckte dabei auf und ab; ein Zeichen, dass etwas sie bewegte. Er hatte noch einmal versucht, etwas über den mysteriösen Nachforschungsauftrag in Brasilien zu erfahren, aber an jenem Tag war nichts mehr aus ihr herauszubringen. Dieser Auftrag war jetzt so etwas wie ein Vermächtnis, dachte er, und wenn er ihm Folge leistete, könnte er ihr noch ein wenig Liebe und Freundschaft über den Tod hinaus mitgeben.
Noch in Gedanken, was er mit Katrinas wenigen Hinweisen anfangen konnte, bemerkte Heller, dass er die falsche Richtung eingeschlagen hatte, er fuhr aus der Stadt hinaus, den Weg, den er das letzte Mal mit Katrina gefahren war. Plötzlich hatte er das Bedürfnis, mit jemandem zu reden. An der nächsten Telefonzelle stoppte er seinen Wagen und rief Sandra in ihrem gemeinsamen Büro an.
„Hallo Sandra. Ich bin wieder da, ich komme gerade von Katrinas Wohnung.“
„Ich hab’s schon vom Sozialamt erfahren – wenn ich gewusst hätte, dass …“
„Schon gut, mach dir keinen Vorwurf, es ist nur …“
Sandra räusperte sich.
„Katrina hat einen Brief für dich hinterlassen. Er lag unfrankiert in unserem Briefkasten.“
Einen Moment war es still in der Leitung.
„Können wir uns in irgendeinem Café treffen. Ich möchte jetzt nicht ins Büro kommen. Am besten gleich?“
„Kein Problem. Wir treffen uns unten am Rhein, gegenüber dem Kastell an der Brücke ist ein Bistro. Da haben wir Ruhe.“
Als Sandra eintraf, saß Heller schon dort. Er stand auf und umarmte sie, was er noch nie gemacht hatte. Sie setzten sich wortlos an den Tisch und Sandra gab ihm den Brief. Eine Weile saßen beide schweigend da, bis die Kellnerin an den Tisch kam, um die Bestellung aufzunehmen.
Heller öffnete den Umschlag vorsichtig, auf dem nur sein Name stand.
„Soll ich eine Weile spazieren gehen?“, sagte Sandra.
„Nein, nein“, erwiderte Heller, „es wäre mir lieber, wenn du bliebst.“ Heller entnahm dem Umschlag einen Brief und eine herausgerissene Seite aus einem brasilianischen Magazin.
Robert, mein Lieber –
es ist schade, sehr schade, dass Du jetzt nicht bei mir bist. Draußen ist ein schöner, sonniger Tag, aber in mir ist es finster, so finster, wie ich es noch nie empfunden habe und die Schatten, die alles so finster machen, wachsen aus meinem Herzen. So verloren hab ich mich noch nie gefühlt. Sicher liegt es daran, dass Du jetzt nicht da bist – aber da ist noch etwas anderes, das mir Angst macht, eine Angst, die ich nicht beschreiben kann.
Robert, mein Herz, ich mache Dir keine Vorwürfe, dass Du mich über Deiner Arbeit für den Moment vergessen hast, etwas treibt mich, wie soll ich es beschreiben. Die Zeit, meine Zeit, scheint mir wie Sand zwischen den Fingern durchzurieseln – und dann diese Leere, eine endlose Leere, darüber wird mir schwindelig. Vielleicht spürst Du meine Gedanken, ich wünsche mir, dass Du zurückkommst. Pronto!
Ich habe mir gerade etwas zusammengemixt (Chemie à la carte), damit meine Dämonen mich eine Weile in Ruhe lassen, um Dir diesen Brief zu schreiben. Moço, ich habe es Dir ja schon vor Deiner Reise gesagt, Du musst unbedingt nach Brasilien gehen, alles über Xavanté und was er hinterlassen hat herausfinden. Du musst Dich auch auf Überraschungen einstellen. Aber das bist Du ja gewöhnt von mir. Und Du musst es tun. Bitte. Du bist der Einzige, dem ich vertraue, Du bist ja ein Teil meiner Seele. Tudo bem. Ich werde Dir alles aufschreiben, was Du wissen musst. Ich weiß, ich habe um ‚mein Bahia‘ immer ein Geheimnis gemacht. In Brasilien wirst Du alles erfahren.
Bevor ich Karl Heinz, meinen Ehemann, kennenlernte und nach Deutschland ging, war ich mit Xavanté, einem deutschen Maler, zusammen, ich habe ihn wegen Karl Heinz aufgegeben. Und ich habe damals einen großen Fehler gemacht. Xavanté lernte ich in Salvador da Bahia kennen. Dort haben wir auch gelebt. Es war eine schöne Zeit mit ihm, damals, ich bewunderte seine Kunst. Seine ersten Arbeiten hatte er unter dem Pseudonym Gisbert Severin vorgestellt, später, in Brasilien, hatte er dann den indianischen Namen Taua Xavanté angenommen. Dass er ein Pseudonym annahm, hing mit Konflikten in seiner Familie zusammen. Mit einem neuen Namen wollte er einen Strich unter seine Vergangenheit ziehen, und so verließ er Familie und Heimat. Ich habe seinen richtigen Namen nie erfahren.
Robert, Du musst herausfinden, wo er zuletzt gelebt hat, bevor er starb, dort findest Du auch seinen Nachlass, einen umfangreichen Kunstschatz. Aber nicht nur das. Mich interessiert dabei etwas ganz anderes. Es bedrückt mich seit Jahren, und jeder Tag hat mir mehr den Mut genommen, mein Schweigen zu brechen. Mehr kann ich Dir auch in diesem Moment nicht sagen. Du wirst es erfahren, wenn es so weit ist.
Es könnte auch publizistisch in Deinem Interesse sein, den umfangreichen Gemäldenachlass zu finden. Wie ich erfahren habe, sind schon einige unberufene Geister hinter ihm her. Das ganze Oeuvre an Exponaten soll ein Vermögen wert sein. Du könntest dafür sorgen, dass alles in die richtigen Hände kommt. Was er geschaffen hat, war große Kunst. Du wirst es selbst herausfinden. Mit seinem ersten Bilderzyklus, ‚Arlekin mit Flügelschlag‘ und ‚Messias auf fliegendem Teppich‘ hat er sich in Südamerika, aber auch in Europa einen Namen gemacht. Robert, du bist Journalist, Du wirst eine Story wollen: Der berühmte Ethnograf Pierre Verger (lebt wahrscheinlich in Bahia) und Brasiliens berühmtester Schriftsteller Jorge Amado gehörten zu seinen Freunden und Bewunderern.
Du musst deine Nachforschungen bald aufnehmen und den unbefugten Geistern zuvorkommen – es muss verhindert werden, dass Xavanté und meine Zeit mit ihm auf die Straße gezerrt werden. (Das wirst Du verstehen, wenn Du Xavanté auf die Spur gekommen bist.) Der liebe Gott und alle Orixas da Bahia mögen Dir beistehen.
Ein paar Informationen für deine Recherchen kann ich Dir geben. Die erste Fährte von Xavanté solltest Du in Rio de Janeiro aufnehmen, er hatte dort Kontakte zu einigen Galeristen, in einer Bar, in der wir verkehrten, hängt vielleicht noch ein Bild, mit dem er seine Rechnungen beglichen hat. In Rio musst Du ohnehin umsteigen, weil Du Anacristina treffen wirst, eine gute Freundin, sie wird Dir helfen Dich in Bahia zurechtzufinden. Auf der beiliegenden Seite aus dem Veja-Magazin ist ein Foto von ihr (von einer Modemesse in São Paulo). Anacristina ist sehr hübsch, verguck Dich nicht in sie, sie ist nichts für Dich. Sie ist eine Carioca und braucht das Leben am Zuckerhut wie die Luft zum Atmen. Tudo bem.
Wichtigster Ort deiner Nachforschungen wird Salvador da Bahia sein, im Bundesstaat Bahia, im Nordosten Brasiliens. In der Hafengegend Salvadors hat X. die Motive gefunden, von denen er geträumt hat, und ist geblieben. Was ich Dir an Portugiesisch beigebracht habe, wird Dir für Deinen Auftrag genügen, und Du hast ja noch Anacristina.
Ich fühle mich jetzt etwas leichter – aber ich muss schließen für heute.
Cuidado, moço – beijos, Katrina
Als Heller den Brief zusammenfaltete, erinnerte er sich daran, wie herzlich sie sich beim letzten Mal verabschiedet hatten. Als er Katrina umarmte, glaubte er außer einer Kaffee- auch eine Alkoholfahne wahrgenommen zu haben, aber er hatte sich weiter nichts dabei gedacht. Als er ihr Haus verließ, hatte er noch einmal hinaufgesehen, er konnte sie nicht sehen, aber er spürte, dass sie ihm nachschaute.
„Kann ich irgendetwas für dich tun“, unterbrach Sandra das Schweigen. Heller gab ihr keine Antwort. Er saß da, und starrte auf das Kuvert in seinen Händen.
Hellers Beine waren schwer wie Blei, als er die Stufen zu seiner Wohnung hinaufsteigen wollte. Vielleicht war das der Grund, dass er nach wenigen Stufen stehen blieb und keinen Impuls verspürte, weiterzugehen. Aus dem Tritt gekommen, dachte er.
Er stieg die Stufen wieder hinab und trat auf die Straße. Der Himmel war grau, es wehte ein unangenehmer, feuchtkalter Wind. Am oberen Ende der Straße befand sich eine Wirtschaft, in der er noch nie gewesen war. Jetzt ging er dort hin, blieb einen Moment davor stehen.
Aus dem Tritt gekommen. „Scheißegal, da geh ich jetzt rein“, murmelte er.
Es war erst Nachmittag, aber in der Kneipe saßen schon etliche Männer am Tresen und rauchten, ein Bier vor sich. Einige Gäste saßen vor dem Fernseher, ein alter Mann hatte sich einen Barhocker vor einen Spielautomaten gezogen und spielte unablässig. Der Wirt betrachtete Heller, als habe er sich verlaufen. Heller setzte sich in eine Ecke und bestellte ein Bier. Seine Augen wanderten zu den Trinkern am Tresen, zu den Leuten vor dem Fernseher, zum Alten vor dem Spielautomaten. Der Alte schien dort immer zu sitzen, schien seine Zeit mit Zocken totzuschlagen. Alles Geld, das hin und wieder unten herausklimperte, steckte er sogleich oben wieder hinein.
Die Zeit totschlagen, dachte Heller. Er fasste nach Katrinas Seestern in der Tüte, fühlte die spitzen Zacken durch das Plastik. Er trank sein Bier aus, bestellte ein weiteres. Heller dachte an den Mann in Katrinas Wohnung, der jetzt ihre Habseligkeiten auflistete. Ihre Lebenswelt, dachte er, verschwand jetzt, in diesem Augenblick, in einem schwarzen Ringbuch DIN A5.
Der Geldautomat klapperte wieder, der Alte schob die Münzen im Schacht geübt zur Seite und starrte auf die rotierenden Scheiben. Heller trank noch ein Bier und noch eins. Für einen Moment zog er die Magazinseite mit Anacristinas Foto heraus, und erst jetzt bemerkte er, dass Katrina auf den Rand Adresse und Telefonnummer geschrieben hatte. Viel war im Kneipendämmerlicht nicht zu erkennen, der Zigarettenqualm wurde immer dichter und brannte in den Augen. Er faltete das Papier sorgfältig wieder zusammen und steckte es weg.
Aus dem Tritt gekommen. Er bestellte noch ein Bier, trank es nur zur Hälfte, rief den Wirt und zahlte.
Als er in das Halbdunkel der Straße trat, traf die frische Luft ihn wie ein Schlag, dann ging er unsicheren Schrittes zu seinem Haus.
Heller wohnte in einem typisch wilhelminischen Bürgerhaus der Jahrhundertwende. Bis auf einige ältere Bewohner, die seit Jahrzehnten in dem fünfstöckigen Haus lebten, doch selten aus der Tür traten, kannte er niemanden. Er wäre jetzt gern jemandem begegnet, um einen guten Abend zu wünschen, einfach ein paar Worte zu wechseln. Aber es begegnete ihm niemand im Treppenhaus, nur dickblättrige Gummibäume, die sich in den Zwischenstöcken wie Unkraut vermehrten, streckten sich ihm wie schwammige Finger entgegen.
Als er im dritten Stock ankam, schlug sein Herz wie nach einer großen Anstrengung, und als er in seinem mit Bildern und Büchern zugestellten Korridor stand, schnappte er in der Enge nach Luft, als habe ihm jemand den Sauerstoff genommen. Aus seinen Kleidern strömte der Geruch eines übervollen Aschenbechers. Er hatte noch immer die Tüte mit dem Seestern in der Hand, er holte ihn heraus und legte ihn auf den Schreibtisch, auf dem ein Foto von Katrina stand. Es zeigte sie in ausgelassener Pose vor einem Schloss in Breslau, das einmal ihren Vorfahren gehört hatte. Erschöpft setzte er sich an den Schreibtisch und starrte das Foto an. Und jetzt?
Über dem Schreibtisch war ein Zettel mit einem Fontane-Zitat an die Wand gepinnt, er hatte es vor einiger Zeit für Katrina herausgesucht, als sie sich in einer Krise befand.
Du wirst es nie zu Tücht’gem bringen bei deines Grames Träumerei’n, die Tränen lassen nichts gelingen, wer schaffen will, muss fröhlich sein.
Darunter eine Losung, die er sich selber gab: „Erst das Unabwendbare, auch wenn es schmerzt, ermöglicht den Blick hinter den Horizont.“ Er riss das Blatt herunter und warf es in den Papierkorb.
3. Rio de Janeiro
Das Telefon klingelte schrill, aber Heller war schon mit allem Gepäck an der Tür und ging nicht mehr dran.
Die Nachtmaschine nach Rio des Janeiro war voll besetzt. Zum Glück bekam er einen Platz in einer der vorderen Reihen, er rechnete mit einem unruhigen Flug. Nachdem der Pilot die Flugroute erläutert hatte, fügte er an, dass über dem Atlantik Turbulenzen zu erwarten seien; es sei empfehlenswert, die Sicherheitsgurte geschlossen zu halten. Heller hatte sich zwecks Ablenkung mit einigen Boulevardblättern eingedeckt. Schlechtwetterzonen überstand er immer nur unter größten Anspannungen. Selbst die Druckveränderung in den Ohren, wenn die Maschine höher stieg, sowie das Gemisch aus Kerosin, Parfüm und undefinierbaren Duftstoffen versetzten Heller in eine seltsame Gemütsbewegung.
Mehrmals zog er einen Brief Anacristinas hervor, betrachtete ihr Foto, wobei ihre Augen, so glaubte er inzwischen, genau auf ihn, über den unsichtbaren Standpunkt des Fotografen hinaus, gerichtet waren. Er las erneut ihre Zeilen, als könne er vorwegnehmen, was die blaue Tinte auf gelbem Papier noch verschwieg. Er hatte ihr die traurige Nachricht von Katrinas Tod und den Termin seiner Anreise mitgeteilt. Anacristina hatte ihrem Brief ein neueres Foto von sich beigelegt, damit er sie am Flughafen erkennen würde. Im Nadelstreifenkostüm erschien sie Heller noch begehrenswerter als auf dem Foto im Magazin; ihr eher blasses, schmales Gesicht unter einer rastaähnlichen Haarpracht, betont durch große dunkle Augen und kräftige Brauen, gab Rätsel auf, verführte dazu, daran hängen zu bleiben. In ihrem Brief schrieb Anacristina, sie hätte keinen persönlichen Kontakt mehr zu Xavanté gehabt, deshalb habe sie sich schon mal etwas umgesehen. Sie sei auf einen groß aufgemachten Zeitungsbericht über eine seiner letzten Ausstellungen gestoßen. Dem Artikel war zu entnehmen, dass Xavanté, obgleich er Deutscher war, zu den berühmtesten Künstlern Brasiliens zählte. Heller könne sich in jedem Fall darauf verlassen, dass sie ihm bei seiner Recherche helfen werde, zumal Katrina eine gute Freundin von ihr gewesen sei. Für sie selbst sei eine Reise nach Bahia immer reizvoll, dort schlage schließlich das Herz Brasiliens. Das Unternehmen sei allerdings nicht ungefährlich. In São Paolo, dem Zentrum des Kunsthandels, sei die Kunstmafia schon einige Zeit hinter Xavantés Exponaten her. Anacristina bestätigte also Katrinas Darstellung, dachte Heller mit Zufriedenheit, dass Xavanté offenbar zu den ganz Großen der südamerikanischen Kunst gehörte. Über die Beziehung zwischen Katrina und Xavanté könne sie nichts weiter sagen, Katrina habe immer strikt vermieden, mit ihr darüber zu reden. Und während ihrer Zeit mit Xavanté sei sie stets zu ihr nach Rio gekommen, oder man habe sich, auf halbem Wege, in São Paulo getroffen.
Das Abendessen an Bord und der Rotwein machten Heller schläfrig, die Launen des Wetters kamen ihm zugute: Entgegen der Ankündigung wurde es ein ruhiger Flug. Er wachte erst auf, als das Licht in der Kabine aufblitzte und die Stewardess ein heißes Erfrischungstuch reichte. Während das Frühstück serviert wurde, überflog er abermals Anacristinas Brief. Doch zu seiner Enttäuschung war bei darin nichts zu entdecken, das seine Neugierde befriedigt hätte.
Heller spürte nach einer Weile wieder einen Druck auf den Ohren, die Maschine verließ ihre Reiseflughöhe und durchflog hin- und herschaukelnd eine Wolkenfront. Nervös zog er seinen Gurt fester.
Als Heller im Flughafen mit der Rolltreppe hinunterfuhr, um sein Gepäck zu holen, schob er sich ungeduldig an den anderen Passagieren vorbei. Eine Hostess lief ihm noch einige Schritte hinterher, um ihm mit einem freundlichen Lächeln einen Stadtplan von Rio und einen Edelsteinprospekt zu überreichen. Wie nett, dachte er, ein guter Anfang; er warf einen Blick auf die Abbildung eines goldgefassten, himmelblauen Turmalins. Während es an der Zollkontrolle nur stockend vorwärtsging, schaute Heller immer wieder erwartungsvoll durch die sich öffnende und schließende Tür nach draußen. Doch die schöne Anacristina war, als er sich endlich durch die dichte Mauer der Wartenden drängte, nicht zu sehen. Er ließ seine Augen wieder und wieder über die zahllosen Gesichter wandern. Er durchquerte mehrmals die Ankunftshalle, setzte sich an eine der Espressobars, in der Hoffnung, dass sie etwas verspätet eintraf. Doch er wartete vergeblich auf Anacristina. Als er ins Stadtzentrum fuhr, waren die Straßen regennass, obwohl die Sonne schien. Gleich nach seiner Ankunft im Hotel rief er sie an, und da er sie nicht erreichte, schickte er ein Telegramm:
Chego no Rio de Janeiro, estou hospedado no Hotel Atlantis Copacabana. Por favor ligue para mim – é urgente, estou no apto. 1107. Robert Heller.
Auch wenn es ihn drängte, seiner Helferin Anacristina gegenüberzustehen, ihm blieb keine andere Wahl, als sich zu gedulden. Unterdessen bezog er sein Zimmer, packte seinen Koffer aus, baute sorgsam einige Bücher auf dem Nachttisch auf. Er legte sich auf das Bett, und während er sich vorzustellen versuchte, was alles ihn erwartete, war er eingenickt.
Am späten Vormittag klingelte das Telefon und Anacristina holte ihn aus dem Schlaf.
„Bom dia Robertsche, como eschtar“, sagte Anacristina in in dem ihm so vertraut klingenden Dialekt, begleitet von Stimmengewirr aus dem Hintergrund.
Der Gedanke, dass es die schöne Frau auf dem Foto war, deren Stimme er hörte, machte Heller benommen.
„Alo Robertsche, tudo bem?“, wiederholte sie.
„Bom dia, Anacristina … I’m sorry“, sagte Heller endlich mit verschlafener Stimme und massierte sich den Hinterkopf. „Estou com um pouco de Jetlag, mas me sinto bem.“
„Du kannst ruhig Deutsch mit mir reden. Desculpa, aber ich konnte dich nicht abholen, ich bin noch in São Paulo. Ich wollte es dir noch sagen, aber du warst schon abgereist. Es wird noch zwei, drei Tage dauern. Leider. Eine Nachbarin hat dein Telegramm entgegengenommen und mich informiert. Was tust du jetzt?“
Heller hatte sich unterdessen aus dem Bett geschält und das Fenster geöffnet, um wach zu werden.
„Ich stehe am Fenster und bewundere die Hanglage der Favela mit Blick aufs Meer“, sagte er, um irgendetwas zu erwidern.
„Bei der bloßen Betrachtung sollte es auch bleiben. Katrina hat mir gesagt, dass du von Natur aus neugierig bist. Im Augenblick ist die Luft in einigen Vierteln von Rio etwas bleihaltig, vor allem in der Nähe der Copacabana. Ich möchte heil mit dir in Bahia ankommen. Also cuidado.“ Sie lachte, es ging in Husten über, weil sie sich offenbar an ihrem Zigarettenrauch verschluckt hatte.
Er habe sicher noch eine Weile mit dem Jetlag zu tun, fuhr Anacristina fort, währenddessen könne er sich in der Stadt etwas umschauen. An der Copacabana solle er aber wegen der nahen Favelas vorsichtig sein, durch die verschärften Drogenrazzien seien diese Favelas momentan gefährliche Wespennester. Für Gringos mit Dollars in der Tasche sei das Copacabana-Viertel ohnehin ein heißes Pflaster.
„Wem sagst du das“, warf Heller ein, „ich mache derartige Reisen nicht zum ersten Mal, das ist schließlich mein Job.“
Er konnte nach Anacristinas Anruf nicht mehr einschlafen. Noch am gleichen Tag machte er sich allein auf den Weg zu Rios Weltwunder, zum Corcovado. Eigentlich hatte er sich vorgestellt, mit Anacristina zum mächtig in den Himmel ragenden Christus hinaufzusteigen, mit ihr den Postkartenblick auf den Zuckerhut zu genießen und vielleicht, aus dieser luftigen Höhe, das eine oder andere Geheimnis dieser janusgesichtigen Stadt zu erfahren. Er durchkämmte die Galerien de Belas Artes, seltsamerweise ohne dabei eine Spur des Künstlers Xavanté zu entdecken. Doch aus Gesprächen, die er mit Galeristen führte, ihren verdeckten Fragen und misstrauischen Blicken war zu erkennen, dass ihr Interesse an den aufzufindenden Gemälden Xavantés größer war, als sie zuzugeben bereit waren. Noch eine Chance, eine Spur des Deutschen mit dem indianischen Namen zu entdecken, hatte er. Obschon ziemlich erschöpft, ließ er sich um den im Stadtinneren gelegenen See, Lagoa Rotrigo de Freitas, fahren, an dessen menschenleeren Ufer nur einige Jogger ihre Runden drehten, und stieg in der Avenida Pessoa aus dem Taxi.
Hier, in Fabios Bar am See, war Katrina, so hatte sie ihm einmal erzählt, mit Xavanté aufgetaucht, sie hatten ordentlich gezecht und Xavanté zahlte mangels Geld mit einem Bild – es hing noch immer da. In Holz geschnitten: Eine schwarze Bahiana tanzt eng mit einem Matrosen, ihr Körper schon dem Mann verdingt, doch ihr Gesicht zeigt Stolz, sie scheint ganz woanders zu weilen. Erschöpfendes über Xavanté konnte Heller aber nicht erfahren. Der Barkeeper hatte den Cachaça indes großzügig gerührt. „Weiter so, moço“, schien eine ihm wohlbekannte Stimme zu sagen, ihre Eigentümerin schien zu lachen und mitzutrinken.
4. Kassandra ruft
Heller stand am Fenster seines Hotelzimmers und verfolgte das Kreisen eines Doppeldeckers über dem Copacabanastrand, im Schlepptau flatterte die Coca Cola-Reklame. Er hatte die Nacht gut geschlafen und beabsichtigte, zu einem Rundgang in die nähere Umgebung aufzubrechen.
Als er seinen Zimmerschlüssel abgab, schob ihm der Portier mit einem unverbindlichen Lächeln ein Merkblatt über den Tresen. Heller überflog das Papier flüchtig und steckte es weg.
„… Ihre Sicherheit – Verhaltenstipps … auf Rios Straßen … nie ohne Bargeld 20 Dollar … Bandidos … unberechenbar … Straßenräuber sondieren das Terrain … Zeiten und Wege wechseln … Bem-vindo ao Brasil!“
Willkommen in Brasilien!
5. Heißer Asphalt
Heller lief zur Rua Francisco Otaviano hinunter, wo Ipanema- und Copacabanastrand aufeinandertrafen. Gemächlich schlenderte er an der langgezogenen Bucht entlang, unterbrach an einer der Strandbuden seinen Weg, um eine gekühlte Kokosmilch zu trinken. Im altehrwürdigen Copacabana Palace, das an die frühe Samba und an Orfeo Negro erinnerte, trank er einen Espresso und wechselte wieder hinüber auf die andere Seite der Avenida Atlantica, wo der Strand im flirrendem Licht mit dem Glitzern des Atlantiks zu einem Gemisch wurde, dem sich die Sinne nicht entziehen konnten.
Tiefschwarze Locken, sonnenverwöhnte Körper – die schönen Frauen der Copacabana raubten Heller den Verstand. Ob die allgegenwärtigen knappen Bikinis und die zur Schau gestellte nackte Haut frivol oder sinnlich war, mochte wohl im Auge des Betrachters liegen, dachte Heller. Ihm schien die hedonistische Schönheit eine verführerische Droge zu sein.
Über den mysteriösen Xavanté hatte er bisher nichts Nennenswertes zu Papier gebracht. Noch wollte er sich Zeit lassen, bis Anacristina in Rio war, und mit ihr gemeinsam erste Spuren aufnehmen.
Doch Anacristina ließ weiter auf sich warten. Katrinas Herzenswunsch, etwas über die letzte Station ihres früheren Lebensgefährten zu erfahren, war die eine Sache, dachte Heller, doch ihn bewegte immer mehr die Frage, was Xavantés Kunstschatz tatsächlich wert war; er spürte, dass mehr hinter den Kunstwerken her waren, als ihm lieb sein konnte. Das Warten auf Anacristina strapazierte die Geduld, je mehr er ahnte, worum es ging, umso heißer wurde ihm der Boden unten den Füßen. Für den kommenden Tag überlege er sich einen Plan B, sollte seine Helferin sich bis dahin noch immer nicht gemeldet haben.
Die anbrechende, funkelnde Nacht Rio de Janeiros wehte in Hellers Zimmer hinein, lustlos blätterte er seine Bücher durch, ohne sich entscheiden zu können, etwas zu lesen. Des Starrens auf das Telefon müde, verließ er das Hotel, um zum Copacabanastrand zu laufen.
Wütend fauchte der Atlantik über den weißen Sand hinüber zur Strandpromenade. Die Bistros mit den leuchtend roten Schirmen füllten sich langsam mit den Nachtschwärmern und den Schönen der Nacht. Unter der zuckenden Neonreklame einer Diskothek wartete eine Menschentraube auf den Einlass in den Palast der Freuden. Plötzlich schien es, als gieße der Himmel das Wasser aller Ozeane über die Stadt, es regnete in Sturzbächen. Heller lief durch tiefe Pfützen hinüber zum Atlantik, watete bis zu den Knöcheln im Wasser die Avenida Atlantica entlang, suchte vergeblich nach einem der gelben Taxis.
Am nächsten Morgen strahlte der Himmel über dem Ipanemastrand in kitschigem Blau, als sei nichts gewesen. Heller fühlte sich nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Er hatte keinen Appetit auf ein Frühstück und trank nur einen Cappuccino. Am Kiosk vor dem Hotel kaufte er einige Zeitungen und ging zur Strandpromenade hinunter, um das nahe gelegene Bistro Pigale am Ende der Copacabana aufzusuchen. In großer Aufmachung berichteten alle Blätter vom Einmarsch irakischer Truppen in Kuwait. Den Rest der Frontseiten füllten der städtische Drogenkrieg und die dazugehörigen Bilder. Alltag in Rio de Janeiro: Blau uniformierte Polizeieinheiten, Schnellfeuergewehre im Anschlag, durchkämmten die Hänge der Favelas. Einer der Schauplätze lag unweit seines Hotels, hin und wieder war von dort Gewehrfeuer zu hören. Unberührt vom Drogenkrieg wehte ein seidiger, berauschender Wind über die Copacabana; es war, als schütte jemand Brandy auf den glühenden Asphalt: Die durch Autoabgase kontaminierte Luft duftete nach Cognac. Das Aroma der Straße irritierte seine Sinne mehr, als dass es zu seinem Wohlbefinden beitrug.
Heller war sich in diesem Moment nicht sicher, ob das heraufziehende Naturschauspiel am schönsten und reizvollsten Strand Brasiliens für die erste Seite seiner Recherche über die skurrile Künstlerexistenz Xavanté taugte, diesen Mann, dessen richtigen Namen er nicht einmal kannte. Um die Wartezeit nicht ganz dem Müßiggang zu opfern, hatte er in der Biblioteca Nacional in alten Feuilletons gestöbert und war auf einige Artikel über Xavanté gestoßen. Der blumigen Sprache der Feuilletonisten war zu entnehmen, dass er seinerzeit dem brasilianischen Zauber, gewissermaßen der Farbe Schwarz in allen Formen und Schattierungen erlegen war. Warum er als Alemão unter dem Pseudonym Xavanté, man könne den Namen auch mit Ch (also Chavanté) schreiben, aufgetreten war, interessierte offensichtlich niemanden. In einer der letzten damals erschienenen Pressemeldungen, einer Art Nachruf, wurde berichtet, Xavanté habe vor seinem leidvollen Ende etwas für die Kunstwelt geschaffen, womit er über sich und seine bis dahin bekannte Einzigartigkeit als Künstler hinausgewachsen sei. In einem schöpferischen Akt, genährt aus reiner Verzweiflung und Gottverlassenheit, habe er versucht, sich dem Tod mit seiner Künstlerhand entgegenzustellen. Es seien Meisterwerke entstanden, auf deren Veröffentlichung die Kunstwelt mit Spannung gewartet habe. In einem Artikel wurde beiläufig ein Umstand erwähnt, der Hellers besonderes Interesse weckte; mit Bedauern wurde vermerkt, dass es kein Werkverzeichnis des offensichtlich umfangreichen Gemäldenachlasses gab. Das habe zumindest, wie es hieß, vorauseilende Interpretationen zugelassen. Für Heller indes war der Umstand alarmierend. Ein solch wertvolles unveröffentlichtes Oeuvre ohne Werkverzeichnis konnte mit entsprechender krimineller Energie leicht in eine Geldmaschine umgewandelt werden.
Heller fand im wichtigen internationalen Kunstlexikon Thieme-Becker, maßgebend für alle Museen, Sammler, Auktionatoren, Galeristen, Kunsthändler und natürlich auch Gauner heraus, dass Xavantés Arbeiten einen hohen Preis bei Auktionen erzielt hatten. Spätestens jetzt wurde Heller klar, dass eine höchst unterschiedliche Klientel unter dem Deckmantel des Kunstinteresses hinter Xavantés Nachlass her war, darunter auch skrupellose Investoren ohne Kunstambitionen.
Die warme, alkoholgeschwängerte Luft konnte – weil seine Helferin noch immer nicht aufgetaucht war – Hellers eingetrübte Stimmung nicht bessern. Er blickte auf die vor ihm liegende TV-Programmseite der Zeitung, darin ein Foto von Vittorio Gassman und Monica Vitti zum Film „Eine Laus im Pelz“. Der Titel schien Heller ein Verweis auf seine Lage zu sein. Er schmeckte Salz auf der Zunge.
6. Favelados
Das Leben in den Straßenschluchten der Copacabana nahm seinen gewohnten Lauf. Gerade noch hatte Heller beobachtet, wie eine luftige weiße Wolke um die Spitze des Zuckerhutes herumtänzelte, sich entfernte, von einer launigen Bö geschubst zurückkehrte, sich wie im Liebesspiel schlängelte. Dann, ganz überraschend, senkte sich der Himmel herab, eine aschgraue Regenwand schob sich von Ipanema kommend wie eine mächtige Kulisse über das helle Blau der Guanabana-Bucht und beendete das heitere Spiel am Zuckerhut. Als das erste aufgeblähte Wolkenkissen sich zu Tropfen verflüssigte, löste sich das träge im champagnerfarbenen Sand liegende Geflecht aus Menschenleibern auf. Alle suchten Zuflucht unter den schützenden Dächern der Strandhütten an der Promenade. Dicke Regentropfen, schwer wie Paranüsse, klatschten in rhythmischen Salven auf den heißen Asphalt. Der trommelnde Guss vom Blechdach einer Zeitungsbude hörte sich an wie das Vorspiel zu einer Capoeira. Bunte Ansichtskarten, wie Girlanden an den Zeitungsständen aufgehängt, hüpften im Wind aufgeregt hin und her, als wollten sie sich losreißen und das Weite suchen. Minutenlang prasselte der Regen so dicht herunter, dass der Zuckerhut nur noch schemenhaft wie der riesige Kopf eines Sauriers durch die Regenwand schimmerte. Kaum hatte Heller sich der Melancholie des strömenden Wassers hingegeben, war alles spukartig vorbei.
Nach dem kühlenden Schauer riss der Himmel auf und holte sich mit heißem Atem aus den dampfenden Straßenschluchten zurück, was er gebracht hatte. Strand und leer gefegte Bürgersteige füllten sich wieder, alles schien wie immer, wenn auf Regen Sonne folgt.
Heller verließ das Bistro und steuerte die belebte Geschäftsstraße, die Rua Nossa Senhora de Copacabana, an, die nur wenige Minuten von seinem Hotel entfernt lag. Er wollte etwas Geld wechseln, doch die Wechselstube war geschlossen. Da eine andere Bank nicht auszumachen war, blieb er an einer Straßenecke unentschlossen stehen, tastete intuitiv in der Hosentasche nach der Geldbörse. Noch während er sich die nächsten Schritte überlegte, packte ihn ein Favelado fest an der Schulter. „Oi amigo, tens uma zigarro?“ Am schraubstockartigen Griff und am kalten Blick des Favelados ahnte Heller sofort die Gefahr. Ein anderer Passant in seiner Nähe musste den Vorgang beobachtet haben, er setzte sich mit einigen Sprüngen auf die andere Straßenseite ab. Unterdessen hatten sich zwei weitere Favelados Heller in den Weg gestellt. Als einer der Straßenjungen befehlsartig „Agora! – Jetzt!“ rief, alles geschah in Sekunden, ergriff Heller ebenfalls die Flucht. Ein Bus hatte sich vor ihn geschoben, versperrte den Fluchtweg auf die andere Straßenseite, Heller rannte in die entgegengesetzte Richtung, rannte in die Falle seiner Häscher.
Er floh wie ein Gnu in der Savanne, das sich von der Herde zu weit entfernt und nun die in der Wildnis herrschenden Gesetze hinzunehmen hatte. Er war auf dem Weg nach Bahia, um Katrinas letzten Wunsch zu erfüllen, die Spuren dieses Xavanté aufzustöbern. Und jetzt, auf halbem Wege, jetzt rannte er, als ginge es um sein Leben, rannte vor einer Horde Straßenräuber davon. Lauf niemals weg vor ihnen, hatte Katrina ihn gewarnt, das ist eine Kriegserklärung für die Bandidos. In diese Falle war er nun getappt. Sollte er stehen bleiben, seinen Häschern eine weiße Fahne entgegenhalten, die Dollars, hinter denen sie her waren, auf die Straße werfen? Wut, Angst – Adrenalin, stieg wie Tausende Ameisen aus der Magengegend in die Atemwege bis ins Hirn, hagelten wie Eisennägel auf die Haut. Hinter ihm war eine Meute hungriger Wölfe, und es schien, als röchen sie die Angst durch seine Poren. Er drehte sich um, sah in ihren schwarzen Fäusten Messer blitzen, prallte in der Hatz gegen Passanten. Dann hatten sie ihn, an den Armen, den Beinen, den Haaren, zerrten ihn in den Staub der Rua Nossa Senhora de Copacabana.
Heller würde sich später immer wieder an ihre sandverklebten T-Shirts erinnern, deren verwaschene Farben rot, schwarz und weiß waren. In fahlen Gesichtern aufgerissene, rot umränderte Augen voller Hass und Drogensucht. Ihr chancenloses Leben im Dreck der Favela schien jeden Ausdruck von Menschlichkeit aus ihren Gesichtern gelöscht zu haben. Sie waren aufs Äußerste erregt, aus heiseren Kehlen schrien sie sich unverständliche Wortfetzen zu. Sie anzureden war sinnlos, mit ihrem Geschrei schienen sie sich inmitten des pulsierenden Verkehrs selbst anzustacheln. Einer drehte Hellers Arme auf den Rücken, er spürte eine Messerklinge an der Kehle, eine anderer schlitzte ihm die Hosenbeine bis zum Tascheninhalt auf. Jemand rief: „Meu Deus!“ Seine Häscher indes hörten die göttliche Anrufung nicht mehr, längst waren sie von der Bildfläche verschwunden wie ein böser Spuk.
Dass er noch am Leben war, nicht einmal eine Schramme davon getragen hatte, sei eigentlich ein Wunder, sagte später einer der Passanten, die machtlos zugeschaut hatten. Er hatte einfach Glück gehabt. Nur ein Zahn hatte durch den Aufprall auf den Asphalt etwas abgekriegt. Heller, noch dort auf der Straße liegend, wo sie ihn heruntergezerrt hatten, sah auf seine aufgeschlitzten Hosenbeine. Ein eher komisches Bild. Einige Passanten kamen zögernd heran und erklärten, er habe wirklich Glück gehabt, großes Glück sogar. Die Favelados seien gedopt und hungrig wie bissige Sandflöhe der schlimmsten Sorte, und es sei besser für ihn gewesen, dass niemand eingegriffen hätte, erklärten sie entschuldigend. Er hatte also allen Grund, sich eines zweiten Lebens zu erfreuen. Sein Herz pochte bis zum Hals, oder war es das Dröhnen des unentwegt vorbeirollenden Verkehrs? Er kroch, die Funktionsfähigkeit seiner Gliedmaßen ausprobierend, vom Rand des Bürgersteigs zurück, lehnte sich gegen eine Hauswand. Über ihm klebte das Wahlplakat eines Präsidentschaftskandidaten, der seinen Wählern den Himmel auf Erden versprach. Füße schlurften, trippelten, schlenderten vor seinen Augen hin und her, niemand schien weiter Notiz von ihm zu nehmen. Omnibusse donnerten vorbei in Richtung Botafogo, Flamengo, Centro-Av. Rio Branco. Zwischen schwarzgrauen Abgaswolken beobachtete Heller auf der gegenüberliegenden Seite zerlumpte Straßenkinder, verstohlen schauten sie herüber, schienen sich wie Tauben zu versammeln, in Erwartung abfallender Reste.
Die Nachmittagshitze kroch über den Asphalt. Vorbeieilende Fußgänger bewegten die schwere Luft, erzeugten einen erfrischenden Fächerschlag. Ein helfender Arm streckte sich Heller entgegen, bot sich an, ihn in das Hier und Jetzt zurückzuholen. „Kann ich Ihnen behilflich sein?“, fragte die dazugehörige Stimme in akzentfreiem Deutsch. Ein Mann zog ihn hoch, und Heller sah die Welt wieder in Augenhöhe. Der Helfer bestätigte, was Heller von anderen Passanten schon erfahren hatte: dass es sein Glück gewesen sei, dass während des Überfalls niemand versucht hatte zu helfen, ein Eingriff hätte erfahrungsgemäß zu einem Blutbad geführt, erklärte er. Die Zeitungen und die Polizeiberichte seien jeden Tag voll davon. Er gab ihm den Rat, besser nicht allein zur Polizei zu gehen, um Anzeige zu erstatten, falls er das zu tun beabsichtige. Es sei für einen Touristen schwer zu verstehen, aber die Polizei stehe nicht unbedingt auf seiner Seite. Der Mann stellte sich als Peter Schirmer vor, er bot Heller an, ihn später zum Polizeirevier zu begleiten. Er gab ihm seine Karte und tauchte im hitzeflirrenden Gewimmel der Rua Nossa Senhora unter.
7. Widerstände
Hellers Zimmer lag im elften, obersten Stock des Hotels, man konnte die Strände von Copacabana und Ipanema sehen. Er hatte das Fenster weit aufgemacht, vom Meer wehte eine frische Brise herauf.
An diesem Tag war alles noch einmal gut gegangen. Alles dort unten – eine pralle Sonnenseite voller Leben – lag zu seinen Füßen. Er hatte es in der Hand, in dieses Leben zurückzukehren und hineinzutauchen. Der indigoblaue Atlantik, der gleißende Strand, die puppenhaft anmutenden Menschen, alles war verkleinert, spielerisch verkleinert. Soll ich jetzt umkehren, dachte er, weil das Unheil ein Zeichen gesetzt hat? Seine Hand fuhr zum Unterkiefer – der schmerzende Zahn, das wäre immerhin ein triftiger Grund, seine Mission abzubrechen. Während Heller mit sich haderte, verrann der Tag ereignislos wie Sand zwischen den Fingern.
Im Dämmerlicht des anbrechenden Tages erschien ein Mann ohne anzuklopfen in Hellers Zimmertür, offenbar hatte er vergessen abzuschließen. Das Gesicht des Mannes lag im Schatten des tief in die Stirn gezogenen Hutes, sodass nicht zu erkennen war, wen er vor sich hatte. Der Unbekannte überreichte Heller einen Brief und verlangte sofortige Beantwortung. Vergeblich versuchte er, den Brief zu öffnen. Plötzlich blitzte in der Hand des Mannes ein Messer auf, oder war es ein Brieföffner, er war sich nicht sicher. Mit geballter Faust schlug er in das Gesicht des Fremden. Das klirrende Geräusch eines Glases und ein heftiger Schmerz in seiner noch immer zur Faust geballten Hand rissen ihn aus dem Schlaf. Er war alles nur ein Trugbild seiner angespannten Nerven; die schmerzende rechte Hand indes, die mit voller Wucht das harte Kopfende seines Bettes getroffen hatte, war Realität. Er hätte sich nicht einmal im Traum vorstellen können, jemals einem Menschen mit derartiger Heftigkeit ins Gesicht zu schlagen. Und der Brief, von dem er geträumt hatte? Nachdenklich rieb er sich die schmerzenden Fingergelenke und warf einen Blick aus dem Fenster. Die Guanabara-Bucht lag noch verschlafen im Morgendunst.
Auf dem Nachttisch lag Anacristinas Brief, als sei er das zurückgebliebene Requisit der nächtlichen Erscheinung. Er drehte und wendete ihn, als werde er ihm die Bedeutung des Traumes verraten.
Nicht ohne Bitterkeit erinnerte sich Heller an die Frauen, die zu den verschiedenen Phasen





























