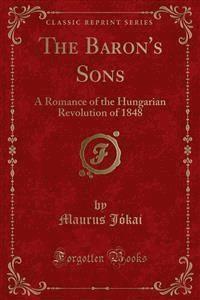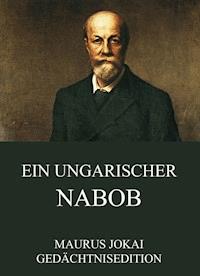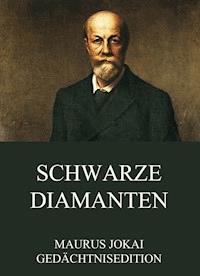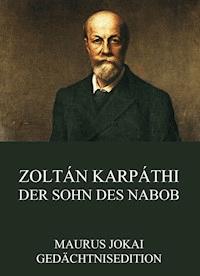
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zoltán Karpáthi, der Held unseres Romans, ist ein Sohn Johann Karpáthis (des ungarischen Nabobs) und so wie mehrere Figuren des älteren Romans, wie Bela Karpáthi (Abellino), Graf Szentirmay usw. auch in Zoltán Karpáthi handelnd auftreten, ja darin eine bedeutende Rolle spielen, ziehen sich auch zahlreiche gemeinsame Fäden durch die Lebensgeschichte von Vater und Sohn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 832
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zoltán Karpáthi, der Sohn des Nabob
Maurus Jokai
Inhalt:
Maurus Jókai – Biografie und Bibliografie
Vorwort des Übersetzers.
Zoltán Karpáthi, der Sohn des Nabob
Erster Teil
Ein Nationalfest
Vornehme Unterhaltung.
Der » Kedves barátom uram«
Das Linsengericht.
Eine Philosophin.
In Szentirma
Der Freudentag.
Die vermauerte Thüre.
Die emancipierte Familie.
Zweiter Teil
Trauertage
Der Zinkendorfer Patient.
Die Briefe des Septemvirs.
Der Märtyrer des Gebens.
Dritter Teil.
Das Geheimnis.
Eine männliche Unterredung.
Handel um eine arme Seele.
Die Entsagung.
Ein schlechter Sieg.
Charaktere.
Vierter Teil.
Frauenschutz.
Der Haudegen.
Harte Herzen.
Stille!
Licht und Schatten.
Alte gute Freunde.
Der Seher und der Erblindete.
Zoltan Karpathi, M. Jokai
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849628703
www.jazzybee-verlag.de
Maurus Jókai – Biografie und Bibliografie
Berühmter ungar. Schriftsteller, geb. 19. Febr. 1825 in Komorn, gest. 5. Mai 1904 in Budapest, erlangte 1846 das Advokatendiplom, beschäftigte sich jedoch ausschließlich mit Literatur und veröffentlichte 1846 seinen ersten Roman: »Hétköznapok« (»Werktage«), der bereits das bedeutende humoristische Talent des Dichters verriet. 1847 übernahm er die Redaktion der Wochenschrift »Életképek« (»Lebensbilder«) und war seit 15. März 1848 einer der literarischen Stimmführer der Freiheitsbewegung. Anfang 1849 floh er zugleich mit der ungarischen Regierung und den Abgeordneten nach Debreczin und redigierte daselbst die »Esti lapok« (»Abendblätter«). Seit 1849 mit der damaligen ersten tragischen Schauspielerin Ungarns, Rosa Laborfalvi (geb. 1820 in Miskolcz, gest. 20. Nov. 1886), verheiratet, lebte er teils in Budapest, teils in seinen Villen im Ofener Gebirge und in Füred am Plattensee, unausgesetzt eine staunenswerte literarische Tätigkeit entfaltend. J. hatte bis zu seinem 50. Geburtstag bereits nahe an 200 Bände veröffentlicht, darunter 29 Romane, zusammen 100 Bände stark, 2 Bände Gedichte, 2 Bände dramatische Dichtungen, 6 Bände Sammlungen humoristischer Aufsätze, 48 Bände Novellen etc. Dabei war er seit 1858 ununterbrochen als Redakteur tätig; er redigierte 1858–81 die humoristische Wochenschrift: »Üstökös« (»Komet«), zuletzt war er Chefredakteur des Regierungsblattes »Nemzet« (»Nation«) und auch im Feuilletonteil andrer Blätter tätig. Als Abgeordneter gehörte er der liberalen Regierungspartei an; 1897 wurde er ins Magnatenhaus berufen. 1899 heiratete er zum zweiten mal, und zwar die jugendliche Schauspielerin Bella Nagy. Seinen literarischen Ruhm begründete er hauptsächlich mit seinen Romanen, in denen zuerst der Einfluß Victor Hugos, dann der Jules Vernes, später der der französischen Realisten erkennbar ist, und von denen viele zuerst ins Deutsche und dann aus dieser Sprache in zahlreiche andre europäische Sprachen übersetzt wurden. Sie zeichnen sich insgesamt durch lebhafte Phantasie, spannende Fabel, durch gesunden Humor und Glanz und Farbe der Sprache aus. Die bedeutenderen sind: »Die weiße Rose« (1854); »Die Türkenwelt in Ungarn« (1855); »Ein ungarischer Nabob« (1856); »Schwarze Diamanten« (1870); »Wie man grau wird« (1872); »Die Narren der Liebe« (1873); »Ein Goldmensch« (1873); »Der Mann mit dem steinernen Herzen« (1874); »Der Roman des künftigen Jahrhunderts« (1876); »Mein, Dein, Sein« (1876); »Komödianten des Lebens« (1877); »Rab Ráby« (1880); »Pater Peter« (1881); »Die armen Reichen« (1881); »Ein Frauenhaar« (1883); »Ein Spieler, der gewinnt« (1883); »Durch alle Höllen« (1884); »Die weiße Frau von Leutschau« (1884); »Nach zehn Jahren« (1885); »Der Zigeunerbaron« (1885); »Kleine Könige« (1886); »Die Dame mit den Meeraugen« (1889); »Reiche Arme« (1891); »Die beiden Trenk« (1894); »Wie schade, altern zu müssen!« (1896); »1848« (1897); »Ein bejahrter Mann ist kein alter Mann« (1898); »Kathlannet« (1899). Geringeren Erfolg erzielte J. mit seinen dramatischen Werken. Seine politischen Gedichte erschienen 1880 (2 Bde.), »Ausgewählte Schriften« von ihm erschienen deutsch Budapest 1881–83 (120 Lfgn.). Eine Prachtausgabe seiner Werke in 100 Bänden erschien 1898. Er war seit 1858 Mitglied der ungarischen Akademie, seit 1860 Mitglied der Kisfaludy-Gesellschaft, seit 1878 Präsident der Petöfi-Gesellschaft. Vgl. L. Névy, Moritz I., Festschrift zu seinem 50jährigen Schriftstellerjubiläum (ungar., Pest 1894).
Vorwort des Übersetzers.
Der Jókaische Roman, von dem die deutsche Lesewelt hier eine Übersetzung erhält, entstand im Jahr 1854, was zu wissen nicht überflüssig, um sich in die Perspektive, von der aus er geschrieben ward, hineinzuversetzen, und zwar erschien derselbe zuerst – frisch von der Pfanne weg, wie eben ein Kapitel fertig geworden – im Feuilleton des ungarischen Journals »Pesti Napló«, dessen Satz sogleich auch für die Buchausgabe verwendet wurde. Wir erwähnen dies, weil daraus manche kleine, hier und da als Vergeßlichkeitssünden untergelaufenen Ungenauigkeiten und Widersprüche sich erklären, welche der Autor gewiß beseitigt haben würde, wenn er das fertige Gemälde im ganzen noch einmal hätte retouchierend übergehen können Einige derselben, die offenbar nur von einemlapsus calamiherrühren, haben wir uns bei der Übersetzung zu verbessern erlaubt.. Bekanntlich ist das vorliegende Werk die Fortsetzung oder neue Folge eines älteren Jókaischen Romans: » Ein ungarischer Nabob«, der bereits einen deutschen Übersetzer gefunden »Ein ungarischer Nabob«. Roman von Maurus Jókai. Deutsch von Adolf Dux. Universal-Bibliothek Nr. 3016-3020.. Zoltán Karpáthi, der Held unseres Romans, ist ein Sohn Johann Karpáthis (des ungarischen Nabobs) und so wie mehrere Figuren des älteren Romans, wie Bela Karpáthi (Abellino), Graf Szentirmay u. s. w. auch in Zoltán Karpáthi handelnd auftreten, ja darin eine bedeutende Rolle spielen, ziehen sich auch zahlreiche gemeinsame Fäden durch die Lebensgeschichte von Vater und Sohn. Obwohl nun Jókai es meisterhaft verstanden hat, jene Anknüpfungspunkte und zurückgreifenden Beziehungen in seinem »Zoltán Karpáthi« derart zu verweben, daß zum vollen Verständnis desselben die Bekanntschaft des Lesers mit dem »ungarischen Nabob« durchaus nicht erforderlich ist, erschien es uns nicht überflüssig, jene Leser, welche von der Existenz des älteren Romans keine Kenntnis haben sollten, auf die Zusammengehörigkeit beider Dichtungen hier aufmerksam zu machen, schon deshalb, weil beide, als unübertreffliche Zeit- und Charakterbilder des vormärzlichen ungarischen Lebens in zwei verschiedenen auf einander folgenden Entwickelungsphasen, sich gegenseitig ergänzen. Auch dann, wenn der Leser den »Nabob« erst nach der Lektüre des gegenwärtigen Romans in die Hände bekommen sollte, wird er denselben mit dem Interesse einer Biographie in aufsteigender Linie lesen, wobei wir indes nicht verschweigen wollen, daß wir – was dichterische Conception, spannendes Interesse der Handlung, sowie der Charaktere, Bedeutsamkeit der zeitgeschichtlichen Episoden (darunter namentlich die Überschwemmung Pests im Jahre 1838) betrifft – den Sohn über den Vater, die spätere über die frühere Dichtung setzen.
Doch wir wollen am liebsten das Werk selbst den Meister loben lassen, und haben es daher auch nicht für nötig erachtet, das »Nachwort« zu reproduzieren, welches Jókai seinem Roman anzuhängen für gut fand, und worin er sich ausführlich über die Tendenz desselben verbreitet, wir glauben vielmehr, daß es dem Autor nur zum Lobe gereichen könne, wenn wir es hier als unsere Überzeugung aussprechen, daß an seiner genialen Schöpfung die freie dichterische Produktion einen ohne Vergleich größeren Anteil hatte, als die, näher besehen, doch nur auf schwachem Fuße nachhinkende Tendenz, jene nämlich, wie sie im Nachworte formuliert wird; wohl aber und man nicht umhin können, im Hinblick auf die unbestreitbar mächtige Wirkung dieser wahrheitsgetreuen, lebensfrischen Zeitgemälde auf Erweckung und Steigerung des nationalen Gefühles bei dem ungarischen Leser, sowohl »Zoltán Karpáthi« als auch den »Nabob« als Tendenzromane im besten Sinne des Wortes gelten Zu lassen.
Das echt nationale, aus dem Leben und der Ausdrucksweise des Volkes geschöpfte Kolorit erschwerte begreiflich nicht wenig die Ausgabe des Übersetzers, der sich am besten bewußt ist, wie weit die Kopie hinter dem Original zurückbleiben mußte. Er glaubte es dabei nicht verschmähen zu dürfen, zur möglichst annähernden Erreichung des lokalen Tones mancher Provinzialismen, Hungarismen und Latinismen sich zu bedienen, welche sich hierlands in der deutschen Umgangssprache im Verkehr mit den übrigen Bewohnern des Landes und zur Bezeichnung heimischer Zustände, Institutionen und Gegenstände eingebürgert haben. Die meisten derselben erklären sich wohl aus dem Zusammenhang im Text selber. Wo es durchaus nötig schien, wurde durch kurze erläuternde Anmerkungen nachgeholfen. Was die Aussprache der vorkommenden ungarischen Eigennamen betrifft, so wird es genügen, zu bemerken, daßewwieö,swiesch,csundchwietsch,szdagegen wie unserß,zwie ein weichess(z. B. in »lesen«)czwietz,zswie das weiche französischeg(voreundi),vwiew,gyziemlich wie ein weichesdj,nywienjundlywie das französischelmouillé lautet.
E. G.
Zoltán Karpáthi, der Sohn des Nabob
Erster Teil
1.
Ein Nationalfest
Saht ihr schon einen angehenden Landwirt, der ein von seinen Vorfahren vernachlässigtes Erbe übernommen hat und nun mit festem Willen, Lust und Fleiß daran geht, das verfallene, avitische Anwesen wieder in guten stand zu setzen? Er zimmert, baut, rodet Gestrüppe aus, pflanzt Bäume. Wie freut er sich dann, wenn an den Spuren seines Fleißes, seines eifrigen Mühens sich die segnende Hand des Herrn zeigt! Mit welcher Lust führt er euch in dem neugebauten Häuschen, dem kleinen Keller herum, dessen Wein liefernde Rebe er eben erst ausgepflanzt hat; wie prahlt er mit der ersten Blume seines Gartens, der ersten Frucht seines Obstbaumes und wie glücklich fühlt er sich, wenn er jemand gefunden, der die Ergüsse seines harmlosen Stolzes anhört und die Saat im Keime lobt.
Die Besitzer stockhoher Hauser und Paläste sehen mit mitleidigem Lächeln auf ihn herab: »was brüstest du dich vor uns, armer Teufel, mit den um deine armselige Hütte gepflanzten Besen, die du einen Garten taufst, was wird aus dir werden? früher oder später mußt du deine Arbeit doch einstellen und erlahmen unter der Last, die du dir aufgebürdet; du führst es doch nicht zu Ende; besser für dich, du hättest gar nicht angefangen, armer Teufel!«
Er aber müht sich ab, ringt und strebt, mit heiliger Geduld für die Nachwelt kämpfend, pflanzt gottvertrauend die Hoffnung auf eine bessere Zukunft in seine Brust, weiht jede Minute der Arbeit, und wenn er sich fruchtlos abgemüht, wenn Täuschung, Unerfahrenheit, schlechte Zeiten und Schicksalsschläge sein Werk zu Schanden gemacht – fängt er von neuem an.
***
Im Jahre des Herrn tausendachthundertsiebenunddreißig in den letzten Tagen des Monats August war Pest Zeuge eines eigentümlichen Nationalfestes.
Man könnte es eher ein Familienfest nennen. Interessierte es damals doch nur so wenige, und diese wenigen konnten alle recht wohl für Glieder einer Familie angesehen werden, welche gemeinsames Lieben, gemeinsamer Kummer, gemeinsame Opfer verschwistert hatten und die nun zusammenkamen, um den Ausbau eines kleinen Hauses zu feiern, wie es leicht jeder andere größer und schöner hat; allein es ist eben unser Haus, und wir haben unsere Freude daran; mögen sie immerhin sagen, daß es klein und unansehnlich ist.
Dies Haus war: das Pester Nationaltheater.
Eifrige Patrioten hatten schon lange daran erinnert, auch wir möchten doch dem Altar der Nationalbildung eine Hütte bauen, wo die vaterländische Kunst ein Asyl, eine Wiege und ein Denkmal finde, damit nicht auch sie dem unverdienten Lose so vieles Guten und Schönen – der Vergessenheit, anheimfalle. Sie sprachen davon, daß die Kunst und die Litteratur es sei, von der die Sprache ihren Wert und ihre Würde erhält, in der Sprache aber lebe die Nation. Das sind Dinge, die man anderwärts längst auswendig weiß, bei uns aber mußten sie erst ausgesprochen und immer wieder und wieder gesagt werden; jener Jüngling, der zuerst davon zu reden anfing, war grau geworden, bis er den Erfolg seiner Reden erlebte.
Aber er erlebte ihn doch.
Es gab welche, die nicht darauf hörten, weil sie es für überflüssig hielten. Unsere Väter existierten ohne das, und so werden auch wir ohne das fortbestehen können.
Andere gab es, denen das Verständnis dafür abging. Für wen und wozu soll das? Welchen Nutzen soll es bringen?
Auch solche gab es, welche darüber spotteten. Der Ungar und Kunst! Auf dem Dorf mag das gut sein, wo nichts besseres da ist; aber hier in Pest! zum Gespötte der Welt! laßt das bleiben.
Die Zweifler kratzten sich den Kopf: es wäre wohl schön, wenn es nur möglich wäre, man hatte es zu einer anderen Zeit anfangen sollen. Die engherzige Selbstsucht fand Gründe, unter denen sich ihre Scheu vor Opfern versteckte: wer wird das Geld dazu hergeben? das braucht viel Geld und wir haben dessen zu anderen Dingen nicht genug.
Und als allmählich die Opferpfennige sich sammelten, da tauchten die Einwürfe auf: wohin werdet ihr bauen? ihr werdet es nicht fertig bringen, das Geld wird das Schicksal anderer Summen teilen, welche durch viele Hände laufen; und wird es auch fertig, was werdet ihr darin aufführen, und wenn ihr auch etwas aufzuführen habt, wer wird euch als Zuschauer kommen?
Entschuldigt ihr Herren, die ihr angesehener, klüger und reicher als wir; wir wollen uns in keinen Wettkampf mit euch einlassen; zeigt uns ein kleines Plätzchen in dem Gassenlabyrinth dieser großen Stadt, wo wir unseren Altar aufstellen können; irgendwo in einem fernen Vorstadtwinkel, wo unsere Armut euere Augen nicht beleidigen wird und wir niemand im Wege stehen; wir bauen uns dann schon ein kleines bescheidenes Haus hin, uns wird es schön genug dünken; wir suchen uns Schauspieler dafür – wir wagen es nicht, sie Künstler zu nennen und stellen keine hohen Anforderungen an sie; auch sie werden sich mit wenigem begnügen und uns zu Liebe fleißig und strebsam sein, vielleicht wird noch mit der Zeit etwas aus ihnen.
In der Josephvorstadt an der Kerepeser Straße wurde ein bescheidener Baugrund ausgemessen für die künftige Wohnstädte der vaterländischen Kunst. Wenn manchmal eine oder die andere herrschaftliche Equipage aus der inneren Stadt sich dahin verirrte, blickten die darin Sitzenden verwundert auf die dort aufgetürmten Stein- und Ziegelhaufen; niemand glaubte, es könne etwas daraus werden. »Eine ins Stocken geratene Bauruine am Ende der Stadt!« sagten lachend, denen es leicht war, zu lachen; »wenn es fertig wird, wird es gut sein zu einem Schaukasten,« scherzten die praktischen Leute, während die Sachverständigen im voraus überzeugt waren, die ganze Geschichte werde einstürzen, denn die Mauern seien nicht stark genug, um das Dach zu tragen.
Und siehe, die Mauern wurden doch aufgebaut, auch das Dach wurde aufgesetzt und stürzte nicht ein; das Gebäude stand fertig. »Aber es wird nie eröffnet werden!« sagten die Hellseher. Es wurde ein Termin dafür angesetzt, er verstrich und wurde nicht eingehalten. Da gab es ein Gelächter und ein Hohngeschrei. Die Trägheit und die Teilnahmlosigkeit gefällt sich immer darin, Pessimist zu sein, nur um nicht nötig zu haben, bei einer Sache mitzuhelfen; lieber erklärt sie im voraus ihr Zustandekommen für unmöglich.
Endlich wurde der 22. August des genannten Jahres als der unwiderrufliche Termin verkündet, an welchem die Pforten des vaterländischen Kunsttempels geöffnet werden sollten.
An der Spitze des Unternehmens standen Männer von eisernem Willen; das ausgesprochene Wort mußte gehalten werden. Gruppen von Zweiflern standen mit lächelnden Gesichtern auf der Kerepeser Straße am Morgen des Tages, an dessen Abend die verkündete Feier stattfinden sollte. Und sie hatten Grund, zu lächeln. Vor ihnen stand ein plumpes, viereckiges Gebäude, noch nicht mit Mörtel beworfen, geschweige denn getüncht; rings herum im Außenhofe Baugerüste, Stein- und Ziegelhaufen, Kalkgruben, Sandhügel, Bretter und Lattenbruchstücke. Wer Arm und Beine riskierend, einen Blick in das Innere warf, der kam zu einem prächtigen Konzert: Hobel und Säge, Hammer und Beil waren in voller Arbeit an den die Welt bedeutenden Brettern; die hämmernden und zimmernden Werkleute stießen links und rechts irgend eine phantastische Gestalt zur Seite, die sich mit einer Papierrolle in der Hand auf die Bühne verirrt hatte. Vielleicht ein Priester Thaliens? Die Armen, die heute noch hier spielen wollen! Frommer Wunsch das! Und vor wem? Wo sollen die Zuschauer herkommen? Die Bürger können nicht ungarisch, die kommen nicht her; die elegante Welt ist heute zu Seiner Gnaden, dem Herrn Rat Köcserepy, geladen, der in seinem prächtigen Weinberge aus dem Schwabenberge in Ofen eine großartige Unterhaltung veranstaltet, zu der alle Notabilitäten gerufen sind; diese also werden bei der Theatereröffnung nicht anwesend sein. Die Juraten haben kein Geld. Dann wären noch die Handwerksgesellen und das gemeine Volk; aber seit einigen Tagen schon geht in der Stadt das falsche Gerücht – niemand weiß, wie es entstanden – die Logen seien so schwach gebaut, daß, wenn zufällig die Galerien sich füllen sollten, der Einsturz zu befürchten sei. Arme Schauspieler, wird es dann ein Wunder sein, wenn ihr » Arpáds Erwachen« den leeren Wänden vorspielen werdet!
Endlich kam der Abend heran, die mit vielem Herzklopfen erwartete Stunde schlug, die Pforten des ungarischen Kunsttempels öffneten sich und siehe, das Haus füllte sich in allen Räumen und stürzte nicht ein, so schwer es auch zu tragen hatte an dem Übergewicht der Freude. Da saßen die Magnaten in ihren mit Sammet ausgeschlagenen Logen, holde Damen, deren Schwanenbusen ein bisher nicht empfundenes Freudegefühl hob; da waren auf der dicht besetzten Galerie schlichte Leute, die sechs Tage der Woche gearbeitet, um den siebenten mitfeiern zu können; da saß der greise Edelmann, der den Lieblingstraum seiner Jugend verwirklicht sah und der greise Taglöhner, der unentgeltlich am Bau des Nationaltheaters gearbeitet hatte. Und jeder war erfreut, den andern dort zu finden, der große Herr den armen Teufel, der gemeine Mann den Adeligen, und im rosigen Lichte heiliger Freude erschien alles so schön, so groß; welch herrlicher Bau, welch stolze Hallen, welche Pracht, welcher Glanz! Und ach, jetzt schwebt der Vorhang in die Höhe, das erste Wort ertönt, O! Wie schön es klingt, wie schön! Seht, seht doch um euch: was glänzt da in jedem Auge? O lasset sie glänzen, die kostbare Perle, den kostbaren Diamant, schöne Frauen! Das aufgeführte Stück ist reich an Schönheiten; gewiß, es ist ein Meisterwerk. Sagt nicht, anderswo giebt es bessere, wir sprechen von dem unsrigen. Welch schöne Dekorationen, welch treffliche Maschinerien, wie geschmackvoll ist das ganze Arrangement! Alles ist überraschend. Was noch fehlt, wird mit der Zeit werden; Dichter und Künstler werden durch Fleiß und Studium den Geist heben, das Publikum wird sich wohlwollend und nachsichtig zeigen gegen sie, wohl wissend, daß sie nach Vervollkommnung streben und guten Rat gern annehmen. Sind doch alle, die hier im gemeinsamen Hause erschienen, gleichsam die Glieder einer großen Familie; ist doch die noch in den Windeln liegende Kunst, die jetzt zum erstenmal ihre Lippen zur Rede öffnet, gleichsam das Kind eines jeden von uns, das wir gemeinschaftlich erziehen, kleiden, warten, und tadeln wir es auch zuweilen, so geschieht es nur, weil wir es so sehr lieben.
In dieser ruhigen Freude verstrich der Abend. Wem wäre es auch eingefallen, zu kritisieren? Der Spott, die Teilnahmlosigkeit, die Gleichgültigkeit waren draußen geblieben. Drinnen war nur Liebe und stummes Entzücken, und eine Freude war es, zu sehen, daß das neue Haus zu klein für alle die Liebe, die sich hineindrängte; noch vor wenigen Stunden hatte man gefürchtet, es werde zu groß und zu weit sein für – die Teilnahmlosigkeit.
Alles war versunken in aufhorchende Lust, als ob im ganzen Publikum, oben und unten, nur ein Herz schlage; – »aber in dieser lautlosen Stille lag Staunen, tiefes Gefühl und die Würde eines sich selbst achtenden Volkes,« sagt der Dichter.
Und als die letzten Worte der dargestellten hehren Dichtung verhallten, schien ein wohlthuender Seufzer den herabsinkenden Vorhang zu bewegen; als die Zuschauer das Haus verließen, war niemand, der nicht noch einen Blick darauf zurückgeworfen hätte; fürwahr, auch von außen ist es schön; haben Mond und Sterne vielleicht mit ihrem Licht in ein paar Stunden es so verschönert? und wie großartig es ist, als wäre es seit gestern höher geworden.
Mond- und Sternenschein begleitete das freudig erregte Volk nach Hause; selbst der Himmel schien klarer als sonst, und wenn Mond und Sterne glänzen, wer könnte da widerstehen, zum Himmel emporzublicken?
Manchmal stieg zwischen den sanft leuchtenden, weißen Sternen eine feurige Rakete um die andere empor von dem fernen Gipfel des Schwabenberges, als wollten sie den ruhigen Glanz der Himmelslichter stören, indem sie krachend und farbige Leuchtkugeln ausstreuend zerplatzten.
Wer unterhält sich dort?
2.
Vornehme Unterhaltung.
Begeben wir uns jetzt in die Sommerwohnung Seiner Gnaden des Herrn Daniel Köcserepy.
Es ist doch seltsam, und man kann sagen, ein wahrer Skandal, daß es der Phantasie des Dichters freisteht, uneingeladen in jede noch so vornehme Wohnung einzutreten; umsonst stellt man vor dieselbe einen Portier, umsonst schreibt man aus eine große Tafel: »Fremden ist der Eingang verboten!« umsonst verteilt man Einladungsbillete, nur gültig für die Person des Eingeladenen: so ein Dichtermensch macht keine Umstände, ohne zu fragen und zu hören, schreitet er mitten durch die ganzesalva guardia, und nicht genug, daß seine Person sich eindrängt, er schleppt auch noch sein ganzes Lesepublikum mit, worunter sich auch Individuen aus dem niederen Adel, vielleicht auch aus dem Bürgerstande und selbst aus dermisera contribuens plebsbefinden, und ohne auch nur dem Herrn und der Frau des Hauses ihre Höflichkeit zu bezeugen, durchwandeln sie die prächtigen Säle – mancher Leser hat vielleicht nicht einmal Handschuhe an – gucken bei jeder Thür hinein, belauschen die geheimsten Unterredungen, kritisieren, machen Randglossen zu dem Gesehenen und Gehörten! In der That, dagegen sollte ein Verbot erlassen werden.
Seine Gnaden Herr Daniel Köcserepy, oder wie er seinen Namen selbst zu schreiben Pflegt: Daniel Keöcherepy, war in seinen jungen Jahren eben nicht an Luxus gewöhnt. Diejenigen, welche so unverschämt sind, sich daran zu erinnern, wissen ganz gut, daß er in seiner Jugend Erzieher gewesen in einem Pester Bürgerhause, und daß er damals ganz einfach Herr Daniel Cserép hieß. Die Hausfrau war eine bejahrte Matrone, und der junge Hofmeister war nicht faul, sich bei ihr in Gunst zu setzen; die Frau heiratete ihn und setzte ihn mit Umgehung der eigenen Kinder zum Universalerben ein. Bald darauf starb die Frau – wie? wodurch? das kümmert uns hier nicht; die Kinder suchten sich fortzubringen, so gut jedes vermochte, der reiche Erbe aber ging nun daran, seine Carriere zu machen.
Wie er hierauf zu dem Posten gelangte, den er jetzt inne hat, wäre eine lange Geschichte. Es heißt, daß der Herr Rat seiner Zeit ein stattlicher Bursche gewesen, der bei den Damen in großer Gunst stand; als er im ***er Komitat bald nachher zum Honorar Vicenotär ernannt wurde, entstand unter den dortigen Schönen ein förmlicher Wettkampf. Der erste Vicegespan hatte zwei Töchter, der zweite besaß deren drei, Daniel machte allen fünfen den Hof. Beide Vicegespane protegierten den hoffnungsvollen jungen Mann. Es währte nicht lange, so wurde er Obernotar. Bei der nächsten Restauration wollte der zweite Vicegespan den ersten stürzen und an seine Stelle kommen; beide legten ihre Angelegenheit in die Hände Köcserepys und Köcserepy stürzte alle beide. Er wurde als dritter kandidiert, jene zwei fielen durch, und er wurde erster Vicegespan. Von da war nur mehr ein Schritt zur Ratswürde. Bald darauf heiratete er zum zweitenmale; natürlich traf er seine Wahl weder unter den zwei, noch unter den drei Exvicegespanstöchtern, sondern er nahm eine vornehme Excellenzfrau, eine schöne, reiche und stolze Dame, und sein Haus ist jetzt eines der ersten in Pest.
Zu all diesem Gerede müssen wir unsererseits in voller Unparteilichkeit hinzufügen, daß Herr Köcserepy einen ausgezeichneten Verstand besitzt, und da diesem eine so feste Willenskraft, wie die seinige, sich beigesellt, so haben wir uns eben nicht zu wundern über das Glück, das ihn auf seiner Lebensbahn begleitete.
Rasche Auffassung und geschicktes Benützen der Umstände, die Kunst, fremde Interessen mit den seinigen zu verflechten und Kaltblütigkeit genug, um auch die am festesten geknüpften Bande zu zerreißen, sobald man bemerkt, der Ziehende zu sein und nicht mehr der Gezogene, dies und hundert andere geistige Ressourcen, die wir nicht alle aufzählen können, haben mehr als einmal schon Wunder raschen Emporkommens bewirkt; auch glaube man ja nicht, daß auf solche plötzlich Emporgestiegene von oben mit Geringschätzung herabgesehen wird, man fürchtet sich vielmehr vor ihnen, denn niemand weiß, wie hoch sie noch steigen können. In den höheren Kreisen imponieren gerade die Parvenus am meisten; jedermann sagt sich verblüfft, daß dieser Mensch durch sich selbst dahin gelangt ist, wohin andere der liebe Gott gestellt hat.
Köcserepys Haus war eines der besuchtesten, sein Salon das Orakel der Modewelt. Bevor er nicht seine Soireen eröffnet, wäre es ein Verstoß, die Saison zu beginnen; wer auf seinen glänzenden Bällen in der Liste der Eingeladenen fehlt, den vermögen alle Herrlichkeiten des Karnevals nicht zu trösten; was Herrn Köcserepy und seiner Gemahlin, der Excellenzfrau, gefällt, das wird mode, das macht jeder nach und findet es schön und nobel.
Nur eine Schwäche besitzt der gnädige Herr; wir nennen es geradezu seine Schwäche, weil er selbst seinen Stolz darein setzt. Seine erste Frau war eine bürgerliche gewesen, eine Pester Kaufmannswitwe. Aus der Zeit seiner Hofmeisterschaft sind ihm viele unangenehme Rückerinnerungen geblieben an jene umsichtigen Herren, welche im Hause seiner seligen ersten Frau aus und eingingen, und mit ihren wohlweisen Reden die Frau davon abzubringen gesucht hatten, den Erzieher ihrer Kinder zum Manne zu nehmen; später hatten sie ihm bei der Testamentsvollstreckung viele Ungelegenheiten verursacht, indem sie zu gunsten der enterbten Kinder sprachen und prozessierten, bei welcher Gelegenheit sie dem jungen Herrn viele unangenehme Wahrheiten ins Gesicht sagten.
Seitdem hatte das Glück den wackern Herrn emporgetragen, und als er das zweite Mal nach Pest zurückkehrte, stand er schon in unerreichbarer Höhe über all den Gewürzkrämern, Baumeistern, Kaufleuten oder Weinhändlern; er konnte ihnen aber auch jetzt noch die alten Beleidigungen, ihre damalige Tücke nicht vergessen, und er hatte gute Gelegenheit, es ihnen auf jedem Schritt und Tritt heimzuzahlen.
Mitten in ihre Häuserreihe baute er seinen Palast hin, der prachtvoller war, als alle anderen; täglich konnten die Herren Gevatter ihn in eleganter Equipage vorüberfahren sehen. Hinten auf der Kutsche stand ein goldverschnürter Heiduck. Dem einstmaligen Erzieher that es wohl, zu denken, wie neidisch ihm jetzt die Herren Gevatter sein mögen.
Von den schlichten Bürgern waren viele durch Fleiß und Glück zu einem nicht zu verachtenden Vermögen gelangt, und obwohl sie es nicht verstanden, mit ihrem Reichtum Staat zu machen, war ihnen Wohlleben und Komfort doch nicht unbekannt.
Schon vor einigen Jahrzehnten, als Handel und Industrie in Pest einen lebhafteren Aufschwung nahmen, war es bei den wohlhabenderen Pester Bürgern üblich geworden, auf den Ofener Gebirgen Gründe anzukaufen und daselbst Gärten anzulegen und Sommerwohnungen zu bauen. Für diejenigen, denen ihr Geschäft so viel einträgt, um einen Überschuß der Einnahmen auf Genüsse verwenden zu können, denen aber eben diese Geschäfte nicht erlauben, sich auf längere Zeit von ihrem Wohnort zu entfernen, sind diese Sommerwohnungen ganz zweckmäßig ausgedacht. Große Herren, die von niemand abhängen, gehen des Sommers auf ihre Güter oder in Bäder, Leute dagegen, deren Herrschaft ein Verkaufsladen, oder manchmal auch nur eine Feder ist, suchen die Sommerfrische dort, wo sie ihnen am nächsten ist, und von wo aus sie sozusagen ihr Haus nicht aus dem Gesichte verlieren.
Die Pester Bürgerschaft betrachtet daher seit lange her das Ofener Schwabengebirge wie ihr gelobtes Land. Bei Annäherung des Frühlings spricht sie mit wahrer Begeisterung von den schon ausschlagenden Bäumen, von dem frischen Quellwasser, an das der Gedanke, wenn man das schweflichte und salitrige Wasser der Pester Brunnen zu trinken verurteilt ist, schon ein Labsal ist, von dem Schlagen der Nachtigallen, von der schönen Aussicht und der herrlichen Luft, die Arznei für jede Krankheit, in der das innere Behagen emporsprießt wie das junge Gras, Hypochondrie und Hämorrhoiden verschwinden wie Nebel vor der Sonne. Auch der Ärmste unternimmt wenigstens ein paarmal im Jahre die Reise von einer halben Meile dahin, um im weichen Grase ausgestreckt sein mitgenommenes bescheidenes Mahl zu genießen.
Aus der Kenntnis, die wir von einigen Charakterzügen Seiner Gnaden des Herrn Köcserepy bereits besitzen, werden wir uns leicht erklären können, warum er gerade ein Vergnügen darin fand, in diese anspruchslosen Berge eine prachtvolle Villa hineinzubauen.
Mögen diejenigen, welche einst ihm gegenüber die Herren gespielt, seine beneidete Herrlichkeit vor Augen haben und sich gedrückt fühlen durch den von ihm entfalteten Glanz, der ihre elenden Schweizerhäuser in Schatten stellt, mögen sie es nicht mehr wagen dürfen, in ihrem ländlichen Negligé herumzugehen, oder auf ihren Eseln herumzureiten, aus Furcht, einem seiner vornehmen Besuche in den Wurf zu kommen; mögen sie um das stolze Bewußtsein, dort zwischen den Bergen die größten Herren zu sein, sich gebracht sehen und genötigt sein, ihm auch dort entweder aus dem Wege zu gehen oder den Hut vor ihm zu ziehen.
Diese seine Absicht stieß anfangs auf große Schwierigkeiten. Die guten Leute, als sie bemerkten, daß er sich unter ihnen ansiedeln wolle, vereitelten überall seine Käufe, indem sie von ihrem Vorkaufsrechte Gebrauch machten. Endlich gelang es ihm, einen öden Grund zu erstehen, dessen Preis er so in die Höhe getrieben hatte, daß, wem nicht geradezu das Geld ins Fenster fliegt, ihn nicht überbieten konnte. So ließen nun die Herren Gevatter den Grund in seinen Händen und waren neugierig, was er damit anfangen werde.
Das ganze Grundstück war ein dürrer, steiniger Erdfleck, dessen einzige spärliche Vegetation Kletten und wilder Salbei bildeten; je tiefer man grub, auf so härteres Gestein kam man; beide Abhänge waren durch Wasserrisse zerklüftet und seit Menschengedenken war kein Gras dort gewachsen.
Der Herr Rat brauchte nur ein paar Jahre, um diese Wüstenei, die nur für einen Hexensabbath geeignet schien, in ein Paradies umzuwandeln. Mit Geld läßt sich alles besiegen, selbst die Natur. Hunderte von Arbeitern waren in Thätigkeit, die Steinschichten wurden auf Wagen geladen und damit die tiefen Wasserrisse ausgefüllt; in tausend und tausend Wagenladungen wurde frische Walderde auf den magern Grund geführt, die abschüssigen Stellen wurden mit Steinmauern eingefaßt; aus allen Teilen des Landes wurden große, fruchttragende Obstbäume mit äußerster Sorgfalt und schweren Kosten in den Garten geschafft, in dessen Mitte ein pomphaftes Kastell in orientalischem Baustile sich erhob, und binnen wenigen Jahren entstanden überall auf der kahlen, öden Fläche blühende Haine, Gruppen von Obstbäumen, Rasenparkette und Laubengänge von edlen Reben; es war ein wahrhaftiges Eden, das jedermann einen unwillkürlichen Seufzer entlockte, der keines solchen Besitzes sich rühmen konnte.
Die benachbarten Villen und Gärten wurden natürlich von so verschwenderischen Schönheiten verdunkelt, doch trösteten sich die guten Herren Gevatter damit, daß, während der Herr Rat seinen zwölf Joch umfassenden Steinbruch in einen Pomeranzenhain umschuf, seine Gemahlin, die Excellenzfrau, ihre Güter im Szathmárer Komitate mit einer halben Million Schulden belastet und daß die herrschaftliche Wolle schon auf sechs Jahre voraus verschleudert ist; wäre es nicht hundertmal klüger gewesen, den öden Fleck den Kletten und dein wilden Salbei zu überlassen, als mit eitlem Pomp sich daraus anzusiedeln, und es sich mehr Mühe tosten zu lassen, als selbst auf die hängenden Gärten der Semiramis verwendet worden sein dürfte. So oft der Herr Rat einen in seinem eigenen Garten gewachsenen Apfel verkostet, kann er sagen, daß er goldene Äpfel ißt, und wenn er in seinen Anlagen spazieren geht, daß er auf Silbersand einherwandle.
Mit solchen Dingen tröstete sich der armselige Neid ...
Im Sommer 1837 hatten die Bewohner der Umgegend noch besonders triftige Gründe, den benachbarten prächtigen Garten mit scheelen Blicken zu betrachten.
Im Frühling dieses Jahres, als die Blüten bereits Frucht angesetzt hatten, fiel Mitte Mai drei Nächte hintereinander Frost; die Obstbäume, als wären sie versengt worden, erfroren allewärts, das unreife Obst fiel herab, den Boden mit einer traurigen Lese bedeckend, die Blätter schrumpften zusammen, alle schwächeren und heiklicheren Bäume standen traurig da mit fahlem, verwelktem Laube.
Nur der Garten des gnädigen Herrn blieb grün; Köcserepy hatte in jenen grausamen Frostnächten für Geld aufgenommene Leute in seinen Garten geschickt, welche unter jedem Baume Strohbündel anzündeten, deren dicht aufsteigender Rauch das Niederfallen des verderblichen Reifes verhinderte. Die mühsame Operation kostete ihm einige tausend Gulden; als aber das traurige Bild allgemeiner Zerstörung in der angrenzenden Vegetation hervortrat, stand Köcserepys Part und Garten wie eine grüne Oase da, und während im ganzen Umkreise kein Obst an den Bäumen zu sehen war, sah man gegen Ende August die Äste seiner Bäume von der Last reifer Früchte darniedergebeugt, und strotzten die Laubengänge von Trauben in allen Farben.
In der ganzen Umgegend sprach man von dem gesegneten Garten, niemand hatte ähnliches aufzuweisen und von weit her kamen Fremde, sich die Erlaubnis erbittend, die merkwürdige Erscheinung besichtigen zu dürfen. Als daher der Herr Rat zum 22. August, dem Tage der Eröffnung des Nationaltheaters, die ganze Pester vornehme Welt in seine Schwabenberger Villa zu einem lustigen Gartenfeste eingeladen hatte, hätte man wohl darauf wetten dürfen, daß keiner der Eingeladenen fehlen und daher die vornehme Welt bei jener Nationalfeier nur höchst spärlich vertreten sein werde.
In dem Augenblicke, wo wir eintreffen, finden wir bereits eine schone zahlreiche Gesellschaft versammelt und in dem Lustgarten zerstreut; wie es die Regeln des Anstandes erheischen, verfügen auch wir uns zuerst in die Hallen der Villa, und wollen erst dann die in den Parklabyrinthen, Glorietten und Eremitagen kampierenden Gruppen aufsuchen.
In der Vorhalle, von der ein aufgespannter großer chinesischer, gestreifter Schirm die heißen Sonnenstrahlen abhält, müssen wir uns durch einen Schwarm gaffender Lakaien Bahn brechen, von deren buntscheckigen Livreen – wenn sich jemand dafür interessieren sollte – eine Kolibrisammlung das entsprechendste Bild liefert.
Bei der Ankunft von Herrschaften stellen sie sich eiligst in Positur und schneiden höfliche Gesichter; sowie aber der Gast zur Thür hineinbekomplimentiert ist, treten sie wieder in einen Knäuel zusammen, um zu kichern und einander zu erzählen: wie die Herrschaft eines jeden beschaffen; wie oft in der Woche dort und – hier – für die Dienerschaft Grütze gekocht wird; an welche« Fräulein sie Liebesbriefe zu bestellen haben; was für Reden die abgewiesenen Gläubiger bei diesem oder jenem im Munde geführt; warum diese oder jene vornehme Heirat nicht zustande gekommen; wieviel der Graf soundso seinem Schneider schuldig; womit dieser oder jener Baron sich wäscht und worin er badet, und dergleichen mehr. Von Köchinnen und Stubenmädchen ist nicht die Rede; das ist ein Thema für die gnädigen Herren; für Bediente wäre es derogierend.
Doch gehen wir weiter.
In dem großen Saale, in den wir jetzt eintreten, würde uns die verschwenderische Pracht überraschen, welche hier von den Arabesken der Vorhänge bis herab zu den gestickten Fußteppichen mit dem ausgesuchtesten Geschmack aufgehäuft ist (denn es genügt nicht, kostbare Sachen zu kaufen, im Arrangement liegt der wahre Zauber der Eleganz und das läßt sich nicht erlernen; dieselben Prachtstücke würden im Saal eines Gewürzkrämers sich ausnehmen wie eine Gewölbsauslage, während sie, nach dem Geschmacke der mit dem Excellenztitel aufgewachsenen vornehmen Dame geordnet, uns in einen Feenpalast versetzen, wie nur lustige Elfen ihn aus Gold, Silber und Seide zu zaubern verstehen und ihr Geheimnis sich von keinem Sterblichen ablauschen lassen); alles, wie gesagt, würde uns hier überraschen, wenn unser Auge nicht schon von einem anderen Schauspiele gefesselt wäre. Welche Fülle von Reiz und Anmut! Wohin wir blicken, begegnet unser Auge bezaubernden Schönheiten, Vor der Schönheit und den Reizen der Frauenwelt unserer höheren Kreise müssen wir uns beugen! Diese edeln Bewegungen, diese leichte, sichere Konversation, diese gewinnende Hoheit ist ihr ausschließliches Eigentum. Von ihrem zarten Antlitze wird die schädliche Einwirkung sengender Sonnenstrahlen und drückender Lebenssorgen gleich fern gehalten; ihre jungen Jahre sind nur der inneren Veredelung gewidmet, die auch ihre körperlichen Reize vergeistigt; in ihre Kreise tragen unsere jungen Kavaliere nicht jene zügellose Freiheit der Konversation, mit der sie die unteren Gesellschaftssphären beglücken; sie leben in einer idealen Welt, ist es zu wundern, daß sie selbst zu Idealen werden, so sehr, daß selbst der ewig kritisierende schwarzblütige Jünger des Momus bei ihrem Anblicke sich entwaffnet fühlt und ganz vergißt, daß er seine Leser und die glänzende Gesellschaft einander noch nicht vorgestellt hat.
Zum Glück hilft uns der Kammerdiener aus der Verlegenheit, der soeben in feierlichem Tone einen neu angelangten Gast anmeldet!
– Seine Hochgeboren, Herr Baron Theodor Berzy!
Und in demselben Augenblicke tritt ein von jedermann gekanntes, allgemein beliebtes Individuum ein, mit turmartig emporgekräuselter Frisur, genialen Gesichtszügen, denen ein aufwärts stehender Schnurrbart und ein an der Unterlippe allein stehen gebliebener Zwickelbart, als waren drei Malerpinsel triangulär dort aufgeklebt, ein vollkommen exotisches Aussehen verleihen; der Baron ist übrigens auchen profilleicht zu erkennen an den über alle Begriffe hoch aufsteigenden Vatermördern, obwohl dann von dem Gesicht selbst nur wenig zu sehen ist; das Interessante seiner Erscheinung wird noch dadurch erhöht, daß er sich nie trägt wie andere Menschenkinder. Gegenwärtig präsentiert er sich uns in dunkelblauem Frack mit engen, bis zu den Handknöcheln herabreichenden Ärmeln und sich rückwärts kreuzenden Schwanzflügeln; um den Hals ist, der erstickenden Hitze zum Trotz, ein prachtvoller weißer Seidenshawl gewunden, der sich in malerischen Verschlingungen unter dem Umschlage der weißen Weste verliert und mit einer kolossalen Busennadel – den Atlas mit der Weltkugel darstellend – festgesteckt ist. Die knappen, bis zum Knöchel reichenden schwarzen Gamaschen lassen rosafarben gewürfelte seidene Strümpfe bis zu den Rändern der glänzenden Lackschuhe hervorblicken und was uns am meisten an ihm auffallen muß, ist, daß er Ohrringe trägt, und zwar keine kleinen goldenen Reife, wie sie mitunter aus Gesundheitsrücksichten auch von Männern getragen zu werden pflegen, sondern lange brillantene Ohrgehänge, welche dem jungen Kavalier ein an gewisse Kazikenhäuptlinge erinnerndes Aussehen verleihen.
Es dauert keine Minute und er ist im Salon bereits wie zu Hause. Für ihn giebt es niemand Unbekannten, denn wen er nicht kennt, der existiert gar nicht für ihn.
Halten wir uns jetzt an seiner Seite, denn er wird uns überall hintragen, wo nur eine interessante Persönlichkeit sich befindet, und so gelangen wir auf die leichteste Art dazu, in der uns unbekannten Welt uns zurechtzufinden.
Zuerst sind es die Frau und der Herr vom Hause, welchen der geniale Baron die Ehre seiner Bewillkommnung erweist.
Eveline – das ist der Name der gnädigen Frau – empfing mit huldreich herablassendem Blicke den jungen Kavalier, der mit einer unnachahmlichen Haupt- und Nackenbewegung sich verbeugte. Köcserepy ging dem Eintretenden zwei Schritte weit entgegen, schüttelte ihm zuerst die eine, dann beide Hände und nannte ihn seinen lieben Freund.
Köcserepy hat das Aussehen eines in der Blüte seiner Jahre stehenden Mannes, obwohl er in Wirklichkeit die Fünfzig schon überschritten hat, allein die kunstvolle kastanienbraune Perücke, das glatt rasierte Gesicht, die tadellos eingesetzten Zähne lassen ihn um vieles jünger erscheinen und im ersten Moment das nicht maskierbare Embonpoint des Unterleibes übersehen. Dazu das süße Lächeln, das ewig auf seinen Lippen schwebt, als wenn er dazu berufen wäre, wenn die Sonne nicht scheint, die Erde mit seinem Lächeln zu beleuchten. Er ist unaussprechlich erfreut, daß seine werten Gäste seine bescheidene Einladung nicht verschmäht haben; aber so tief er das Haupt zu beugen versteht, so hoch weiß er es dann auch wieder emporzuwerfen und erwartet, daß jedes Kompliment ihm erwidert werde.
Lassen wir ihn jetzt anderswohin lächeln, neu anlangende Gäste mit süßen Reden und süßen Mienen beglücken und setzen wir unseren Rundgang unter Führung des Barons fort.
Die gnädige Frau ist eine Dame in den Vierzigen und kann ihren Jahren zum Trotz immer noch für eine Schönheit gelten; ihre ältesten Bekannten finden keine andere Veränderung an ihr, als daß ihre Formen voller geworden. Ihre regelmäßigen Gesichtszüge haben stets den Ausdruck, den sie selbst ihnen zu geben wünscht, ihre großen schwarzen Augen sehen einem bis in den Grund des Herzens und sind ebenso sehr auf ihrer Hut, niemand durch sich in das Innere blicken zu lassen.
Den Baron streifte ein Lächeln von diesem schönen, kalten Gesicht, Dies Lächeln hatte für ihn ebensowenig zu bedeuten, wie für andere; er aber fühlte sich überglücklich dadurch.
– Meine Gnädige, ich bedauere nur eines an diesem schönen Tage, und das ist, daß ich nicht Adam getauft worden.
Die Dame blickte fragend auf den spaßigen Kavalier, während die Umstehenden neugierig die Köpfe nach ihm wandten, um zu erfahren, was ihm an seinem Taufnamen nicht recht sei.
– Denn dann hätte ich, in den Garten Euer Gnaden eintretend, sagen können, daß heute Adam ins Paradies zurückgekehrt sei.
– Ein wahrhaft Byronscher Gedanke! rief Köcserepy, der anderswohin zu sprechen und anderswohin zu hören verstand. (Warum das ein Byronscher Einfall sein sollte, davon wußte er sich schwerlich Rechenschaft zu geben, denn von Byron wußte er eben nur so viel, daß er die Dardanellen durchschwommen und wahrscheinlich ebenso ein Sonderling gewesen, wie Baron Berzy; der Herr Rat kümmerte sich überhaupt weder um ausländische noch inländische schriftstellerische Berühmtheiten, obwohl er sich gern das Ansehen gab, sie alle zu kennen.)
Neben der Frau Rätin saß in einem Fauteuil eine bejahrte Matrone, welche bereits vollkommen allen Ansprüchen weiblicher Gefallsucht entsagt zu haben schien, denn sie nahm sich nicht einmal mehr die Mühe, in ihrem Anzug mit der Mode zu gehen, und trug noch immer dasselbe lavendelfarbene Seidenkleid, mit dem sie auf dem Wiener Kongreß brilliert hatte; nur mit Mühe hält sie sich in dem Armstuhl aufrecht und vermag ohne fremden Beistand keine Bewegung auszuführen; aber trotzdem trägt sie noch Verlangen nach großen Gesellschaften und ist so glücklich, wenn sie durch das silberne Horn, das sie beständig in der Hand hält, ein oder das andere Wörtchen erhaschen kann, von der sie umschwirrenden lebhaften Konversation.
– Was hat Alfred gesagt? rief sie, als sie sah, daß über etwas gelacht wurde; hat Alfred wieder einen Witz gemacht? – und dabei gelang es ihr, einen der Frackschoße des Barons zu erwischen, an dem sie ihn zu sich zog, während sie das Horn ans Ohr setzte.
Der gefangene Ritter schrie in das Gehörrohr: Ihr unterthänigster Diener, Madame!
– Ah, Sie sind in der That immer witzig, erwiderte die alte Dame und lachte so herzlich, als ob sie jetzt wisse, worüber die anderen gelacht. Also Sie kommen aus dem Kasino?
(Sie hatte verstanden, der Baron komme aus dem Kasino.)
– Ich nicht, aber Mitzislaw kommt von dort, erwiderte der in die Falle Geratene, und warf durch eine geschickte Diversion der immer fragenden und alles falsch verstehenden Dame einen jungen Mann, der dort herumstand, in die Fangarme, an dem nichts Merkwürdiges, als daß sein Schnurrbart nach abwärts gekrümmt ist, und daß man ihn ins Gesicht Mitzislaw ruft (offenbar hatten seine Taufpaten im ungarischen Kalender keinen passenden Namen für ihn finden können), während man hinter seinem Rücken mit den fünf ersten Buchstaben seines Vornamens sich begnügt. Sonst ist er ein guter Quadrilltänzer und tanzt mit jedermann, nur muß ihm gesagt werden, mit wem er tanzen soll; auch ein angenehmer Gesellschafter ist er, da er selbst wenig spricht und den andern sprechen läßt; auf den Landtagen fungiert er alsAbsentium Ablegatus.
Nachdem so der Baron sich geschickt mit diesem interessanten Individuum ausgewechselt hatte, kehrte er selbst zur Frau Rätin zurück, seine Hand leicht aus ihre Stuhllehne legend.
An ihren Augen war zu merken, daß sie irgend einen angenehmen Gegenstand mit ihren Blicken verfolgte. Zwei Mädchen wandelten im Saal auf und ab, die Arme umeinander geschlungen. Das eine Mädchen war Laura Ilvay, die Enkelin der alten Dame, eine hohe, stolze Gestalt, eine jener Schönheiten, die man nur mit Wehmut ansehen kann. Wer dieses eigentümliche gezirkelte Rot der Wangen, diese schwellenden Korallenlippen betrachtet, wer beim Tanz diese schlanke, beinahe bis zur Formlosigkeit zusammengeschnürte Taille umfaßt und in seinen Fingern das fieberhafte Pochen der Lungen hindurchfühlt, der muß von tiefem Mitleid ergriffen werden gegen ein Geschöpf, von dem er mit Gewißheit weiß, daß es sterben wird, bevor es das Leben noch genossen hat. Nach jedem, Ball tritt Blut auf ihre Lippen und während des langen Cotillons hören ihre Tänzer jenes gefährliche, trockene Hüsteln, das an den Sarg mahnt; wer denkt aber in solchen Augenblicken daran?
Das andere Mädchen ist noch kaum mehr als ein Kind, höchstens zwölf Jahre alt, aber hoch aufgeschossen und des raschen Wachstums wegen ungewöhnlich zart und schwächlich. Das längliche, blasse Gesicht trägt das unverkennbare Gepräge in sich verschlossener Gefühlsinnigkeit; auf den schmalen, schön geschnittenen Lippen schwebt der Ausdruck kindlicher Melancholie; die alabasterweiße Stirne, die feingeschweiften Augenbrauen vereinigen sich zu einem harmonisch schönen Ganzen.
Es ist das die Tochter der Excellenzfrau von ihrem zweiten Gemahl, dem Herrn Rat.
Zwischen Laura und Wilhelmine liegt ein Abstand von mindestens zwölf Jahren, dennoch halten sie zusammen und plaudern miteinander, als wären sie die vertrautesten Spielgenossinnen. Wilma will älter scheinen, als sie ist, sie meidet die Gesellschaft von Kindern ihres Alters und schließt sich immer an Erwachsene an; bei Laura tritt der umgekehrte Fall ein und so sind die beiden Mädchen die besten Freundinnen miteinander, wie man zu sagen pflegt.
Der Baron bemerkte im Gesichte der Frau Rätin jenen aufleuchtenden Strahl mütterlicher Zärtlichkeit, welcher beim Anblick ihrer Tochter die Kälte der marmornen Züge milderte; zur Mutter gewendet, sagte er mit dem Tone der Bewunderung: welches Ideal von einem Kinde! Dies Gesicht voll Ernst und Hoheit gleicht ganz der Hedwig von Anjou, deren Porträt ich im Krakauer Dome sah.
Die Mutter lächelte bei diesen schmeichelhaften Worten, auch der Herr Rat rieb sich erfreut die Hände, nur hätte er gern gewußt, wer denn eigentlich diese Hedwig von Anjou gewesen sein mag.
– Eine Heilige und eine Königin! sagte Berzy, als käme er der Frage Köcserepys zuvor und kniff sich sein Monocle ins Auge, um diese Schönheit von seltener Vollendung noch genauer bewundern zu können.
Es konnte der Aufmerksamkeit der beiden Mädchen nicht entgehen, daß man von ihnen spreche und auf sie blicke; bei solcher Gelegenheit ist es sehr passend, so zu thun, als glaube man gerufen zu sein und hin zu eilen und zu fragen, was die lieben Anverwandten befehlen. Die Rätin nahm wieder ihr ernstes Gesicht an, denn es wäre nicht gut, wenn die Tochter bemerkte, was die Mutter für sie empfindet; Frau von Ilvay richtete einige Falten und Schleifen an Lauras Anzug zurecht und der Baron, seinen Chapeaubas unter den Arm schiebend, schwebte mit der kleinen Sylphide weiter.
Mitzislaw hatte indessen sich ganz echauffiert, indem er, in das Schallrohr hineinbrüllend, mit schönem, rednerischen Feuer alles erzählte, was seit acht Tagen im Kasino vorgegangen, wobei er in der Regel seine eigene Meinung damit zu unterstützen suchte, daß er den ihm Nächststehenden als Zeugen anrief: »ist's nicht so?« als ob er selbst nicht ganz sicher wäre, ob auch alles wahr, was er gesagt, und nicht ungern die Hälfte davon sich abdisputieren ließe.
Sein ergötzliches Bestreben, der alten Dame sich verständlich zu machen, hatte nach und nach den größern Teil der Gesellschaft um ihn versammelt, was das Unbehagen des jungenAbsentium Ablegatusnicht wenig steigerte.
–A propos! rief eine neue Stimme dazwischen,à propos, heute soll ja in Pest irgend ein ungarisches Theater eröffnet werden, oder was?
Mitzislaw geriet bei dieser Frage in große Verlegenheit; er war zweifelhaft, ob es für ihn schicklich sei, hiervon unterrichtet zu sein oder nicht, und ob es nicht die am meisten Beifall findende Antwort darauf wäre, zu sagen, er wisse davon kein Wort.
Während er nach Luft und guten Rat schnappt, bleibt uns Zeit, den Frager genau zu betrachten.
Es ist dies Seine Wohlgeboren, Herr Gabriel Maßlaczky. Ich bitte sich nicht daran zu stoßen, daß er nur einSpectabilisist; trotzdem ist er einer der angesehensten Männer, ein berühmter Advokat, ein mächtiger Ränkeschmied, dem mehr als einer der Anwesenden viel zu verdanken hat; der Bevollmächtigte mehrerer Magnatenfamilien und überdies ein kühner, unternehmender Geist, der sich mit den Ellbogen in die Gesellschaft drängt.
Der ganze Mensch ist ein Miniaturfigürchen; Hand, Fuß, die ganze werte Person ist winzig, selbst die Stimme ist eine Kinderstimme, und wird nur scharf und kreischend, wenn er zu disputieren anfängt; dann steckt er die eine Hand unter den Frackschoß, während die andere lebhaft gestikuliert; das Blut steigt ihm ins Gesicht und er wird rot bis zum Ohrläppchen; bei großer Gemütsaufregung stellt er sich auf die Fußspitzen und pflegt überhaupt mit jedermann so zu reden, als hätte er einen Kriminalverbrecher vor sich.
– Wie? was? Sie haben nichts davon gehört? begann er das Verhör mit dem ins Gedränge geratenen jungen Mann, sich höher und immer höher aufrichtend. Das ist unmöglich. Kommen Sie nicht aus dem Kasino? Im Kasino aber werden über diesen Gegenstand schon seit mehreren Tagen lebhafte Debatten geführt. Wie man hört, soll Graf Rudolph Szentirmay dort gesagt haben, daß kein ungarischer Magnat, der einen Tropfen Selbstgefühl habe, bei der Eröffnung fehlen dürfe. Was wandelt diesen Szentirmay an? Was versteht er unter Selbstgefühl? Was hat das Selbstgefühl mit Theatergesindel zu schaffen? Ich erleb' es noch, daß sie auch das noch zu einem patriotischen Akt stempeln.
Der Herr Rat, als ein Mann, der auf strengen Anstand hält, empfand es übel, daß derDominus Spectabilisin dieser feinen Gesellschaft so lärmte und er sagte ihm daher lächelnd: und ich möchte mich doch zu wetten getrauen, daß Szentirmay diesen Abend unter uns zubringen wird.
Maßlaczky, die Pointe dieser Äußerung mißverstehend, glaubte, es sei damit beabsichtigt, ihn einzuschüchtern und fing nur um so lauter zu schreien an.
– Desto besser. Ich scheue mich nicht, ihm ins Gesicht zu sagen, daß er, als er von Selbstgefühl sprach, seine Gedanken nicht beisammen hatte.
– Herr Fiskal, bemerkte Baron Berzy, den die lebhafte Konversation herbeigelockt hatte, über Szentirmay ist es nicht geraten, laut zu räsonnieren.
DerSpectabilis, die Hand ins Gilet streckend, antwortete mit großem Pathos: Herr Baron, ich fürchte mich vor niemand und was ich sage, dabei bleibe ich. Graf Szentirmay schießt und schlägt gut: ich aber weiß, daß die Gesetze und ihre Vollstrecker, die Dikasterien, dazu da sind, friedliche Bürger zu beschützen und mich schreckt man mit Waffendrohungen nicht.
Dann, als besänne er sich, daß ähnliche Repliken nicht nach dem Geschmack von Damen, fuhr er, gegen sie gewendet, fort: wo, wie hier, eine so schöne, glänzende Gesellschaft versammelt ist, in der Geistesanmut und Schönheit uns fesseln, kann da einem Manne von Bildung die Wahl schwer fallen zwischen der Einladung des gnädigen Herrn Rates und Ihrer Exzellenz seiner Frau Gemahlin zu einem so genußreichen Feste, und der des Grafen Szentirmay zu einer so faden Unterhaltung?
Dies sollte ein Kompliment für die Gesellschaft sein, das indes eine so große Verantwortung auf Herrn Köcserepys Schultern wälzte, daß dieser sich beeilte, dieselbe von sich abzulehnen.
– O bitte, auch ich bin ein Freund jeder nationalen Bestrebung und obwohl ich es für zweckmäßiger hielte, die Nationalwohlfahrt zuerst im materiellen Fortschritte zu suchen, so möchte ich deshalb doch um die Welt nicht einer abweichenden Ansicht entgegentreten, und wenn ich hatte wissen können, daß diese Feier mit unserer kleinen Unterhaltung kollidieren werde, hätte ich sie lieber auf einen anderen Tag verschoben.
– O, deshalb machen sich Euer Gnaden keine Vorwürfe, beeilte sich der Fiskal, ihm in die Rede zu fallen; ich kann versichern, daß, wenn ich auch nur die Wahl hätte zwischen Federnschleißen und Hingehen, ich doch nicht hingehen würde.
Der Herr Rat beteuerte neuerdings, daß er jedes andere patriotische Unternehmen zu unterstützen bereit sei, nur fange man die Sache nicht beim rechten Ende an.
Derselbe Herr pflegte hinwiederum, wenn er um die Teilnahme an Unternehmungen zur Förderung materieller Interessen angegangen wurde, zu antworten, daß er allerdings ein großer Freund jedes vaterländischen Fortschrittes sei, daß man jedoch zuerst auf dem geistigen Gebiete beginnen sollte.
Die Ankunft neuer Gäste lenkte jetzt plötzlich die Aufmerksamkeit anderswohin; draußen war Wagengerassel und Peitschenknallen vernehmbar; der Herr Obergespan Tarnaváry, der schon seit länger als zwanzig Jahren jeden Sommer mit seiner Familie im Ofener Kaiserbad zubringt und kein anderes Bad besucht, kam in vierspänniger Karosse auf die Terasse angefahren.
Im Fond des Wagens saß der Herr Obergespan, ihm gegenüber der Jurat, denn obwohl sie die einzigen Personen im Wagen waren, hätte es doch gegen den Anstand verstoßen, wenn der Jurat neben seinem Chef Platz genommen hätte.
Wie der Wagen stehen blieb, sprang der Jurat von seinem Sitze herab, und half seinem Prinzipal zum Wagen heraus.
Der Herr Obergespan war ein kleiner untersetzter Mann mit ungewöhnlich kurzem Hals und breiten Schultern, sein fettes fleischiges Gesicht war gebräunt und blatternarbig, wie Kordovanleder; zwei feurige, schwarze, wilde Augen, ganz von tatarischem Typus, blitzten daraus hervor: sein kurzer Schnurrbart spaltet sich, aller Wachspomade zum Trotz, auf beiden Seiten in drei bis vier Spitzen und alle Friseurkünste sind nicht imstande, sein borstiges Haar dahin zu bringen, daß es nicht emporstehe, wie eine Helmblende. Wenn er einhergeht, trägt er den Kopf hoch und tritt auf, als wolle er der Erde sein Gewicht fühlen lassen; seine Stimme hört sich an, wie die eines Menschen, der von vielem Zanken heiser geworden. Sie ist scharf und rauh; er kümmert sich nicht viel um die Leute, sondern pflegt jedermann sehr kurz abzufertigen und wählt die Worte nicht; seine Handschrift gleicht ägyptischen Hieroglyphen und kann nur von solchen entziffert werden, die schon Übung darin besitzen; er räsonniert ganz richtig, daß es sich weit besser für andere Leute schicke, seine Schrift lesen zu lernen, als für ihn, besser schreiben zu lernen; auf feine Garderobe verwendet er sehr wenig Sorgfalt; auch jetzt ist er zu der glänzenden Unterhaltung in einem grauen Sommerüberwurf erschienen; er fürwahr wird bei solcher Hitze sich niemand zuliebe in Staat werfen!
Der Jurat jedoch hatte seine Beine in enge Stiefelhosen und Topanken zwängen und einen Attila anziehen müssen, und folgte so, mit umgeschnalltem Säbel, in einer Entfernung von zwei Schritten seinem Prinzipal bis ins Vorzimmer.
–Audiat! rief ihn hier, den kurzen Hals nach rückwärts drehend, der Prinzipal zu;audiat! Sie bleiben hier im Vorzimmer und warten, bis ich rufe.
Der junge Rechtspraktikant verneigte sich und blieb, während der Säbel klirrend an den Boden stieß, dort, wo es ihm geheißen worden, zwischen der buntscheckigen Dienerschaft stehen, welche kichernd und schäkernd hinter seinem Rücken die Köpfe zusammensteckte und sich nicht viel Mühe gab, ihre Bemerkungen leise zu machen.
– Was für einen spaßigen Heiducken der Herr Obergespan hat, bemerkte Baron Berzys kleiner Groom, der seine beiden Hände in den Westentaschen vergraben hatte.
– Das ist kein Heiduck, sondern ein Jurat, belehrte ihn ein alter herrschaftlicher Husar.
– Was ist das, ein Jurat? erkundigte sich ein langbeiniger Büchsenspanner, den irgend ein ungarischer Lord sich als Muster verschrieben hatte.
– Der Oberpfeifenträger des gnädigen Herrn, antwortete ein mutwilliger Kammerdiener, der in den Herrschaftskreisen für einen hübschen Jungen galt.
Diesmal ging es nicht ohne lautes Gelächter ab.
Der arme Jurat errötete und schwieg still. Er stellte sich bald auf den rechten, bald auf den linken Fuß und strich sich mit philosophischer Ruhe den kleinen Schnurrbart, der auf seiner Oberlippe zu sprossen begann.
Der Herr Obergespan aber eilte auf die Saalthüre zu, wo der Herr Rat schon bereit stand, ihn zu empfangen und sich so tief verneigte, daß er um einen halben Kopf kleiner erschien, als der Herr Obergespan, während er ihm die Hand schüttelte; dann aber, als er ihn in den Saal führte, schnellte er den Kopf noch einmal so hoch empor, als wollte er den Anwesenden zurufen: Seht her, auch der ist mein Gast!
Es sei hier bemerkt, daß nicht alle Menschen die Befriedigung ihrer Eitelkeit in der Toilette suchen; während der eine Diamanten und kostbare Knöpfe sich auf den Leib hängt, putzt sich ein anderer mit glänzenden Gästen heraus, und diese Bereinigung auserlesener Herren und Damen dient nur demselben Zweck, wie ein seltener Rhododendronflor, oder eine Sammlung von Spieluhren und anderem Kram.
Der Herr Obergespan ist nicht gewohnt, in welcher Gesellschaft immer, viel Umstände zu machen, was er auch hier beweist, indem er niemand seinen Gruß erwidert. Von dem Hausherrn zur gnädigen Frau geführt, verneigt er sich ein wenig, soweit er es imstande ist, und murmelt etwas in den Bart, was einem »ergebensten Diener« gleicht. Der Herr Rat tritt zurück, um freien Raum zu lassen zur Konversation zwischen seiner Frau und dem Obergespan, welcher dieser mit den Worten eröffnet: es ist verdammt heiß, gnädige Frau.
Und mit diesen Worten zieht er sein Schnupftuch aus dem Gehrock und wischt sich damit den Schweiß von den borstigen Stirnhaaren. Daß die Rocktasche, die er mit dem Schnupftuch herausgezogen, draußen hängen bleibt, kümmert ihn wenig.
Mitzislaw und der Baron eilen herbei, um ihn zu begrüßen. Mitzislaw ist einfältig genug, gleich nach den ersten Worten den Obergespan zu fragen, ob nicht auch die gnädige Frau die Gesellschaft mit ihrer Gegenwart beglücken werde, worauf Tarnaváry ihn mit solchen Blicken durchbohrt, daß der junge Dandy ganz blaß wird.
– Wie kannst du auch so dumm fragen, Mitzi! flüstert ihm der Baron ins Ohr. Der Obergespan steht zu Hause unter dem Pantoffel und nichts geniert ihn so sehr, als wenn man sich nach seiner Frau erkundigt, die nach eigenem Kopf ihre Wege geht.
Der Obergespan schien eine Weile darüber nachzudenken, wie er auf diese kompromittierende Frage mit gebührendem Ingrimm zu replizieren habe; dann brach er los: auf meine Frau machen Sie sich keine Rechnung, die hat andere Dinge zu thun. Heute muß sie schlechterdings in das neu eröffnete Komödienhaus. Meinetwegen, ich gehe ihr nicht nach. Ich war noch in meinem Leben in keiner Komödie und werde auch niemals in eine Komödie gehen – niemals! Und als schiene ihm eine zweimalige Beteuerung nicht genügend, rief er noch ein drittes Mal aus: niemals! und schlug dabei mit der Faust auf den Tisch, daß er krachte.
Die Stimme des anmeldenden Kammerdieners klang dazwischen: Seine Hochgeboren der Herr Graf Rudolph Szentirmay mit Familie!
Bei dieser Anmeldung machte sich eine lebhafte Bewegung in der Gesellschaft bemerkbar; viele schienen überrascht: Szentirmay gehörte nicht zu denjenigen, welche die Mitglieder dieses Zirkels ihre guten Freunde nennen; wie kommt es, daß auch er am Tage der sich vorbereitenden großen Feier von Pest herüber kommt, und zwar mit seiner ganzen Familie, mit Frau und Tochter; ja, reitet nicht selbst sein Mündel, der junge Zoltán Karpáthi, neben dem Wagen? Niemand kann es begreifen. Daran, daß es ja erst fünf Uhr nachmittags ist und daß man um sieben Uhr wieder in Pest sein kann, fällt es niemand ein zu denken; eine solche Absicht läßt sich nicht voraussetzen. Wozu auch wäre er dann erst herübergekommen, und warum dann die Einladung überhaupt annehmen? Unbegreiflich bleibt es nun aber doch, wie er von etwas wegbleiben kann, wozu er selbst andere so leidenschaftlich angeeifert und zusammengetrommelt.
Köcserepy sah in der Ankunft der Szentirmays nichts als einen errungenen Triumph und eilte ihnen entgegen, sie zu empfangen.
Jedermann, wenn er es auch nicht zeigte, sah dem ankommenden Grafen mit Interesse entgegen und war neugierig, einen der Leiter der Reichstagsopposition und den mächtigen Beförderer nationaler Unternehmungen an einem Orte zu erblicken, wo er wenig Wahrscheinlichkeit hatte, Parteigenossen zu finden.
Der eintretende Graf, ein Mann in reifem Alter, war eine hohe Gestalt; seine Gesichtszüge, trotz des ruhigen Ernstes, der auf ihnen lag, hatten etwas Vertrauenerweckendes; mitten auf der hohen Stirne hatte tiefes Nachdenken eine senkrechte Furche gezogen, welche die Muskeln über den Augenbrauen starker hervortreten ließ, was Männern so gut läßt; sein Vollbart, wie er zu jener Zeit noch wenig getragen wurde, machte ihn zu einer etwas fremdartigen Erscheinung in dieser glattrasierten Gesellschaft, und man erblickte auch hierin ein Zeichen von Opposition.
Seine Gemahlin, Gräfin Flora, mochte jetzt im dreißigsten Jahre stehen; ihr schönes, edles Gesicht zeigte nur darin eine Veränderung, daß sich demselben durch die Gefühle der Mutter ein neuer charakteristischer Zug eingeprägt hatte. Sonst war sie noch immer dasselbe heitere, gemütliche Wesen, als das die Freunde ihrer Jugend sie kannten, und die Grübchen der Wangen und des schön geformten Kinnes hätten es ihr auch schwer gemacht, ernst zu erscheinen.
Ihre Tochter, die zehnjährige Kathinka, ist ihr sehr ähnlich, und diejenigen, welche die Mutter als junges Mädchen gesehen, finden viele ihrer Züge in der Tochter wieder: diese kindliche Sanftmut, denselben reinen unschuldigen Blick der Augen, diese anmutigen, feingeschnittenen Lippen, Das Mädchen hatte nur ein Perkailkleid an, denn in den Familien unserer höheren Stande, mögen sie noch so reich sein, ist es löbliche Sitte, die Töchter vor ihrer Verheiratung nicht in Seide gehen zu lassen.
Aus dem Umstande, daß die Gräfin die Gouvernante ihrer Tochter nicht mitgebracht, können wir überdies entnehmen, wie wenig sie daran denkt, vor der Welt eine affektierte Strenge zur Schau zu tragen, und daß sie die mütterlichen Sorgen nicht ausschließlich anderen überläßt.
Das vierte Familienmitglied ist unser Zoltán Karpáthi.
Er verdient es in der That, daß wir neugierig sind, ihn uns näher zu betrachten.
Knaben sind in der Regel am wenigsten schön und am unbeholfensten in den sogenannten Flegeljahren, wo sie die kindliche Naivetät schon verloren und die Ritterlichkeit des Jünglingsalters noch nicht erlangt haben.
Der junge Karpáthi macht eine Ausnahme von dieser Regel.
Seine ganze Körperbildung ist von überraschender Schönheit; in seinen Formen zeigt sich jugendliche Kraft und Elasticität; jede seiner Bewegungen ist gewandt, kühn und voll Anstand; seine Gesichtsfarbe ist die lieblichste Mischung sonnengebräunten männlichen Teints und des frischen Rots der Kindheit; aus seinen Zügen spricht Adel und Verstand, der Schnitt seiner Lippen ist fein, beinahe von weiblicher Zartheit, aber die großen leuchtenden Sterne der Augen verraten einen männlichen Geist.