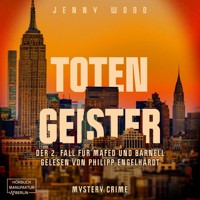Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Zombie Zone Germany
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
"Du kennst die Regeln!" Natürlich kannte ich sie. Ich hatte sie selbst mit aufgestellt. Die Regeln – für Lisa und ihre Freunde der einzige Schutz vor dem sicheren Tod. Jeder muss sich an den Plan halten. Eine fixe Idee rettet Lisa und ihre Freunde, als Chaos in Deutschland ausbricht, und stellt sie vor neue Herausforderungen. Gemeinsam errichten sie sich auf engstem Raum eine sichere Zone, lernen in der apokalyptischen Welt zu überleben. Dabei muss man sich auf jeden verlassen können und darf keine Schwäche zeigen. Freundschaften, Werte und die Liebe werden auf eine harte Probe gestellt und neu definiert. Doch das Leben spielt nach seinen eigenen Regeln. Zombie Zone Germany: Unsere Städte wurden Höllen. Sie kamen über Nacht. Ihr Hunger war unstillbar. Sie fielen wie Heuschreckenschwärme über die Lebenden her. Zerrissen sie, fraßen, machten aus ihnen etwas Entsetzliches. In den Straßen herrscht verwestes Fleisch. Zwischen zerschossenen Häusern und Bombenkratern gibt es kaum noch sichere Verstecke.In Deutschland ist der Tod zu einer seltenen Gnade geworden. Hohe Stahlbetonwände sichern die Grenzen. Jagdflieger und Kampfhubschrauber dröhnen darüber. Es wird auf alles geschossen, was sich (noch) bewegt. Deutschland wurde isoliert – steht unter Quarantäne. Die wenigen Überlebenden haben sich zu Gruppen zusammengeschlossen, oder agieren auf eigene, verzweifelte Faust. Gefangen unter Feinden. Im eigenen Land. Doch ist der Mensch noch des Menschen Freund, wenn die Nahrung knapp wird und ein Pfad aus kaltem Blut in eine Zukunft ohne Hoffnung führt? Bisher in der Reihe erschienen: ZZG: Die Anthologie ZZG: Trümmer (Simona Turini) ZZG: Tag 78 (Vincent Voss) ZZG: Letzter Plan (Jenny Wood) ZZG: Zirkus (Carolin Gmyrek) ZZG: Blutzoll (Matthias Ramtke) ZZG: XOA (Lisanne Surborg) ZZG Anthologie: Der Beginn
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zombie Zone Germany:
Letzter Plan
Jenny Wood
Herausgegeben von Torsten Exter
© 2016 Amrûn Verlag Jürgen Eglseer, Traunstein
Herausgeber der Reihe: Torsten Exter
Lektorat: Torsten ExterUmschlaggestaltung: Christian Günther
Alle Rechte vorbehalten
ISBN – 978-3-95869-266-4
Besuchen Sie unsere Webseite:
http://amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar
Für Lisa.
Die Einzige, der ich zutrauen würde,
eine Zombieapokalypse zu überleben.
Regel Nummer 1
Wird ein Mitglied der Gruppe infiziert, muss er die Gruppe verlassen oder wird getötet
Regel Nummer 2
Das Wohl der Gruppe ist über das des Einzelnen zu stellen
Regel Nummer 3
Jeder hilft dort, wo er gebraucht wird, seinen Fähigkeiten entsprechend
Regel Nummer 4
Im schlimmsten Fall ist jeder auf sich allein gestellt
Regel Nummer 5
Wenn Rettung in Sicht ist, ist die ganze Gruppe zu informieren oder dem Evakuierungstrupp der Standort der Gruppe mitzuteilen
Prolog
Mein keuchender Atem malte Wolken vor dem Gesicht. Die eiskalte Luft brannte in der Lunge wie Feuer. Meine Seitenstiche wurden unerträglich, aber ich zwang mich, weiter zu rennen. Schritte dicht hinter mir, verrieten, dass Nick noch da war. Das gefrorene Laub knisterte wie dünnes Eis unter unseren Sohlen. Eine mondlose Nacht erschwerte uns das vorwärtskommen. Andauernd stolperte ich über eine Wurzel oder musste einem Baum ausweichen, den ich vorher nicht gesehen hatte.
Neben mir jagten weitere Schatten durch das Dickicht. Wenn ich mich anstrengte, konnte ich Phil und Rick erkennen, die ein gutes Stück vor uns liefen. Unser Keuchen und das Rauschen des Blutes erfüllte die Nacht und übertönte beinahe das Stöhnen der nahenden Gefahr. Jemand schrie, Bastian antwortete, was ich aber nicht verstand.
Nicht zurückblicken! Meine Hände ballte sich zu Fäusten, als ich die letzten Kraftreserven anzapfte, um das Tempo zu halten. Wie lange rannten wir schon? Wie weit war unser Haus entfernt? Keiner würde diese Geschwindigkeit lange durchhalten. Rannten wir überhaupt in die richtige Richtung?
Unsere Verfolger interessierte das alles nicht. Sie spürten keinen Schmerz, keine Kälte und wurden nicht müde. Sie würden uns so lange jagen, bis sie ihre Beute hatten. Sie wollten unser Fleisch.
Adrenalin strömte durch meinen Körper. Ich setzte über einen umgestürzten Baumstamm und rannte einfach weiter. Regel Nummer 4 war in Kraft getreten. Im schlimmsten Fall war jeder auf sich selbst gestellt. Ich war klein und flink und hatte gute Chancen zu entwischen, aber was war mit den anderen?
»Weiter!«, brüllte Nick hinter mir. Die Panik machte seine Stimme schrill. Ich hatte ihn noch nie so verängstigt erlebt.
Weiter! Als ob ich das nicht weiß! Nur kein Blick zurück!
Schweiß rann heiß und klebrig meinen Rücken hinab. Die Muskeln in meinen Waden schmerzten und machten die Beine schwer. Ich durfte nicht langsamer werden!
Der Schrei verwandelte sich in ein gequältes Kreischen. Vielleicht Gwen, Krümmel oder einer der Jungs, der in seiner Panik wie ein Mädchen klang. Ich zog den Kopf ein, wollte diesen Laut nicht hören. Angst schnürte mir die Kehle zu, ließ mich japsen.
Ein Schuss zerfetzte die Nacht. Wieder schrie jemand auf – dieses Mal erkannte ich Deannys Stimme. Aufgeregtes Gebrüll kam von rechts aus dem Wald.
Mein Herz gefror und meine Füße stemmten sich in den Boden. Ich blieb so abrupt stehen, dass Nick beinahe in mich rein rannte.
»Was soll der Scheiß?«, fuhr er mich an, griff nach meinem Handgelenk und zog mich hastig weiter.
Ich versuchte, mich aus seinem Griff zu winden und schlug ihm auf den Oberarm. »Deanny ist in Gefahr!«
»Du kennst die Regeln!«
Natürlich kannte ich sie. Ich hatte sie selbst mit aufgestellt. Niemand soll den Helden spielen. Verletzte Gruppenmitglieder werden zurückgelassen. Auf dem Papier klang das so einfach, doch in der Realität zerriss es mir das Herz. Ich wog die Möglichkeiten ab. Wahrscheinlich würden wir uns selbst in große Gefahr begeben, aber wir konnten sie doch nicht einfach so im Stich lassen. »Wir müssen ihr helfen!«
»Nein! Das müssen wir nicht! Jeder ist für sich selbst verantwortlich!«
Ich verdrehte meine Hand und schaffte es, dass er mich losließ. »Dann kümmre du dich um dich selbst und ich mich um Deanny«, keifte ich und eilte in Richtung der Schreie.
Hinter mir fluchte Nick, dann folgte er mir. Er würde mich niemals im Stich lassen, egal, was ich tat.
Die Angst um meine Freundin setzte neue Energien in mir frei. Ich hastete über den unebenen Waldboden, ignorierte Äste, die mir durchs Gesicht schnitten und das Stöhnen der Gegner.
Das Mündungsfeuer einer Pistole erhellte für einen kurzen Moment die Szene. Deanny war gestürzt und hielt sich heulend das Bein. Es war unnatürlich verdreht. Der Schienenbeinknochen ragte zersplittert durch die Jeans. Bastian kauerte neben ihr und versuchte, sie hochzuheben, aber sie schrie immer wieder vor Schmerz auf. Weinend schlug sie nach ihrem Freund und fuhr ihn an, er solle sie gefälligst zurücklassen.
Hörnchen stand ein Stück abseits und hatte einen der Untoten erschossen, der zu ihnen aufgeholt hatte. Ein weiterer Zombie schlich sich von der Seite an und hockte im Schutz einiger Büsche. Keiner der drei konnte ihn von seinem Standpunkt aus sehen. Das Monstrum setzte zum Sprung auf seine Beute an. Ich wollte sie warnen, doch der Schrei blieb in meiner Kehle stecken.
Ich schaffe es nicht rechtzeitig, hallte es mir durch den Kopf.
Meine Hose verfing sich an einem Ast. Der Stoff zerriss, als ich hektisch daran zog. »Verdammte Scheiße!«
Nick rannte an mir vorbei, um Bastian zu helfen. Mein Gefluche alarmierte Hörnchen, der gerade noch dem Ungeheuer auswich und zweimal in den Kopf schoss.
»Lisa!«
Die Warnung ließ mich herumwirbeln. Ich sah, wie drei Kreaturen hinter mir aus den Schatten brachen. Ihre Gesichter waren halb verfallen – einem fehlte sogar der Unterkiefer. Das lichte Haar klebte ihnen blutverschmiert und strähnig am Schädel. Die Untoten jaulten auf, als sie mich in ihrer Nähe entdeckten.
Blindlings stürmte ich weiter, weg von den anderen, um sie zu schützen. Wieder schrie jemand meinen Namen, aber ich reagierte nicht. Verzweifelte Tränen schossen mir in die Augen und nahmen mir die Sicht. Die Panik drohte mich zu kontrollieren. Ich strauchelte, trat auf das zerrissene Hosenbein und fiel.
Mehrere Stimmen riefen nach mir. Nick! Er würde mir helfen. Er durfte mir nicht helfen!
Mit zitternden Knie versuchte ich, mich aufzurappeln. Etwas Kaltes umschloss mein Fußgelenk und zerrte daran. Ich öffnete den Mund um zu schreien, bekam aber nur Erde hinein, als ich zurück gerissen wurde. Hustend schlug ich um mich, trat nach dem Angreifer. Ein widerliches Knacken, gefolgt von einem Grunzen verriet mir, dass ich getroffen hatte. Von meiner Angst berauscht, kroch ich weiter.
»Lisa!« Trotz der hysterischen Stimme erkannte ich Nick. Er war mir gefolgt. Mein Herz machte einen Satz.
»Verschwinde!«, brüllte ich ihm entgegen. »Hau ab!«
Äste zerbrachen krachend. Dieses Mal waren es mehrere Hände, die nach mir griffen. Fingernägel gruben sich tief in meine Haut. Ich schrie vor Schmerz, versucht erneut, mich zu wehren, aber die Hände waren wie Schraubstöcke. Durch den Tränenschleier sah ich, wie die Kreaturen sich über mich beugten. Bevor ich reagieren konnte, bohrten sich gelbe Zähne in meine Hüfte. Der Schmerz raubte mir die Luft zum Schreien. Mein Herzschlag dröhnte in den Ohren, als ob er meinen Schädel sprengen wollte. Ich brachte nur ein verzerrtes Wimmern zustande.
Es war vorbei. Nach all den Monaten des Kampfes und der Qual. Ich fühlte mich ausgelaugt und leer, beinahe glücklich, dass es endlich ein Ende hatte. Nur dumpf nahm ich noch meine Umgebung wahr, sah, wie Nick einem der Wesen ein Messer in den Hinterkopf rammte. Taubheit erfüllte mich. Ich wollte nur noch schlafen. Ich spürte kaum, wie die Jäger meinen Bauch aufschlitzten und ihren Hunger an meinen Eingeweiden stillten.
Ich schreckte hoch und starrte mit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit. Keuchend stieß ich den Atem aus. Wie von selbst tasteten meine Hände über meinen Bauch, um zu prüfen, ob noch alle inneren Organe an ihrem richtigen Platz waren. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich begriff, dass ich nicht durch den Wald rannte, sondern in meinem Bett lag.
Spärliches Mondlicht bahnte sich seinen Weg vorbei an der Jalousie und ließ nur die Umrisse des Schlafsaals erkennen. Von der hinteren Ecke drang ein wohliges Schnarchen an mein Ohr – ein Laut, der mich sonst störte, nun aber irgendwie beruhigte. Es war ein Zeichen von Leben.
Neben mir knurrte Nick etwas Unverständliches in sein Kopfkissen. Noch im Halbschlaf drehte er sich zu mir um, schlang den Arm um meinen Bauch und zog mich zu sich. Wie von selbst fanden seine Lippen meine Schulter. Sein warmer Atem auf meiner Haut blies die Angst fort und hinterließ einen angenehmen Schauer. »Wieder so ein Traum?«, nuschelte er und gähnte ausgiebig.
Ich fuhr mir erschöpft über die Augen und merkte, dass meine Haare an der Stirn klebten. Als Antwort seufzte ich nur und schlug die Decke beiseite. Ich musste mich bewegen, irgendwie ablenken.
Nick wollte mich wieder zu sich ziehen, aber ich streifte vorsichtig seinen Arm ab. »Ich geh eben was trinken«, erklärte ich leise. »Kann jetzt eh nicht einschlafen.«
»Mir würde da was anderes einfallen«, erwiderte mein Freund und ich konnte mir sein anzügliches Grinsen bildlich vorstellen.
Stumm rollte ich mit den Augen, boxte ihm sacht gegen die Schulter und schlich so leise wie möglich aus dem Zimmer. Das Schnarchen kam kurz ins Stocken, als ich die knarrende Tür aufzog, intonierte dann aber gleichmäßig weiter. Wahrscheinlich war auch Nick wieder eingeschlafen, noch bevor ich die Tür hinter mir geschlossen hatte.
Der Flur wurde dämmrig erhellt vom Licht, das aus der unteren Etage kam. Ich hatte nicht darauf geachtet, ob alle Betten belegt waren, aber scheinbar war ich nicht die Einzige mit einem Schlafproblem. Vielleicht war es auch die Nachtwache, die sich bei einem Kaffee aufwärmte.
Ich ging die Treppe hinunter und folgte dem goldenen Lichtschein. Als ich den Spiegel im Flur passierte, legte ich meine Hand auf der Höhe meines Gesichts auf das Glas. Ich wollte mich nicht sehen müssen. Schon tagsüber war ich nur noch ein Schatten von mir selbst. Ich wollte gar nicht wissen, wie ich nachts nach einem Albtraum aussah.
Vorsichtig schob ich die Tür zum Wohnzimmer einen Spalt weiter auf und steckte den Kopf hinein.
Gwen saß mit einem Buch in der Hand auf dem Sofa und war ganz in den Roman vertieft. Sie hatte diese verträumte Eigenart, auf der Lippe herumzukauen, wenn sie sich auf den Text konzentrierte. Für sie war Lesen Flucht und Therapie zugleich.
Auf ihrem Schoß lag ein Kissen, auf dem wiederum Phils Kopf ruhte. Der junge Mann schlief – ein seltener Anblick, der mich zum Lächeln brachte. Phil hatten die ganzen Gefahren vielleicht am meisten verändert. Er schien fast nie zu schlafen, war unruhig und gereizt. Da tat es mir gut, ihn einmal so entspannt zu sehen. Wenn seine Miene nicht so grimmig war, konnte ich tatsächlich den alten Freund darin erkennen, mit dem ich vor Jahren zur Schule gegangen war.
Zögernd trat ich ins Wohnzimmer. Ich wollte die ruhige Atmosphäre nicht zerstören, doch als eine alte Diele unter meinen Füßen knarrte, schaute Gwen überrascht auf. Sie legte den Kopf schief und musterte mich kritisch, ehe sie das Buch weglegte. »Alles in Ordnung?«
»Ja, mach dir nicht immer gleich Sorgen. Ich hatte nur Durst«, flüsterte ich.
Gwens Blick machte klar, dass sie mir nicht glaubte, aber sie bohrte nicht weiter. »Du brauchst nicht flüstern. So schnell wird er nicht wach.«
Ich ließ mich auf das zweite Sofa sinken und deutete auf Phil. »Du hast eine beruhigende Wirkung auf ihn.«
Ein schelmisches Grinsen schlich sich auf Gwens Züge. »Ja, ich und die Tablette, die ich in seinem Tee aufgelöst habe«, erklärte sie mit einem Wink zu der halbleeren Tasse auf dem Tisch. Wir lachten leise, bis Phil ein Murren von sich gab und sich zögerlich bewegte.
Gwen biss sich auf die Unterlippe und wartete ein paar Atemzüge. Erst als Phil wieder gleichmäßig atmete, entspannte sie sich. »Du siehst aus, als ob du auch einen Schluck vertragen könntest.«
Ich zuckte gleichgültig mit den Achseln. Meine schlaflosen Nächte hatten sich nach all den Monaten in diesem ungewollten Gefängnis auf ein erträgliches Maß reduziert. Ich hatte schnell gelernt, mich auf das nötigste zu beschränken und war wohl unter allen Mitbewohner die psychisch stabilste. Zumindest redete ich mir das erfolgreich ein. In Wahrheit gab es bestimmt mindestens drei Leute, die mich am liebsten längst erschossen hätten.
»Was ist mit dir? Willst du jetzt die ganze Nacht da sitzen bleiben?«, entgegnete ich und zog die Augenbrauen zusammen. Seitdem Deutschland unter Quarantäne gestellt worden war und wir uns alle hier her zurückgezogen hatten, hatte Gwen mehr als 30 Kilo abgenommen und sah damit fast schon selbst wie eine lebende Tote aus.
Sie war der gute Geist im Haus. Sie achtete darauf, dass alle genug aßen und schliefen. Sie tröstete einen, wenn die Albträume kamen, gab den Jungs eine Ohrfeige, wenn sie ihren Frust im Alkohol ertränken wollten. Immer wieder bemühte sie sich um eine Spur Normalität, durch einen Plausch beim Kaffee trinken, gemeinsame Abendessen oder Filmnächte. Ohne sie wären wahrscheinlich alle längst durchgedreht, doch dabei achtete sie selbst kaum auf sich.
Gwen antwortete in der gleichen Manier wie ich und zog die Schultern hoch. »Ich leg mich hin, wenn er wach wird. Dann muss ich eh flüchten und mich in meinem Zimmer einschließen. Er wird wieder sauer auf mich sein, weil er schon wieder auf den Trick mit dem Schlafmittel reingefallen ist.«
Ich schaute auf meine Finger und fing unbewusst an, an einem eingerissenen Nagel zu knibbeln. Wahrscheinlich durchschaute Phil Gwens Versuche, ihn ruhig zu stellen, und nahm sie als dankbare Ausrede, um nicht schwach zu wirken. Immerhin war er Krankenpfleger und hatte ihr die Wirkung aller Medikamente selbst erklärt.
Trotzdem stimmten mich ihre Worte nachdenklich. Immer wieder machte sich der Zweifel in mir breit, verunsicherte mich und schickte mir diese schrecklichen Träume. »Manchmal habe ich Angst, dass … dass uns alle die Kraft verlässt, bevor … das hier alles vorbei ist.«
Ich sah im Augenwinkel, dass Gwen sich vorbeugen wollte, um nach meiner Hand zu greifen, doch Phils Position hinderte sie daran. »Alles was ich jetzt sage, klingt nach einer abgedroschenen Floskel.« Sie verzog das Gesicht und deutete ein Kopfschütteln an. »Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, alles wird gut. Aber viel schlechter kann es ja auch nicht mehr werden, oder?«
Ich kicherte und schaute wieder auf. Gwen hatte ihr sanftes Lächeln aufgesetzt und blickte mich beinahe mütterlich an. »Aber mal ganz ehrlich, wir sind nicht mehr dieselben wie damals als das ganze Theater anfing. Und wenn sie uns schon nicht gekriegt haben, dann jetzt erst recht nicht.« Sie verdrehte die Augen zur Decke und wedelte kurz mit der Hand. »Naja, zumindest nicht, ohne dass wir ihnen vorher kräftig in den Arsch treten.«
Regel Nr. 1Wird ein Mitglied der Gruppe infiziert, muss er die Gruppe verlassen oder wird getötet
Wir hielten die Nachrichten für einen schlechten Scherz – so wie ein Großteil der Weltbevölkerung. Zombies in Deutschland! Untote fallen Menschen an! Leichen entsteigen ihren Gräbern! Das musste eine geschmacklose Promotour für irgendeinen durchgeknallten Film sein. Leider war es das nicht und als wir das begriffen, war es fast schon zu spät.
Die Gefahr breitete sich vom Osten her aus und überrannte Deutschland in nur wenigen Tagen. Als der Seuchenschutz die ersten Erkrankungen im Ruhrgebiet bekannt gab, handelten wir ganz instinktiv. Anarchie brach in der Stadt aus. Selbst Nick und ich hatten uns nicht mehr an der allgemeinen Ausgangssperre gestört und wollten uns nur noch in Sicherheit bringen. Wir nutzen meine medizinische Sondererlaubnis und machten uns auf den Weg. Jetzt gab es nur noch ein Ziel: wir mussten zu unseren Freunden nach Berchum gelangen – mit einem kurzen Zwischenstopp.
Fluchend steckte ich mein Smartphone in die Jeanstasche. Das Netz war überlastet und mein Anruf war gar nicht mehr rausgegangen. Seine Verwandtschaft an Silvester zu erreichen war wohl einfacher. Ich wusste nicht, wo meine Freunde waren, was sie taten und ob sie sich an unseren Plan erinnerten. Es war zum verrückt werden.
Ich brauchte einen Moment, um meine Gedanken zu sortieren und mich zu orientieren. Mein Praktikum während der Ausbildung war schon eine ganze Weile her und seitdem hatte sich das Allgemeine Krankenhaus in der Innenstadt etwas verändert. Die Menschen um mich herum rannten kopflos durcheinander, Ärzte schrien Befehle, irgendwo weinte ein Kind. Draußen kreischte das Martinshorn. Es würde nicht mehr lange dauern, bis das Militär anrückte, um wieder für Ruhe zu sorgen.
Eine weinende Krankenschwester rempelte mich an und rannte ohne ein Wort hinaus. Ich schaute ihr perplex hinterher und rieb mir die Schulter.
»Ich halte das immer noch für eine schlechte Idee«, rief mein Freund über den Lärm hinweg. Nick überragte mich um zwei Köpfe und blickte der Schwester ebenfalls mit gerunzelter Stirn nach. Er war immer der ruhigere, rationalere von uns beiden, doch die aufeinander gebissenen Kiefer verrieten seine Anspannung. Sein ausgeprägter Beschützerinstinkt lief gerade wahrscheinlich Amok. Am liebsten hätte er mich wohl in den Kofferraum unseres Autos gestopft und mich an irgendeinen sicheren Ort gebracht – falls es so etwas überhaupt noch gab.
Ich schluckte meine Angst herunter und deutete ein Kopfschütteln an. An Sturheit stand ich ihm in nichts nach. »Wir halten uns an den Plan.«
Nick stieß einen abwertenden Laut aus. »Ein Plan, der im besoffenen Kopf erdacht wurde. Was ist, wenn wir die einzigen sind, die sich daran halten?«
Ich warf ihm einen flehenden Blick zu. Diese Diskussion hatten wir in den letzten Stunden schon dreimal geführt, immer mit demselben Ergebnis – er hatte keine bessere Idee. Geschlagen zog Nick die Schultern hoch und deutete mir an, vorauszugehen.
Ich zögerte, ließ den Blick schweifen. Wenn mehrere Leute dieselbe Idee hatten, wie wir, würden sie wohl alle in die Ambulanz rennen und sich dort einstecken, was sie zwischen die Finger bekamen. Also schlugen wir besser einen anderen Weg ein.
So schnell wir konnten wechselten wir den Flügel. Allein das stellte sich schon als große Herausforderung heraus, da scheinbar jeder Patient und Mitarbeiter auf den Beinen war. Ich hoffte darauf, dass Nick mich im Auge behielt und bahnte mir mit meinen Ellbogen einen Weg. Ein Stück vor uns stürzte ein älterer Mann im Gedränge. Ich schnappte erschrocken nach Luft, wollte ihm helfen, aber Nick schob mich einfach weiter. Ich sah noch, wie ein Pfleger zu dem Herrn rannte, bevor ich in den nächsten Gang bog.
Erst im Treppenhaus wurde es ruhiger. Ich sprang mehrere Stufen auf einmal hoch bis ich die Tür zur Orthopädischen Station erreicht hatte. Der Flur war wie verlassen – wie ich es mir gedacht hatte. Die meisten Patienten hatten sich selbst entlassen oder waren bettlägerig und die wenigen Schwestern waren damit beschäftigt, sie in ihren Zimmern zu beruhigen. Ich gab Nick einen Wink und huschte ins Schwesternzimmer.
Mein Blick flatterte durch den Raum, bis ich den Medizinschrank entdeckte. Unbewusst hielt ich den Atem an, als ich an den Türen zog. Nicht verschlossen! In all der Aufregung mussten die Pfleger das vergessen haben. Erleichtert stieß ich einen Seufzer aus.
Nick nahm den Rucksack ab und zusammen stopften wir Mullbinden, Kompressen, Spritzen, Schmerzmittel und andere Dinge in die Tasche. Das musste fürs erste reichen.
Als nichts mehr hineinpasste, zog Nick die Schnüre zu und warf den Rucksack wieder über die Schulter. »Und jetzt nichts wie weg hier«, raunte er und warf einen prüfenden Blick durch die Tür. Ich nickte, auch wenn er das schon nicht mehr sehen konnte.
Ohne weiter abzuwarten, rannte Nick quer über den Flur zum Treppenhaus. Ich trat ebenfalls aus dem Raum, warf aber einen letzten Blick zu den Zimmern. Aus einem kam gerade eine jüngere Schwester heraus. Die Augen der Mitarbeiterin weiteten sich überrascht. »Hey! Was machen Sie da?«
»Scheiße!« Ich schalt mich selbst. Warum hatte ich nur gezögert und war nicht einfach Nick gefolgt? Panisch rannte ich los. In Krisenzeiten wegen dem Diebstahl wichtiger Medikamente belangt zu werden, war keine gute Idee. Aber ich hatte die Rechnung ohne die Schwester gemacht, die mir mutig folgte.
Nach unten nahm ich mehrere Stufen gleichzeitig, aber meine Verfolgerin schien beflügelt zu sein und holte schnell auf. Wo war nur Nick?
»Verflucht, bleiben Sie stehen!«
Gehetzt warf ich einen Blick über die Schulter, verfehlte eine Stufe und stürzte. Schmerz explodierte in meinem Brustkorb, als ich der Länge nach auf die Treppen knallte. Die Krankenschwester kreischte erschrocken auf. Ich versuchte, mich irgendwo festzuhalten. Mein Körper rutschte unkontrolliert weiter, bis mein Schädel unsanft an der nächsten Wand stoppte. Der Schmerz wurde von einer bleiernen Dunkelheit geschluckt.
Das Dröhnen in meinem Kopf machte dem Läuten des Kölner Doms Konkurrenz und ließ mich gequält aufstöhnen. Ich vergrub die Finger in den Haaren, als ob das meinen Schädel daran hindern würde in tausend Teile zu zerspringen.
»Hey, sie ist wach«, hörte ich jemanden zischen.
Die Matratze, auf der ich lag, bewegte sich, als ein neues Gewicht hinzukam. Ein flammender Schmerz jagte angestachelt durch diese Bewegung meine Rippen hinauf und ließ mich meinen Kopf ganz vergessen. Ich kreischte auf, schlug aus Reflex um mich und erwischte etwas hart.
Nick gab ein leises Knurren von sich. »Entschuldige«, murmelte er und umschloss beruhigend meine Handgelenke.
Vorsichtig blinzelte ich aus verklebten Augen zu ihm auf. Der Raum lag in einem angenehmen, orangenen Licht und wirkte warm und sicher. Ich brauchte einen Moment, bis ich begriff, wo ich war. Ich lag in Robins Bett und draußen ging bereits die Sonne unter. Wir hatten es geschafft, wir waren in Berchum bei unseren Freunden. Das war der Plan gewesen. Ein kleines Haus am Rand des Waldes diente uns als Rückzugsort.
Erleichtert brachte ich ein Lächeln zustande, was mir irgendwie missglückt sein musste, denn Nick musterte mich besorgt.
»Wo tut es dir weh?«
Ich drehte mich halb zu ihm, zuckte aber schon nach wenigen Zentimetern erneut zusammen. Keuchend verdrehte ich die Augen und ließ mich wieder zurückfallen. »Frag mal, wo es nicht weh tut. Dann bin ich schneller.«
Ein Schmunzeln schlich sich auf Nicks Züge und er nickte zufrieden. Scheinbar war er mit sich selbst übereingekommen, dass es mir gut ginge, so lange ich noch zynisch sein konnte.
»Was ist passiert?«, wollte ich wissen und blinzelte den letzten Schlaf aus den Augen. Zögernd tastete ich mit den Fingern meine Hüfte ab und zuckte vor Schmerz zusammen. Das wiederum löste eine Kettenreaktion aus und noch mehr wunde Stellen meldeten sich. Ich fühlte mich, als sei ich unter eine Herde Büffel geraten. So sanft wie möglich zog ich den Hosenbund an meiner linken Seite herunter und legte eine rote Prellung frei, die sich langsam schon blau verfärbte. In wenigen Tagen würde meine Hüfte in allen Regenbogenfarben leuchten.
»Da war diese Pflegerin«, erinnerte ich mich langsam.
Mein Freund nickte und griff nach meinen Händen, damit ich mich nicht weiter untersuchte. »Du bist die Treppe heruntergestürzt und bewusstlos liegen geblieben. Da hat die Frau Panik bekommen und ist zurück gerannt, um Hilfe zu holen.«Ich zog zweifelnd die Augenbrauen zusammen.
»Naja, oder um dich einfach da verrecken zu lassen«, schob Nick lachend hinterher. »Ich habe dich aufgehoben und zum Auto gebracht. Jetzt sind wir in Sicherheit. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.« Zärtlich strich er mir eine Strähne aus dem Gesicht.
Die Medizinerin in mir tobte und ging im Geiste alles durch, was ich mir gebrochen oder verrenkt haben könnte. Wahrscheinlich musste ich sogar geröntgt werden. Aber wieder ins Krankenhaus? Das war unmöglich.
Ich startete einen zweiten Versuch mich aufzurichten. Wenn man den Schmerz erwartete, konnte man sich irgendwie drauf einstellen. Schwankend kam ich auf die Beine. Nick war ebenfalls aufgesprungen und hielt mich am Ellbogen. Seine Miene wirkte blass und besorgt. Mit wachsamen Augen beobachtete er jede meiner Bewegungen.
Sogar Alex, den ich bisher gar nicht wahrgenommen hatte, kam auf mich zu, blieb aber unschlüssig neben mir stehen, weil er nicht wusste, was er tun sollte. Der großgewachsene, schlanke Kasache hatte manchmal das Talent, sich wie ein tollpatschiger Welpe zu bewegen. Er war ein fröhlicher Typ, der auch über sich selbst lachen konnte, auch wenn er auf den ersten Blick recht ruhig wirkte. Wahrscheinlich lag es an seinem kleinen Sprachfehler, dass er nicht so im Mittelpunkt stehen wollte, denn wenn er gestresst oder nervös war, begann er leicht zu stottern.
Mein Herz machte einen Satz, als mein Hirn endlich begriff, wer da neben mir stand und dass es ihm demnach gut ging. »Du glaubst gar nicht, wie ich mich freue, dich zu sehen!«, platzte es aus mir heraus. Überschwänglicher als in meinem Zustand gut war, fiel ich ihm um den Hals.
Alex gab einen überraschten Laut von sich, umarmte mich dann aber auch. »Ich bin schon seit den ersten U… Unruhen hier. Meine Eltern sind bei Verwandten und werden erst mal dortbleiben. A… Alleine Zuhause habe ich dann doch etwas Schiss bekommen.« Er lächelte schüchtern und ich drückte ihn erneut an mich, was mich leise jammern ließ. Alarmiert schob Alex mich von sich und musterte mich prüfend, als ob ein Arm abgefallen sein könnte oder ähnliches.
»Es geht mir gut«, murrte ich und strafte der Aussage Lüge, als ich einen Schritt machte und aufstöhnte. »Ich brauch nur Schmerzmittel … ganz viel. Und einen Wodka.«
Rasch fand Alex sein Schmunzeln wieder und deutete mit einem Nicken zur Tür. »Die anderen sind unten. Irgendwo finden wir bestimmt die richtige Medizin.«
»Unser Rucksack«, fiel mir wieder ein. »Wir haben Schmerzmittel aus dem Krankenhaus geholt. Ich kann es mir selbst spritzen.«
Mein Freund nickte. »Der steht unten im Wohnzimmer. Ich wäre aber beruhigter, wenn du das Phil oder Fabian machen lassen würdest.«
Ich winkte beruhigend ab. Zugänge legte ich schließlich jeden Tag.
Wir verließen das Zimmer und stiegen die Treppe hinab ins Erdgeschoss, von wo uns schon aufgeregte Stimmen empfingen.
»Nein, ich werde dich nicht in die Stadt fahren!« Robins Tonart verriet, dass er das nicht zum ersten Mal gesagt hatte. Der Mittlere der drei Brüder war recht temperamentvoll und machte seinem Ärger gerne Luft. Meistens war er dann aber nach fünf Minuten wieder handzahm. Trotzdem stellte ich mich darauf ein, erst mal ungewollt in die Schusslinie zu gelangen.
»Das ist Selbstmord. Ganz davon zu schweigen, dass das Militär gerade eine Ausgangssperre verhängt hat«, stand Anne ihrem Sohn bei.
Ich warf Nick einen fragenden Blick zu, weil ich mich wunderte, wer wohl so dumm war und jetzt noch in die Stadt fahren wollte, doch der zuckte nur mit den Schultern. Als Warnung klopfte ich kurz gegen den Türrahmen. Sofort verstummten alle Gespräche.
Obwohl die Küche eigentlich recht groß war, sorgte der Andrang von Menschen dafür, dass es überfüllt wirkte. Vor Überraschung formten meine Lippen ein O. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie alle es hierherschaffen würden, geschweige denn, dass sie an unseren Plan dachten. Denn wenn man ehrlich war, war Verpeiltheit einer der prägendsten Wesenszüge meiner Freunde.
Hörnchen lehnte an der Fensterbank und hielt Krümmel im Arm, die bitterlich weinte und gar nicht bemerkte, dass ich den Raum betrat. Er lächelte mir flüchtig zu, ohne das beruhigende Flüstern ins Ohr seiner Freundin zu unterbrechen. Robin stand vornüber gebeugt auf den Küchentisch gelehnt und blickte mich überrascht an. Das zerzauste, blonde Haar und die Brille auf der Nasenspitze ließ ihn wie einen verwirrten Studenten wirken, der gerade einen Vortrag hielt. Seine Mutter und sein älterer Bruder Rick standen mit vor der Brust verschränkten Armen hinter ihm, an die Küchenzeile gelehnt. Bastian und seine Freundin Deanny saßen am Tisch. Deanny strahlte über beide Ohren als sie mich sah. Ihre Wimperntusche war verschmiert und verriet, dass auch sie geweint hatte. Jetzt wirkte sie allerdings recht gefasst.
Eine junge, mir unbekannte Frau stand mit dem Rücken zu mir und hatte das Kinn trotzig vor gereckt. Sie trug schwarze Kleidung, schwere Boots und einen Nietengürtel. Eine Wolke von Patchulli umgab sie und ließ mich husten. Mürrisch wandte sich die Fremde zu mir um und taxierte uns wie besonders abartige Insekten. Ich hasste sie. Also ignorierte ich sie.
»Wo ist Gwen?«, wandte ich mich an meine Freunde.
Anne lächelte warm und kam auf mich zu, um mich vorsichtig zu umarmen. Sie war für uns alle so etwas wie eine Ersatzmutter. All die Jahre hatte sie nichts dagegen gehabt, dass die Freunde ihrer Jungs hier ein und ausgingen oder manchmal sogar heftige Partys feierten. Gelegentlich leistete sie uns sogar bei einem gemütlichen Bier Gesellschaft. Sie war herzensgut und beherrschte die perfekte Mischung zwischen Coolness und Strenge.