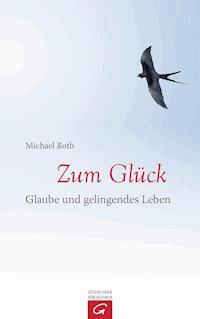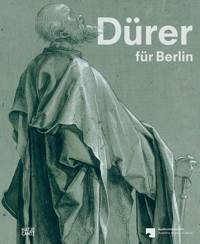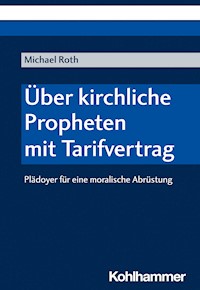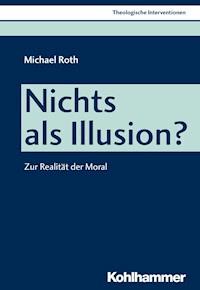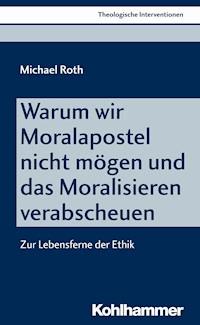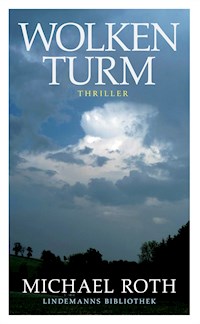22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der langjährige Außenpolitiker Michael Roth schreibt in radikaler Offenheit von den «Zonen der Angst» der Berufspolitik. Vom innerparteilichen Machtkampf. Den sozialen Medien und dem drohenden Shitstorm. Dem Pranger, weil man die Rituale und die Sprache der eigenen Bubble, Partei oder Peergroup infrage stellt. Dem falschen politischen Spiel mit gesellschaftlichen Ängsten. Darunter hat der Mensch Michael Roth immer stärker gelitten – und seine psychische Erkrankung erst spät erkannt. Mit seinem Buch möchte er anderen Mut machen, sich den eigenen Ängsten zu stellen. Dabei schont er weder seine politischen Weggefährten noch sich selbst.
Fast sein halbes Leben lang war Michael Roth Berufspolitiker, zuletzt als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Ein leidenschaftlicher Unterstützer der Ukraine, der seine Haltung gegenüber Russland früh überdacht hat und auch deshalb nicht nur in seiner eigenen Partei in der Kritik stand. Roth wuchs in schwierigen Verhältnissen im nordhessischen «Zonenrandgebiet» auf. Mit 28 zog er in den Bundestag ein. Er erlebte die erste rot-grüne Koalition im Bund, die Jahre der Großen Koalition und schließlich das jäh gescheiterte Experiment der Ampel. Nach fast 27 Jahren als direkt gewählter Abgeordneter und einer psychischen Erkrankung entschied er, seine politische Karriere zu beenden. Nun legt er eine sehr persönliche Geschichte über sein Leben in der Politik und mit der Angst vor: radikal offenherzig, analytisch klar und schonungslos selbstkritisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Michael Roth
Zonen der Angst
Über Leben und Leidenschaft in der Politik
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Widmung
Prolog: Die Möwen über dem Bebelplatz
Fall ins Bodenlose
Im Anfang war die Angst
Der lange Marsch
Auf den hinteren Bänken
Im Amt
Go East
Die Angst, zu gewinnen
Tage der Dunkelheit
Off
Die letzte Runde
Die Angstlosen
Epilog: Reise ins Ungewisse
Dank
Register
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
Gewidmet den Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfern in Europa und der Welt
Prolog: Die Möwen über dem Bebelplatz
Sie enttäuschen mich nicht. Sie sind wieder da. Die Möwen über dem Bebelplatz. Es sind meine letzten Tage als Bundestagsabgeordneter. Morgen kommt der neugewählte Bundestag erstmals zusammen. Dann endet meine Zeit im Parlament endgültig. Das Kreischen und Krächzen, Bellen und Rufen der Möwen, es zog mich stets an. Ich verbinde mit diesen Vögeln Sehnsuchtsorte. Bis heute weiß ich nicht, warum in Berlin, weit vom Meer entfernt, Möwen heimisch sind. Wenn ich mich so richtig beschissen fühlte, mir alles zu viel wurde, hoffte ich, auch in Berlin, unweit meiner Wohnung, den Möwen zuhören zu können. Zumindest in meiner Fantasie konnte ich dann für einen Moment den Zwängen des politischen Alltags und den dunklen Seiten meiner Seele entfliehen. Die Möwen entführten mich an Orte, die mir Heimat geworden sind und damit Sicherheit versprechen.
Es dauerte lange, sehr lange, bis ich lernte: Flucht ist keine Lösung. Durch Flucht allein werde ich meine Angst, meine Unsicherheit, meine Zweifel nicht bezwingen. Ich muss mich diesen Gefühlen stellen. Die Rufe der Möwen lassen mich träumen, von der Freiheit, dem Leben ohne Angst. Aber der Schlüssel zur Verwirklichung meiner Träume liegt in mir selbst. Freundschaft und Liebe, aber auch eine lange Therapie halfen mir, ihn zu finden. Inzwischen immer öfter. Die Angst ist kein Kerker meiner selbst mehr. Ich kann aus ihr heraustreten. Sie hat mich und mein Leben in und mit der Politik auf verschiedene Weise geprägt. Und darüber möchte ich schreiben.
Fast mein halbes Leben lang war ich Berufspolitiker. Mit Ende zwanzig, also noch in sehr jungem Alter, zog ich 1998 zum ersten Mal ins gesamtdeutsche Parlament ein, das damals noch für einige Monate in Bonn tagte. Nach mehr als einem Vierteljahrhundert und sieben Legislaturperioden als direkt gewählter Abgeordneter meines nordhessischen Wahlkreises Werra-Meißner/Hersfeld-Rotenburg habe ich erkannt, dass ich nicht mehr weitermachen will. Mit Mitte fünfzig scheint mir der richtige Zeitpunkt gekommen, noch einmal etwas Neues zu wagen.
Wenngleich ich in meiner politischen Laufbahn nie höchste Staatsämter bekleidet habe, kein Bundesminister, geschweige denn Bundeskanzler geworden bin, hatte ich dennoch das Bedürfnis, nach einem langen Leben in der Politik ein Buch zu schreiben, wenn man so will: ein klassisches Memoir, mit allen Unzulänglichkeiten, die der subjektiven Erinnerung geschuldet sind. Es handelt vom Zusammenhang zwischen Angst und Politik, von den verschiedenen Zonen der Angst, in die sich Menschen begeben, wenn sie Politik als Beruf betreiben. Dem innerparteilichen Machtkampf, der Angst, zu verlieren, aber auch zu gewinnen. Dem kommunikativen Raum der sozialen Medien, der Angst, durch einen unbedachten Tweet oder eine unsaubere Formulierung einem Shitstorm hilflos ausgesetzt zu sein. Der Angst vor dem Pranger, weil man die Rituale, Dogmen und die Sprache der eigenen Bubble, Partei oder Peergroup infrage stellt. Der Angst, in der Politik permanent in einem unsicheren Umfeld zu entscheiden, ungewollte Wirkungen von Entscheidungen nicht überblicken, nicht alle Themen in ihrer Tiefe durchdringen zu können. Der Angst, sich in einem hoch arbeitsteiligen Parlament auf die Expertise anderer verlassen zu müssen, ihnen zu vertrauen, schon die richtigen Vorschläge bei politischen Entscheidungen zu unterbreiten. Der Angst, der Flut an Terminen, Anfragen, Wünschen und Begehrlichkeiten nicht gerecht werden zu können. Dem falschen Spiel mit den gesellschaftlichen Ängsten, dem bewussten Schüren von Ängsten in der Bevölkerung, sei es vor der russischen Atombombe oder dem Verlust von Arbeitsplätzen, günstiger Energie und billigen Produkten, wenn wir uns nicht unterwürfig gegenüber autoritären Regimen verhalten. Dieses Buch ist aber keine Abrechnung mit der Politik. Auch wenn der öffentliche Einsatz für ein gutes Leben manchmal anstrengend und enttäuschend ist, lohnt er. Ich bin so dankbar für die Chance, an wichtiger Stelle über so lange Zeit gewirkt haben zu dürfen.
Der Natur der Sache nach ist in diesem Buch also viel von der Politik die Rede, aber sie bildet letztlich nur den Rahmen einer Erzählung über meinen eigenen Umgang mit der Angst. Meine Hoffnung ist, dass ich damit auch ein Publikum erreichen kann, das nicht jeden Abend vor dem Fernseher wie gebannt die einschlägigen politischen Talkrunden des Landes verfolgt. Ich möchte Menschen Mut machen, die mit ähnlichen psychischen Problemen zu kämpfen haben, wie sie sich irgendwann vor mir auftürmten. Vielleicht finden die einen oder anderen darin ein paar hilfreiche Gedanken für einen besseren Umgang mit der Angst in ihrem eigenen Leben. Ich durfte in den vergangenen Jahren viel darüber lernen, wie ich meine Ängste überwinden kann, in meinem Leben in, aber auch außerhalb der Politik. Ein Leitstern sind mir stets die Menschen gewesen, die für ihre Freiheit wirklich etwas riskieren, sogar das eigene Leben aufs Spiel setzen. Menschen, die nicht nur vom heimischen Sofa satt und sicher die Weltläufe kommentieren und ständig etwas zu meckern haben. Vielmehr Menschen, die aufstehen, Haltung zeigen, etwas wagen, die nicht wollen, dass die Welt so bleibt, wie sie ist. Viele von ihnen durfte ich als Außenpolitiker persönlich kennenlernen, und sie sind mir zum Teil zu echten Freundinnen und Freunden geworden. Sie haben mir Kraft gegeben, wenn ich mal wieder in der Sachzwangslogik und in innerparteilichen Konflikten gefangen war. Sie haben mich ermahnt, dass aufgeben und der Rückzug ins Private keine Option sind. Auch über sie werde ich schreiben, denn anhand ihres Einsatzes für Demokratie und Freiheit lässt sich zeigen: Politik muss immer auch eine Sache der Leidenschaft und des Mutes bleiben, sich einer Mission zu verschreiben, so zynisch die Mechanismen des politischen Betriebs im Einzelnen auch sein mögen. Heute, im Angesicht einer neuen «Achse der Autokraten» (Anne Applebaum), machthungriger Diktaturen wie Russland, China, Iran und Nordkorea, aber auch angesichts der Rückkehr eines unberechenbaren Populismus ins Weiße Haus, erscheint mir diese Einsicht wichtiger denn je.
Wenn ich gleich im zweiten Kapitel von meiner Herkunft, meiner Familie und meinem Erwachsenwerden erzähle, dient das vor allem der tieferen Auseinandersetzung mit einem zentralen Moment in meinem Leben, in dem ich dem Druck nicht mehr standhalten konnte, in dem nichts mehr ging, in dem ich mich rausziehen musste, um zu überleben. Gefühle von Angst und Scham haben mich von Kindesbeinen an geprägt. In meiner Zeit als Berufspolitiker habe ich das zu spät erkannt. Der Schatten meiner Vergangenheit holte mich immer wieder ein. Damit selbstbewusster umzugehen, habe ich erst in den vergangenen Jahren gelernt. Meine psychische Gesundheit litt stark darunter, auch davon wird das Buch handeln. Sigmund Freud verstand Angst als ein Signal des Ichs, das uns vor drohenden Gefahren oder Konflikten warnt – sei es vor realen Bedrohungen, inneren Spannungen zwischen konflikthaften Trieben oder den Forderungen unseres Gewissens. Sie kann uns einerseits schützen, andererseits aber lähmend wirken, wenn wir ihre Ursachen nicht verstehen. Rückblickend erkenne ich, wie oft meine Angst ein Ausdruck solcher inneren Konflikte war, die mich zwischen meinen Wünschen, Erwartungen und der Realität zerrieben. Am Ende einer langen politischen Laufbahn und am Beginn eines neuen Kapitels, das ich voller Neugier und Freude aufzuschlagen beginne, darf ich endlich sagen: Ein Leben ohne Angst ist möglich. Den Möwen über dem Bebelplatz kann ich ohne Wehmut «Macht’s gut und auf Wiedersehen» zurufen.
Fall ins Bodenlose
Ich musste erst 52 Jahre alt werden. Bis dahin war ich ein Meister darin, bei mir selbst alle Anzeichen einer psychischen Erkrankung auszublenden. Angst und Depression waren schlichtweg keine Themen, die in meiner Vorstellungskraft eine größere Rolle gespielt hätten, und damit dürfte es mir zunächst genauso gegangen sein wie dem Großteil der Betroffenen. In der Selbstbetrachtung schätzte ich mich sehr wohl als einen Menschen mit Höhen und Tiefen ein. Ich hatte zwar immer wieder Phasen der Angst und Unsicherheit erlebt, bildete mir ein zu wissen, was es bedeutet, mich schlecht zu fühlen, und gab hin und wieder dem Impuls nach, mich meinem Umfeld – politisch und privat – zu entziehen. Aber solche Momente verbuchte ich stets unter den «schlechten Tagen», die doch auch zum Leben dazugehörten. Im Bundestagswahlkampf 2021 legte sich jedoch ein tiefschwarzer Schatten auf alles, was mir wichtig war, auf meine Arbeit, mein Engagement, meine Partnerschaft, meine Freundschaften. Ich verlor den Boden unter den Füßen.
Als ich Anfang August aus dem Sommerurlaub zurückkehrte, luden wir unsere Unterstützerinnen und Unterstützer im Wahlkreis ein, um die heiße Phase des Wahlkampfs einzuläuten. Zu diesem Anlass präsentierten wir auch die neuen Wahlplakate. Vor dem Bad Hersfelder Rathaus ließ mein Team eine große Plakatwand aufbauen und einen Eiswagen kommen – eine charmante Geste, die auch Menschen anzog, die sich sonst eher am Rande der sozialdemokratischen Kerngemeinde bewegten. Geplant war ein heiterer, leichter Einstieg in jenen politischen Abnutzungskampf, in dem ich mittlerweile zwar ein alter Haudegen geworden war, der aber stets auch viel Kraft gekostet hatte. Wir hatten uns einige Wochen zuvor für das Motto «Wo die Zuversicht zuhause ist» entschieden. Doch an jenem Morgen fühlte ich mich alles andere als zuversichtlich, ich fühlte mich hundeelend – so sehr, dass ich ernsthaft erwog, die Veranstaltung abzusagen. Ich war erkältet, aber die Symptome meines Unwohlseins lagen viel tiefer. Es war nicht der Infekt, der mich in lähmender Unruhe auf dem Sofa hielt – es war Angst. Die Vorstellung, in ein paar Stunden eine größere Menschenmenge bespaßen und Zuversicht ausstrahlen zu müssen, erschien mir plötzlich absurd überfordernd. Mich ergriff Panik. Nach zwei Wochen eines erholsamen Wanderurlaubs in den Bergen hätten mein Körper leicht und mein Geist gestärkt sein müssen. Nun erschienen mir die wenigen Meter von unserem Haus zum Rathaus wie ein unüberwindbares Gebirge.
Von außen wirkte es, als führte ich den vielleicht besten Wahlkampf meines Lebens. Innerlich aber waren da nur Leere, Erschöpfung und Furcht. Es mag widersprüchlich klingen: Die öffentlichen Auftritte retteten mich, obwohl ich dringend Ruhe gebraucht hätte. Auf Wahlkampfveranstaltungen musste ich einfach nur funktionieren, wie ein Zirkuspferd in der Manege, daran hatte ich mich über all die Jahre gewöhnt, auch an die damit verbundene Anerkennung. Doch schwerer wog inzwischen die Zeit zwischen den Auftritten. Niemand merkte, wie schlecht es mir ging, mit Ausnahme meines Mannes. Wenn ich abends nach Hause kam, setzte ich mich apathisch auf unser Sofa und wollte kein Wort mehr reden. Heimlich führte ich eine Strichliste, wie viele Tage Wahlkampf ich noch durchstehen musste. Mein Team musste mich in dieser Zeit zu vielen Terminen schieben, die ich üblicherweise locker absolvierte. Sie gaben wie immer ihr Bestes und versuchten es mit allen Tricks: Sie redeten auf mich ein, schimpften manchmal auch, motivierten und lockten mich, nach dem Prinzip: «Da musst du jetzt wirklich hin, die nächste Veranstaltung können wir dann vielleicht absagen …»
Dabei lief es politisch sehr gut, endlich war der erhoffte Rückenwind aus Berlin da. Sechs Wochen vor der Wahl überholte die SPD die Union bundesweit in den Umfragen – eine Trendwende, an die außer dem Kanzlerkandidaten und seinem engsten Umfeld wohl kaum noch jemand geglaubt hatte. Der Wahlabend, den ich gemeinsam mit meinem Team in Bad Hersfeld verbrachte, wurde für meine Partei und mich zum Moment des großen Triumphs. Mit über 43 Prozent der Erststimmen verteidigte ich mein Direktmandat souverän. Erneut holte ich parteiübergreifend die meisten Erststimmen in ganz Hessen, bundesweit schnitten nur vier SPD-Kandidaten in ihren Wahlkreisen besser ab als ich. Viele bekannte Sozialdemokraten hatten mich im Wahlkampf vor Ort unterstützt, auch Olaf Scholz. Selten habe ich den Bad Hersfelder Linggplatz so voll erlebt. Scholz zeigte sich auf der Bühne im öffentlichen Gespräch mit mir locker und humorvoll. Die Bürgerinnen und Bürger reichten Fragen auf Bierdeckeln ein, Scholz antwortete knapp, klar, ohne Schnörkel – fast sokratisch in der Kürze, aber ohne distanzierte Ironie. Da keine Zeit für einen Imbiss blieb, hatte er um zwei Käsebrötchen für die Autofahrt gebeten. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen und schmierte ihm zuhause ein paar Stullen.
Von außen betrachtet, hatte ich geliefert. Der Wahlkreis blieb rot(h). Die SPD gewann die Wahl, Scholz wurde Kanzler einer Ampel-Koalition in Berlin – ein politisches Großprojekt, dem ich viel abgewinnen konnte. Wie es in mir aussah, versuchte ich mir nicht anmerken zu lassen. Schon während des Wahlkampfs hatten Nancy Faeser, die hessische Landesvorsitzende, und andere führende Genossen meines Landesverbands öffentlich gefordert, ich müsse als Spitzenkandidat der hessischen SPD im nächsten Bundeskabinett auf jeden Fall berücksichtigt werden. Manche, die es gut mit mir meinten, waren über die etwas großspurig vorgetragenen Ansprüche unglücklich. Sicher erwartete ich dieses öffentliche Bekenntnis anfangs auch selbst. Es gab jedoch, wie vor jeder Regierungsbildung, eine Reihe von Unbekannten. Zudem hatte Olaf Scholz früh klargemacht, dass sein Kabinett geschlechterparitätisch besetzt sein werde: zur Hälfte Frauen, zur Hälfte Männer. Und da die FDP nur eines ihrer vier Ressorts mit einer Ministerin besetzte, musste die SPD diesen Männerüberschuss ausgleichen, damit der künftige Kanzler sein Wort halten konnte.
Als nach den erfolgreichen Koalitionsverhandlungen am ersten Wochenende im Dezember 2021 das Personaltableau für die Bundesregierung festgelegt wurde, feierten wir zu Hause unseren traditionellen Rosa Advent – mit Freunden, Feuerzangenbowle und Lichterglanz. Doch ich war in Gedanken in Berlin, weil ich den Anruf erwartete. Auch andere Aspiranten auf Posten und Pöstchen meldeten sich bei mir. «Hast du schon was gehört?» Nein. Und das blieb auch so. Ich war bei der Verteilung der sozialdemokratischen Regierungsämter hinten runtergefallen. Es meldete sich auch niemand von denjenigen, die wochenlang meinen Namen gestreut hatten. Kein Anruf, kein Wort. Faeser, die ihren Platz eigentlich stets in Wiesbaden gesehen hatte, wurde dann selbst Innenministerin. Mit Christine Lambrecht, die bereits ihren Abschied aus der Politik angekündigt hatte, zog zudem eine weitere Hessin als Verteidigungsministerin ins Kabinett ein. Zwei Frauen aus Hessen – da war für mich einfach kein Platz mehr. Mit Sören Bartol und Edgar Franke wurden zudem zwei nordhessische Kollegen Parlamentarische Staatssekretäre im Bau- bzw. Gesundheitsministerium. Alle hatten ihre Schäfchen ins Trockene gebracht. Nur ich stand draußen allein im Regen. Es war, als sei ich geräuschlos aus dem inneren Kreis gefallen.
Am darauffolgenden Montag flog ich in aller Herrgottsfrühe nach Paris. Ein Abschied in würdiger Kulisse: Mein französischer Amtskollege verlieh mir den Rang eines Offiziers der Ehrenlegion. Ich wusste, dass dies meine letzte Reise als Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit sein würde. Es war nicht nur das Ende meiner Amtszeit als Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Es war nach acht Jahren auch ein Abschied aus der politischen Verantwortung in einem Regierungsamt. Ich war raus. Ich war enttäuscht – aber mehr noch: Ich schämte mich. Gegenüber all jenen, die große Stücke auf mich gehalten hatten. Ich versuchte, die unzähligen Nachrichten von Freundinnen und Freunden, Journalisten und Weggefährtinnen zu ignorieren. Aber es gelang mir nicht. Bei meiner Dankesrede in einem der prunkvollen Säle des Quai d’Orsay, des französischen Außenministeriums, versagte mir zum Schluss die Stimme, und ich vergoss Tränen. Das war mir peinlich, aber ich konnte nicht anders. An diesem Montag hatte mich ein Gedanke im Griff: Das war’s, da kommt nichts mehr.
Wie andere Politiker brauchte auch ich einen immer größeren Adrenalin-Kick, den mir eine wichtigere Aufgabe und ein neues Amt zu versprechen meinten. Seit meinem Eintritt in die Berufspolitik mit Ende zwanzig wurde schon aus meinem Wahlkreis die Erwartung an mich herangetragen, es einmal weit zu bringen. Durchsetzungsvermögen und Unerschütterlichkeit gehören zu den wichtigsten Charaktereigenschaften, die Politikerinnen und Politikern von außen zugeschrieben werden: durch tiefste Täler zu gehen, ohne sich öffentlich etwas anmerken zu lassen, nach schweren Niederlagen wieder aufzustehen. Dabei entsteht bestenfalls das Bild von Schwerstarbeitern im Weinberg des Herrn, die ohne Freizeit rund um die Uhr schuften, weil die Krisen und Konflikte dieser Welt ebenfalls keine Pause machen. Sie lassen jede Kritik an sich abprallen, weil sie Besseres zu tun haben, als sich und ihre Überzeugungen kritisch zu befragen. Jedes Anzeichen von Angst und Schwäche kann ihnen – von der Konkurrenz über mediale Bande gespielt – negativ ausgelegt werden, auch jeder Fehltritt in den sozialen Medien. Dann lautet das Urteil schnell: «Der ist ungeeignet», «Der hat sich nicht im Griff», oder – leider ein oft mit Blick auf Politikerinnen zu vernehmender Vorwurf, der den immer noch sexistischen Grundtenor unserer Gesellschaft offenbart – «Die ist einfach inkompetent». Folglich darf sich niemand darüber wundern, wenn Menschen in der Politik dazu neigen, körperliche und seelische Leiden zu verheimlichen oder herunterzuspielen. Auch meiner Generation wurde noch eingetrichtert: «Hab’ dich nicht so. Schluck’ den Schmerz herunter. Sei keine Memme.» Insgeheim wusste ich ja längst, dass ich nicht so tickte. Ich wollte funktionieren und immer höher hinaus, war aber längst am Anschlag. Ich brauchte eine gewisse Zeit, um mich mit der neuen Lage abzufinden. Ich haderte mit allem, auch damit, überhaupt nochmal bei der Bundestagswahl angetreten zu sein. Was ich erst viel später begriff: Dass ich meinen vermeintlichen Lebenstraum, ein großes Ministeramt, nach der Bundestagswahl 2021 begraben musste, war am Ende die Chance, als Mensch im Politikbetrieb zu überleben und eine fundamentale Krise zu überstehen.
Bald erinnerte ich mich an die Worte eines mir gut bekannten Journalisten, der mir offenbart hatte, er halte mich eigentlich für den idealen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses. Ich hatte dieses Amt bislang eher als Versorgungsposten für altgediente Ex-Minister gesehen oder als Trostpreis für alle, die im Ministerrennen leer ausgegangen waren. Doch anders als ein Regierungsamt verpflichtete der Ausschussvorsitz nicht zu strenger Loyalität gegenüber der Exekutive. Er bot Spielraum, Einfluss und die Möglichkeit zur Profilierung – mithin ein rares Gut im politischen Betrieb: Autonomie. Ich war mittlerweile ein erfahrener Parlamentarier mit klar erkennbarer europapolitischer Kante und Regierungserfahrung. Als Chef des wichtigsten parlamentarischen Kontrollgremiums der deutschen Außenpolitik würde sich mir die Chance eröffnen, deren parteiübergreifender Hüter zu werden – perfekt für jemanden wie mich, der beide Seiten gut kannte: Exekutive und Legislative.
Je intensiver ich darüber nachdachte, desto mehr überzeugte mich die Idee. Ich begann mit dem Klinkenputzen, die Rückendeckung von Olaf Scholz hatte ich. Ich gewann in unserem Gespräch den Eindruck, dass er ein schlechtes Gewissen hatte, nachdem man mich bei der Vergabe der Regierungsposten übergangen hatte. Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich signalisierte mir seine Zustimmung. Damals hatten wir noch ein ordentliches Verhältnis. Gegenwind kam hingegen von früheren Landespolitikern wie Ralf Stegner und dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin Michael Müller, die zwar erstmals in den Bundestag eingezogen waren, aber selbstverständlich davon ausgingen, auf Anhieb wichtige Posten zu übernehmen. Beide erhoben ebenfalls Anspruch auf den Ausschussvorsitz, scheuten aber eine Kampfabstimmung in der Fraktion, nachdem mich die Fraktionsführung offiziell nominiert hatte.
Nach Carlo Schmid und Hans-Ulrich Klose war ich erst der dritte Sozialdemokrat, der den Vorsitz des Auswärtigen Ausschusses – eigentlich klassisches Terrain der Unionsparteien – übernehmen durfte. Die neue Aufgabe nötigte mir schließlich auch einigen Respekt ab. Mit Europa, Russland und den transatlantischen Beziehungen kannte ich mich sehr gut aus. Als klassischer Internationalist der alten Schule war mein Blick auf die Welt jedoch nicht frei von blinden Flecken – ein gewisser Eurozentrismus war mir nicht abzusprechen. Gerade im Hinblick auf Afrika, Südamerika und Asien hatte ich Nachholbedarf, in den ersten Wochen vertiefte ich mich deshalb in die Dossiers über diese Weltregionen. Was ich dabei über China las, verdüsterte meinen Blick auf das Land zusätzlich.
Politisch hatte das Jahr 2021 für mich mit dem Ausschussvorsitz also doch noch versöhnlich geendet. Mein desolater innerer Zustand offenbarte sich dann aber in einer Zeit der Ruhe, im Dazwischen. Mein Mann und ich waren zum Jahreswechsel 2021/22 mit Freunden in den Urlaub nach Mallorca geflogen und wollten den Silvesterabend eigentlich in einem Restaurant verbringen. Für die gemeinschaftliche Vor- und Zubereitung eines großen Silvester-Dinners, wie wir es ursprünglich geplant hatten, fühlte ich mich viel zu erschöpft, obwohl ich im Urlaub war. Meine Gedanken ähnelten einem großen schwarzen Meer, ich spürte nichts als eine erdrückende emotionale Leere. Die anderen hatten mich gebeten, rechtzeitig einen Tisch im Restaurant zu reservieren, aber selbst diese einfache Aufgabe bekam ich nicht mehr hin. Diese seelische Lähmung wurde mir fälschlicherweise als Schusseligkeit und Desinteresse ausgelegt, weshalb die Runde beschloss, dass ich nach einem gemeinsamen Einkauf zur Strafe kochen solle. Schließlich galt ich als passabler Koch. Wir fuhren alle zusammen in den Supermarkt. Dort fragte mich mein Mann: «Was willst du denn kochen, brauchen wir was Bestimmtes?» Ich blickte abwesend in die vor mir befindlichen Auslagen und antwortete nur: «Ich weiß es nicht.» Daraufhin platzte ihm der Kragen. Er brüllte mich vor versammelter Mannschaft an, unsere Freunde blickten nur beschämt zur Seite. Ich verließ den Supermarkt fluchtartig, setzte mich ins Auto und fing an zu weinen. Nach einer stillen Heimfahrt versuchte ich mich am Abend zusammenzureißen, was mir jedoch nur leidlich gelang. Erneut kam es zu einem heftigen Streit mit meinem Mann, der mir zu verstehen gab, dass er mich in diesem Zustand nicht mehr ertragen konnte. Es war ein trostloses, trauriges Silvester. Und ich schämte mich erneut. Nicht nur für mein Verhalten – auch dafür, dass ich so deutlich wie nie zuvor eine innere Zerbrechlichkeit spürte, die mit einem Gefühl völliger Hilflosigkeit einherging. In Berlin war ich ein außenpolitischer Spitzenmann, trug die Maske der Souveränität – und konnte doch keinen Tisch reservieren, kein Abendessen planen, kein Wort mehr sagen.
Die dunklen Wochen nach der hektischen, aber auch schönen Advents- und Weihnachtszeit waren für mich schon immer schwierig. Zwar fiel ich in dieser Zeit regelmäßig in ein Loch, bis es Ende März wieder heller wurde und der Frühling anbrach. Aber diesmal war es schlimmer. Ich hatte zu rein gar nichts mehr Lust. Dass ich mir vor meinen Freunden eine solche Blöße gab, war neu. Natürlich ärgerte ich mich auch über meinen Mann, weil er mich vor den anderen zur Schnecke gemacht hatte, aber ich konnte ihn auch verstehen, nach all den Wochen und Monaten, in denen er es die meiste Zeit mit einem Zombie zu tun gehabt hatte. Am Neujahrsmorgen bereitete ich für uns ein Frühstück zu. Wir saßen gemeinsam am Tisch und redeten nur das Nötigste miteinander. «Kannst du mir mal die Butter reichen?» «Gibt es noch Kaffee?» Dann sprach ich es zum ersten Mal aus: «Es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Und zwar professionelle.»
Für Familie und Freunde ist ein solches Bekenntnis be- und entlastend zugleich. Sie haben einerseits die Gewissheit, dass ein nahestehender Mensch psychisch erkrankt ist, und brauchen sich ihren Kopf nicht länger darüber zu zerbrechen, woran er oder sie denn nun leidet. Andererseits können sie der betroffenen Person aber auch nicht wirklich helfen, sie sind vielleicht sogar selbst Teil des Problems, jedenfalls eher selten Teil der Lösung. Das zu akzeptieren, schmerzt. Aber ich brauchte jetzt nicht nur meinen Partner oder eine vertraute Freundin an meiner Seite, sondern jemanden, mit dem ich unvoreingenommen und in radikaler Offenheit sprechen konnte. Über einen Freund fand ich in Berlin schnell eine Psychiaterin und Psychotherapeutin, bei der ich noch im Januar 2022 eine Therapie begann. Sie begleitet mich bis heute.
Die gesellschaftlich verbreitete Tendenz, eine psychische Erkrankung als «Burnout» zu verklären, in meinem Fall vielleicht verursacht durch die Zumutungen des politischen Betriebs – die langen Arbeitstage, die vielen Reisen, den mangelnden Schlaf, die Anfeindungen, die Niederlagen und persönlichen Enttäuschungen –, gleicht einem kollektiven Selbstbetrug. Sicher hat mir der Stress eines Lebens als Politiker phasenweise enorm zugesetzt. Allerdings wurde es umso schlimmer, je mehr ich meine Ängste mit dem seit meiner Kindheit und Jugend eingeübten Fluchtreflex beantwortete. Flucht vor unangenehmen Situationen in der Politik, aber auch der krampfhafte Versuch, der großen emotionalen Leere im Privaten, im Dazwischen, zu entfliehen – Verhaltensmuster, die mir das Leben immens erschwerten. Die Folge war ein Teufelskreis, in dem ich selbst zum Katalysator meines Unbehagens wurde. Kurzum: Mein psychisches Leiden hatte tiefere Ursachen; es wäre wohlfeil, es im Nachhinein allein im Job zu suchen.
Andersherum formuliert: Durch die Möglichkeit, im Rampenlicht zu stehen, von einem Termin zum nächsten zu hetzen, sich mit allem, bloß nicht mit sich selbst auseinanderzusetzen, wird die Politik zu einem Betätigungsfeld, in das ein psychisch erkrankter Mensch flüchten kann, um sein Leiden zu verdrängen – jedoch nur auf Zeit, und zu einem sehr hohen Preis. In den Therapiesitzungen rückten die Katastrophen meiner Kindheit und Jugend schneller in den Vordergrund, als mir lieb war. Ich hatte zuvor niemals mit jemandem wirklich darüber geredet – auch nicht mit meinem Mann. Allein der Gedanke an diese Jahre ekelte mich. Ich wollte diese Erinnerungen in mir auslöschen: meine Familie, meine Eltern, mein ganzes Unglück als junger schwuler Kerl in der nordhessischen Provinz. Die Kehrseite dieser unfassbaren Verdrängungsleistung war eine Art toxisches Vermeidungsverhalten, das im politischen Betrieb, aber auch im zwischenmenschlichen Bereich seinen Tribut zollte. Eigentlich hatte ich gehofft, mich durch den frühen Tod meines Vaters endgültig aus dem Morast der Vergangenheit befreien zu können. Nun merkte ich, wie falsch ich mit dieser simplen Ursache-Wirkungs-Rechnung lag. Im Idealfall hätte ich jetzt eine längere Ruhepause einlegen, einen Gang zurückschalten und mir die nötige Zeit nehmen müssen, damit meine seelischen Wunden heilen können. Aber dann kehrte am 24. Februar 2022 der Krieg zurück nach Europa, es begann eine neue Zeitrechnung – und alles wurde noch schlimmer.
Im Anfang war die Angst
Die Unterstützung der Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen den russischen Aggressor ist am Ende meiner politischen Laufbahn zu meiner wichtigsten Mission geworden: mit allen bescheidenen Mitteln, die mir als Vorsitzendem des Auswärtigen Ausschusses zur Verfügung standen. Faktische Macht hatte ich keine mehr, aber die Macht des Wortes war mir geblieben. Sie verhalf mir zu einer öffentlichen Aufmerksamkeit, wie ich sie in meinem mehr als zweieinhalb Jahrzehnte währenden Abgeordnetenleben zuvor nie erlebt hatte. Ich war zuletzt ein Überzeugungstäter, der es verstand, nach außen entschlossen und schneidig aufzutreten, um den Befreiungskampf der Ukraine auch an der deutschen Nebenfront zu unterstützen – aber ich war innerlich auch ein sehr unsicherer Mann in der Lebensmitte mit einer psychischen Erkrankung. Der auf den psychischen Zusammenbruch zusteuerte, als er in seiner eigenen Partei immer härter angegangen wurde. Der beinahe daran zerbrach, von den eigenen Genossinnen und Genossen geschnitten zu werden. Der es ganz nach oben, auf den Mount Everest der Politik, aus verschiedenen Gründen nie hätte schaffen können. Der spät, aber nicht zu spät, erkannte, dass die wahre Kunst des Bergsteigens nicht darin besteht, um jeden Preis den Gipfel zu erklimmen, sondern zu wissen, wann man umkehren muss, um am Berg nicht sein Leben zu verlieren.
Viele Menschen erliegen der Verlockung, die Gründe für ihre psychischen Probleme, für charakterliche bzw. persönliche Schwächen nahezu ausschließlich in einer schweren Kindheit zu suchen. Sie suhlen sich förmlich im eigenen Leid. Das ist oft kaum zu ertragen. Ab einem bestimmten Punkt im Leben ist jeder für sich selbst verantwortlich. Allerdings gibt es noch eine zweite, weitverbreitete Variante gelebter Verantwortungslosigkeit gegenüber seinem Umfeld und sich selbst: indem man kindliche und jugendliche Traumata dauerhaft zu verdrängen versucht, statt sich ihnen konsequent zu stellen, und permanent den schnellsten Fluchtweg nimmt. So habe ich es auch oft getan. Der autobiografische Rückblick kann in therapeutischer Hinsicht auch heilsam und erkenntnisleitend sein, wenn er nicht bloß der persönlichen Entlastung dient. Bevor ich mich einer äußerst schwierigen Phase in meinem Leben und dem Politikbetrieb als Ganzem auf der Grundlage eigener Erfahrungen zuwende, muss ich daher zunächst eine Reise in meine Kindheit und Jugend wagen. Ich muss in meiner Biografie bis an die Anfänge zurückkehren, um Anhaltspunkte zu geben, wie ich zu dem Politiker wurde, der ich war, oder besser: wie ich auch zu ihm wurde. Erst aus dieser Auseinandersetzung mit meiner Herkunft erschließt sich meine Perspektive auf die Politik, wie ich sie in diesem Buch mit den Leserinnen und Lesern teile.
Die Angst ist mir bis heute ein treuer Begleiter geblieben. Meine Familie und ich lebten am Ende der freien Welt. Heringen in der nordhessischen Provinz in den 1970er Jahren, bestens vom Staat gefördertes Zonenrandgebiet. Eine Region mit klassischem Kalibergbau, mit gutbezahlten und sicheren Arbeitsplätzen. Ein winziger Ausschnitt des westdeutschen Wirtschaftswunders, eine Region, die es sich in der Abgeschiedenheit wohlig-kleinbürgerlich eingerichtet hatte. Zugleich Schauplatz einer unglücklichen Kindheit, meiner Kindheit. Meine Heimat. Bis heute.
Seit ich denken kann, herrschte bei uns zuhause eine Atmosphäre, die von Aggression und Feindseligkeit geprägt war. Meine Eltern kamen, wie in der damaligen Zeit üblich, sehr jung und eher zufällig zusammen: mein Vater war zwanzig, meine Mutter 19 Jahre alt. Mit einer Liebesheirat hatte ihre Verbindung wenig zu tun, wie bei so vielen, die den gesellschaftlichen Konventionen der Zeit gerecht werden mussten. Sie hatten von ihren Eltern, der in vielerlei Hinsicht versehrten Weltkriegsgeneration, selbst kaum Empathie empfangen und gaben ihre Traumata an uns, ihre Kinder, weiter: unbeabsichtigt, unbewusst, aber mächtig. Im Abstand von zwei, sieben und neun Jahren folgten mir, dem Erstgeborenen, drei weitere Jungs, meine Brüder. Mit jedem weiteren Kind wuchs jedoch die Überforderung meiner Mutter, einer Frau, die ihr Möglichstes tat, um die Familie zusammenzuhalten, für sie da zu sein, der aber die Mittel dazu fehlten. Mein Vater entzog sich gänzlich den familiären Lasten. Wir lebten damals in einem Viergenerationenhaushalt mit Nebenerwerbslandwirtschaft im Haus der Eltern meiner Mutter. Die Eltern meines Vaters wohnten im nahegelegenen Dorf Kleinensee. Alle Männer in unserer Familie waren Bergleute, ein Beruf, der uns zumindest formal dem Mittelstand zuordnete. Doch emotionale Enge und belastendes Schweigen bestimmten unseren Alltag.
Mein Vater hatte sich ganz anderes vom Leben erhofft. Er war von seinen Anlagen her ein eher weicher Mann, der liebend gern kochte, auch wenn er das Chaos in der Küche und den Abwasch anschließend meiner Mutter überließ. Er fiel aus der Rolle. Er war von seiner dominanten Mutter zeitlebens geschurigelt worden und hatte nie tun dürfen, was er wollte. Nach dem Willen seiner Eltern wurde er Techniker, dann Bergmann, obwohl er einfach nicht dafür gemacht war. Er träumte davon, Koch zu werden. Zudem musste er ein junges Mädchen heiraten, das er eigentlich gar nicht kannte, weil sie bereits nach wenigen Monaten Beziehung schwanger wurde. Weder meine Mutter noch er hatten sich in vorigen Partnerschaften ausprobieren können, sie wussten nicht, wer oder was ihnen überhaupt guttat. Kategorien vom guten Leben in einer Partnerschaft existierten in den frühen 1970er Jahren allenfalls in aufgeklärten Akademikerhaushalten. Mein Vater zerbrach an den Erwartungen, die von einem an Sekundärtugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit, Pflichtbewusstsein oder Zuverlässigkeit orientierten Bergleutemilieu an ihn gerichtet wurden, verschleuderte das Geld, brüllte zuhause cholerisch herum oder versank in Selbstmitleid, sobald er zu viel getrunken hatte. Im Alkohol fand er für ein paar Stunden eine ruinöse Form des Trostes, die ihn den Rest der Zeit zu einem jähzornigen Menschen werden ließ. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, erinnere ich mich als erstes an diesen ständigen Psychoterror, die Regellosigkeit und Willkürherrschaft, die mein Vater als Folge seines schleichenden Kontrollverlusts zuhause errichtet hatte. Die für die Zeit üblichen Ohrfeigen oder mütterlichen Schläge mit dem Kochlöffel waren da noch mein geringstes Problem.
Unvergessen bleibt mir das entwürdigende Ritual, ihn immer wieder sonntags aus der Kneipe holen zu müssen, wenn das Mittagessen längst auf dem Tisch stand. Ein Kind von sechs Jahren, das seinen Vater vom Trinken abhalten sollte, weil die Eltern keine gemeinsame Sprache fanden. Meiner Mutter fehlten die Kraft und der Mut, sich von meinem Vater zu lösen, und ihm die Selbsterkenntnis, dass er die Verantwortung für eine so große Familie nicht zu tragen wusste. Wenn ich mit meinem Vater unterwegs war, herrschte bei mir pure Angst vor seinem Kontrollverlust. Wenn er sich wieder einmal betrank, geriet ich in Panik. Wie sollte ich ihn bloß wieder nach Hause bringen? Er fuhr auch alkoholisiert Auto oder Traktor. Die kleine Nebenerwerbslandwirtschaft meiner Großeltern bestand aus zwei Kühen, zwei Schweinen, ein paar Äckern und Wiesen. Wenn wir mit dem Traktor unterwegs waren, kannte mein Vater beim Trinken keine Hemmungen. In Schlangenlinien ging es auf Feldwegen nach Hause, ich fürchtete jedes Mal, gleich im nächsten Straßengraben zu landen. Manchmal musste ich in das Lenkrad greifen, um die Katastrophe zu verhindern.
Gegenüber meiner Mutter empfand ich eher Mitleid, keine Verachtung. Anders bei meinem Vater, dessen eigene Qualen ich als Heranwachsender noch nicht ermessen konnte. Ich hasste ihn, sah ihn nur als Täter, nicht als Opfer, das er auch war. Aus seiner Unsicherheit und seinem fehlenden Selbstwertgefühl entsprang eine Grausamkeit, die mich, seinen Ältesten, besonders traf. Er führte mich vor seinen Trinkgefährten vor, wenn ihm danach war, oder rächte sich später an mir – für Demütigungen, die nicht ich, sondern sein frustrierendes Leben ihm auferlegt hatte. Möglichkeiten der Erniedrigung waren da viele. Meine Kindheit war geprägt von der Willkür immer neuer Verbote und einer Menge Tadel. Auf Lob und Zuspruch wartete ich vergeblich.
Mein Vater versuchte im nüchternen Zustand die im proletarischen Milieu längst angekommene bürgerliche Fassade so gut es ging aufrechtzuerhalten. Oft kochte er exakt so, wie es seine aus dem Sudetenland vertriebene Mutter auch getan hatte. Beim Essen achtete er streng auf gute Tischmanieren. So wie ihm das seine Eltern eingebläut hatten, malträtierte er auch uns. Es wurde geschwiegen, während der Mahlzeit nicht getrunken. Nur einer sprach, oder besser, schrie: mein Vater. Nach seinem ausgiebigen Mittagsschlaf stand der Sonntagsspaziergang an. Wir trotteten lustlos hinter unseren Eltern her. Ich hasste diese bemühten Versuche der Herstellung familiärer Idylle. Aber wenn ich nicht spurte, wurde ich bestraft. Es ging noch schlimmer, als etwas nicht tun zu dürfen, als für alles Mögliche beschimpft zu werden. Jeden November und Februar wurde bei uns im Haus ein Schwein geschlachtet, dessen Fleisch der Metzger anschließend zu Wurst verarbeitete. Wenn mein Vater sonntagabends das Abendbrot vorbereitete, häufte er auf meinem Teller mehrere Brote mit Blut- und Leberwurst an – wissend, dass ich diese Wurst überhaupt nicht mochte. Er zwang mich, sie alle aufzuessen, und begründete sein Vorgehen mit einer der Paradesentenzen des Patriarchats: «Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt!»
Bei Jugendlichen kommt der Moment, in dem sie sich ruckartig von ihren Eltern abzusetzen beginnen: auf die Heldenverehrung folgt ein theatralischer Bruch, der nach der Pubertät im Idealfall schnell verheilt. Für mich aber war es unmöglich, überhaupt erst Stolz auf meinen Vater zu entwickeln, ihm eine Statue zu errichten, die ich anschließend hätte zertrümmern können. Zeitlebens sollte er es nicht schaffen, auf eigenen Beinen zu stehen. Stets versank ich schamerfüllt im Boden, wenn auf der Straße und in der Nachbarschaft abschätzig über ihn gesprochen wurde. In einem Dorf oder einer Kleinstadt, wo die Bewohner sich gegenseitig wie durch Glaswände beobachten, herrscht ein eigener Kreislauf der Doppelmoral: «Was sollen denn die Nachbarn über uns denken?» Um kurz darauf selbst abschätzig über jene Nachbarn zu sprechen. «Ach, du bist das Kind von dem …», hieß es dann mir gegenüber kurz und knapp.
Sobald der Name meines Vaters fiel, brach mir der Angstschweiß aus. Jeder äußere Blick stellte eine Gefahr dar. Viel später, als ich schon Bundestagsabgeordneter war, bestand meine größte Sorge immer noch darin, bei Veranstaltungen in meinem Wahlkreis auf ihn angesprochen zu werden, weil ich dann in einer tief ins emotionale Gedächtnis eingeschriebenen inneren Reaktion sofort das Schlimmste befürchtete: dass er wieder eine Rechnung nicht bezahlt, wieder irgendwo einen Ausfall gehabt hatte, der zum Dorfgespräch geworden war. Als die familiäre Lage zu eskalieren drohte und er immer mehr Schulden anhäufte, schritten die Eltern meines Vaters ein und beschafften für ihren Sohn und seine Familie ein Haus in ihrem Heimatort Kleinensee, einem zu Heringen gehörenden Dorf. Sie hofften, ihn dort besser kontrollieren zu können und wieder in die Spur zu bringen. Vergebens, wie sich schon nach kurzer Zeit herausstellte. Wegen seiner notorischen Unzuverlässigkeit verlor er seinen Job als Bergmann.
Dieser Umzug verschärfte meinen familiären Alptraum in gewisser Weise sogar noch. Die 13 Kilometer Entfernung zwischen Kleinensee und Heringen waren für mich damals die ganze Welt: Sie entrissen mich meiner geliebten Großmutter Mathilde, dem einzigen Menschen, der mir bis dato Liebe und Sicherheit geboten und eine Art Nest im Chaos bereitet hatte. Sie war der Fels in der Brandung. Bis zu ihrem Tod 2004 blieb sie der wichtigste Mensch in meinem Leben. Mein Vater wusste aus der gemeinsamen Heringer Zeit um unser enges Verhältnis, und wenn er nun in Kleinensee wiederholt Geld brauchte, knüpfte er die Besuche des Enkels bei den Großeltern in Heringen an finanzielle Zuwendungen. Wenn die nicht kamen, durfte ich nicht zu meiner geliebten Oma – so plump, aber effektiv war die Logik seiner Manipulation. Ich war kein Objekt väterlicher Liebe, sondern ein Erpressungsmittel.
Mein Kleinenseer Exil lässt sich im Nachhinein in ein Bild aktueller Popkultur fassen: Wie ein ausgestoßener Bürger in der Serie «Game of Thrones» wurde ich zur Mauer geschickt, einer riesigen Grenzbefestigungsanlage am nördlichen Ende der Sieben Königslande, hinter der die Anderen, die Wildlinge, das große Nichts lauerten. Kleinensee lag unmittelbar an der innerdeutschen Grenze zwischen Hessen und Thüringen. Das idyllische Dörfchen war durch eine Mauer vom gegenüberliegenden, zur DDR gehörenden Ort Großensee getrennt. Obwohl wir offiziell noch im Westen lebten, verirrte sich kein Mensch zufällig in dieses trostlose Zonenrandgebiet. Kleinensee lag im Tal unterhalb eines steilen Hangs, der einzigen Verbindung gen Westen. Wenn im Winter der Schnee lag und es glatt war, fuhr der Bus oftmals nicht; als Folge war ich dann im ansonsten nach allen Seiten umzäunten Dorf eingesperrt. In die DDR hätte ich schlecht flüchten können. «Hinterm Horizont geht’s weiter» – diese Refrain-Zeile aus dem bekannten Liedtext von Udo Lindenberg traf auf meine Heimat ganz gewiss nicht zu. Ich fühlte mich in Kleinensee wie in einem Gefängnis. Aber auch wenn ich in Heringen aus dem Fenster blickte, sah ich in der Ferne einen dunklen Wald und wusste, dass sich dort der kilometerlange, mit Selbstschussanlagen gespickte Zaun befand. An ihm führte kein Weg vorbei. Jenseits der Grenze warteten die Wachsoldaten der NVA.
Der üble Leumund meines Vaters hatte auch in Kleinensee die Runde gemacht. Seine Söhne wurden infolgedessen zur Zielscheibe schlimmer Schikanen, wie sie einander nur Kinder und Jugendliche zufügen können. Damals war es auf dem Dorf noch üblich, viel Zeit in der Natur zu verbringen, unbeaufsichtigt draußen zu spielen, Mannschaftssport zu treiben und schon in jungem Alter Alkohol zu trinken. Den ersten Vollrausch hatte man spätestens zur Konfirmation, nur mit diesem Initiationsritus wurde man Teil der Dorfjugend. Für mich waren diese Gebräuche quälend. Alkohol war das Gift, das meine Familie zerstörte. Ich verband damit zahllose beschämende Momente und ließ früh die Finger davon. Zum Vereinsmeier taugte ich von vornherein nicht, eher bewog mich meine belastete Herkunft zum permanenten Rückzug in eigene Fantasiewelten. Ich war gerne mit mir allein, träumte von einem besseren Leben. Meine Patin schrieb mir dagegen in mein Poesiealbum, das damals jeder Jugendliche besaß: «Seine Pflichten nie versäumen ist mehr, als große Dinge träumen.» Mit meinem Rückzug aus der dörflichen Gemeinschaft setzte ich unbeabsichtigt eine unheilvolle Dynamik in Gang, die sich bei jedem Aufeinandertreffen mit Gleichaltrigen verstärkte. Die anderen ließen mich offen spüren, dass ich der Außenseiter war, der Sohn des Alkoholikers, der sich in der Schule auch noch für etwas Besseres hielt. Sie piesackten und mobbten mich, den Schwächeren.
Zuhause ging es weiter wie bisher, nur dass mein Vater durch seine Arbeitslosigkeit noch mehr Zeit hatte, seinen Frust an seinen Nächsten auszulassen. Mein trauriger Zustand besserte sich, als mich die Eltern meines Vaters, die sehr anständige Leute waren – und die einzigen Menschen, die er respektierte, besser: vor denen er Angst hatte –, ein paar Straßenzüge weiter bei sich aufnahmen. Nachdem ihre jüngste Tochter, die Schwester meines Vaters, im Streit ausgezogen war, kamen sie auf die Idee, die entstandene emotionale Leerstelle mit mir zu füllen. Die meiste Zeit entging ich dadurch den endlosen Streitereien meiner Eltern und verschwand auch zunehmend vom Radar meines Vaters. Doch auch der gute Wille meiner Großeltern änderte nichts an meiner grundstürzenden Verlorenheit an diesem Nicht-Ort: In Kleinensee fühlte ich mich wie der einsamste Mensch der Welt.