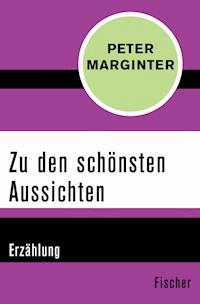
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Peter Marginter ist ein Meister der Parodie und der Groteske. In Metaphern schwelgend erzählt er vom Leben, das ihm einzig ein großes Verwandlungsspiel ist. Unter anderem treten auf: Tortenesser, Kurgäste, Taubenzüchter, Generäle, verhutzelte Frauen, Engelsgesichter, Wurstfabrikanten, Literaten … Auf höchst originelle Weise versteht es Marginter, eine skurrile, märchenhafte Welt zu beschwören, in der die Grenze zwischen Wirklichkeit und Phantasie immer wieder verschwimmt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Peter Marginter
Zu den schönsten Aussichten
Erzählung
FISCHER Digital
Inhalt
für Alfred Brendel
An das Göttliche glauben
Die allein, die es selber sind.
HÖLDERLIN
Ich heiße Kronidis. Engelbert Kronidis.[1]
Es lebt sich nicht immer leicht mit einem solchen Namen, nicht in dieser kurzen Zeit jedenfalls und auf so engem Raum. Dazu das fatale Bewußtsein, daß jeder Griff, jeder Schritt, jedes Wort die Welt verändert, notwendig und unvermeidbar … Als Halbwüchsiger habe ich noch geglaubt, daß Mut dazu gehört. Mut! Ich wäre gern mutig gewesen. Wie meine Geschwister, die mich nie ganz ernst nehmen werden. Darüber bin ich hinaus. Mir ist es auch ziemlich egal, was meine Geschwister über mich denken. Ich habe gelernt, daß es nicht Mut ist, der sie trägt, sondern einfach ein gewisser Mangel an Einsicht. Oder doch das Vertrauen auf ein Schicksal, das mächtiger ist als unsere Taten und ihre Folgen.
Auch mich hat ja zuletzt dieses Vertrauen getragen, bis hierher in dieses windschiefe Gasthaus »Zu den schönsten Aussichten«, wo ich auf der Veranda sitze, schreibe und mein Schicksal erwarte. Das Zimmer war reserviert, seit jeher reserviert, wie mir der Wirt versicherte, und ob es nun eine Frage von Tagen oder Jahren ist, soll mir gleichgültig sein. Bis dahin will ich hier sitzen und schreiben, atme den würzigen Holzgeruch der Veranda, den Speckduft aus der Küche, und schaue aus den Fenstern über Landschaften, die ich kenne, und Landschaften, die mir bekannt vorkommen. Die Fenster bestehen aus vielen quadratischen Scheiben mit hölzernen Stegen dazwischen. Das ergibt einen Raster, der es mir ermöglichen könnte, jeden Punkt dieser Landschaften so genau zu bestimmen, daß auch ein anderer ihn danach wiederfindet. Allerdings müßte er auf demselben Platz sitzen, um denselben Blickwinkel zu haben: Ein sehr unwahrscheinlicher Zufall, mit dem sich nicht rechnen läßt, wechsle doch ich selbst fast täglich meinen Ort auf der langen, harten Bank entlang der altersbraunen Täfelung. Was sonst sollte ich als einziger Gast tun in dieser Veranda, die rund um das Haus herum führt? Abgesehen davon spielen auch die Hausleute mit, sie decken mir jeden Morgen das Frühstück woanders als am Vortag, um mir eine Überraschung zu bereiten, denn an dem Frühstück selbst ändert sich nichts. Natürlich bleibt es auch immer dasselbe Heft, in dem ich meine Beobachtungen und Erinnerungen aufzeichne, und überhaupt überwiegen im Nahbereich durchaus die Konstanten. Nur die Aussichten sind variabel. Vielleicht nicht sehr, aber es macht das Warten erträglich. Ich langweile mich eigentlich selten.
Droben in meinem Zimmer habe ich mich eingerichtet, als ob ich hier zu Hause wäre. Freilich kann ich nicht gleichzeitig auf den zwei Stühlen sitzen, geschweige denn die zwei Kästen mit dem bescheidenen Inhalt meines Rucksacks füllen. Und das Bett ist viel zu breit für mich. Manchmal, wenn ich in der Nacht aufwache, halte ich das zweite Kissen neben mir umschlungen und flüstere: »Moira …« Ob sie ahnt, daß sie mich hier treffen wird?
Ich kann mich wieder frei bewegen, das ist schon viel. Der Raum, von dem ich erwähnt habe, daß er eng gewesen sei, war an dem Ende, das mit meinem Anfang zusammenfällt, nicht größer als auch die anderen Torwächterhäuser, die an den Toren des großen Gartens lagen. Wir nannten unser kleines Haus etwas prätentiös und irreführend »The Lodge«. Torwächterhäuser werden gern so genannt, und an sich sagt das gar nichts.
Immerhin war unser Haus in einem hübschen klassizistischen Stil gehalten, nach dem Vorbild eines dorischen Monopteros, wenn auch mit anachronistischen Elementen, die den gegenwärtigen klimatischen Bedingungen und Lebensverhältnissen entsprachen. Drinnen gab es außer Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer sogar ein Bad mit WC. Dieses Bad war eigentlich der einzige wirklich geräumige Raum, denn im übrigen Haus erdrückten uns fast die wuchtigen Möbel, alles alte Erbstücke, mit vielen Erinnerungen verbunden, von denen wir uns nicht trennen wollten, obwohl wir längst nicht mehr ihre Maßstäbe erreichten. »Wartet nur, Kinder«, pflegte Mama zu sagen, »das kommt alles wieder in Mode, wenn ihr lange genug wartet.« Und dazu Tante Klara! Schon die Eingangstür war zu schmal für Tante Klara, seitlings nur konnte sie in den winzigen Vorraum chassieren, den sie im Winterpelz bis in die Winkel ausfüllte. Auch noch der Schirmständer mußte entfernt werden, um ihr das Einschwenken in die Küche zu ermöglichen. Wir Geschwister schliefen teils unter den schrägen, tief herabgezogenen Decken des Dachraums, zu dem man durch die Klappe über dem Eßtisch hinaufgelangte, teils in der Küche. Dennoch verbrachten wir dort eine glückliche, recht sorglose Kindheit, und wir waren richtig stolz, wenn an den Wochenenden die Touristen unser Haus photographierten. Ich wenigstens fühlte mich auch frei darin. Die Enge, die ich zu passieren hatte, war eine andere, in einem mehr existentiellen Sinn.
Übrigens blieb unser Haus nicht ganz so klein. Irgendwann bauten wir eine Garage an, die zugleich auch als Werkstatt diente, und dann gab es ja noch die Keller, an deren Erweiterung und Vertiefung der gute Papa seine Freizeit verwandte. Was er mit den Kellern vorhatte, wurde uns nie recht klar, vielleicht war es nur ein unbestimmter Drang sich auszudehnen, dem er da folgte.
Hinter Mamas Gemüsebeeten beginnt der Garten. Die Büsche und Bäume drängten hier nahe heran, ein lockerer, dennoch undurchdringlicher Wall. Vom Tor aus, das ich nur verschlossen kenne, sieht man weiter, da läuft die Allee schnurgeradeaus. Aber dort, wo sich in der Perspektive die beiden Baumreihen treffen, versickert auch die Allee im Grünen. Dort endeten auch unsere Streifzüge, die wir als Kinder unternahmen. Urplötzlich überkam uns jedesmal die Furcht, daß wir uns verlieren könnten, und dann rannten wir nach Hause, so schnell uns die Beine trugen. Auch graute uns vor den Wesen, von denen wir uns vorstellten, daß sie die Wege ausgetreten hatten, deren Ansätze man im Dickicht zu erkennen glaubte. Beim Spielen blieben wir immer in Sichtweite des Hauses, und später dachten wir kaum mehr an den Garten. Mag sein, daß in seiner Mitte unser Stammschloß verborgen liegt. Ich habe es nicht gefunden, und das Ding auf der verblaßten Daguerreotypie in unserem Familienalbum wirkt auch nicht besonders einladend. Es gibt andere Gärten, die weniger unheimlich sind, und vor allem war da die Stadt, die uns anzog, und die sogenannte weite Welt.
Drei Erwachsene und sieben Kinder in einem so kleinen Haus! Ich erinnere mich, daß Papa gelegentlich noch andere Verwandte andeutete, aber mehr paßten wirklich nicht hinein. Auch sonst kann ich leicht auf diese Onkel und Tanten und ihre Nachkommenschaft verzichten. Unsere Familie ist ohne sie schwierig genug.
Ich würde gern wissen, was aus unserem Haus geworden ist. Hin und wieder packt mich das Heimweh wie ein körperlicher Schmerz. So ein Doppelzimmer in einem Gasthaus kann schon eine sehr einsame Stätte sein, trotz aller schönsten Aussichten. Ob sie mich vermissen? Sie? Ich weiß ja nicht einmal, wer dort jetzt ein und aus geht. Nach der Jahreszeit könnte Mama den Hagebuttenwein ansetzen. Ob Papa noch immer im Keller wühlt?
Nein: Morgen suche ich mir einen anderen Platz …
Nicht jeder Bart verbirgt etwas.
Das ist eine von den Binsenweisheiten, mit denen man ziemlich weit durchs Leben kommt. Die meisten Bärte sind so offensichtlich darauf hingetrimmt, mehr zu zeigen, sogar mehr als darunter steckt. Im allgemeinen empfiehlt es sich, die Hälfte abzuziehen. Leute wie ich, die nicht von Natur aus zur Nachdenklichkeit neigen, vergessen freilich leicht, daß jeder solche Satz einen Gegensatz hat, der mit ihm zusammen erst die ganze Wahrheit ergibt: Manche Bärte verbergen etwas.
Ich habe mir eine Weile lang eingebildet, daß ich diese Erkenntnis einem Zufall verdanke. Seither hat sich allerdings einiges ereignet. Ich bin, wie man sagt, reifer geworden.
Angefangen hat das an einem meiner ersten Tage in B.
Richtig krank war ich ja nicht, höchstens etwas überspannt und überfressen. Das hatten auch die Ärzte begriffen. Sie heuchelten ein oberflächliches Interesse an meinem Blutdruck, ließen mich Kniebeugen machen und die Zunge herausstrecken und nickten gewichtig. Das wiederholte sich jeden Morgen. Im übrigen bestand meine Kur darin, daß ich außer den abendlichen Schlaftabletten wenig und schlecht zu essen bekam.
Kein Wunder, daß auch ich mir angewöhnte, nach dem Frühstück unverzüglich eine der Konditoreien am Hauptplatz aufzusuchen. Andere Kurgäste, die dort schon saßen, schauten bei meinem Eintreten diskret in eine andere Richtung. Wenn ich Glück hatte, fand ich einen Fensterplatz. Der Kellner brachte Zeitung und Kaffee, und ein beschämend dünnes Mädchen schob den Wagen heran, auf dem sich die Torten und Kuchen türmten.
An jenem Tag hatte ich mir etwas ausgewählt, das wie eine Linzertorte aussah, aber gänzlich ungenießbar war. Ein kleistrig süßes, scheußliches Ding. Die Zeitung kannte ich auch bereits, rührte daher verdrossen in meinem Kaffee und beobachtete einen Mann, der draußen in der Mitte des Platzes auf einer der Steinbänke vor der Pestsäule die Tauben fütterte.
Ein friedliches, freundliches Bild, das mich bald besänftigte. Der Mann hatte einen oder mehrere Bärte und trug dazu eine Fellmütze und einen Mantel mit Pelzkragen, so daß er außerordentlich haarig wirkte, wie ein Bär. Die Tauben drängten sich zu seinen Füßen, zuletzt bestimmt an die hundert, und er griff immer wieder in die Taschen seines Mantels. Die Taschen waren scheinbar unerschöpflich und die Tauben unersättlich.
So, fiel mir ein, mußte man sich vielleicht den Geheimrat – reifere Leser werden sich möglicherweise sogar an seinen Namen erinnern – vorstellen. Papa hatte vor meiner Abreise angedeutet, daß er es für durchaus wünschenswert halte, Bekanntschaft mit dem Geheimrat zu machen. Ich hatte die Bemerkung nicht sehr ernst genommen. Auch jetzt war der Gedanke, daß der wirkliche Geheimrat auf einer Steinbank vor der Pestsäule von B. sitzen und die Tauben füttern könnte, eher belustigend.
Immerhin war meine Neugier soweit erregt, daß ich mir den haarigen Herrn einmal aus der Nähe anschauen wollte. Die angebliche Linzertorte gab mir einen prächtigen Vorwand. Statt mich bei dem dünnen und vermutlich unschuldigen Mädchen zu beschweren, konnte ich das Zeug den Tauben vorwerfen.
Ich zahlte also, wickelte die Torte in eine Papierserviette, ließ mir in den Mantel helfen und ging aus der Konditorei hinüber zur Pestsäule. Unterwegs wurde mir allerdings klar, daß es eine grobe Ungehörigkeit gewesen wäre, durch rücksichtsloses Vorprellen die Tauben, die der Unbekannte um sich gesammelt hatte, zu verscheuchen. Ich schlug daher einen Bogen, der mich zu einer anderen, dem Gegenstand meines Interesses halb abgewandten Bank führte.
Ich hatte mich eben hingesetzt und ein paar Krümel gestreut, ohne zunächst damit auch nur eine einzige Taube anzulocken, als irgend etwas die dummen Tiere meines Nachbarn erschreckte. Sie stoben auf, eine silbrige, knatternde Wolke, und umkreisten die Pestsäule. Dann fielen sie bei mir ein, um sich auf meine Krümel zu stürzen.
Ich war davon zumindest ebenso überrascht wie der Herr von nebenan und hatte alle Hände voll zu tun, um die Nachfrage zu befriedigen. Trotzdem entging mir nicht der scharfe Blick, der mich traf. Der Herr stand auf, klopfte die Brösel von seinem Mantel und entschritt, während ich mich mit den ekelhaften, gurrenden Biestern herumschlug.
Damit wäre die Sache für mich erledigt gewesen, wenn die verdammte Kur mich nicht am folgenden Tag noch früher als sonst aus dem Bett getrieben hätte. Man wollte meinen Morgenharn, lange vor dem sogenannten Frühstück, und da ich nun schon wach war und mein Magen knurrte, zog ich mich an und begab mich zum Hauptplatz.
Die Stadt war noch farblos, fröstlig und fast menschenleer. Um so mehr erstaunte es mich, als ich am Fuß der Pestsäule den Bärtigen wiedersah. Er stand mit dem Rücken zu mir, und als ich beim Überqueren des Platzes hinter ihn kam, streute er mit der breiten Geste eines Sämanns eine Handvoll rosig leuchtender Körner unter die Tauben, die ihn schon gurrend umtrippelten.
Ich blieb stehen, teils um das Idyll nicht zu stören, teils auch aus Befremden. Noch trippelte und gurrte es, aber da schlug auch bereits mein Verdacht in Entsetzen um. Die ersten Vögel schwankten wie betrunken, drehten sich im Kreis, schlugen schwerfällig mit den Flügeln und kippten schließlich um. Ich stand wie gelähmt. Um den Mann vor mir breitete sich ein Teppich von zuckenden, erstarrenden Vogelleibern. Ich wollte ihn anschreien, Einhalt gebieten – es gelang mir nicht. Jetzt war er anscheinend mit dem Ergebnis zufrieden, schob sich mit den Schuhen den Weg frei. Zweimal hielt er an, bückte sich und hob zwei Tauben auf, steckte sie in einen Papiersack.
Und dann war er fort. Ich taumelte in die Konditorei, obwohl mir für diesmal jeder Appetit vergangen war, bestellte daher auch einen doppelten Cognac, bevor ich mich in einen der vielen freien Sessel am Fenster fallen ließ, den Blick wie gebannt auf den leblosen Vögeln, die draußen herumlagen.
»Unmensch«, stöhnte ich. Wie war es möglich, diesen armen Geschöpfen ihre natürliche Flatterhaftigkeit so grausam zu vergelten?
Während mich noch das Grauen und die seifige Schärfe des Cognacs schüttelten, belebte sich aber vor meinen Augen die Szene wieder. Die erstarrten Körper zuckten, Flügel spreizten sich, und zuletzt stand eine Taube nach der anderen wieder auf ihren zwei Beinen. Sie trippelten noch ein Weilchen durcheinander und flogen dann plötzlich ab, eine silbrige, knatternde Wolke.
Jemand im ersten Stock eines Hauses auf der anderen Seite des Hauptplatzes hatte ein Fenster aufgestoßen, und nach den Tauben traf nun mich der Widerschein der Morgensonne. Geblendet kniff ich die Lider zu. Als ich das Licht nicht mehr auf ihnen spürte und sie wieder öffnete, war der ganze Spuk vorüber, an Tauben erinnerten nur mehr der Heilige Geist, der zwischen Gottvater und Sohn die aus üppigem Marmorgewölk wie ein Atompilz hochgezwirbelte Pestsäule krönte, und Häubchen von weißem Taubendreck. Das Fenster gegenüber zeigte das Brustbild einer jungen Frau, miniaturfern zweifellos, aber ich sah sie wie durch ein starkes Glas, ganz deutlich. Sie war sehr schön, und als sie für einen Augenblick die Hand hob, winkte ich zurück. Daß sie mich hier hinter dem Konditoreifenster im Schatten sehen könnte, war natürlich ausgeschlossen. Und so bezog auch nur der Ober meine Geste auf sich und kam von der Theke herübergesegelt, um sich nach meinen Wünschen zu erkundigen. Aber ich vergaß dieses Bild nie mehr: Die wieder zum Leben erwachten Tauben, der über sie hin und auf mich zu huschende Lichtfleck, der lautlose Aufprall des Glanzes und zuletzt die schöne Frau im Fenster, wie sie die Hand hob.
Dann freilich kehrten meine Gedanken zu den vorangegangenen Ereignissen zurück. Hatte ich also dem Bärtigen unrecht getan? Zweifellos hatte er die Tauben nicht vergiftet, sondern nur betäubt. Aber warum hatte er dann diese zwei Tauben eingesteckt? Was ging hier vor?
Es war niemand da, den ich hätte fragen wollen, aber ich war fest entschlossen, es herauszukriegen. Zwei weitere Tage lag ich in der Konditorei auf der Lauer. Und dann – zur Jausenzeit, unter einem golddurchwirkten Vorfrühlingshimmel – saß er plötzlich wieder auf der Bank, wie irgendein Pensionist und Taubenfreund.
Diesmal verzichtete ich auf die Linzertorte. Geradewegs, als ob ich es sehr eilig hätte und an nichts anderes dächte, lief ich in die Tauben hinein und scheuchte sie auf. Der Aufruhr bremste mich ab, ich zog meinen Hut.
»Entschuldigen Sie –«
»Keine Ursache«, fand er und erhob sich.
»Aber –«, beharrte ich.
Er war etwas größer als ich und auch sonst eine eindrucksvolle Gestalt. Der breit ausschwingende Schnurrbart über einem spatelförmigen Vollbart verlieh ihm etwas Militärisches. Ich nahm Haltung an, und das schien ihm zu gefallen.
»Kurgast?« fragte er.
»Jawohl«, schnarrte ich.
»Viel zu jung«, meinte er und schüttelte mißbilligend den Kopf.
»Ich werde jeden Tag älter«, verteidigte ich mich.
Er schmunzelte unter seinen Bärten, hob grüßend die Hand an seine Fellmütze und ging.
Das nächste Mal gelang es mir, schon vor ihm auf der Bank zu sitzen. Er nickte mir zu wie einem Bekannten, mit dessen Existenz man sich abgefunden hat, und nach einigen belanglosen Sätzen über das Wetter stellte ich mich vor.
»Oh«, sagte er. »Sehr erfreut. Mein Name ist Kundalin. Alexander Napoleonowitsch Kundalin, General a.D.«
»Und Taubenfreund«, ergänzte ich, um das Gespräch auf den bewußten Vorfall zu lenken.
»Taubenzüchter«, berichtigte er und deutete auf die Vögel, die ungeduldig vor uns trippelten: »Nichts als ordinäres Ungeziefer heute, leider …« Er brachte eine Handvoll Futter aus der rechten Manteltasche und streute es unter sie. »Aber auch unter den Tauben von B. gibt es Besonderheiten, sozusagen verwilderte Aristokraten. Das Halten von Tauben war ja, wie Sie wissen, früher einmal ein Privileg des Adels.«
Ich wußte es nicht und hätte gern den Grund dieses merkwürdigen Vorrechts erfahren, wollte den General aber nicht unterbrechen.
»Ja«, fuhr er fort, »die Tauben von B. sind eine kuriose Gesellschaft. Sehen Sie die dort drüben, die mit den Spitzenhöschen! Das ist so ein Bastard, aber eine schlechte Linie, da lohnt es sich nicht. Manchmal, an besseren Tagen, da taucht aus heiterem Himmel etwas wirklich Seltenes auf. Und dann –« Er griff in seine linke Tasche, hielt mir auf der flachen Hand ein Häufchen rosaroter Körner hin. »Meine eigene Mischung: Lähmt sie für ein paar Minuten, so daß ich mir meine Kandidaten herausklauben kann. Aber das geht leider nur sehr früh am Morgen, wenn die Weiber vom Tierschutzverein nicht um die Wege sind.«
»Ah!« rief ich.
»Ja, so war das«, bestätigte er. »Sie haben sich gewundert, nicht wahr? Wenn Sie Lust haben, müssen Sie mich bei Gelegenheit besuchen.«
Der General bewohnte eine Etage in einer von den gepflegten Zinsvillen, die mit ihren Gärten an den Kurpark grenzen. Auch das Gelände des Kurheims ›Hermes‹, in dem ich mehr luxuriös als bequem untergebracht war, schließt an den Kurpark. Wenn ich Schlüssel zu den beiden Hintertürchen besessen hätte, wäre der Weg sehr kurz gewesen. Die Wohnung des Generals entsprach durchaus meinen Vorstellungen. Er zeigte mir seinen Generalstab, den er in einer Art Botanisiertrommel aus abgewetztem Leder verwahrt hielt. Nur Marschallstäbe, belehrte er mich, werden in Tornistern aufgehoben.
»Ich sage es Ihnen, weil Sie offensichtlich nicht gedient haben«, fügte er hinzu.
»Woher wissen Sie das?« fragte ich überrascht.
»Seit Ihrem kleinen Aufbauversuch, damals am Platz«, klärte er mich auf. »Strammstehen, junger Freund, will geübt sein, wer es einmal begriffen hat, dem bleibt das. Die richtige Haltung geht sozusagen vom Schließmuskel aus, wenn Sie den anspannen, ordnet sich das übrige fast von selber, die Hände an der Hosennaht und dergleichen sind dann nur ein Ausdruck der inneren Sammlung um dieses Zentrum. Als frischgebackener Generalstäbler habe ich einmal etwas darüber geschrieben: ›Clausewitz und die Kunst des Strammstehens‹, zu seiner Zeit fast ein Bestseller.«
»Oh!« rief ich. »Sie sind –«
»Zuviel der Ehre«, verneinte er. »Ich schrieb zwar unter Pseudonym, aber der, den Sie meinen, ist jünger.«
Eine ältliche Person schleppte einen Samowar an, und der General bat mich mit einer Handbewegung in einen der Clubfauteuils vor dem niederen Onyxtisch. Wir tranken den Tee aus altmodischen Gläsern, echt russischen Tee ohne Milch, dafür mit reichlich Kandiszucker. Auch die dürren, salzigen Kekse schmeckten nach den Steppen Asiens. Trotzdem fühlte ich mich merkwürdig zu Hause. »Eine von Ihren Tauben?« erkundigte ich mich im Hinblick auf den grauweißen, recht martialischen Vogel, der mich vom Buffet her mit seinen starren Glasaugen fixierte.
»Ein Prototyp«, bestätigte der General. »Ein anderes Mal will ich Sie gern in mein kleines Häuschen mitnehmen und Ihnen auch die anderen Tiere zeigen. Nein, ich züchte nicht nur Tauben – und nicht nur aus uneigennützigem Interesse, von einer Generalspension wird heutzutage niemand fett. Auch nicht von Tauben, muß ich leider hinzufügen. Aber einem ausgedienten General wird man diese kleine Passion nicht verübeln.«
»Das ist jedenfalls eine sehr eigenartige Taube«, sagte ich.
»Ungewohnt«, gab der General zu. »Dennoch zweifle ich nicht, daß ich auf dem rechten Weg bin. Vielleicht werde ich doch noch den Tag erleben, an dem ich der Welt die Echte Friedenstaube vorführen kann.«
»Die Echte Friedenstaube?« fragte ich verblüfft.
»Columba pacis.« Der General nickte. »Sozusagen eine Wunderwaffe, wenn Sie es umgekehrt betrachten. Halten Sie mich jetzt für verrückt?«
»N-nein«, log ich.
»Es würde mir auch nichts ausmachen«, versicherte er. »Trotzdem werden Sie verstehen, daß ein Mensch mit meiner Vergangenheit das Kriegspielen satt hat. Wollen Sie meine Orden sehen?« Er deutete auf ein Mahagonimöbel mit vielen schmalen Laden, wie es zur Aufbewahrung von Münzsammlungen verwendet wird. »Voll bis oben. Ich war kein alltäglicher General.«
»Generäle sind überhaupt nicht alltäglich«, wandte ich ein.
»Meinen Sie?« Er lachte. »Kann sein, daß Sie recht haben. Vielleicht ist unsere Zeit wirklich vorbei. Heute fiele mir die Wahl schwer, wenn ich ein junger Mann wie Sie wäre und einen Beruf ergreifen müßte. Aber in meinen Tagen …« Er strich seine Bärte und betrachtete mich forschend. »Ich fürchte, Sie werden es nicht begreifen. Auch ich kann es nicht begreifen, ich sehe nur, daß heute die Kinder ganz anders erzogen werden. Damals, als ich ein kleiner Junge war, fand man sich nicht damit ab, daß die meisten Menschen einander nicht ausstehen können. Wir mußten immer artig sein, immer höflich und womöglich liebenswürdig, ganz besonders zu alten Damen, im allgemeinen aber zu allen Erwachsenen und sogar zu Mädchen. Wir durften keinen Schwächeren prügeln. Ständig mußten wir Ordnung halten, die Hände waschen, die Haare schneiden lassen: Nichts als Heuchelei! Und später wurden wir Generäle und bildeten uns ein, daß man dasselbe auch auf den Krieg anwenden könnte. Wir träumten von der Idealen Schlacht, die schon entschieden war, bevor sie geschlagen wurde. Der Krieg als logisch-pädagogisches Spiel nach den Regeln unserer Kinderstuben, ausschließlich im Sandkasten.« Er zuckte mit den Achseln. »Natürlich ein Irrtum: Krieg ohne Blut, Tränen und Trümmer! Eine Chimäre. Der Schwächere zieht auf jeden Fall den kürzeren, aber der Starke soll auch ein paar Haare lassen. Und Verluste sind immer relativ. Ich kenne da eine Geschichte, die irgendwie herpaßt.[2] Aber die wahre Geschichte, das ist die Geschichte der Generäle, ebenso wahr wie langweilig.« Er schien zu überlegen, welche er mir erzählen sollte.
Die Geschichte der Generäle, an die der General dachte, war offenbar ganz außerordentlich langweilig. Zuerst bemerkte ich es nicht wegen der vielen Haare. Die Bärte des Generals verbargen doch einiges, und die eisengrauen Locken hingen ihm jetzt tief in die Stirn, bis an die Brauen. Erst als die Pause sehr lange dauerte und der General schließlich leise zu schnurren begann, wurde mir klar, daß er eingeschlafen war. Ein alter, müder Herr.
Ich wollte ihn nicht stören, blieb daher ruhig sitzen, holte nur mein Teeglas heran und streckte die Beine aus. Draußen dämmerte es, und im Zimmer war es schon richtig dunkel. Auch ich wurde schläfrig. Eine Weile beobachtete ich die ausgestopfte Friedenstaube, dann sank mein Kopf vornüber, das Kinn auf die Brust.
Lange kann es nicht gedauert haben, denn das Zwielicht war fast unverändert, als das Knarren der Flügeltüre mich weckte. Ich blickte auf. In dem Spalt, bis zu dem sich die Tür geöffnet hatte, stand eine weibliche Gestalt, ein Mädchen oder eine junge Frau in einem leichten, gegürteten Mantel. Ihre Gesichtszüge waren kaum mehr zu unterscheiden, aber ich hätte schwören wollen, daß es niemand anderer war als die Frau, die mir an jenem Morgen in dem fernen Fenster am Hauptplatz erschienen war. Als sie uns da sitzen sah, lächelte sie und legte einen Finger an die Lippen. Lautlos, ohne ein Knarren nun, zog sie sich zurück. Unsinn, sagte ich mir, und zugleich schnarchte der General laut auf und erwachte.
»Wo bin ich stehengeblieben?« fragte er. »Es ist ja stockfinster!«
»Ja«, sagte ich und stand auf. »Ich werde jetzt gehen müssen. Im Kurheim ist man pünktlich.«
Außerdem – aber das behielt ich bei mir – hasse ich Geschichten. Selbst meine eigene.
Ich weiß, ich bin ein Opfer meines Milieus und meiner Herkunft.
Baron Harold Auspitz, der Wunderrabbi aus der Mommsengasse, hatte Mama gewarnt, Papa beschworen: Der Saturn stand im Jupiter, Mars konjugierte mit Venus, Merkur trat in Neptun. Sonne und Mond gingen in Opposition. Eine unmögliche, unheilvolle Konstellation. Die Erde bebte diskret.
In der Staatsoper gab man eine leider verschollene Oper von Monteverdi, und die Eltern wären besser hingegangen, statt Tante Klara zu schicken, mit der sie seit dem frühen Ableben ihres Mannes das Bett teilten. Der Tante schwante nichts Gutes, aber sie war so dick, daß sie zwei Plätze brauchte, und sie hatte Geburtstag. Außerdem durfte das Abonnement nicht verfallen, rotsamtene Erbsitze im zweiten Rang, man ruinierte sich ohnehin für seine Gesundheit und das Geschäft. Vielleicht würde die Oper abbrennen, Tante Klara war darauf gefaßt, aber sie, die Witwe, hatte kein hungriges Maul zu stopfen, außer dem eigenen.
Mein Bruder Johann, der sich in reiferen Jahren, nach dem letzten Konkurs Papas, Jean nannte, erblickte neun Monate später das Licht der Welt, denselben Glühstrumpf, an den auch ich mich noch gern erinnere. Dr. Arty Fischl, der einzige Freund, der uns aus jener Zeit geblieben ist, sagte schon damals: »Er neigt zum Verschwinden.« Baron Auspitz verwies auf seine Warnung. »Wir werden ihn trotzdem liebhaben«, versprach Mama.
In der Tat gab es kein zweites Mitglied unserer großen Familie, das man so oft hatte suchen müssen wie Johann-Jean. Unser Hausherr, der von den Sternen wenig hält, führte diesen lästigen Zug auf gewisse Bemühungen zurück, denen Johann-Jean im zarten Säuglingsalter ausgesetzt wurde. Meine guten Eltern, ständig von der Sorge um uns erfüllt, ließen ihn nämlich einige Male an belebten Orten liegen, immer in der vergeblichen Hoffnung, ein unbekannter reicher Kinderfreund würde sich seiner annehmen, und ohne zu bedenken, daß seine kleine Seele durch die regelmäßigen Mißerfolge einen dauernden Schaden erleiden könnte.
Als Bübchen und Bub, mit reicher Phantasie ausgestattet, nutzte Johann-Jean jede Gelegenheit, sich der Aufsicht zu entziehen. Dabei kannte er sich in unserer Stadt bald besser aus als ein Taxichauffeur, so daß wir nur unruhig wurden, wenn er nicht zu den Hauptmahlzeiten erschien. Nach drei oder vier Tagen bemerkte dann Papa, daß Mamas Augen an der Pendule hingen, und fragte uns: »Wo ist euer Bruder Johann?« Aber er kam schließlich doch wieder. Und da jeder von uns früher oder später seine eigenen Wege ging, gewöhnten wir uns an seine Besonderheit.
Die Pubertät bewirkte bei Johann-Jean nicht nur die üblichen physischen Veränderungen, auch sein angeborenes Talent reifte. Nicht nur Mama, wir alle liebten ihn. Wenn wir uns auch nicht mehr um ihn sorgten, waren wir doch glücklich, ihn unter uns zu wissen. Da er im Handumdrehen verschwinden konnte, vermied man alles Unbedachte. Ach, vergebens! Johann-Jean hatte sich etwas ganz Neues ausgedacht, das ihm erlaubte, selbst als Anwesender verschwunden zu sein. Er verkleidete sich.
»An den Kindern sind immer die Eltern schuld«, behauptete der Fürsorgerat Fiala bei jedem seiner Kontrollbesuche. »Weil sie nichts wie Vergnügen im Kopf haben.«
Er lachte dabei, weil es gar zu offensichtlich war, daß dieser Vorwurf auf unsere Eltern nicht zutraf.
Wir brauchten lange, bis wir herausgefunden hatten, wer der Fürsorgerat Fiala wirklich war, und es ging uns auch nichts ab, als er danach ausblieb. In anderen Fällen aber waren wir Johann-Jean durchaus zu Dank verpflichtet. Er ersetzte uns auch viele angenehmere Bekannte, als sie sich, den großen Konkurs vorausahnend, von uns zurückzogen. So half er, daß Papa sein Los leichter tragen konnte. Eine freudige Überraschung für ihn, der längst nicht mehr gewohnt war, daß man geringe Summen von ihm forderte, bereitete Johann-Jean jedesmal am Ultimo, wenn er in der Maske des Gerichtsvollziehers sein Taschengeld eintrieb. Nur durch Zufall und allmählich – man grüßte etwa einen Freund, der am Vortag bei uns zu Besuch gewesen war, und wurde von ihm kalt ignoriert – erfuhren meine Eltern, wie tief ihr Ansehen bereits gesunken war.
Wo Johann-Jean sich herumtrieb, wenn er nicht bei uns weilte, erfuhren wir selten. Die Schule jedenfalls hat er nie regelmäßig besucht. Abgesehen davon, daß er so häufig verschwand, war er sehr undurchsichtig, schweigsam wie jeder große Künstler, der seiner Berufung lebt.
Manchmal hörten wir über Dritte und Vierte von ihm. Seine Verwandlungen waren so überzeugend, daß er mitunter echter wirkte als die kopierte Person. Der Fall der Gräfin* de**, die von einem Cocktail der Herzogin*** de**** entfernt wurde, weil sie angeblich schon anwesend war, fand sogar Niederschlag in den Salonblättern.
Ein anderer wäre vielleicht auf die schiefe Bahn geraten, statt sein ehrliches Brot beizeiten mit saurem Schweiß zu begießen. Nicht so Johann-Jean, der sich mit uns Geschwistern in den aufrechten Charakter Papas und Mamas verhaltene Liebenswürdigkeit teilte. Seine Streiche waren grundsätzlich harmlos angelegt, sozusagen ergötzend und belehrend, und nie auf unsauberen Gewinn bedacht.
Jeder mißliche Ausgang bedrückte ihn schwer. Einmal – auch darüber berichteten sowohl der »Abendstern« als auch der »Taschenspiegel« – wies er einen hohen Orden, den unser Bundespräsident im Vorbeischreiten dem außerordentlichen und bevollmächtigten Minister eines afrikanischen Zwergstaates anheften wollte, so stolz von sich, daß der wahre Mohr diplomatisch verwickelt wurde und sich in einen Brieföffner stürzte. Zum Glück und mit Hilfe von Dr. Fischl konnte Papa den Hintergrund des aufsehenerregenden Selbstmords vertuschen, aber das kostete uns den besseren Teil von Mamas Mitgift. Johann-Jean blieb ungeschoren, er mußte uns jedoch geloben, daß er nie mehr in seinem Leben einen Orden ablehnen werde.
Aus den zwei Beispielen könnte ein Fremder den Eindruck gewinnen, daß Johann-Jean – hie ao. und bev. Minister, dort Gräfin – ein Snob gewesen sei, und das trifft ja in gewisser Hinsicht für die meisten Künstler zu, wenn sie erst einmal auf der Leiter des Erfolgs hoch genug geklommen sind. Aber Johann-Jean blieb immer dem Volk verbunden. Wohl schmeichelte ihm das Rampenlicht, wohl mundeten ihm die Kaviarbrötchen und Martinis der happy few, aber er tat es auch um eines Gansels und der reinen Kunst willen bei einer Bauernhochzeit als verlassene Geliebte oder auf einem Betriebsausflug als Aufsichtsratsvorsitzender. Vorübergehend war Johann-Jean sogar von klassenkämpferischen Motiven bewegt. Als unheilverkündender Doppelgänger bekehrte Johann-Jean ganze Sitzungssäle voll profitgieriger Kapitalisten zu den Idealen christlicher Nächstenliebe, und selbst unser guter Papa erlebte zu seinem ratlosen Entsetzen, wie ein aschgrauer Gläubiger mit zitternden Fingern Schuldscheine zerriß, ihn an die Brust zog und unter Tränen um Vergebung bat.
Von großen Festen brachte Johann-Jean immer einige Leckerbissen mit. Der Schneider Dokupil, dessen Freundschaft er wegen seiner aufwendigen Garderobe pflegte, hatte ihm die Innentaschen aller Gesellschaftsanzüge mit wasserdichter Ölseide gefüttert und auch in die wallenden Teile der Abendkleider derartige Behälter eingebaut. Tante Klara vor allem pries in diesem für sie besonders wichtigen Belang den Familiensinn ihres Neffen und stellte fest, daß das Genie dem teuersten Hochschulstudium vorzuziehen sei.
Mit den Jahren jedoch rieb die Kunst, der er sich mit heiligem Ernst widmete, den sensiblen Johann-Jean auf. Er sah müde und abgespannt aus und mimte fast nur mehr krankhafte Charaktere.
Selten nahm er sich noch die Mühe, sich für uns eigens umzuziehen. Wir wußten kaum mehr, wie er wirklich aussah, und nur die Überlegung, daß sich Popstars, Weltrekordfahrer oder rauschgiftsüchtige Maharanis gewiß nicht an unseren bescheidenen Tisch verirrt hätten, überzeugte uns, daß es dennoch niemand anderer als unser Johann-Jean war, der sich unter uns befand. Auch so kam er aber leider seltener als früher, obwohl diese stillen Abende, wie er mir gestand, für ihn wie eine Rast auf einer glücklichen Insel waren.
Vielleicht war der Fleischhauer, dem Tante Klara in einer schwachen Stunde zum Opfer fiel, schuld an der Entfremdung. Tante Klara, deren Fülle mit Sandwiches und Pastetchen allein nicht genüge getan werden konnte, hatte den biederen Mann gern erhört. Es war eine Vernunftehe, wenigstens ihrerseits, aber unser neuer Onkel pochte auf Familienanschluß. Her- und Zukunft trennten ihn und uns: nennen wir es ruhig Standesunterschied, so hoch sein Rang in den düsteren Bezirken, aus denen er kam, gewesen sein mag. Das feine, sülzige Fett Tante Klaras hatte nur zur Gemütlichkeit beigetragen, Onkel Alois Pichler mit seinem kernigen Muskelspeck blieb ein Fremdkörper. Mit Ausnahme Tante Klaras reagierten wir bald auf ihn so allergisch, daß wir selbst seine Würste und Koteletts bei allem Heißhunger nur widerwillig und mit Ekel verzehrten. Die Harmonie, die trotz aller Schicksalsschläge immer in unserem Kreis gewaltet hatte, war dahin. Wir stritten nicht, nein, aber wir saßen satt, schweigend, die Bäuche geschwollen von den Gaben des Onkels, um den Tisch und ließen stumpf und resigniert die Berichte über seine Schlächtereien über uns ergehen.
Als uns zu Bewußtsein kam, daß Johann-Jean seit Monaten fehlte, und Papa, den plötzlich etwas von seiner alten Entschlußkraft anwandelte, uns den Befehl erteilte, ihn endlich und auf der Stelle zu suchen, murrten wir und fanden, unser Bruder sei mit seinen siebenundzwanzig Jahren alt genug, um auf sich aufzupassen. Erst die inständigen Bitten Mamas brachten uns auf die Beine.





























