
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Vor 300 Jahren hat die Menschheit sich selbst fast ausgelöscht. Einige reiche und kluge Menschen haben sich rechtzeitig in semiautarke Refugien zurückgezogen, und ihre Nachkommen führen ein sicheres, beschütztes Leben dort. Außerhalb bedrohen zahlreiche Gefahren die Nachkommen der letzten Überlebenden der Katastrophe, das Erwachsenenalter erreicht kaum jemand. Jeder Tag ist ein Kampf um Nahrung, gegen tödliche Krankheiten und wilde Tiere. Die Refugien also Inseln des Glücks? Sklaverei, allgegenwärtiger Drogenkonsum, ein korrupter Ältestenrat, strenges Reglement und kein Familienleben sind der Preis. Mikan ist Ernährungsexperte im einzigen Refugium in Portugal. Als konsequenter Misanthrop und Drogenhasser hat er sich viele Feinde gemacht und landet durch Sabotage außerhalb des Schutzschirms des Refugiums. In einer Welt, in welcher der verweichlichte Mikan trotz seiner herausragenden Intelligenz keine Chance aufs Überleben hat ...
Erster Band einer Trilogie
Kontakt: [email protected]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zuflucht
Refugium 1
Gewidmet allen, denen die Zukunft unseres Planeten wichtig ist, auf einer Welt, in der Menschen noch eine Rolle spielen. BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenKapitel 1: Der Clanchef und das Mädchen
„Ich sehe, du hast neue Pfeile geschnitzt.“
Das Mädchen hob mit freudig leuchtenden Augen bestätigend ihre Hand.
Anerkennend nickte Pinko, ihr Ziehvater. „Mir scheint, dass wir heute Abend einen guten Braten über dem Feuer rösten werden.“
Das Mädchen hob erneut leicht die Hand und lächelte.
Sie waren auf dem Weg zu einem kleinen Tal, in dem erst am Vortag ein Wildwechsel gesichtet worden war. Ein Tag der großen Jagd. Das Mädchen hatte darauf hingefiebert, das erste Mal an vorderster Stelle mit Pinko auf die Jagd zu gehen. Ihre Haare waren streng nach hinten gebunden, sodass sie ihr nicht die Sicht nehmen konnten. Vorausschauend hatte sie eine dünne Moosschicht in ihre Schuhe gelegt, damit sie sich lautlos wie eine Eule bewegen konnte.
Sie betrachtete Pinko bewundernd. Er fügte sich in die Umgebung wie der Geist, der in manchen Märchen erschien. Er verschmolz mit dem Hintergrund, seine Schritte waren sowohl kräftig und schnell als auch federnd leise. Wer mit Pinko jagen ging, brachte immer Beute nach Hause. Seine Arme waren stark, sein Bogen lang und treffsicher. Unvermittelt blieb er stehen.
„Hier ist ein guter Platz für dich, Kind. Sei gelassen. Ich weiß, dass du im richtigen Moment treffen wirst.“
Pinko zeigte auf einen Busch, der eine kleine Kuhle verdeckte. Mitten im Busch gab es dennoch freie Stellen, von denen aus man gut geschützt schießen konnte.
Pinko legte ihr die Hand auf die Schulter.
„Ich wünsche dir eine gute Jagd.“
Sie verneigte sich leicht vor ihm und wünschte ihm ohne Worte das Gleiche.
Pinko ging noch gut hundert Schritt weiter, bis sie beide in einem Busch halb verdeckt lauerten, weit auseinander, jedoch in Sichtweite. Die anderen aus ihrer Gruppe würden versuchen, Jagdbeute zwischen ihnen hindurchzutreiben. Eine Herde von Huftieren vielleicht, aber auch wilde Schweine waren in der Gegend gesichtet worden. Es würde sicher nicht mehr lange dauern, die Treiber hatten bereits über einen Raubvogelruf Signal gegeben, sie hatten Wild gesichtet.
Pinko und das Mädchen waren die besten Schützen im Jagdclan, doch heute war es das erste Mal, dass sie beide zusammen die Jagd anführten. Das Mädchen hatte erst dreizehn Sommer gesehen und doch verfehlte sie ihr Ziel nur äußerst selten. Sie war aufgeregt. Die Ungewissheit war das Schlimmste. Ob ein wilder Eber dabei wäre, der ihnen gefährlich werden konnte, ob sie ein oder sogar zwei Tiere treffen würde. Leicht angespannt kniete sie mit einem Bein auf dem Boden, mehrere Pfeile lagen direkt neben ihr griffbereit und der Köcher war gefüllt mit frisch geschnitzten Pfeilen. Sie brauchten das Fleisch, der Winter war noch lange nicht zu Ende, Reif lag auf den Gräsern.
Das Mädchen atmete ruhig, horchte und beobachtete ihre Umgebung. Alles war still, ungewöhnlich still, das Treiben hatte noch nicht begonnen. Sie durfte die Aufmerksamkeit nicht sinken lassen, eine Sekunde Ablenkung reichte aus, die Jagd scheitern zu lassen. Ihr Blick schweifte umher, ohne dass sie ihren Kopf bewegte. Da sah sie ihn. Weit entfernt, vielleicht gerade noch in ihrer Schussweite. Er war farblich mit dem Baum verschmolzen, in dem er saß, deshalb hatte sie ihn nicht sofort bemerkt. Weißbraune Lederkleidung, die Haare eng gebunden. Sie hatte ihn nur entdeckt, weil er sich gerührt hatte. Eine Bewegung, die durch ihre Geschmeidigkeit kaum wahrzunehmen war: Er hatte einen Pfeil eingelegt. Langsam und gelassen. Gerade hob er den Bogen in Pinkos Richtung.
Dem Mädchen war sofort klar, was er vorhatte. Der Halunke Tratino: Ein exzellenter Schütze, aber er hatte sich an keine Clanregeln halten können und dadurch das Überleben der Gruppe gefährdet. Vor sechs Mondwechseln war er aus dem Jagdclan ausgestoßen worden, von Pinko, dem vom Clan gewählten Chef. Nun wollte er sich rächen, weil dieser ihn nach Beratung mit den Ältesten des Clans vor den Augen aller verstoßen hatte. In die Wildnis hatte er ihn gejagt und seinen Bogen zerbrochen.
Eigentlich hätte Tratino längst tot sein müssen. Ohne den Schutz des Clans überlebte niemand lange in der Wildnis. Und doch war er hier. Mit einem neuen Bogen. Er war auf Rache aus!
Gedankenschnell jagten Pläne durch ihren Kopf. Sie musste Pinko warnen - sie konnte Tratino vielleicht mit einem Pfeil erreichen und töten - sie musste die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Das Mädchen schrie. Sie schrie, so laut sie konnte, den Todesschrei eines wilden Schweins. Es war der Warnruf des Clans, Pinko würde es verstehen.
Noch während sie schrie, zog sie den Pfeil in der Sehne auf Spannung und zielte auf Tratino. Er war weit entfernt, zu weit, doch sie musste trotzdem versuchen, ihn zu treffen. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass Pinko sich auf ihren Schrei hin leicht aufgerichtet hatte. Doch er brachte sich nicht in Sicherheit, wechselte nicht hinter den Stamm, neben dem er gekauert hatte. Das Mädchen war verzweifelt, verstand nicht, warum er nicht wie erforderlich reagierte!
Ihr Schrei hatte auch Tratino nicht ansatzweise von seinem Vorhaben abgelenkt, er spannte, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen, die Sehne seines Bogens, als ihr Schrei gerade verebbte. Sie jagte mit dem Verstummen ihren Pfeil los und rannte, ohne auf den Untergrund zu achten, schnell wie ein angreifender Wulf in Richtung Pinko.
Wieder schrie sie, der Schrei kam heiser aus ihrer Kehle, schon der erste war zu laut gewesen für eine Stimme, die höchstens alle paar Tage den Clanjüngsten ein Märchen erzählte und sonst nie erklang. Pinko war ihr viel näher als Tratino, keine hundert Schritt entfernt, sie würde ihn schnell erreicht haben. Sie sah beim Rennen, dass ihr Pfeil nur den Stamm unterhalb des Asts aufriss, auf dem der Angreifer kauerte. Tratino lachte mit höhnisch verzerrter Fratze, sie sah seine weißen Zähne blitzen, während sie an Baumstämmen entlang raste. Einen Wimpernschlag später musste sie zusehen, wie sich mit einem dumpfen Schlag Tratinos Pfeil in Pinkos Seite bohrte.
Noch einmal schrie sie, doch dieser Schrei war kaum noch zu hören, ihre Stimme versagte nun vollkommen. Sie hätte beim ersten Blick auf den Ausgestoßenen: „Tratino, neben dir!“ rufen sollen, um Pinko eindeutig zu warnen, aber kein Wort davon war ihr möglich gewesen, selbst in diesem Augenblick höchster Gefahr hatte sich kein menschlicher Laut bilden lassen. Doch warum hatte Pinko den Warnschrei des wilden Schweins nicht verstanden? Er verstand alles, er wusste um jede Gefahr!
Tratinos Lachen war nach dem erfolgreichen Schuss laut geworden, ein Triumphschrei, der sogar bis zu ihr zu hören war. Vernehmbar auch sein Sprung vom Baum, als er auf dem hart gefrorenen Boden auftraf. Sein Lachen wurde leiser, als er zwischen den Büschen und Bäumen verschwand. Das Mädchen überlegte kurz, ihm nachzujagen, um ihm einen weiteren Pfeil hinterher zu schicken. Doch sie blieb stehen, den Blick auf Pinko gerichtet, der zusammengesunken am Baumstamm lehnte, die linke Hand um den Pfeil gelegt, der sich quer durch seine Brust gebohrt hatte. Er atmete noch. Zuerst musste sie Pinko helfen, seine Wunde sofort versorgen.
Sie warf sich neben ihm auf die Knie, ihre Augen fragend auf sein schmerzgepeinigtes Gesicht gerichtet. Warum, fragten ihre Augen, warum hast du dich nicht in Sicherheit gebracht? Sie beugte sich über ihn, sah, dass der Pfeil das Herz erreicht haben musste. Sie brachte ihr Ohr an seinen Mund, doch sie erhielt keine Antwort, Pinkos Augen wurden starr, ohne dass er ein Wort verloren hatte.
Im nächsten Moment jagte eine Wildschweinrotte neben ihnen entlang, dicht gefolgt von den Treibern. Jetzt erst wurde dem Mädchen die Tragweite des Geschehenen richtig bewusst. Der Clanchef war tot, Tratino am Leben, die wichtige Jagdbeute entkommen.
Es war ihre Schuld! Wenn sie Pinko mit einem eindeutigen Ruf hätte warnen können, würde er noch leben. Sie hätten zusammen Tratino verfolgen und töten können. Alles wäre gut ausgegangen, sie hätten die Jagd noch zu Ende bringen können und der Clan hätte genügend Fleisch für den Rest des Winters gehabt.
Die Schreie der Treiber kamen näher, sie erinnerten das Mädchen an den Tag, an dem ihre Eltern gestorben waren. Diese hatten sie vergeblich beschützen wollen, als die Fremden sie gefangen nahmen. Die näherkommenden Schreie jagten wie vor zwei Sommern durch ihren Kopf. Pinko lag tot vor ihr, wie damals ihr Vater und ihre Mutter …
„Ich weiß, dass du im richtigen Moment treffen wirst“, das hatte Pinko zu ihr gesagt. Sie hatte nicht getroffen. Zitternd richtete sie sich auf. Für Pinko konnte sie nichts mehr tun. Er war ihr Ziehvater gewesen, hatte ihr alles beigebracht, was sie wusste und konnte. Er hatte ihr das Jagen gezeigt, ihr erklärt, wie sie sich gegen einen Feind verteidigen konnte, sodass sie ihre panische Angst mit der Zeit verlor. Mit Pinkos Tod war ihre Bindung an den Clan gekappt. Sie fühlte sich ausgestoßen wie Tratino.
Gerade kamen die ersten Treiber bei ihr an, der erst zehnjährige Millo, der Bruder Pinkos: Klipp, der alte Grav, ihre Ziehschwester Tira, nur einen Sommer jünger als sie. Alle erfassten die Situation mit einem Blick, Tira warf sich neben ihrem Vater auf den Boden und schluchzte wehklagend. Das Mädchen stand wie verloren da, die Treiber blickten sie fragend an, erwarteten jedoch keine Antwort. Sie wussten, dass das Mädchen außer bei den selten erzählten Märchen nie sprach. Klipp kniete sich neben Tira und zog den Pfeil aus Pinkos Seite. Sein älterer Bruder war gestorben, feige ermordet. Klipp war der Zweite des Clans und trug nun die Verantwortung, bis ein neuer Chef bestimmt würde. Er untersuchte den Pfeil.
„Drei kurze Marken. Tratino!“
Grav nahm den Pfeil aus Klipps Hand.
„Ja, Tratino. Wir hätten ihn töten sollen, nicht ausstoßen.“
Das Mädchen zeigte mit ihrem lang ausgestreckten Arm in die Richtung des Stammes, der die Risse ihres Pfeils trug.
„Von dort aus hat er geschossen?“
Das Mädchen nickte, ihr Gesicht erstarrt in einer Maske des Schmerzes.
„Er hat überlebt. Ohne den Clan. Und er ist der gleiche Meisterschütze wie zuvor“, knurrte Grav.
Er und Klipp liefen zu dem Stamm, von dem aus Tratino den tödlichen Schuss abgegeben hatte. Sie fanden nur wenige Meter entfernt den Pfeil des Mädchens, es steckte etwas von der Rinde des Stammes in seiner Spitze.
„Ebenfalls ein guter Schuss, aber leider daneben“, murmelte Klipp und gab Grav ein Zeichen, mit ihm zurück zur Gruppe zu laufen. Alleine überlebte man nicht lange außerhalb des Clans. Gemeinsam schützte man sich am besten.
Neben der Trauer um seinen Bruder, der er jedoch außerhalb des Lagers keinen Raum geben wollte, blitzte Klipp widerwillig ein Funken Anerkennung für Tratino durch seine Gedanken. Tratino hatte gut ein halbes Jahr ohne den Clanschutz überlebt, obwohl seit zwei Monaten Winter herrschte. Doch gleich richtete Klipp seine Aufmerksamkeit wieder auf das momentane Geschehen. Gedanken durften nicht schweifen. Nicht außerhalb des schützenden Lagers.
„Grav und Tira! Ihr tragt Pinko. Du sicherst mit mir zusammen auf dem Weg zum Lager!“, wandte er sich an das Mädchen. Diese war wie eingefroren gewesen, nun nickte sie und legte einen Pfeil auf die Sehne, ließ ihre Blicke umherschweifen. Der Zug kam langsam voran, es war ein stilles Geleit.
Am Abend würden sie Pinko verbrennen. Seiner Heldentaten gedenken. Sie würden gut ein Viertel des Tages brauchen, um das Lager in diesem Tempo zu erreichen. Die Sinne des Mädchens waren stets wachsam auf die Außenwelt gerichtet, jetzt noch mehr als sonst. Sie würde helfen, die Gruppe heil ins Lager zu bringen.
Es war bereits Abend, als sie dort anlangten, Schnee begann zu fallen, dicke, schwere Flocken. Sie verdeckten ihre Spuren schon nach kurzer Zeit. Der Schnee schluckte auch die wenigen Geräusche des Waldes und ihrer Schritte. Dennoch wurden sie schnell wahrgenommen, die Kinder rannten auf sie zu, in freudiger Erwartung der Beute. Das Lachen verebbte rasch, erste Klagerufe ertönten.
Das Mädchen blickte auf die vertraute Gruppe, saugte die Gesichter und Gestalten ein letztes Mal in sich auf, eine Erinnerung, die sie begleiten würde. Der Clan war jetzt wieder vereint, alle waren sicher. Lautlos drehte das Mädchen sich um und rannte mit leisen, langen Schritten davon. Sie würde nicht wiederkehren.
Kapitel 2: Das Mädchen und der Wulf
Die Dunkelheit wich langsam dem ersten Dämmerlicht, es war die kühlste Stunde am Morgen, doch der Tag war bereits warm und würde heiß werden. Schon surrten und brummten die ersten Insekten des Tages, sie eroberten den Raum zwischen den Büschen und Bäumen. Das Mädchen war eine halbe Stunde lang schnell gelaufen und dennoch schlug ihr Puls langsam und ruhig, als sie auf ihren Jagdsitz kletterte, hoch oben im alten Baum mit den gezackten Blättern. Hier war sie geschützt vor tierischen Jägern und hatte einen klaren Blick auf die Lichtung, die vor ihr lag. Sie suchte eine bequeme und sichere Position auf dem breiten Ast und nahm ihren Bogen vom Rücken. Behutsam legte sie einen Pfeil locker an die Sehne.
Es würde nicht lange dauern, bis Beute vorbeikam. Ein kleiner Bach und eine saftige Wiese lockte unwiderstehlich, das lehrte die Erfahrung. Wirbelnde Insekten verteilten sich über die Lichtung und schwebten über dem Wasser des Bachs. Die Insekten hielten meist Abstand vom Mädchen, setzte sich einmal ein Käfer oder eine wilde Hornisse auf ihre Haut, so blieb sie ruhig. Das Mädchen fühlte sich einen kurzen Moment lang wohl und sicher in ihrem Ausguck, aber sofort kam ihr Pinkos Warnung in den Sinn: „Seid immerzu wachsam, der tödliche Feind kommt unerwartet“. Ihre Sinne öffneten sich weit, sie wurde eins mit der Umgebung. Sie wartete. Bewegungslos.
Die Sonne begann zu steigen, erste Sonnenstrahlen erhellten die Lichtung, als ein paar wilde Kaninchen vorsichtig auf die Lichtung hoppelten. Sie begannen zu mümmeln, aufmerksam die Ohren gespitzt. Eine kleine Beute. Würde sie eines treffen, wären die anderen sofort verschwunden. Sie beobachtete die Tiere. Ein paar der kleineren begannen zu spielen und wilde Haken zu schlagen. Sie wären schwierig zu treffen. Ein hoher, durchdringender Schrei des Wächters warnte die anderen: Von jetzt auf nachher verschwanden sie blitzartig, ein neuer Akteur würde auftreten.
Wenige Sekunden später näherte sich ein wildes Schwein, es sah krank aus, war allein, seine Rotte hatte es wohl ausgestoßen. Es trank vom Bach und trollte sich wieder. Kranke Tiere waren keine Jagdbeute, zu leicht konnte man sich eine Krankheit einfangen. Pinko hatte sie gewarnt: „Unser größter Feind sind nicht die anderen Jäger, es sind die Krankheiten“.
Die Sonne begann ihren Höhepunkt zu erreichen, als eine Herde Wild bedächtig und vorsichtig auf die Wiese trat. Das Fell des Leittieres schimmerte in der Sonne, sein Geweih war mächtig. Es sicherte seine Herde, drei Muttertiere, zwei Jungtiere und ein fast ausgewachsenes Kitz. Die Jägerin traf gelassen ihre Wahl und spannte langsam und leise den Bogen. Als ihr Pfeil die Sehne verließ, war ein leises Surren zu hören, das Leittier spitzte seine Ohren, doch es war bereits zu spät. Das Kitz zuckte zusammen, der Pfeil steckte in seinem zitternden Körper, es stakte noch ein paar unsichere Schritte und sackte zusammen. Der Rest der Herde war bereits verschwunden, in Panik davongestiebt, bevor es ganz auf den Boden sank.
Jetzt musste es schnell gehen. Die Jägerin sprang vom Baum, landete sicher auf den Beinen und rannte zum Kitz. Es war bereits tot, seine Augen gebrochen. Sie zog den Pfeil aus dem leblosen Körper und säuberte ihn kurz in der Erde. Sie strich ein wenig Erde auf die leicht blutende Wunde, band zügig jeweils ein Seil an die Vorder- und Hinterläufe und schwang sich das Tier auf den Rücken. Es wog schwer, sie hatte eine gute Entscheidung getroffen, die Jungtiere hätte sie nicht tragen können. Sie war alleine unterwegs, ein Zerteilen der Beute wäre durch den verstärkten Blutgeruch zu gefährlich gewesen, der Weg zurück zu weit.
Nur wenig später lief die Jägerin in langsamem Trab zurück in die Zuflucht. Sie hielt ihr Messer in der Hand, bereit das Trageseil zu kappen und die Beute zurückzulassen, sollte ein Jäger kommen, der stärker war als sie.
* * * * * * * * * * * * *
Das Mädchen wartete.
Ohne sich zu bewegen.
Dafür wuselten die Zwillinge umso ungestümer durch das Bett. Sie zogen die geflickten Decken über sich, schoben sie wieder herunter, schmissen die Kissen mehrere Male an eine andere Stelle, boxten sich gegenseitig, brüllten als Antwort drauf los und zappelten wild in ihrem Bett herum, das sie sich mit Mara teilten. Das war nichts Besonderes, so begann praktisch jeder Abend mit den beiden Brüdern.
Mara war erst sieben Jahre alt, gut zwei Jahre jünger als die Zwillinge, aber sie hatte die Jungs gut im Griff.
„Schluss, Tonn und Kar! Das Mädchen erzählt sonst nichts!“
Vorwurfsvoll warf Mara aus zusammengekniffenen Augen den Zwillingen einen strengen Blick zu, der sogleich Wirkung zeigte. Wenn Mara so schaute, war es höchste Zeit, zur Ruhe zu kommen.
Nicht, dass die beiden Jungs jetzt komplett bewegungslos dagelegen hätten, das gab ihr Naturell nicht her, aber sie waren zumindest still und richteten ihre Blicke erwartungsvoll auf das Mädchen, das im Schneidersitz auf dem Lager neben dem Bett der drei Kleinen saß und nun lächelnd nickte.
„Rotkäppchen“, sagte sie und dieses eine Wort fand Zustimmung bei allen drei Kindern.
„Ja, Rotkäppchen! Bitte fang an!“
Das Mädchen wartete noch ein oder zwei Minuten, bis es wirklich still geworden war und begann zu erzählen.
Es war einmal ein kleines, kräftiges Mädchen, das schätzten alle sehr, weil es mit jedem Pfeil sein Ziel traf und niemals mehr aß, als ihm zustand. Eines Tages nähte die Großmutter dem Mädchen ein schützendes Käppchen aus rotem Samt, an dem hing ein ebenfalls rotes Mundtuch aus reinster Seide, das gegen jede Art von Insekten schützte. Dieses Käppchen setzte sich das Mädchen auf den Kopf und nahm es niemals mehr ab. Deswegen nannten es alle Rotkäppchen.
Es kam der Tag, da sprach seine Mutter zu ihm: „Komm, Rotkäppchen, hier sind ein Stück Fladen und eine Flasche Holundersaft. Binde dein Mundtuch gut um, nimm den Korb und bring ihn der kranken Großmutter hinaus. Mach dich auf, bevor es heiß wird und die blutgierigen Insekten die Herrschaft übernehmen. Lauf im Wald nicht vom Wege ab und wenn du die Großmutter siehst, sag ihr gute Gesundheit.“
„Ich will alles richtig machen“, versprach das Rotkäppchen der Mutter, und gab ihr die Hand drauf. Sie machte sich auf den Weg zur Großmutter, die alleine in einer Hütte mitten im finsteren Wald wohnte, gut eine halbe Stunde Fußweg entfernt. Dort im dunklen, tiefen Wald begegnete dem Mädchen mit einem Male der Wulf, dessen Fell glänzend anlag und dem die scharfen Zähne sichtbar aus dem Maul ragten. Doch Rotkäppchen wusste nicht, was das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm.
Vikor, der auf seinem Lager nebenan saß, lauschte dem Mädchen ebenso aufmerksam wie die drei Kleinen. Nach außen zeigte er eine ablehnende Haltung, die Arme vor dem Körper verschränkt, die Stirn gerunzelt und die Mundwinkel gespannt. Und dennoch hatte er das Buch, in dem er gerade noch gelesen hatte – „Schnelle Hilfe bei Infektionen“ – auf den Tisch gelegt und hörte zu, wie jeden Abend, wenn das Mädchen erzählte.
Es waren immer Märchen, nicht vorgelesen, sondern aus der Erinnerung heraus erzählt. Dutzende von verschiedenen Märchen, wunderbar vorgetragen, spannend und wortgewandt.
Es war gegen die Regeln!
Regel 8 lautete: Es dürfen keine erfundenen Geschichten gelesen oder erzählt werden, nur Geschichten, aus denen man etwas lernen und Wissen sammeln kann.
Es gab insgesamt zwölf Regeln. Vikor hatte sie auf den Überrest einer großen Tafel geschrieben und las jeden Morgen eine davon zum Frühstück vor. Alle, die anwesend waren, sprachen die Regel mit. Jeder aus der Gruppe kannte die Regeln auswendig. Sie waren Gesetz und ließen eigentlich keine Ausnahme zu. Doch das Mädchen hatte Ausnahmen in die Zuflucht gebracht, als sie am Ende des letzten Winters zu ihnen gestoßen war, der Schnee lag damals gut einen halben Meter hoch.
Das Mädchen sprach die Regeln nie mit, wenngleich sie bei manchen zustimmend nickte.
Sie sprach niemals, nicht ein einziges Wort. Nur die Märchen erzählte sie abends, sonst hätte man glauben können, sie wäre gar nicht in der Lage zu sprechen. Es war ein Mysterium, eines der Rätsel, derer es so viele in ihrer Gruppe gab und die sie klaglos annahmen und mit denen sie lebten.
Des Mädchens Stimme war klar, wohlklingend, langsam schwingend und melodiös. Es war angenehm und beruhigend, ihr zuzuhören. Doch so oft Vikor schon versucht hatte, sie zu einer Äußerung auch während des Tages zu bewegen, es war ihm nicht gelungen. Selbst in gefährlichen Situationen blieb das Mädchen sprachlos, rang erfolglos mit Worten, die ihr nicht über die Lippen kommen wollten. Vikor wusste den Grund dafür nicht, und es gefiel ihm keineswegs, dass die verbindlichen Regeln durch sie einen Riss bekommen hatten. Doch er schätzte den Beitrag des Mädchens für die Gruppe als Jägerin sehr und die Märchen verzauberten auch ihn.
Kapitel 3: Sindalon
Das Sindalon lauerte unbeweglich, seine Aufmerksamkeit war vollkommen auf die Beute gerichtet. Mikan hielt den Atem an und beobachtete es fasziniert. Ah, da bist du ja wieder, begrüßte er das Raubtier, das ihm wohl selbst in Lauerstellung bis zur Hüfte reichte. Dem Tier bei der Jagd zuzuschauen, war ihm schon lange nicht mehr gelungen. Vorsichtig und lautlos hob er das Fernglas an die Augen und holte so den Räuber in sein nahes Blickfeld.
Die Anspannung des Sindalons war in jeder Faser seines eleganten und kraftvollen Körpers zu erkennen. Langsam schob es seinen Oberkörper nach vorne, näher an seine Beute heran, optisch getarnt durch die es umgebende üppige Bepflanzung. Seine Gestalt ähnelte der eines Hundes oder Wolfs vergangener Zeiten, war jedoch deutlich größer und kompakter. Sein dichtes Fell glänzte vollkommen schwarz im Licht der Quadrantensonne. Erstaunlicherweise waren seine Vorderbeine ein wenig länger als die Hinterbeine, was es jedoch eine beachtliche Geschwindigkeit erreichen ließ, wie Mikan aus zahlreichen Beobachtungen wusste. Auch die langen, aus dem Maul stehenden, leicht gekrümmten Reißzähne hatten ihn von Anfang an fasziniert. Sie sahen extrem gefährlich aus, dolchartig, weiß schimmernd und messerscharf. Wen es damit gepackt hatte, war verloren, aus diesen Zähnen gab es kein Entkommen, auch dies hatte Mikan bereits beobachtet.
Ganz sicher handelte es sich bei dem Tier um eine Mutation, denn Wölfe und ähnliches Getier waren seines Wissens längst ausgestorben. Dieser tierische Räuber jedoch hatte sich an die neuen Gegebenheiten bestens angepasst, war zum perfekten Überlebenskünstler geworden; anders konnte man, nach Mikans Verständnis, in der gefährlichen Außenwelt sicherlich nicht überleben. Kaum zwei Meter trennten das Sindalon noch von seiner Beute. Mikan atmete so leise aus, wie er es nur vermochte.
Sindalon, so hatte er das Tier benannt. Seinen wirklichen wissenschaftlichen Namen, wenn es denn überhaupt einen gab, wusste er nicht. All sein Wissen über die Fauna außerhalb des geschützten Refugiums, in dem er lebte, kannte er nur aus Dokumentationsmaterial älteren Datums. Eigentlich durfte es dieses Sindalon im Grüngürtel gar nicht geben und Mikan wäre unbedingt verpflichtet gewesen, dessen Anwesenheit sofort den Behörden zu melden. Das hätte jedoch das Ende des Tieres und seiner Beobachtungen bedeutet. Das konnte er nicht akzeptieren!
Mikan zog seine Stirn in grüblerische Falten. Irgendwie musste es das Sindalon geschafft haben, die Sperre zwischen Außenwelt und Grüngürtel zu überwinden. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, wenn er den offiziellen Verlautbarungen der Regierung glauben würde. Nun, er nahm sich fest vor, dieses Rätsel baldmöglichst zu lösen.
Denn tatsächlich: In den langen Jahren seiner Tätigkeit im Grüngürtel war dieses Sindalon das erste und einzige Tier, das von draußen gekommen sein musste. Nun, das Sindalon war klug, musste Mikan anerkennend feststellen; immerhin unternahm es keinen Versuch, vom Grüngürtel weiter in den Kern des Refugiums zu gelangen, was sein unvermeidliches Ende bedeuten würde.
Ja, es ist mein absolutes Privatvergnügen, das fantastische Tier zu beobachten, das muss ja keiner wissen! Mein Nichtstun schützt es! Es hält sich nur in diesem Quadranten auf, stellte er zum wiederholten Mal fest. Ein Wechsel in einen der beiden angrenzenden Grüngürtel-Quadranten war ihm offensichtlich nicht möglich. Er nickte innerlich: Sonst wäre das ohnehin unbegreifliche Rätsel noch um einiges größer gewesen.
Wer sollte das Geheimnis auch aufdecken! Er war ja der einzige Mensch, der regelmäßig in den Grüngürtel kam. Der Schutzschirm zwischen Außenwelt und Grüngürtel war in der Anfangszeit des Refugiums regelmäßig kontrolliert worden, mehrmals im Jahr. Doch da seines Wissens über Hunderte von Jahren nie eine Fehlfunktion festgestellt wurde, hatte man die Kontrollen aus Kostengründen reduziert. Mittlerweile kam der Kontroll- und Wartungsroboter sogar nur noch alle zwei Jahre zum Einsatz. Dann wäre es natürlich so weit: Die Lücke im Schutzschirm, die das Sindalon benutzte, würde unweigerlich entdeckt werden. Doch bis dahin wollte er, Mikan, das Geheimnis des Sindalons sicher bewahren. Sein Forscherherz, das reale, lebendige Tiere dieser Größenordnung zum rasenden Klopfen brachte, ließ nichts anderes zu.
Mikan schob die stetig wiederkehrenden Gedanken an die Herkunft des Räubers beiseite und beobachtete weiter aufmerksam die unnachahmliche Jagdstrategie des Tieres. Seine Beute, ein kleiner, hilfloser Hase, hoppelte weiterhin sorglos umher, denn in seinem Weltbild gab es keine Fressfeinde. Die Ausdünnung der Kleintiere im Grüngürtel erfolgte normalerweise maschinell gesteuert auf so unauffällige Art und Weise, dass keinerlei Argwohn bei den zurückbleibenden Tieren entstand. Doch Mikan nahm diese Tiere kaum wahr: Sie dienten wie das geerntete pflanzliche Material als Nahrungsgrundlage für die Refugiumbewohner.
Bei diesem Gedanken verzog er angewidert sein Gesicht: Tiere, die größer als exakt vierzig Zentimeter waren, durften sich im Grüngürtel nicht aufhalten! Vorschriften! Immer wieder diese lächerlichen, kleinkarierten Refugiums-Vorschriften! Seltsam fand Mikan nur, dass dies außer ihm niemanden zu stören schien.
Niemand außer ihm beobachtete Tiere! Niemand, den er kannte, würde freiwillig seine eigene sterile Welt verlassen, in der sich alles nur ums eigene Vergnügen drehte! Auf Drogenbasis natürlich, schnaubte er innerlich. Doch im gleichen Moment fiel ihm Valea ein. Es gab Ausnahmen. Es hatte Ausnahmen gegeben.
Weiter und weiter verlagerte das für sein Opfer unsichtbare Sindalon das Gewicht nach vorne. Sobald ein Sturz unvermeidlich schien, würde es lospreschen und schnell wie ein Blitz seine prächtigen Fangzähne in den Nacken des bereits jetzt verlorenen Hasen graben, das wusste Mikan aus früheren Beobachtungen. Los, pack ihn!, spornte er in Gedanken das Raubtier an. Pack ihn!
Dazu wäre es ohne Zweifel gekommen, wenn Mikan in seiner kaum zu ertragenden Anspannung nicht deutlich vernehmlich gestöhnt hätte. Hase und Sindalon erstarrten abrupt in ihren Bewegungen. Einen kurzen Augenblick später raste das anvisierte Beutetier Haken schlagend von dannen: Unbekannte Geräusche dieser Art lösten immer noch angeborene Fluchtreflexe aus. Die Anspannung des Sindalons fiel in sich zusammen, es kauerte sich dicht über den Boden und wandte langsam den Kopf in Richtung des wahrgenommenen Geräuschs.
Nur einen Moment später hatte der Jäger eine neue, Erfolg versprechende Beute im Visier. Noch nie hatte Mikan in solch kalte Augen gesehen. Einen Augenblick lang hatte er den Eindruck, einem intelligenten Wesen von abgrundtiefer Bosheit gegenüberzustehen, doch dann drängten sich Tod verheißende Gedanken in den Vordergrund. Wie Ameisen kribbelte es durch seinen ganzen Körper und ihm blieb der Atem im Hals stecken. Unter strikter Vermeidung hastiger Bewegungen ließ er das nun überflüssige Fernglas sinken. Vielleicht hätte er doch nicht so sorglos …
Kapitel 4: Feind im eigenen Haus
Vikor wusste nicht, warum er das Mädchen jeden Abend die 8. Regel brechen ließ. Nicht, dass er noch nie darüber nachgedacht hätte. Schließlich war er sonst gnadenlos, sobald eine Regel verletzt wurde, wie alle Mitglieder der Gruppe schon einmal erfahren hatten. Die strikte Einhaltung der Regeln half, Leben zu bewahren, sicherte ihre Gemeinschaft. Alle außer dem Mädchen hatten die Vorschriften sehr schnell nach ihrer Ankunft in der Zuflucht akzeptieren gelernt.
War er nachsichtig, weil er sonst die Stimme des Mädchens nie hören würde?
Vielleicht aber auch, weil ihn die Märchen selbst in ihren Bann zogen. Enthielten Märchen nicht sogar brauchbares, grundlegendes Wissen und bekamen so ihre Berechtigung? Manchmal hatte er tatsächlich den Eindruck – trotz der so völlig anderen Zeit, in der sie entstanden waren.
Oder ließ er es nur deshalb zu, weil die drei Kleinen mit diesen Geschichten gut zur Ruhe fanden?
Bevor das Mädchen, das noch immer keinen Namen hatte, vor einigen Monaten zu ihnen gestoßen war, waren die Zwillinge trotz aller Ermahnungen spät abends über die Tische getanzt, und derart überdreht nur schwer zu lenken gewesen. Jetzt lagen sie jeden Abend, kaum war die Sonne untergegangen, in ihrem Bett und warteten sehnsüchtig, und so ruhig sie es eben vermochten, auf das Mädchen und ihre Geschichte.
Und der Wulf dachte bei sich: Das junge, zarte Ding ist ein leckerer Bissen, der wird mir besser munden als die alte Großmutter. Du musst es listig anfangen, so wirst du sogar beide schnappen.
Er sprach zum Rotkäppchen: „Sieh einmal die Blumen und die bunten Schmetterlinge, die über die Lichtung dort tanzen. Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Bienen so lieblich summen? Der Wald ist ein lustiges, erbauliches Haus, schau dich um!“
Rotkäppchen sah mit einem Male, wie nicht nur Hunderte von stechenden und beißenden Insekten, sondern auch Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her blitzten. Und es sah die bunten Blumen auf der Lichtung im Wald, über die riesige, farbenfrohe Schmetterlinge flatterten. Es dachte sich: Der kranken Großmutter werden die Blumen auch Freude bereiten. Ich bringe ihr einen Strauß davon mit. Es ist so früh am Tag, dass ich dennoch zur rechten Zeit bei ihr ankommen werde. Rotkäppchen lief in den Wald, pflückte die schönsten Blumen und lief herrlichen Schmetterlingen hinterher. Dabei geriet es tiefer und tiefer in den dunklen Wald hinein.
Vikor stand auf und ging zu Lunaros Lager. Im Zimmer standen zwei große Betten und auf dem Boden waren zwei Lager aus Decken und Stroh gerichtet. Auf einem von ihnen lag Lunaro. Sein Gesicht schien blass und rund wie der Mond an vollen Tagen, aber sein Körper war dünn wie ein Strich. Seine Schwäche ließ ihn in den letzten Tagen nur noch für ein bis höchstens zwei Stunden das Lager verlassen, trotzdem war er nie untätig. Seine dünnen, langen Finger arbeiteten pausenlos. Er schraubte, drehte, verband Kabel oder Schnüre und untersuchte alle Gegenstände, die ihm das Mädchen von ihren Streifzügen mitbrachte.
Vikor setzte sich zu Lunaro, der zwar genauso aufmerksam den Abenteuern des kleinen Rotkäppchens lauschte wie die drei Kleinen, aber nebenher Draht um eine Klinge wickelte.
Vikor sah Lunaro fragend an.
Dieser zuckte mit resigniertem Blick die Schultern.
Er zeigte dem nur wenig älteren Vikor seine rechte Hand. Hier hatte sich an einer kleinen Schnittwunde ein rötlicher Streifen gebildet. Eine winzige, leicht bläulich schimmernde rote Ader, die stündlich ein wenig länger wurde. Sie reichte schon einen kleinen Teil des Unterarms hinauf.
Blutvergiftung. Das hatte Vikor gleich erkannt. Auch alle anderen Symptome, die hinzugekommen waren, passten: marmorierte, leicht unterkühlte Haut, die Schwächeanfälle, das gelblich verfärbte Gesicht … Vikor hatte sein Wissen aus medizinischen Büchern. Diese waren ihm die liebsten, sie waren so nützlich. Vikor besaß eine ganze Sammlung, die meisten davon bereits mehrfach gelesen, er hatte das Wissen daraus in sich aufgesogen.
Blutvergiftung konnte behandelt werden: mit einem Antibiotikum.
Wenn man welches hatte.
Die Gruppe besaß keine Antibiotika.
Vikor hatte gehofft, dass die Wunde von alleine verheilte. Immerhin war es anfangs nur ein winziger blauroter Fleck gewesen. Aber Lunaro war schon schwach gewesen, als sie sich vor einem Jahr das erste Mal trafen, auf der Suche nach einer Zuflucht. Ein starker, erfindungsreicher Geist in einem schwachen, kranken Körper. Die einzige andere Behandlung für Blutvergiftung, die Vikor kannte, war eine Amputation des Arms, doch mit ihren primitiven Mitteln würde sein wertgeschätzter Freund das erst recht nicht überleben. Es sah nicht gut für ihn aus.
Neben Lunaros Lager stand eine Öllampe. In ihrem flackernden Schein arbeitete er jeden Abend, bis ihm vor Erschöpfung das Werkzeug aus der Hand fiel.
Das Mädchen war währenddessen zum Ende der Geschichte gelangt.
Als der starke Jäger ein paar Schnitte getan hatte, da sah er ein rotes Käppchen leuchten und das Mädchen sprang heraus und rief: „Ach, wie war's so dunkel in dem Wulf seinem Leib!“ Die Großmutter kam auch lebendig heraus und atmete tief ein, leider auch gleich ein paar Insekten. Davon musste sie schrecklich husten und Rotkäppchen klopfte ihr kräftig auf den Rücken. Geschwind holten sie große Steine heran, damit füllten sie dem Wulf den Bauch und nähten ihn mit ihrer Knochennadel fest zu. Als der Wulf aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er tot umfiel.
Da waren alle vergnügt. Der Jäger zog dem Wulf den Pelz ab, das Rotkäppchen brach ihm die kostbaren Zähne heraus und schnitt das Fleisch in handliche Stücke, es würde ihnen allen munden. Die Großmutter trank den Holundersaft und Rotkäppchen dachte: Du wirst dein Lebtag nicht wieder vom Weg abweichen, wenn es dir verboten ist.
Nur kurze Zeit später waren die drei Kleinen eingeschlafen und Stille kehrte im Zimmer ein.
Vikor brachte Lunaro einen Rest Suppe ans Lager.
„Iss, du brauchst deine Kraft.“
Lunaro wehrte schwach ab. „Ich habe genug gegessen. Gib den Rest dem Mädchen. Sie ist zu dünn. Und sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Gemeinschaft. Ich dagegen werde von Tag zu Tag nutzloser.“
Vikor schüttelte energisch den Kopf. „Im Moment brauchst du alle Energie, die du bekommen kannst, Lunaro. Du bist krank. Und red keinen Quatsch: Wir brauchen dich! Wer sonst könnte das Wasserrad reparieren? Iss!“
Lunaro beugte sich der Strenge Vikors und setzte sich schwerfällig im Bett auf. Alle gehorchten Vikor. Wer es zum wiederholten Mal nicht tat, musste die Gruppe verlassen. Es war die erste und grundlegendste der zwölf Regeln: Vikors Wort ist Gesetz.
Es hatte der Gruppe bisher gut getan, Vikors Vorschriften einzuhalten. Vikor hielt die Gruppe zusammen und beschützte sie.
Lunaro löffelte dankbar die Suppe. Immer wieder musste er innehalten, weil ihm sogar dafür die Kraft fehlte. Er wurde schwächer, er war eine Last geworden, egal, was Vikor sagte.
Vikor ging zu seinem eigenen Lager zurück, setzte sich darauf und nahm ein weiteres Buch vom winzigen Tisch, der daneben stand: „Selbstversorger für Anfänger.“ Ein ganzer Stapel Bücher lag auf dem Tischchen, „Psychologie für Idioten“, „Medizinisches Wissen für Notfälle“, „Logische Denkrätsel für Mathe-Genies“ und viele mehr. Vikor konnte sehr gut lesen, als Einziger der Gruppe flüssig und unheimlich schnell. Er liebte Wissen und war froh über jedes Buch, das ihm das Mädchen von ihren Streifzügen mitbrachte; auch wenn er erfundene Geschichten direkt aussortierte und zum Anzündpapier erklärte. Rund um sein Strohlager bildete sich eine kleine Mauer aus Büchern, sie trennte sein Lager am Kopfende vom Bett der drei Kleinen.
Vor allem medizinische Bücher interessierten ihn, denn Krankheiten waren der größte Feind, den es zu besiegen galt. Seine Mutter war an einer Blinddarmentzündung gestorben, die sein Vater zwar erkennen, doch nicht heilen konnte. Seine kleine Schwester starb nach langem, qualvollem Kampf am Fieber, das durch eine unbekannte Krankheit hervorgerufen wurde, sie war keine fünf Jahre alt geworden.
Auch Kilawa berichtete von Seuchen in ihrer alten Gruppe, durch die letztlich alle zu Tode gekommen waren und sie allein mit Mara zurück ließen. Vikor löschte die kleine Öllampe, als es draußen schon lange dunkel war. Zum Glück brauchte er nicht viel Schlaf und konnte so Nacht für Nacht sein Wissen vermehren. Der Tag gehörte der Arbeit, dem Sammeln und Verwerten von Nahrung, dem Entwickeln von Schutzmaßnahmen und dem schlichten Überleben; die Nacht gab ihm Ausblick auf die Zukunft, auf Hoffnung und Entwicklung.
Kapitel 5: Im Grüngürtel
Ein intelligentes Wesen von abgrundtiefer Bosheit? Mikan wusste nicht wirklich, ob dieser Gedanke der Wahrheit nahekam oder nicht. Die Außenwelt, aus der das Tier stammen musste, barg eigentlich nur Geheimnisse für ihn. Faszinierende und auch gefährliche, wie er gerade mit flatternden Nerven feststellte.
Das Sindalon wandte sich ihm nun frontal zu und näherte sich auf geschmeidigen Füßen der Stelle, an der Mikan erstarrt sein Schicksal erwartete. Fast konnte er die Reißzähne schon spüren, die in sein weiches Fleisch drangen und sein Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Schnöde Angst um sein Leben hatte ihn im Griff, die Beine fühlten sich an wie Gummi, beinahe knickte er ein. Eine Situation, so surreal wie ein Spaziergang in den Weltraum.
Mikan war unbewaffnet, denn Waffen gab es im Refugium nur im Museum. Wozu auch Waffen? Es gab keinerlei Feinde im Inneren ihres Schutzraums. Deswegen existierten eben keine Verhaltensregeln für eine solche Situation, sie war einfach nicht vorgesehen und eigentlich unmöglich.
Gut, es war dumm von mir, das nicht vorherzusehen. Aber ich will trotzdem nicht feige sterben, sagte sich Mikan und tat das Einzige, das ihm sinnvoll erschien.
„Hiahiahia!“, schrie er, so laut er konnte, breitete die Arme aus, um größer zu wirken und sprang dem Sindalon ein paar Schritte entgegen. Die einer Eingebung entsprungene Strategie schien wirkungsvoll, denn das Sindalon blieb abrupt stehen. Hatte er doch noch eine Chance? Hoffnungsvoll machte Mikan mit seinem ohrenbetäubenden Lärm weiter, bewegte sich jetzt jedoch langsam, aber stetig rückwärts, statt in Richtung des Tieres.
Trotz der brenzligen Situation war sich ein Teil seines Gehirns bewusst, welch groteske Figur er gerade abgab, und wie schadenfroh seine Kollegen reagiert hätten, wenn sie ihn so hätten sehen können. Das hätte seinen Ruf eines Verrückten mit Sicherheit gefestigt.
„Hia Hia! Verdammtes Biest, bleib, wo du bist!“, wiederholte er schreiend in aller Lautstärke, die ihm zur Verfügung stand. Und tatsächlich: Das Tier blieb weiterhin stehen und schaute ihm geduckt bei seinem lautstarken Rückzug mit aufgestellten Ohren und aggressiv verkleinerten Augenschlitzen nach. Vorerst jedenfalls. Vielleicht spielte es ja auch nur mit ihm wie die sprichwörtliche Katze mit der Maus. Zwar gab es im gesamten Refugium keine Katzen mehr, doch Mäuse innerhalb des Grüngürtels in Hülle und Fülle. Mikan war verstaunt, was alles unkontrolliert durch seinen Kopf schoss, während seine Sinne hellwach auf die Situation gerichtet blieben.
Gut einhundert Meter trennten ihn von dem Ernteroboter, dessen Programmierung er eben noch auf den neuesten Stand gebracht hatte. Ich hätte mich nicht so weit von ihm entfernen sollen, ich wusste doch von der Gefahr durch das Sindalon, schimpfte er innerlich mit sich und schrie trotz einer beginnenden Heiserkeit in voller Lautstärke weiter.
Mehr als die Hälfte der Strecke hatte er bereits hinter sich gebracht und das Sindalon wirkte aus der Entfernung nicht mehr ganz so bedrohlich, als der Verfolger plötzlich durch den niedrigen Bewuchs losjagte. Er hatte den Räuber also keineswegs durch sein Geschrei ausreichend erschreckt, wie hatte er das auch nur eine Sekunde glauben können. Das gefährliche Tier spielte tatsächlich mit ihm, denn in seiner Weltsicht gab es aus Erfahrung kein Entkommen für die Beute. Es handelte sich um ein einseitiges Spiel, eines auf Leben und Tod. Zumindest für ihn, Mikan. Denn dass er, einmal eingeholt, sterben musste, war so sicher wie der Regen um siebzehn Uhr.
All seine Kraft legte Mikan jetzt in den Sprint. Den universalen Autodongel, der unter anderem auch als Fernbedienung für die automatische Tür diente, umklammerte er bereits auslösebereit mit der Hand.
Noch nie zuvor war Mikan um sein Leben gerannt. Noch nie war er auch nur halb so schnell gesprintet wie jetzt. Wie sehr bedauerte er in diesem Moment, dass Sport ihn bisher nicht ansatzweise interessiert hatte. Sein Faible für geistige Betätigung half ihm in dieser Lage kein bisschen. Die Lunge drohte ihm aus der Brust zu springen, die eben noch kühle Luft brannte wie glühende Kohlen. Das Adrenalin setzte Kraftreserven frei, von deren Existenz er bisher keine Ahnung gehabt hatte und er flog regelrecht über den Boden.
Noch etwa drei Meter trennten ihn von der rettenden Tür, als er die Gegenwart des Raubtieres körperlich als bedrohliches Kribbeln in seinem Nacken spüren konnte. In größter Verzweiflung versuchte er einen gewaltigen Sprung, um so vielleicht dem finalen Angriff des Sindalons zu entkommen. Noch während er durch die Luft flog, drückte er den Auslöser für die Tür und hoffte inständig, das richtige Timing erwischt zu haben. Sollte er gegen die geschlossene Tür prallen oder das Sindalon mit ihm hinein witschen, dann gab es einen Festschmaus, der für ihn kein Genuss wäre. Noch ehe die Tür ganz offen war, betätigte er bereits den Schließmechanismus an dem Dongel.
Sein Aufprall auf dem metallenen Boden im Inneren des Ernteroboters fiel mit dem Krachen des Sindalons gegen die inzwischen wieder fast ganz geschlossene Tür zusammen. Das hässliche Geräusch klang wie Musik in Mikans Ohren.
Die Umgebung verschwamm vor seinen Augen, minutenlang kämpfte er mit einer Atemnot, die ihm fast die Besinnung raubte, sein Herz hämmerte wie ein Pressluft-Roboter. Erst als er wieder einigermaßen Luft bekam, konnte er einen klaren Gedanken fassen.
„Oh Mann, offensichtlich muss es doch etwas im Leben geben, für das es wert ist, nicht sterben zu wollen.“ Er schnaufte durch und stand auf.
„Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was es ist.“ Selbstgespräche waren ihm längst zur lieben Gewohnheit geworden.
Die Erleichterung hatte ihn sogar richtig gesprächig gemacht.
„Verdammte Mikrobenscheiße! Ein wirklich beeindruckendes Tier! Diese Kraft und Schnelligkeit! Dabei so zielstrebig! Ich muss unbedingt mehr über dieses Wesen herausfinden. Mit ihm könnte man den Ältestenrat mal ganz gehörig aufscheuchen“, amüsierte er sich aufgekratzt und rieb sich den schmerzhaft geprellten Arm.
Trotz des gerade überwundenen Schreckens ließ ihn der Gedanke grinsen. Was für ein erhebender Anblick das wäre, wenn die alten ehrwürdigen Männer in Panik auseinander stieben würden! Wie würde er ihnen das nach all den Auseinandersetzungen gönnen, die er mit den sturen und uneinsichtigen senilen Dummköpfen schon gehabt hatte.
Vom Sindalon war nichts mehr zu hören, die Außenhaut des Ernteroboters war zu solide abgedichtet. Er begab sich daher zur Schaltzentrale, um nach dem Tier Ausschau zu halten. Der Roboter war mit einer ausgezeichneten Rundum-Optik ausgestattet und Mikan entdeckte das Tier direkt vor der Tür lauernd. Wahrscheinlich dachte es: Wenn die Beute dort verschwunden ist, muss sie von dort aus auch wieder auftauchen. Mikan bemerkte keine sichtbare Verletzung, keine Irritation des Sindalons. Das Tier musste wirklich was aushalten können, wenn es den Aufprall bei dieser hohen Geschwindigkeit so einfach weggesteckt hatte.
„Na warte, du Missgeburt!“, schimpfte Mikan und betätigte die alles durchdringende Hupe der Maschine.
Der grandiose Erfolg der Aktion entlockte Mikan ein schadenfrohes Lachen: Das Sindalon stob mit Höchstgeschwindigkeit davon. Dennoch wagte er nicht, wieder auszusteigen, sondern brachte den Ernteroboter auf Kurs. An keiner Stelle des Grüngürtels war die nächste Schleuse zum Inneren des Refugiums weiter als zwölf Kilometer entfernt, vom Platz des jetzigen Standorts waren es sogar nur acht. Sicher war das Sindalon klug genug, sich von der Schleuse fernzuhalten und so würde Mikan ohne Probleme in ihrer Nähe aussteigen können, um Zutritt zum Kern zu erlangen. Sein Herz schlug ihm immer noch bis zum Hals.
Der Ernteroboter glitt nun fast geräuschlos durch die üppige Vegetation des Grüngürtels und ging seiner Arbeit nach. Nur ab und zu ertönte ein Warnsignal für die Kleintiere, die sich darin heimisch fühlten, Hasen vor allem, aber auch Meerschweinchen und andere kleine Nager, Hauptsache sie vermehrten sich schnell genug für den Fleischbedarf der Bevölkerung. Mit Freude drückte Mikan auf seinen zahlreichen Reisen mit dem Ernteroboter zwischendurch den Extra-Laut-Knopf: Er liebte es, die Tiere davonstieben zu sehen. Zumindest hatte sein kleiner Spaß eine Rechtfertigung: Von diesem Gefährt sollte ja nur die nichtfleischliche Biomasse geerntet werden.
Wie liebte Mikan diese grüne Einsamkeit. Er atmete tief durch und kam langsam zur Ruhe. So weit das Auge blickte: nur Pflanzen in allen Grüntönen, ab und zu ein Tupfer rot, gelb und blau, Blüten von Mohn und Löwenzahn, große, bunte Schmetterlinge, die nicht nur der Bestäubung dienten, sondern zudem seinem Auge ein zauberhaftes, farbenfrohes Bild boten. Ja, die Natur war schön! Die Blumen und Sträucher, die Gräser und Halme, die der Ernteroboter in sich hineinfraß, erfreuten auch die Sinne und Mikan verstand seine ignoranten Mitmenschen absolut nicht. „Dummköpfe, allesamt!“
Mikan spürte beim Betrachten des bunten Farbenspiels vor sich wie immer eine innere Ausgeglichenheit und Ruhe, die er sonst nur in der Musik fand. Dies war sein ganz privates Glück, seins ganz allein, weil seine nur auf schnellen Lustgewinn ausgerichteten Mitmenschen keine Antenne für derlei Dinge mehr besaßen.
Auch deswegen schätzte er die Arbeit mit der Flora und ihrer Entwicklung, widmete ihr seine Energie und sein Leben: Weil sie ihm immer wieder einsame Stunden bescherte, eine Kostbarkeit, die sonst im dicht besiedelten Refugium nicht zu erhalten war. Nun, scheint ja auch niemand zu brauchen, schnaufte er grimmig.
Der Ernteroboter näherte sich Schleuse Nummer drei und Mikan schwang sich aus dem Gefährt. Er schaute sich vorsichtig um, aber das Sindalon hatte sich tatsächlich längst aus dem Staub gemacht.
Der Roboter drehte ab und begab sich zur Entladestation. Mikan schaute kurz zu, wie die hoch konzentrierte Biomasse in Sekundenschnelle in ein Silo transferiert wurde. Bald würde der Ernteroboter sich für weitere fünf Stunden seiner unermüdlichen Erntetätigkeit widmen. Ein ewiger Kreislauf, dessen reibungsloses Funktionieren eine der Voraussetzungen für das Leben im Refugium war, obwohl die Mehrheit seiner Bewohner davon keine Ahnung hatte.
Ja, es ist perfekt ausgeklügelt, dachte Mikan, während er auf die Schleuse zuging. Ein ausgewogenes Gleichgewicht tierischer und pflanzlicher Lebewesen im Grüngürtel sorgte seit Jahrhunderten für einen reich gedeckten Tisch für alle Bewohner des Refugiums.
An der Schleuse saßen die zwei Schleusenwächter auf ihren Tech-Sesseln und blickten dem Ankommenden ohne Überraschung entgegen. Jeder Schleusenmitarbeiter kannte Mikan, der für die Programmierung der Ernteroboter und ganz allgemein für die Ernährung zuständig war.
„So, heute also mal wieder den Robbi als Ausflugsvehikel missbraucht“, begrüßte ihn einer der beiden Schleusenwächter, auf dessen digitalem Namensschild Hauer stand, und grinste hämisch.
„Kannst ja gerne mal mitkommen“, entgegnete Mikan und verkniff sich den Schimpfnamen, den er schon auf der Zunge gehabt hatte. Diese Schnarchzapfen und ihr ständiges dummes Geschwätz waren nicht mal einen Fluch wert.
Als ob die Wächter jemals freiwillig den Grüngürtel betreten würden! Selbst die abgezäunten, kleinen Freizeitflächen, die sich direkt neben den Schleusen befanden, erfreuten sich keiner hohen Besucherzahl und standen schon lange auf der wirtschaftlichen Abschussliste.
Die meisten hielten ihn, Mikan, für verrückt, weil er jede Gelegenheit nutzte, draußen zu sein. Doch das war ihm egal! Sein Leben war überhaupt nur durch diese Arbeit zu ertragen, er wäre sonst endgültig vor Langeweile eingegangen. Sollten sich die verblödeten Ober im Refugium doch ihr Hirn mit Drogen wegpusten, ihm stand der Sinn ganz gewiss nicht danach. Eine sinnvolle Arbeit war das viel bessere Aufputschmittel.
Während der Arbeitszeit waren alle Drogen außer der für Konzentration verboten: Wächter Nummer zwei sah man bereits nach wenigen Stunden Entzugserscheinungen an. Die blutunterlaufenen Augen, die Mikan leidend anblickten, sprachen Bände.
„Na, fehlt dir dein Betthäschen?“, fragte Mikan ihn hämisch grinsend; er spielte auf die meist konsumierte Droge ‚Sexrausch‘ an.
Mit Schaudern dachte er an sein aus Dummheit und wissenschaftlichen Forscherdrang erfolgtes Experiment damit. Tief in ihm schlummernde Begierden hatten sich in seinem Hirn eingenistet, und in seinem durch die Droge hervorgerufenen Traum hatte er Handlungen begangen, derer er sich lieber nicht erinnerte. Hemmungslos, pornografisch, unkontrolliert, alles Attribute, die er nie wieder auf sich anwenden wollte. Einmal und nie wieder! Nein, Drogen zu konsumieren hatte bei ihm einen Stellenwert im Unterirdischen und deswegen hatte er auch keinerlei Verständnis für diejenigen, die es regelmäßig taten. Ha, praktisch alle.
„Du weißt ja nicht, was du verpasst, du Freak“, höhnte der Wächter und Mikans wissendes Grinsen brachte ihn noch mehr in Rage. Nur weil ihm Mikans Bedeutung als Wissenschaftler für das Refugium hinlänglich bekannt war, wagte er es nicht, ihm weitere Beschimpfungen hinterher zu rufen. Er begnügte sich damit, heimlich hinter seinem Rücken das Gesicht zu verziehen und sich gegen die Stirn zu tippen.
Man hielt Mikan, gelinde gesagt, für einen Sonderling, einen Verrückten. Die Ernährung hatte sich zwar seit seinen erfolgreichen Versuchen im Grüngürtel in puncto Vielseitigkeit erheblich verbessert, doch was sollte man von jemandem halten, der die Einsamkeit suchte und Drogen ablehnte? Zudem wurde er im persönlichen Kontakt meist derart beleidigend, dass es eigentlich nur zwei ziemlich gleichstark vertretene Meinungen im Refugium über ihn gab: Verrückt sagten die einen, unausstehlich die anderen.
Es waren Urteile, die Mikan freilich kannte und über deren hartnäckiges Fortbestehen er sich immer wieder amüsierte. Denn nichts war ihm lieber, als Außenseiter in dieser ihm verhassten Gesellschaft zu sein. Dieses Etikett sah er als Auszeichnung, und er tat alles, um ihm weiterhin gerecht zu werden.
Kapitel 6: Drain
Idioten, allesamt! Mikan hielt mit seiner Meinung über seine Zeitgenossen keineswegs hinter dem Berg. So ließ er sich auch von den Faxen des Schleusenwächters hinter seinem Rücken, die ihm selbstverständlich aufgefallen waren, nicht beeindrucken. Er war schon fast durch die Tür, als er sich doch noch einmal umdrehte.
„Wisst ihr“, er musste es einfach loswerden, „auf der nach oben offenen Skala für Hirnlosigkeit könnte man euch beide selbst mit dem Fernglas nicht mehr entdecken.“ Zwar schauten ihn die Wächter böse an, aber es war offensichtlich, dass sie den vollständigen Sinn des Gesagten nicht erfasst hatten.
Das zauberte Mikan ein süffisantes Grinsen aufs Gesicht, bestätigte es doch fabelhaft seine Theorie allgegenwärtiger grenzenloser Dummheit im Refugium. Einfachste Zusammenhänge wurden nicht mehr verstanden, und selbst bösartige, beleidigende Bemerkungen konnten nur noch über ihren Ton verletzen, da komplizierte Zusammenhänge, die über ein direktes Ursache-Wirkung Prinzip hinausgingen, die intellektuellen Fähigkeiten der meisten Refugiumbewohner überforderten. Sancta simplicitas!, hatte man das in früheren Jahrhunderten kommentiert.
Immer noch belustigt verließ er das Gebäude und bekam plötzlich Sehnsucht nach seiner ganz persönlichen Vergnügungsstätte. Wie den Grüngürtel musste er auch diese praktisch mit niemandem sonst teilen. „Ha. Geschenkt! Es ist ja nicht so, als ob ich jemanden vom Museum fernhalten müsste! Die Refugiums-Banausen können wahrscheinlich nicht mal Asservaten-Kammer oder Prärefugienzeit richtig aussprechen!“
Mikan liebte Selbstgespräche. „Der einzige Mensch, mit dem ich intelligente Gespräche führen kann: C'est moi!“, war eine seiner bevorzugten Devisen.
Mikan ließ eines der seltenen Lächeln über sein Gesicht wandern. Ja, bald würde er seinen Tempel sehen, sein ganz persönliches Refugium. Doch gleich wich das Lächeln wieder einem verächtlichen Auflachen. „Ha, ein Paradies für mich, ein Ort der Langeweile für alle anderen. Ein Museum über eine Zeit, in der es keine maßgeschneiderten Drogen gab: für die so langweilig wie die Endlosschleife eines Holofilms über das Wachstum von Pflanzen im Dunkeln. Primitivlinge!“
Zu seinem Leidwesen konnte er sich nicht direkt dorthin begeben, da er seine heutige Tätigkeit abschließend im Arbeitsministerium dokumentieren musste und gleich im Anschluss die allmonatliche Nachbarschafts-Versammlung seiner Wohneinheit anstand. Oh, wie er sie hasste, diese Versammlungen! Doch nicht daran teilzunehmen, war keine Alternative, denn allzu leicht konnten Beschlüsse gefasst werden, die für Mikans Seelenfrieden unerträgliche Konsequenzen nach sich ziehen würden.
Mit Schrecken dachte er an das folgenschwere Versäumen eines dieser Nachbarschaftstreffen zurück: In jener lang zurückliegenden Zeit hatte er sich von dem Rebellionsgeist seiner damaligen Geliebten Valea anstecken lassen und war zum ersten Mal ferngeblieben. Ihm lief es allein bei der Erinnerung kalt den Rücken hinunter: Prompt hatte man beschlossen, in ihrer Wohneinheit eine Drogenabrufstelle zu installieren!
Und an diesem unsäglichen Drogomaten musste er bei jedem Verlassen seiner Wohnung vorbeilaufen und viel zu oft mit ansehen, wie ein Drogensüchtiger sich gerade die nächste Rate seiner körperlichen und vor allem geistigen Selbstzerstörung ausliefern ließ. Niemals wäre das zustande gekommen, wenn er damals mit abgestimmt hätte! Nein, niemals, denn solche schwerwiegenden Entscheidungen mussten einstimmig gefällt werden. Eine sehr vernünftige und sinnvolle Regelung, eine der wenigen dieser Art, doch leider in der Bevölkerung sehr umstritten: Es bestand die Gefahr, dass dieser letzte Rettungsanker der Intelligenz auch noch eliminiert wurde …

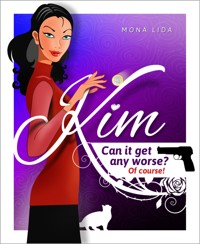

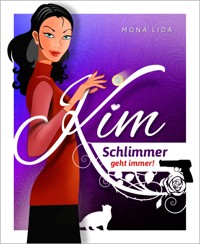
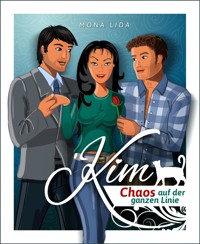













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










