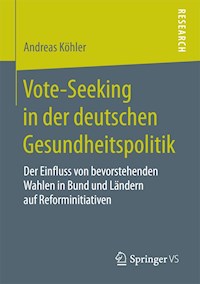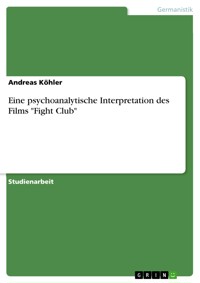Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mauritz ist Assistent an der Universität und will dem trägen Dasein im Institut seines Professors und dessen Sekretärin entfliehen. Seine Seele und sein ganzes Leben will er neu gestalten. Aus dem harmlosen angepassten Akademiker wird ein ebenso angepasster, aber keineswegs mehr harmloser Verschwörer. Schritt um Schritt entwickelt sich der unglückliche, an seiner Bedeutungs- und Zukunftslosigkeit leidende Mauritz zum Mitglied einer sendungsversessenen Natur- und Seelensekte, die ihre Weltbekehrung schliesslich mit Waffengewalt durchsetzen will. Ein Bund harmloser Schwärmer wandelt sich zur auserwählten Gruppe, die zu einem Bombenanschlag und letztlich zum Märtyrertum bereit ist. Sonntags Zeitung: «Köhler jedoch gelingt, was bisher selten zum Ausdruck kam: den Wandel aufzuzeigen, der etwas beängstigend Normales hat. So normal, dass man glaubt, in einen Spiegel zu blicken.» Schweizerische Ärztezeitung: «Der Psychiater Andreas Köhler geht in seinem Roman Zur Quell den Mechanismen auf den Grund, die harmlose Schwärmer in gefährliche Weltverbesserer verwandeln. Spannend sind innere und äussere Entwicklungen miteinander verknüpft, Machtkämpfe und Realitätsverlust, Psychorituale und paramilitärische Übungen, Erlösungsmythen und heiliger Krieg.» Der Bund: «Insbesondere diese schleichende Radikalisierung der Therapiegemeinschaft hat Köhler kenntnisreich und differenziert herausgearbeitet.»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aber nicht allein die Erinnerung an seinen Urzustand soll ihm bleiben, sondern er lebt auch wieder auf in der Heiligen Harmonie mit der ganzen Natur, er versteht ihre Wunder und die Macht der verbrüderten Geister steht ihm zu Gebote.
E. T. A. HOFFMANN: DER GOLDENE TOPF
In Wahrheit steht es ganz anders: Indem ihr entzückt den Kanon eures Gesetzes aus der Natur zu lesen vorgebt, wollt ihr etwas Umgekehrtes, ihr wunderlichen Schauspieler und Selbst-Betrüger! Euer Stolz will der Natur, sogar der Natur, eure Moral, euer Ideal vorschreiben und einverleiben ...
FRIEDRICH NIETZSCHE: JEN SEITS VON GUT UND BÖSE
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
I
NACHDEM SICH das Röhren und die letzten Dieseldünste des weit hinten am Waldrand noch sichtbaren Postautos verflüchtigt hatten, konnte ich endlich frische Luft atmen. Auf der Fahrt, erst im engen Abteil der Lokalbahn, dann im schwerfälligen Bergpostauto, hatte ich dauernd gegen Schwindel und Übelkeit gekämpft. Die muffigen, von den Strahlen der Mittagssonne aufgeheizten Sitze hatten nach Kunststoff gestunken; nicht genug, während der unzähligen Kehren der steilen Strasse waren aus der Lüftung des Wagenraums Abgase und Gummigeruch gedrungen und hatten mir Magen, Därme und alle Sinne und alles Denken durcheinandergebracht.
Der schmale Kiesstreifen neben der asphaltierten Strasse, der nur durch ein verwittertes Schild als Haltestelle gekennzeichnet war, befand sich weitab jeglicher Siedlung. Auf steilem, welligem Wiesengelände, das sich zu bewaldeten Anhöhen hochzog, hielten sich einzelne schief gewachsene Apfel- und Birnbäume. Ausser zwei, drei verstreuten, entfernt am gegenüberliegenden Abhang gelegenen kleinen Bauerngehöften waren keine Häuser zu sehen.
Ich riss die unförmige Reisetasche hoch, die der Chauffeur aus dem tiefen Gepäckboden des Postautos hervorgezerrt und mir vor die Füsse geworfen hatte, und schwang sie über die Schulter, doch erkannte ich im selben Augenblick, wie unsinnig das war, da ich nicht im Mindesten wusste, in welche Richtung ich hätte gehen sollen. Zudem hatte das wiederholte tiefe Durchatmen meine Übelkeit keineswegs zum Verschwinden gebracht; im Gegenteil, in den Beinen machte sich zunehmend eine Schwäche bemerkbar, die mich fürchten liess, über kurz oder lang ohnmächtig niederzusinken.
«Sand!», las ich auf dem Kasten, der am Strassenrand stand, und darunter: «Nur bei Glatteis zu verwenden!» Verloren buchstabierte ich noch und noch die verwaschene Schrift, wie wenn sich aus ihr eine geheime Botschaft hätte lesen lassen, die mir meinen weiteren Weg gezeigt oder mich wenigstens von meiner Übelkeit befreit hätte. Schliesslich stellte ich die Tasche auf den verbogenen Metalldeckel des Kastens und stützte mich mit beiden Armen ab; was blieb mir anderes übrig, als hier zu warten und zu hoffen, es würde mich irgendwann jemand abholen.
Trotzdem schreckte ich auf, als plötzlich in einem Buschbestand unweit von mir trockene Äste knackten und kurz danach ein kräftiges «Hallo!» zu hören war. Aus dem Gestrüpp jenseits der Strasse trat ein braungebrannter Mann von etwas über dreissig Jahren. Sein Haar war kurz geschnitten, ebenso Schnauz und Bart. Der stämmige Körper steckte in einem dunkelgrünen Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und in oliv und braun gesprenkelten Hosen, deren Enden mit einer Art Gamaschen zusammengeschnürt waren. An den Füssen trug er hohe schwarze Lederschuhe mit dickem Profil. Mit weiten Schritten überquerte er die Strasse und stellte sich vor mich hin.
«Mauritz?»
Ich nickte.
«Ich bin Gerhardt. Haus zur Quell.» Dabei drückte er mir kräftig die Hand. «Weiter geht's zu Fuss.»
Er zeigte mit seinem Holzstock, der deutlich länger als ein Spazierstock war und oben in einen eigenartig geformten Metallgriff mit breiter Lederschlaufe auslief, unbestimmt in die Richtung, aus der er gekommen war. Seine Stimme hatte einen klaren und trockenen, beinahe metallischen Klang; den Akzent konnte ich nicht einordnen, zumal er, während er wartete, bis ich meine Tasche umgehängt hatte, kein weiteres Wort verlor. Er wandte sich mit einem Schwung um und marschierte los. Ich schritt hinter ihm her und zwängte mich durch das Gebüsch, aus dem er aufgetaucht war.
Auf einem schmalen Weg, der stellenweise kaum sichtbar war, ging es über eine ansteigende Wiese, dann einem Waldrand entlang, bis wir bei einer Abzweigung in den Wald drangen. Den trainierten, lockeren Schritt des Mannes konnte ich knapp halten, doch begann ich kräftig zu schwitzen, und die Tasche drückte mir auf Schulter und Arm. Der Pfad zog sich mehr oder weniger steil bergauf und in unregelmässigen Windungen hin und her, in Bachbette hinein, über Wurzeln und Baumstrünke hinan, sodass ich in dieser mir völlig unbekannten Gegend die Orientierung, welche noch nie meine Stärke gewesen war, bald verlor.
Ich folgte schweigend meinem Führer. Abermals überquerten wir eine dünn bewachsene, von nackten Stufen durchfurchte Wiese, auf welcher einige Kühe grasten. Die hohe Sommersonne brannte auf meinen Nacken; ich keuchte mehr und mehr und wechselte in immer kürzeren Abständen die Tasche von einer Schulter zur anderen. Meine Übelkeit war zwar verschwunden, hatte aber einem, wie ich überzeugt war, hörbaren Herzklopfen Platz gemacht. Das Blut schoss mir stossweise in den Kopf; meine Beine waren steif und schwer wie Blei, und die Füsse in den flachen und profillosen, neben Gerhardts wuchtigen Armee- oder Treckerstiefeln lächerlich aussehenden Strassenschuhen schwollen immer mehr an und schmerzten.
Oberhalb der Wiese bog der Weg wieder in einen Wald und folgte über längere Zeit einem Bachlauf. Hier war es etwas kühler. Unvermittelt blieb Gerhardt, der auf dem ganzen Weg kein Wort gesprochen hatte, stehen.
«Pause!», stellte er fest. «Anstrengend?»
Ich nickte und liess die Tasche von der verkrampften Schulter gleiten. Er schwieg wieder und begann mit seinem Stock zu spielen, spiesste ab und zu einige am Boden liegende, trockene Blätter mit der Stahlspitze auf oder hob geschickt kleine Ästchen an, um sie dann mit einem plötzlichen Ruck aus dem Handgelenk den Weg hinunterzuschleudern. Als zwischen den Baumwipfeln kurz ein Flugzeug sichtbar wurde, brachte er den Stock mit rascher Bewegung in Anschlag und zielte wie mit einem Gewehr in den Himmel.
«Piff-paff, piff-paff, rätä-rätätätätätätääää!», imitierte er ein altes Schiesseisen oder irgendwelche Marschmusik, worauf er schelmisch lachte.
Bald jedoch bedachte er mich mit einem halb fragenden, halb aufmunternden Blick und marschierte entschlossen weiter. Ich verwünschte mich dafür, so viel in die Tasche gepackt zu haben, neben Kleidern, Schuhen, Toilettenzeug und anderem Kleinkram auch noch etliche Bücher, die nun besonders schwer drückten. Natürlich hatte ich beim Packen nicht mit einem solchen Marsch gerechnet. Genauer gesagt: Ich hatte mit nichts gerechnet und an nichts Bestimmtes gedacht. Ich hatte mich für dieses Haus – das Haus zur Quell im Appenzellischen – entschieden, weil es sich genügend weit weg von all den Widerwärtigkeiten meines Alltags befand, aber nicht in unüberblick- und unberechenbarer Ferne, wo ich mangelhafte Qualifikationen der Leitung hätte riskieren müssen.
Unser Marsch kam mir endlos vor. Ich war ausschliesslich damit beschäftigt, auf die vielen gewundenen, den Weg in alle Richtungen kreuzenden Wurzeln zu achten, immer wieder an den Henkeln meiner Tasche zu reissen und auf keinen Fall Anzeichen von Schwäche zu zeigen oder gar schlappzumachen.
«Unser Haus», erklärte Gerhardt unversehens, nachdem wir um einige mannshohe Felsbrocken gebogen und anschliessend über ein kleines, verwittertes Zauntreppchen geklettert waren. Wie ich aufschaute, trennte uns nur noch ein kurzes Wegstück über eine abfallende Wiese von einem frei stehenden, ansehnlichen Gebäudekomplex. Wir befanden uns in einem Hochtal. Beide Flanken waren steil und bewaldet; da und dort zeigten sich felsige Partien. Hinten führte das Tal in eine dicht von Bäumen gesäumte Schlucht. Das Haus thronte über leicht geneigtem Wiesengelände, welches sich bis zu einem aus der Schlucht hervorquellenden Bach hinunterzog. Es bestand aus einem mehrere Stockwerke hohen Gebäude, welches mit seinen gebeizten Holzschindeln und dem nach allen vier Seiten geneigten Blechdach im hell beschienenen Gras schwer und dunkel wirkte, und einem beinahe gleich hohen, zweistöckigen Anbau aus hellgelbem Backstein mit hohen Fenstern, die mit roten Steinbogen überwölbt waren. Auf der gegenüberliegenden Seite eines gekiesten Platzes befand sich ein ausladender, im unteren Teil offener Holzbau, der als Remise für verschiedene landwirtschaftliche Maschinen diente. Mitten auf der Fassade des Hauptgebäudes stand auf einem schwarzen Metalltäfelchen in fein geschwungenen Goldlettern: «Zor Quöll».
Für weitere Eindrücke blieb jedoch keine Zeit, denn Gerhardt war bereits die Sandsteintreppe zum Haupthaus hochgestiegen und hatte die schwere Eichentür geöffnet, in deren Rahmen er stehen blieb, sich umdrehte und mich herbeiwinkte.
Wir betraten eine Diele, die mir nach dem gleissenden Mittagssonnenlicht düster vorkam. Erst mit der Zeit bemerkte ich die schwarz gekleidete Frau, die auf der Treppe ins obere Stockwerk stand und auf mich herabschaute; nur das Weiss ihrer Augen war deutlich erkennbar. Sie hob ihre Hand zum Gruss und stieg anschliessend ohne Geräusch nach oben.
Gerhardt hiess mich einen Moment warten und verschwand hinter einer Tür. Endlich konnte ich meine Tasche auf den Boden stellen. Nirgends war ein Stuhl zu sehen, und da ich vollkommen erschöpft war und noch keuchte, liess ich mich auf der Treppe nieder. Die Diele war grossflächig und mündete auf der einen Seite in einen Flur. Hinter mir schwang sich die Treppe in die oberen Stockwerke hinauf. Im Halbrund der breiten Stufen hing eine Reihe metallisch glänzender Röhren, die ich für eine Art moderner Skulptur hielt.
Nach einer Weile öffnete sich die Tür wieder, und Gerhardt rief mich in ein geräumiges Zimmer, wo hinter einem ausladenden Schreibtisch ein breiter Mann sass. Die dunkelblonden Haare seines grossen, runden Kopfs waren halblang geschnitten und hinter die Ohren gekämmt; das rötliche, volle Gesicht glänzte. Aus dem Ausschnitt seines weissen Hemdes quoll ein dunkelrotes Halstuch. Mit breitem Strahlen seines Gesichts erhob er sich halb von seinem mattroten Drehsessel, streckte mir eine weiche, kleine Hand entgegen und sagte: «Ich bin Fred. Freut mich, dich kennen zu lernen. Mauritz heisst du – ist das richtig? Du hast sicher schon bemerkt, dass wir uns hier alle duzen. Willkommen in unserer Gemeinschaft.»
Schmunzelnd meinte er: «Ein steiler Weg hier herauf. Ungewohnt für dich, wie ich sehe.» Gerhardt war unterdessen zur Tür hinausgegangen. Fred, der ihm nachgeblickt hatte, fügte lachend hinzu: «Gerhardt wird dich nicht geschont haben, so wie ich ihn kenne. Setz dich! Mach es dir bequem!»
Er stützte seine Ellbogen auf den breiten, massiven Schreibtisch aus dunklem Holz und überflog verschiedene Papiere, die zwischen einem schiefen Bonsaibäumchen und einer Tiffany-Lampe in Form eines Kranzes gläserner Calla-Blüten ausgebreitet lagen. Dann wandte er sich wieder mir zu: «Du bist erstmals im Haus zur Quell, kennst dich noch nicht aus. Keine Sorge, das gibt sich rasch. Du wirst dich hier bald wohl fühlen.»
Darauf lehnte er sich zurück und fragte: «Wie bist du auf uns gekommen? Und was weisst du bereits über unser Haus?»
Ich musste gestehen, dass mir alles vollkommen unbekannt war und mich lediglich ein Inserat auf das Haus aufmerksam gemacht hatte.
«Nicht schlimm, gar nicht schlimm. Ich will dir aber lange Erklärungen ersparen; du wirst bald selbst sehen und erfahren, wer wir sind und wie wir arbeiten. Lass alles auf dich zukommen. Öffne dich für all das, was hier geschieht, oder besser, was wir alle geschehen lassen. Diese Bereitschaft ist das Wichtigste – und gleichzeitig das Einzige, was du mitbringen sollst: uneingeschränkte Bereitschaft, dich zu öffnen und in den Prozess einzusteigen. Alles andere wird sich von selbst ergeben.»
Er blickte zur Decke und fuhr nach einer Pause weiter: «Aber erst müssen wir noch einige Formalitäten erledigen. Übrigens, hast du Hunger? Durst? Natürlich, ohne Zweifel!» Mein Nicken wartete er gar nicht ab, sondern fügte hinzu, dass er bereits Anweisungen gegeben habe, drüben im Speisesaal etwas für mich bereitzustellen.
Dann fragte er nach meinen Personalien, nach Beruf und Arbeit, nach körperlichen Erkrankungen oder Behinderungen irgendwelcher Art, die den beabsichtigten Erfahrungsprozess beeinflussen oder beeinträchtigen könnten, und liess mich schliesslich unterschreiben, dass ich aus freien Stücken und nach eigenem Willen ins Haus zur Quell eintreten und mich der Ordnung des Hauses und den entsprechenden Regeln, die alle im alleinigen Interesse der Gäste und ihres Zusammenlebens bestünden, nach bestem Wissen und Gewissen und nach meinem ausschliesslich eigenen Bedürfnis unterziehen würde, worauf wir noch das Finanzielle regelten.
Nachdem ich unterschrieben hatte, legte er die Schriftstücke in ein Mäppchen, welches er in einen schwarz gebeizten Rollschrank wegschloss. Im Zurückdrehen schwang er seinen massigen Körper hoch und umkurvte den Schreibtisch.
«So, und nun endlich zu deiner leiblichen Stärkung.»
Mit diesen Worten wandte er sich zur Tür. Ich folgte ihm durch die Diele und den Flur zu einem hellen, auf der Sonnenseite des Hauses gelegenen Raum, dessen breite Fenster weit geöffnet waren und den Blick auf einen von Gebüsch umsäumten, reichen Garten mit Blumenbeeten freigaben.
An den Wänden des Raums zog sich eine hell gestrichene Holztäfelung beinahe bis zur Decke hoch; das Parkett, zum grössten Teil von einem meergrünen, orientalischen Teppich mit verschlungenen Ornamenten bedeckt, war kunstvoll aus verschiedenfarbigen Holzsorten gefertigt, wie ich es in einem Haus in gebirgiger Gegend nicht erwartet hätte. Genau in der Mitte des Raums standen eine lange, schwere, mit einem weissen Damasttuch bedeckte Tafel und ein gutes Dutzend gepolsterter Stühle. Über dem Tisch, an der weissen, mit feinen rosa Stuckrosetten verzierten Decke hingen zwei Lüster, die im warmen Sonnenlicht mitzuleuchten schienen. Den Fenstern gegenüber befand sich eine lang gezogene Anrichte, auf welcher verschiedene Platten und Schüsseln bereitstanden. Die Mitte des Tischs nahm ein schweres, poliertes Kupfergeschirr ein, aus dem eine üppige Anthurie – nicht zu vergleichen mit dem mageren Gewächs, das seit Jahren bei meiner Mutter auf dem Fenstersims vor sich hin dämmerte – ihre glühend roten Blütenzungen in alle Richtungen streckte. Daneben lag ein einzelnes Gedeck mit grossem Porzellanteller, schwerem Silberbesteck und zwei Kristallgläsern.
«Unser Mittagessen ist schon vorbei. Aber zu einem Imbiss für dich reicht es bestimmt noch.» Fred wandte zur Anrichte und deckte die Platten ab. Käse, Trockenfleisch, Schinken kamen zum Vorschein, sowie rohes, in feine Streifen geschnittenes Gemüse und Salatblätter nebst einigen Schälchen mit verschiedenen Saucen. Alles war frisch und äusserst appetitlich angerichtet.
«Was willst du trinken? Bedien dich selbst: Most steht hier, ein ganz feiner Most, aus der Gegend. Im Kühlfach Eistee; Milch ist auch da. Hier ein Sieder für heisses Wasser, kannst dir frischen Tee aufgiessen; die Kräuter sind in diesen Dosen. Nimm dir, wozu du Lust hast. Ich lasse dich jetzt allein, will mich noch auf unsere Mittenbesinnung vom Nachmittag vorbereiten.» Er griff nach einem Stück Schinken, tunkte es in eine rötliche Sauce und schob es geniesserisch in den Mund.
«Lass dir Zeit. Ich hole dich nach dem Essen zur Mittenbesinnung ab; da steigst du gleich in unsere Arbeit. Und lernst alle anderen kennen. Bis bald. Deine Tasche hat man sicher schon nach oben gebracht.» Damit verliess er den Speisesaal und schloss die Tür hinter sich.
Ich war derart ausgedörrt, dass ich noch im Stehen vor der Anrichte zwei Glas des kühlen Mostes trank, bevor ich den Teller vom Tisch holte und zu füllen begann. Dann setzte ich mich und ass mit grossem Appetit, derweil ich in aller Ruhe die wundervolle Aussicht durch die offenen Fenster auf die sommerliche Gebirgslandschaft genoss.
Alles schmeckte so köstlich, wie es aussah und duftete. Ich beglückwünschte mich zu meiner guten Wahl und schalt mich höchstens zwischendurch einen Toren, dass ich nicht schon viel früher entschieden, sondern etliche unnütze Monate mit zögerlichem Hin-und-her-Überlegen vertan hatte. Das Inserat, durch welches ich auf dieses Haus aufmerksam gemacht worden war, hatte ich nach mehrmaligem, erst nachlässigem, dann halbwegs interessiertem Durchlesen aus der Zeitung gerissen und auf die Ablage unter dem Spiegelkasten in meinem Badezimmer gelegt. Immer wieder einmal hatte ich es, meist beim Rasieren, überflogen, ohne eine Anmeldung – eine Anmeldung zur Therapie! – ernsthaft ins Auge zu fassen. Die längste Zeit hatte ich gehofft, das Ganze würde sich sonst irgendwie – das heisst ohne grösseren Aufwand – geben.
«Schmöckt's?» Ich war derart in meine Gedanken versunken gewesen, dass ich nicht bemerkt hatte, wie jemand durch die Tür hinter mir eingetreten war und nun neben mir stand. Erschrocken nickte ich, mit vollem Mund, und blickte zu einer Frau auf. Sie war wohl etwas über die Vierzig, schlank, aufgerichtet, mit dunklem Teint, dunklen Augen und schwarzen, üppigen, nach hinten gesteckten Haaren. Sie trug ein dunkelblaues Kleid und darüber eine weisse Schürze. Ihre gepflegten Hände hatte sie ineinander gelegt.
«So ist's recht, nur tüchtig zugelangt; Sie haben wohl eine weite Reise hinter sich. Nur keine Halbbatzigkeiten!» Sie ging zur Anrichte hinüber und schaute in die verschiedenen Schüsseln.
«Brauchen Sie noch etwas? Mehr Käse? Salat?» Ich wehrte ab, hatte ich doch bereits reichlich geschöpft und vom frischen, kräftigen Brot gegessen.
«Den Pudding im Kühlfach haben Sie gesehen? Schlagsahne ist auch da, falls Sie mögen. Bewegung in frischer Bergluft macht hungrig. Die Fenster soll ich offen lassen?»
Ich nickte, worauf sie einen kleinen Knicks machte und «Pmöntä!» sagte.
Ich musste sie verdutzt angesehen haben, denn sie wiederholte mit leicht spöttischem Lächeln: «Pmöntä! – Frau Pmöntä.» Dann erklärte sie: «Gmünter heisst das in Ihrer Sprache. Meine Domäne ist Logis und Küche, Wäsche waschen und Knöpfe annähen. Und alles Übrige, was Sie zu einem angenehmen Aufenthalt hier oben nötig haben. Wenn Sie etwas wünschen, rufen Sie mich ungeniert. Ich bin drüben in der Küche oder in meinem Arbeitszimmer zu finden.»
Es kam mir gerade noch rechtzeitig in den Sinn, mich selbst flüchtig vorzustellen, was sie mit kurzem Lächeln und Kopfnicken quittierte, bevor sie wieder durch die Tür neben der Anrichte enteilte.
Drüben musste sich also die Küche befinden, und nun erst gewahrte ich ein leises Klappern von Besteck und Geschirr. Kein anderes Geräusch durchbrach die Stille des Hauses, ausser dem fernen Rauschen des Bachs, das durch die Fenster hereindrang.
Ich leerte meinen Teller und entschied mich, doch noch eine zweite Portion zu holen. Schon lange hatte ich nicht mehr so schmackhaft gegessen, so schmackhaft und in einer derart ruhigen Atmosphäre. Seit Jahren ging ich über Mittag in den lärmigen Selfservice unweit des Universitätsinstituts und wählte irgendetwas aus den immer gleichen Menüs; zum Abendessen aber lag ich gewöhnlich auf dem Diwan vor dem Fernseher und löffelte direkt aus den unterwegs eingekauften Büchsen und Fertigpackungen.
Den leeren Teller stellte ich auf die Anrichte und nahm den milchig weissen, fein nach Mandeln duftenden Pudding aus dem Kühlschrank, gab die frische Schlagsahne dazu und liess mir auch diese Leckerei schmecken, während ich zurückgelehnt den Blick wieder durch die Fenster auf die sonnenbeschienenen Wiesen und den dunklen Wald jenseits des Bachlaufs lenkte. Bei allem Genuss dieser Annehmlichkeiten konnte ich mir allerdings nicht verhehlen, dass der Rest, der eigentliche Sinn meines Aufenthalts in diesem Haus, wohl weit weniger delikat und genüsslich werden würde.
Plötzlich hörte ich warme, tiefe Töne, eine kurze Melodie, die sich regelmässig wiederholte. Es musste sich um eine Art Gong handeln, wobei ich aber nicht ausmachen konnte, woher die Klänge kamen; vielmehr schien mir, als ob der ganze Raum, in dem ich mich befand, sanft mitschwänge.
Da ich draussen Schritte zu vernehmen glaubte, wandte ich meinen Blick unwillkürlich zur Tür, die auf den Flur hinausführte. Erst jetzt bemerkte ich das grosse Ölgemälde an der Wand, das so gar nicht in diesen hellen Raum und zur heiteren Aussicht aus den Fenstern passen wollte. In schweren, dunklen Farbtönen gehalten und in einer expressiven, ja bizarren Technik gemalt, liess es in einen düster-schattigen Felsgrund blicken, wo sich ein lila-grüner Tümpel gefangen hatte. Im Wasser spiegelten sich der Himmel und das Gewirr von Ästen der schweren Fichten, welche hoch oben die violetten Felsen säumten.
Bereits stand Freds breite Gestalt unter der Tür. Ich folgte ihm in die Diele hinaus, wo hinter einem kurzen Durchgang eine mächtige, zweiflüglige, halb offene Eichentür zu sehen war.
«Halt!», kam es im Halbdunkeln von Fred, der die Hand erhoben hatte. «Hier wechseln wir die Fussbekleidung. Nie mit Strassenschuhen in unsere Halle! Alle tragen wir eigens für diesen Raum gearbeitete Schuhe. Welche Grösse brauchst du? Aha. Nimm diese hier; die sollten passen. Sie sind neu und ungetragen. Du kannst sie behalten. Wenn du dich bei uns eingerichtet hast, so komm jeweils in möglichst bequemer Kleidung – nichts Beengendes! – zur Mittenbesinnung und zu den anderen Arbeiten und Übungen.»
In diesem Augenblick – ich hatte keine Ahnung warum - spürte ich wieder den Druck in der Brust, dieses Klemmen und Drängen, das wie üblich in den Hals hinaufstiess und den Mund austrocknete. Ich liess mir nichts anmerken und zog die neuen, hellgrauen, äusserst behaglichen Schuhe aus dünnen Schichten feinsten Leders an. Meine staubigen, nach dem langen Marsch noch ausgetretener wirkenden Schuhe stellte ich in das Regal an der Wand und folgte Fred in eine grosse, längliche Halle mit hohen Fenstern auf beiden Seiten, welche sich im dunklen, polierten und trotzdem wie genarbt wirkenden Boden spiegelten. Vier gusseiserne, kannelierte, mit Kapitellen verzierte Säulen zogen sich zur leicht gewölbten, weiss gekalkten Decke hoch. An der Stirnseite hing ein schwerer Teppich, welcher beinahe die ganze Wand bedeckte. Er zeigte dasselbe Signet, das ich neben der Eingangstür erblickt hatte: Lila Wellen flossen auf grünblauem Hintergrund, während stilisierte Sonnenstrahlen gelb leuchteten.
Im Geviert der Säulen war eine grössere Zahl graubeiger, gepolsterter Matten ausgelegt und bildete einen Dreiviertelkreis. Zwischen ihnen und der Wand mit dem Teppich lag eine einzelne Matte, welche den Kreis schloss.
Fred wies mir einen Platz zu. Von draussen waren gedämpfte Stimmen zu hören; mehrere Männer und Frauen zwischen Ende zwanzig und Ende dreissig betraten den Raum und nahmen ihre Plätze auf den Matten ein. Mir gegenüber machte ein Mann Anstalten sich zu setzen, überlegte es sich plötzlich anders, streckte sich wieder, schritt zu einem der Fenster und schaute wie unbeteiligt hinaus. Er trug ein dunkles Jackett und braune Kordhosen; sein Körper war hager, sein Gesicht schmal und bleich. Nach einer Weile drehte er sich um und blickte aus tiefliegenden Augen ohne Regung zu mir herüber.
«Allerliebst!», wisperte es neben mir. Eine Frau in weitem, bernsteinfarbenem Kleid war im Begriffe, sich auf die Matte links von mir zu setzen. Ihr schulterlanges, gewelltes Haar hatte dieselbe dunkelrostrote Farbe wie ihre Lippen, die sie kurz spitzte. Sie trug grosse, dünne Ohrringe und eleganten Goldschmuck an ihren schlanken Händen. «Meine neue Nachbarschaft in der Halle! Lieb, wirklich lieb! Wie heisst du?», fragte sie mich im gleichen flüsternden Ton.
«Mauritz», wiederholte sie, nachdem ich ihr meinen Namen zugeflüstert hatte; den Familiennamen liess sie weg. «Schön! Ich bin Mellinde. Mellinde mit zwei L. Wunderschön, dass du zu uns gefunden hast. Es wird dir hier gefallen. Mit Sicherheit. Hüte dich bloss vor den beiden unverschämten Frechdachsen da drüben!»
Zwei verwegen dreinblickende Jugendliche waren im Gänsemarsch hereingekommen; der eine von ihnen trug überweite, hellbraune Hosen, ein riesiges, hellgelbes Hemd, das frei herunterhing, und eine Mütze mit langem, schwarzem Schirm, der andere einen grauen, handgestrickten Pullover, ein dickes Wollkäppi und grau-schwarz gestreifte Hosen; nur die Schuhe waren dieselben wie bei allen anderen. Sie umrundeten Mellinde und mich zwei- oder dreimal in gestelztem Schritt, worauf sich der eine wie ein Zirkusdirektor tief verbeugte und wortlos mit wilden Gesten auf seinen Gefährten und sich wies, der andere seine Augen zukniff, kurz nickte und mit schlaksigen Bewegungen seinem Platz zusteuerte.
Auf die Matte vor dem Wandteppich hatte sich mit runden, fliessenden Bewegungen eine Frau von knapp dreissig Jahren gesetzt, deren sanftes, weiches Gesicht einen auffallend zarten, rosafarbenen Teint hatte und von blonden Haaren umrahmt war. Sie trug weite Hosen und ein ebenso weites Hemd, was mich an Judo-Bekleidung oder an den Dress der Physiotherapeutinnen erinnerte, denen ich jeweils auf meinem Weg zur Arbeit begegnete.
Mit verschränkten Beinen und auf den Knien abgestützten Handgelenken sassen alle im Schneidersitz auf den Matten. Ich folgte dem Beispiel und setzte mich ebenfalls aufrecht mitten auf meine mit rauem, doch geschmeidigem Leder bespannte Unterlage. Noch nie war ich in einer solchen Stellung gesessen, und beim Versuch, meine Oberschenkel zu grätschen, gelang es mir nur mit allergrösster Mühe, meine Knie so weit auseinander zu zwingen, dass ich die Unterschenkel kreuzen konnte. Ganz ruhig war es geworden; nur einer der beiden Jugendlichen rutschte hin und her und zwinkerte mit den Augen.
Die Stille durchbrach die Frau mit der zarten Haut: «Wir grüssen uns im Kreis.» Rundherum wurden beide Arme seitlich in die Höhe gehoben und langsam wieder gesenkt.
Dann fuhr sie fort: «Wir grüssen uns im Kreis – und begrüssen ein neues Glied in unserem Kreis. Mauritz ist eben zu uns gestossen und wird ab heute an unserer Arbeit teilnehmen. Er weilt zum ersten Mal im Haus und kennt unsere Arbeitsweise noch nicht. Wir beschränken uns also auf die einfachsten Übungen und vergessen dabei nicht: Das Einfachste ist das Wichtigste – und auch das Schwierigste.»
Während sie sprach, spürte ich wieder diesen lähmenden Druck in meiner Brust, diese eigenartige Empfindung, die nicht eigentlich ein Schmerz war und sich auch nicht genau lokalisieren liess, meist aber irgendwie vom Herzen auszugehen schien und die sich noch steigerte, als alle Blicke auf mich gerichtet waren.
«Zuerst wollen wir uns jedoch vorstellen. Ich bin Irene.»
Dann folgte reihum Name auf Namen. Diese konnte ich mir allesamt nicht merken – mit Ausnahme von Clara und Mellinde. Clara war die ganz in Schwarz gekleidete junge Frau mit den vollen Lippen, die ihre kastanienbraunen Haare zu einem kleinen Knoten hochgesteckt hatte. Sie war es gewesen, die mich beim Betreten des Hauses von der Treppe herunter gegrüsst hatte. Unsicher nannte auch ich am Schluss meinen Namen, worauf mir Irene freundlich zunickte.
«Wir schliessen uns und öffnen uns», fuhr sie fort, «wir schliessen uns – und öffnen uns.»
Irene wiederholte diese langsam und betont ruhig gesprochenen Worte mehrmals, dann fügte sie hinzu: «Mauritz will ich diese Übung, unsere wichtigste und wesentlichste Übung, erklären. <Wir schliessen uns und öffnen uns> will heissen, dass wir uns von äusseren, fremden Einflüssen abwenden, allen Ablenkungen verschliessen und unserem leiblichen und geistigen Inneren öffnen. Das ist es, was wir Mittenbesinnung nennen. Wir schliessen die Augen und suchen unsere Mitte. Wir lassen alles fahren, was uns an diesem Blick nach innen, an unserer Versenkung hindert, alle fremden Gedanken, alle Spannungen und Hemmungen. Wir atmen ruhig und frei; wir spüren das Strömen der Luft in unsere Lungen, das Dehnen der Rippen, das Weichen der Flanken.»
Nachdem ich die Augen geschlossen und meine Unterarme auf die Schenkel gestützt hatte, versuchte ich, den Anweisungen folgend, die Übung anzugehen. Irene musste bemerkt haben, dass ich mich mit dem Sitzen schwer tat, denn sie holte einen dreibeinigen Schemel mit leicht nach vorn geneigter Fläche, der neben der Tür gestanden hatte, und stellte ihn hinter meine Matte.
«Setz dich hier hin. Am Anfang geht es so einfacher. Und anfangen müssen wir alle einmal. Wenn du dich eingewöhnt hast, wirst du ganz von selbst auf ebener Erde sitzen wollen.»
Von neuem versuchte ich, mich in meinen Körper zu versenken und alles um mich zu vergessen. Ab und zu war Irenes sanfte und leise Stimme zu hören. Langsam und monoton sprach sie Sätze wie: «Zum Zentrum strömt beseelte Kraft», oder «Empfindung herrscht; Gedanken weichen», doch gelang es mir nicht im Geringsten, mich zu entspannen, zumal ich weiterhin den Druck in meiner Brust spürte; ja es kam mir vor, als ob sich dieser, während ich mich auf mein körperliches Inneres konzentrierte, mehr und mehr ausbreiten und bis in die äussersten Enden meiner Glieder, ja sogar darüber hinaus ausdehnen wollte.
Auch meine Gedanken konnte ich nicht beiseiteschieben; kunterbunt tanzten Bilder vor meinem inneren Auge – Mellinde mit den beiden L und den Ohrringen, Gerhardts kräftiger Rücken auf der stummen Wanderung, Professor Braggenbass und das ganze Institut, in welchem ich noch bis vor zwei Tagen herumgesessen hatte – und verhinderten jede Konzentration.
Überdies fühlte ich mich steifer und steifer werden; Schultern und Arme begannen zu schmerzen, und die Beine drohten einzuschlafen. Plötzlich spürte ich eine Hand in meinem Nacken. Ich zuckte unwillkürlich zusammen und öffnete die Augen. Als ich mich umdrehte, sah ich wieder Irene hinter mir.
Sie schüttelte den Kopf und flüsterte: «So geht das nicht. Du bist viel zu verkrampft. Dein Trapezius ist hart wie Stein.» Sie legte ihre warmen Hände auf meinen Nacken und strich mit ihren weichen, doch kräftigen Daumenballen über meine verkrampfte Muskulatur. «Besser wieder zurück auf die Matte! Leg dich auf den Rücken! – Ja so. Hände auf die Hüften. Augen wieder schliessen. Versuch es noch einmal!»
Erneut begann ich von vorn. Die Schmerzen und der Druck liessen zwar nicht nach, wurden aber allmählich dumpfer, und ich spürte mit der Zeit eine gewisse Wärme durch meinen Körper fliessen. Doch gelang es mir so wenig wie zuvor, Denken und Fühlen meinem Körper und seiner Mitte – was bedeutete das? – zuzuwenden. Rundherum war nichts zu hören, was hätte ablenken können, ausser ab und zu Irenes Stimme oder ein tieferes Atemholen von Mellinde. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie die Aufmerksamkeit bewusst nach innen zu lenken war.
Schliesslich wechselte Irenes Stimme ihren Klang, wurde kräftiger und lauter und wiederholte mehrfach: «Flut durchströmt die Glieder; Licht erweckt die Sinne.» Rundherum regte und bewegte es sich; jemand gähnte.
«Du kannst langsam die Augen öffnen, Mauritz. Spann deine Muskeln an; nicht alle auf einmal, Glied um Glied, ruhig, langsam, aber kräftig. Ja, so ist es richtig. Setz dich dann auf. Geht es?»
Ich nickte.
Irene fragte in die Runde: «Wer ist heute mit dem Wasser an der Reihe?»
Eine Frau, einige Jahre älter als Irene, mit fahlem, halblangem, strähnigem Haar, braunem Pullover, kariertem Wollrock und braunen Strümpfen stand auf und schritt in eine Ecke, wo sich über einem steinernen Becken ein Wasserhahn befand. Sie füllte eine Reihe von Trinkgefässen mit Wasser, brachte sie auf einem Tablett in unseren Kreis und reichte jedem einen der fein gerippten Zinnbecher.
Alle tranken wir ohne ein Wort zu sprechen. Stille herrschte, nur der Bursche mit der Baseballmütze – wie sein Nachbar musste er im frühen Erwachsenenalter stehen, doch wirkte er wegen seiner Kleidung und seines Gebarens wie ein Jugendlicher – trommelte mit den Fingernägeln auf den Becher.
«Nachher werden wir unsere Mittenbesinnung nochmals üben», bedeutete mir Irene. «Wenn du fertig getrunken hast, kannst du dich wieder hinlegen, Mauritz.»
Ich nickte, den Becher noch an den Lippen. Die Frau im karierten Rock sammelte die leeren Trinkgefässe wieder ein und stellte das Tablett neben das Becken zurück. Auch beim zweiten Üben schossen mir wild und wirr Gedanken durch den Kopf, die ich weder wegschieben noch fassen konnte, und verhinderten jede bewusste Entspannung. Doch überkam mich mit einem Mal – ich hatte keinerlei Vorstellung, wie lange wir schon am Üben waren – eine derartige Müdigkeit, ja Erschöpfung, dass ich wohl eingeschlafen wäre, wenn uns Irene nicht mit der gleichen Formel «Flut durchströmt die Glieder; Licht erweckt die Sinne» zurückgerufen hätte. Zwar fühlte ich mich benommen, doch war wenigstens der Druck in meinem Körper halbwegs gewichen, und auch eigentliche Schmerzen spürte ich nicht mehr. Allmählich standen alle auf, streckten sich und schüttelten Arme und Beine. Fred trat zu mir heran und forderte mich auf, ihm zu folgen, da er mir meine Kammer zeigen wolle.
«Es folgt die Zeit der einzelnen Erfahrungen und Entwicklungen oder privater Studien. Was das ist, wirst du später hören. Du kannst dich in deiner Kammer einrichten oder einfach ausruhen; du hast genügend Zeit für dich. Und zum Abendessen wirst du rechtzeitig gerufen.»
Während wir die Treppe hochstiegen, wies er mit der Hand auf die verschieden langen, silbernen Röhren, die von der Decke des obersten Stockwerks hingen und sagte: «Zu allen gemeinschaftlichen Tätigkeiten rufen wir uns mit den Klängen, den Klängen der Zeit, wie wir sie nennen. Bald wirst du auch darüber mehr erfahren.»
Im zweiten Stock angelangt, folgten wir dem Flur bis an sein Ende, wo Fred zur Linken eine Tür öffnete und mich in ein freundliches, von halb geschlossenen Fensterläden beschattetes Zimmer eintreten liess. Rechts befand sich ein Bett mit einem kleingemusterten Überwurf, daneben ein Nachttischchen mit Lampe, auf der linken Seite ein Waschbecken und eine breite Kommode mit altmodischem Marmoraufsatz. Seitlich vor dem geöffneten Fenster standen Tisch und Stuhl, etwas davor ein gepolsterter Sessel, neben dem meine Tasche lag.
«Deine private Kammer. Mach es dir bequem», hörte ich Fred hinter mir, «das heisst, beinahe hätte ich es vergessen: Vorn links am Ende des Flurs kannst du duschen, wann immer du willst; es sind mehrere Duschen da und auch immer frische Tücher. Soll ich sie dir zeigen?»
Ich schüttelte den Kopf: «Nicht nötig; ich werde sie sicherlich finden.»
«Dann lass ich dich nun allein. Gute Ruhe!» Damit verliess er mich.
Endlich konnte ich eine Zigarette rauchen. Ich kramte in meiner Reisetasche nach Packung und Feuerzeug. Als ich nirgends, weder in der Kommode noch in den Nachttisch Schubladen einen Aschenbecher fand, warf ich die Schachtel wieder in die Tasche und entschloss mich, erst einmal zu duschen.
Die geräumigen Duschen waren blitzblank und trocken; mehrere unterschiedlich duftende Seifen lagen in Schalen bereit. Ein Schrank enthielt etliche Stapel von vorgewärmten weissen Frotteetüchern und frischen, zusammengefalteten, ebenfalls gewärmten Bademänteln. Nach ausgiebigem Duschen zog ich mir einen der weichen Mäntel an und huschte eilig in meine Kammer zurück, um mir am Fenster eine Zigarette anzuzünden.
Da die Läden halb geschlossen waren, hatte die frische und reine Luft in der Kammer eine angenehm laue Temperatur. Wiesen und Weiden vor dem Haus waren hell beschienen, doch im steilen Hang auf der anderen Talseite leuchteten nur noch die Spitzen der Tannen aus dem dunklen Wald hervor, und auch die Schlucht hinten im Tal lag beinahe vollständig im spätnachmittäglichen Schatten. Einige Kühe waren am Grasen und trotteten dabei langsam talwärts dem einzigen Bauernhof entgegen, der rechts unten gerade noch zu sehen war. Neben dessen Scheune bewegten sich weisse Flecken, die ich erst mit der Zeit als herumkletternde Ziegen ausmachen konnte.
Den Zigarettenstummel löschte ich unter dem Wasserhahn, wusste jedoch nicht, wohin damit – ihn einfach aus dem Fenster zu werfen traute ich mich nicht, obwohl draussen niemand zu sehen war – und stellte ihn schliesslich auf den Rand des Waschbeckens. Immer noch in den Bademantel gehüllt legte ich mich aufs Bett und blickte zur Decke, die durch feine Holzleisten in quadratische Felder eingeteilt war, um nachzudenken, worauf ich mich eingelassen hatte und wie meine Therapie in diesem Haus zur Quell wohl aussehen würde. Bestand sie lediglich aus den Übungen, die ich gerade mitgemacht hatte? Kam noch anderes dazu? Was waren das für Leute, die ausser mir zur Behandlung da waren? Welches waren überhaupt die Therapeuten und welches die ...? Die anderen. Ich wusste nicht, wie ich die anderen, zu denen ich nun auch gehörte, nennen sollte. Patienten? Klienten? Gäste? Und wie würden die Therapeuten meine Probleme beurteilen? Welches waren überhaupt meine Probleme?
Ich musste nach kurzer Zeit eingedöst sein und träumte von einer Frau auf dunkler nächtlicher Strasse, das Gesicht vom Neonlicht der Nachtlokalschilder links und rechts fahl beschienen, mit roten Lippen, roten Haaren und einem neugierig fragenden Blick. Sie hielt die ganze Welt und mich und alle Menschen rundherum für wunderbar, und trotzdem floh ich sie und versuchte, mich in irgendwelchen Hinterhöfen vor ihr zu verbergen, was aber nichts half, denn in jedem der unzähligen Verstecke stöberte sie mich nach kurzer Zeit wieder auf.
NACH DEM allmählichen Erwachen blieb ich eine Weile mit geschlossenen Augen liegen und atmete behaglich die frische Bergluft, die durchs Fenster hereinwehte, als ich plötzlich ein leises Geräusch, ein Rascheln oder Reiben von Stoff, vernahm. Ich riss die Augen auf und erblickte Gesicht und Oberkörper eines Mannes, desselben, der mich unten in der Säulenhalle schon gemustert hatte. Ich schoss auf.
Er sass mir schräg gegenüber im Polsterstuhl, entspannt nach hinten gelehnt, die Beine übereinander geschlagen, und beobachtete mich aus seinen dunklen Augenhöhlen in aller Ruhe und mit beherrschtem, gelassenem Gesichtsausdruck. Er mochte Mitte dreissig sein. Sein Haar war dunkel – nur die Schläfen zeigten ein erstes Grau – und kontrastierte zum bleichen Gesicht mit den strengen Zügen. Seine Hände ruhten gefaltet auf den Oberschenkeln; die Füsse steckten in eleganten, braunen Lederschuhen mit geflochtener Spitze.
Als er meinen erschrockenen Blick sah, verzog er die schmalen, leicht geschwungenen Lippen zu einem Lächeln und meinte: «Offenbar kannst du dich doch entspannen. Ein erster Erfolg! Leg dich ruhig wieder hin.»
Es folgte eine Pause, worauf er hinzufügte: «Wir haben uns heute Nachmittag schon gesehen. Ich bin Waldo, du erinnerst dich? Ich werde hier im Hause dein persönlicher Begleiter sein, der Begleiter deiner Entwicklung. Unsere Arbeit hier - eine anstrengende Arbeit, mach dich darauf gefasst! – hat einen gemeinschaftlichen Teil. Du hast ihn ja bereits beschnuppert.»
Ich hatte mich wieder hingelegt und nickte.
«Zudem aber hat sie auch einen persönlichen, individuellen, privaten Teil, dem wir beide, du und ich, uns gemeinsam widmen werden.» Waldo machte wieder eine Pause, so als wollte er sicher gehen, dass ich jeden Satz und jedes Detail genau im Kopf behielt, dann fuhr er fort: «Vermutlich dachtest du an Therapie, Psychotherapie oder Ähnliches, als du dich bei uns angemeldet hast. Ganz falsch ist das nicht, jedoch höchst ungenau, und darum benutzen wir solche Bezeichnungen auch nicht. Heutzutage wird bereits simpelstes Schmieren mit Farbe oder Peddigrohrbasteln als Therapie angepriesen, und Heerscharen von Besserwissern nennen sich Therapeut und meinen, die Mitmenschen mit ihren tiefsinnigen Banalitäten segnen zu müssen.»
Waldo hatte sich abgewandt und schaute schweigend zum Fenster. Unwillkürlich drehte auch ich meinen Kopf. In der Kammer herrschte gedämpftes Licht, während es draussen immer noch hell war; doch hatte der schmale Streifen des Himmels, der zwischen den Läden sichtbar war, inzwischen eine blass-grünlichblaue Farbe angenommen.
«Erfahrung ist der Begriff, von dem ich ausgehen will, um dir zu erklären, was wir hier tun – und was du hier tust. Erfahrung und Entwicklung. Wir erspüren, was in uns, in unseren Tiefen vorgeht, und suchen nach den Spuren unserer Entwicklung. Auf dieser Spurensuche erfahren wir, dass sich der Entfaltung unserer Persönlichkeit, unseres Individuums, Hindernisse in den Weg gestellt haben. Oft sind es eigentliche Verletzungen, welche als nie verheilte Wunden ein ganzes Leben lang den Menschen quälen. Er krankt an seinen im Verborgenen schwärenden Wunden; er blutet, ohne es zu wissen, wird kraftlos, ziellos, hoffnungslos. Statt dass sich seine Seele gemäss ihrer natürlichen Anlage entfaltet, verharrt sie gelähmt im Stand der Unreife und droht, schon als Knospe zu verwelken. Darauf richtet sich unsere Arbeit: Wir haben diese Wunden zu suchen, zu pflegen, zu heilen und die behinderte Entwicklung nachzuholen.»
Waldo kehrte sich wieder mir zu und blickte mich mit seinen graublauen Augen an.
«Unser Haus zur Quell ist der Ort, der entscheidende Ort – warum das so ist, wirst du später erfahren -, der diese Entwicklung, oder Neu-Entwicklung, diese Wandlung aus einem Zustand der verletzten Unreife erst ermöglicht. Wichtig dabei ist: Du, du selbst erfährst und entwickelst dich. Wir können dir diese Arbeit nicht abnehmen; wir sind lediglich Führer und Gefährten auf deinem Weg. Auch wir – die Begleiter – mussten solche Entwicklungen durchschreiten, die einmal schmerzlich und bedrohlich, ein andermal befreiend und beflügelnd sind. So nennen wir uns nicht Therapeuten, schon gar nicht Psychotherapeuten; nein, wir nennen uns Begleiter oder Leiter, manchmal auch ganz einfach Fortgeschrittene, weil wir bereits ein längeres Stück des Weges hinter uns gebracht haben. Um es noch deutlicher zu machen: Wir gehören nicht zum Heer der Seelenbearbeiter und Psychotechniker. Wir haben in unserer eigenen, langen und mühsamen Entwicklung die Erkenntnisse gewonnen, wie anderen Menschen, den uns Nachschreitenden, zu ihrem eigenen Weg verholfen werden kann.»
Waldo musste einen Fleck auf einem seiner Schuhe entdeckt haben, denn er runzelte plötzlich die Stirn und rieb energisch mit dem Daumenhallen über das weiche Leder. Als er aufstand, wurde seine hagere Gestalt von dem Streifen Sonnenlicht beschienen, welcher zwischen den Fensterläden in die Kammer drang.
«Wir werden uns oft – und regelmässig – begegnen. Du wirst deinen Weg, deinen eigenen Weg beschreiten, wie jeder von uns. Meine Aufgabe ist es, Erstarrungen zu lösen, Festgefahrenes in Bewegung zu setzen. Und dafür zu sorgen, dass du dabei nicht in die Irre gehst.»
Er trat ans Fenster. Der Himmel war noch grüner geworden; ein leises Rauschen aus den Ästen vor dem Fenster durchbrach die Stille. Waldos scharf geschnittenes Profil mit den schmalen Lippen, dem vorgereckten Kinn und dem vorstehenden Adamsapfel leuchtete im rötlichen Licht des zur Neige gehenden Tages.
«Das genügt. Zu gegebener Zeit werde ich dich rufen.» Er drehte sich um und bewegte sich zur Tür. Beim Lavabo stutzte er für einen Augenblick. Dann verliess er die Kammer mit einem freundlichen Nicken.
Ich fühlte mich irgendwie ertappt, ohne genau zu wissen, wobei. Vielleicht hing es damit zusammen, dass ich mitten am Tag im Bademantel faul und untätig auf dem Bett gelegen und mich nicht um meine bevorstehende Behandlung – oder nach Waldo: um meine Entwicklung – gekümmert hatte. Um meinen Weg, um meine Arbeit. Ich hatte also etwas zu tun. Andererseits war mir ja von Fred geraten worden, mich gemütlich auszuruhen. Warum also sollte ich nicht auf dem Bett liegen?
Ich brauchte mir allerdings nichts vorzumachen: Natürlich war mir erlaubt worden, auf dem Bett zu liegen, egal ob in Kleidern, im Pyjama oder Bademantel. Natürlich durfte ich mich von der anstrengenden Wanderung und den neuen Eindrücken in diesem Hause erholen und ausruhen. Doch die Wahrheit war, dass ich dauernd, will sagen, seit Jahren nichts anderes getan hatte als herumzuliegen, ja dass sich mein ganzes bisheriges Leben in vollkommener Trägheit abgewickelt hatte und dass genau darin der Grund bestand, warum ich in dieses Therapiehaus – in dieses Haus der Entwicklung – gereist war.
Wollte ich ehrlich sein, so musste ich mir eingestehen, dass meine Brustbeschwerden, so quälend und unerträglich sie bisweilen sein mochten, nur ein Vorwand für die Anmeldung gewesen waren. Mein eigentliches Problem war nicht dieser Druck. Mein eigentliches Problem war meine jahrelange, alles umfassende Untätigkeit, meine Lethargie, meine Lähmung, mein Herumliegen. Und genau bei diesem Herumliegen, bei diesem für mich typischen Herumliegen hatte Waldo mich ertappt. «Festgefahrenes in Bewegung setzen», hatte er gesagt. Genau das war es: Ich war festgefahren, erstarrt; und das Druckgefühl war Folge dieser Erstarrung.
Hatte er das einfach so, bei der ersten Begegnung, bemerkt? Hatte er mir das angesehen und im Handumdrehen seine Schlussfolgerungen gezogen?
Waldo war Fachmann – im Inserat hatte es geheissen: «Ausschliesslich bestausgewiesene Fachkräfte führen das Haus.» -, und so musste es ihm ein Leichtes gewesen sein, in mich hineinzusehen, ohne lange nach meinen Beschwerden oder nach dem Grund meines Kommens zu fragen. Darüber hinaus glaubte ich im Nachhinein, in seinem Gesicht beim Verlassen der Kammer nicht nur ein freundliches Lächeln, sondern auch ein kritisches Hochheben der Augenbrauen gesehen zu haben.
Waldo hatte sich nicht Psychotherapeut nennen wollen. Was war er dann? Welches war seine Fachausbildung? Arzt? Psychologe? Psychiater? Im Inserat war von interdisziplinärem Zusammenwirken der Fachleute die Rede gewesen. Im Grunde war es mir egal. Ich wusste ohnehin nicht, worin diese Ausbildungen im Einzelnen bestehen. Immerhin: Waldos Worte von der Entwicklung, die es in Gang zu setzen gilt, beruhigten mich. Mochte es auch peinlich sein, von ihm so überrascht zu werden, so zeigten mir seine Ausführungen zweifellos, dass man von Grund auf an die Sache heranging und sich nicht mit irgendeiner Schmalspur-Behandlung begnügte.
Mit meiner Wahl schien ich es allem Anschein nach gut getroffen zu haben, – obwohl von einer Wahl kaum die Rede sein konnte; ich hatte ja nur dieses eine Inserat aufbewahrt und insgeheim die längste Zeit gewusst, dass ich etwas unternehmen musste. Etwas Radikales. Weg! Fort! Weg aus diesen immer gleichen Wänden, aus diesen immer gleichen Tagen, weg aus dem unerträglich gewordenen Trott. Und weg aus diesem Universitätsinstitut, bei dessen Bohnerwachsgeruch mir täglich übel wurde. Weg von dieser dummen Kuh von Sekretärin mit ihrem Madonnenlächeln – und weg von Braggenbass, dem ich meine ganze Kraft geopfert hatte. Weg! Irgendwohin! An einen Ort, der in nichts meiner kleinen, engen Welt gleichen würde.
Und doch waren Wochen und Monate vergangen, bis mich der bedrohliche, die Atmung einschnürende Druck in der Brust, der, wer weiss, eines Tages zu Erstickungsanfällen hätte führen können, schliesslich gezwungen hatte, die angegebene Telefonnummer einzustellen. Man müsse mich noch für einige Zeit vertrösten, war die Auskunft gewesen, da die Plätze beschränkt seien, würde sich aber so bald als möglich melden. Aufkeimende Bedenken, ich hätte mich zu rasch abwimmeln lassen, verflogen, als der Termin, auf den ich schliesslich eingeladen wurde, just mit dem Beginn der Semesterferien an der Universität und einer längeren Abwesenheit von Braggenbass zusammenfiel.
Noch immer lag ich auf dem Bett. Die Luft in der Kammer wurde kühler, doch wollte ich nicht unter die Decke kriechen, sondern möglichst lange diese Reglosigkeit und Ruhe geniessen, und obwohl mich eben noch ein Gefühl der Peinlichkeit geplagt hatte, lösten die Erinnerungen an meinen Entschluss eine Art Stolz aus, Stolz auf den Mut, meine stickige Wohnung und den Braggenbass-Mief hinter mir gelassen zu haben.
Ich hätte noch lange so liegen mögen, doch meldete sich plötzlich der eigenartige Gong, die Klänge der Zeit, wie Fred sie genannt hatte. Auch diesmal war es eine einfache Folge harmonischer Töne, die in meiner Kammer gut hörbar waren: sicherlich die Aufforderung zum Abendessen. Eilends zog ich frische Sachen aus meiner Tasche, derweil es an der Tür klopfte und Fred den Kopf hereinstreckte.
«Keine Hast! Lass dir Zeit!», sagte er munter, als er in die Kammer trat und einige Schritte hin und her ging. «Übrigens: Im Hause soll nicht geraucht werden», fügte er hinzu, als er den Zigarettenstummel entdeckte, «das Haus dient der Gesundheit. Unserer Gesundheit. Wer es nicht lassen kann, der soll draussen seinen Lüsten frönen.»
Erneut fühlte ich mich ertappt, errötete und vermochte nur zu nicken.
DIE GOLDENE Abendsonne und ein roter Himmel strahlten in den festlich glänzenden Speisesaal, dessen Leuchter über dem Tisch brannten und sich in den Porzellantellern mit den barock geschwungenen Rändern und dem Silberbesteck spiegelten. Bei der Anrichte stand Frau Gmünter mit der linnenen, makellos weissen Schürze über ihrem dunklen Kleid und hantierte an den verschiedenen Platten und Krügen.
Fred geleitete mich zum Tisch und verliess den Raum sogleich wieder. Alle grössten, und Mellinde, die eine blaue Bluse und einen blasslila Schal trug, winkte mich zu sich heran und bot mir den freien Platz an ihrer rechten Seite an.
«Willkommen zu unserer ersten gemeinsamen Mahlzeit! Hast du gut geruht? Oder bist gar deinen Studien nachgegangen? Ach nein, so weit bist du noch nicht. Bist ja zum ersten Mal hier, stimmt's?»
Ich nickte.
«Dann wird dir einiges ungewöhnlich vorkommen. Gewiss das Allerungewöhnlichste ist die Art, wie für Zunge und Gaumen gesorgt wird, – und die gute Seele, die dahinter steht», damit drehte sich Mellinde zur Anrichte um, «nämlich Frau Gmünter. Ihr verdanken wir diese Pracht und ebenso eine Speisekarte, die uns täglich überrascht. Mach dich darauf gefasst, dass du in diesem Hause verwöhnt wirst wie noch nie in deinem Leben.»
Frau Gmünter, die nun mit einer weissen Serviette über dem linken Unterarm vor dem Buffet wartete, grüsste mit einem Kopfnicken.
In diesem Moment war von draussen ein Rumoren zu hören, worauf Mellinde bemerkte: «Endlich! Pascal und Wili. Wie üblich die Letzten.» Pascal trug einen kleinen Kopfhörer unter seiner Schirmmütze, den er sorgfältig hervorzog und neben das Gedeck legte, während er sich umständlich setzte. Wili folgte ihm und zwinkerte erst Mellinde, dann mir zu und erhob sich nochmals halbwegs, um Frau Gmünter zu winken und mit einem Blick die Anrichte zu überfliegen.
Frau Gmünter servierte als Erstes eine Bouillon, in der feine Omelettenstreifchen schwammen. Die Suppe war kräftig; alle löffelten sie mit grossem Appetit und ohne ein Wort zu wechseln. Einige liessen sich eine zweite Portion servieren, bevor der würzig duftende, mit Käse überbackene Gemüseauflauf aufgetischt wurde.
«Most dazu?», fragte Mellinde.
Frau Gmünter trat an meine Seite und fragte: «Süesse ode ghürotne?»
«Im <Ghürotne>», erklärte Mellinde, «vermählt sich süsser Most mit saurem Obstwein. Probier ihn; er ist himmlisch. Und verdirbt weder Magen noch Leber.»
Frau Gmünter goss ein; alle stiessen mit ihren Gläsern an, und mit einem kräftigen «Prost!» wurde ich nochmals herzlich willkommen geheissen. Dem Gemüseauflauf folgte frischer Apfelkuchen, wahlweise mit warmer Vanillecreme oder Schlagsahne; dazu wurden verschiedene Sorten von Tee serviert.
«Die Kräuter werden selbstverständlich alle hier oben gezogen», betonte Mellinde, «hoffentlich hast du keinen Kaffee erwartet; der ist im Hause verpönt. Er verhindere die geistige Gelassenheit, behauptet Waldo. Du kennst ihn schon, Waldo – und auch Fred?»
Ich nickte.
«Einer von ihnen wird dein Leiter, dein persönlicher Begleiter sein. Waldo, wie ich annehme. Hat er schon mit dir gesprochen?»
«Ja.»
«Aha. Wie du siehst, ist heute Abend keiner der Leiter unter uns; darum ist der Platz oben am Tisch nicht besetzt. Die Leiter sind um diese Zeit meist unter sich und essen getrennt von uns. Dabei besprechen sie den Ablauf des Tages und der Arbeit. Und beschäftigen sich mit ihrem eigenen Weg. Hin und wieder kommt es vor, dass jemand von ihnen bei uns am Tisch sitzt, Irene, Waldo oder Fred, oder, selten, wunderselten Gerhardt. Er mag keine Tischgespräche.»
Ich erhoffte mir, Genaueres über den Gang der Behandlung im Haus zu erfahren; dabei passierte mir das Missgeschick, von Therapie zu sprechen.
«Das kann man nicht allgemein sagen, sondern hängt ganz von der einzelnen Person ab. Und von dem Ort, an dem sie sich in ihrer Entwicklung befindet», antwortete Hildegard, die bleiche Frau im braunen Pullover, die am Nachmittag das Wasser in den Zinnbechern gereicht hatte, «und natürlich von der Zeit, die sie durchschreitet. Therapie ist allerdings nicht der richtige Begriff. Wir hier arbeiten aktiv; wir bewegen uns. Wir leben unsere tätige Wandlung!»
Pascal hatte sich unterdessen das dritte Stück Apfeltorte servieren lassen und einen Berg Schlagsahne darüber geschichtet.
«Jawohl, Hildegard! Bewegen und beleben, wandeln und handeln, das ist unser Ziel; das ist die Welt, die wir suchen und Kuchen; das ist’s, was wir tun und ruhn und Huhn», bekräftigte er und balancierte längere Zeit ein grosses Stück Kuchen auf seiner Gabel, bevor er es mit einer würdevollen Bewegung in den Mund schob.
«Spar dir deine Kunststücke für draussen», wies ihn Mellinde lachend zurecht, «und führ sie morgen Mauritz vor.»
Mir zugewandt meinte sie: «Wili und Pascal sind nämlich Artisten, sozusagen unsere Hausartisten. Du wirst staunen.»
Pascal zwinkerte zu mir herüber. «Wie-gende, wä-gende, wa-gende, wo-gende, bewe-gende, erle-bende Erregung. Sozusagen», skandierte er, schwieg unvermittelt und starrte die längste Zeit an die Decke.
Als das Abendessen seinem Ende entgegenging, spürte ich in mir das Verlangen nach einer Zigarette. Ich hatte seit Jahren nicht mehr so wenig geraucht wie an diesem Tag; nun aber wurde der Drang derart gross, dass ich mich nach einem Aschenbecher umsah, doch kam mir rechtzeitig das von Fred erwähnte Rauchverbot in den Sinn. Ungeduldig wartete ich auf die erstbeste Gelegenheit, mich möglichst unauffällig vom Stuhl erheben und hinausgehen zu können. Das gelang mir, als Frau Gmünter die leeren Teller wegräumte. Alle erhoben sich; die meisten wechselten mit ihren Tassen in einen grosszügigen Raum, der durch zwei Schiebetüren mit geschliffenen Glasscheiben vom Speisesaal abgetrennt war und in dem breite Sessel standen.
Ich eilte in meine Kammer hinauf, um meine Zigaretten zu holen. Sie lagen auf dem Tisch, doch konnte ich das Feuerzeug trotz gründlichen Suchens nicht mehr finden. Verärgert steckte ich die angebrochene Schachtel in die Tasche und begab mich wieder nach unten, scheute mich jedoch, bei den anderen nach Streichhölzern zu fragen und dadurch meine Schwäche preiszugeben; es war anzunehmen, dass an diesem Ort der umfassenden Gesundheitspflege niemand rauchte.
So verliess ich das Haus, schritt die Steintreppe hinunter und blieb unschlüssig auf dem Kiesplatz stehen. Ein vollkommen klarer, ultramariner Himmel wölbte sich über den dumpfgrünen Matten; nur im Nordwesten, wo das letzte Abendrot verglüht war, leuchtete er noch türkisfarben. Rundherum säumten schwarzbewaldete Hänge das Tal.
Ich konnte mich nicht erinnern, je einen derart klaren und reinen Himmel gesehen zu haben. Eine undurchschaubare, schweigende, fremde Natur, reglos und zeitlos, umfing mich mit diesem Einnachten, eine Natur, der ich mich in meinem bisherigen Leben entzogen hatte, die nun aber ungehindert auf mich wirkte. In diesen Himmel blickend wurde mir klar, dass ich mich nicht nur in die Obhut der Leiter und dieses Hauses begeben, sondern mich auch unmittelbar der Natur gestellt hatte und auch ihre Macht zu spüren bekommen würde. Ich war nicht mehr Herrscher und gleichermassen Gefangener einer engen, kontrollierbaren, städtischen Kleinwohnung, sondern ein Schatten, so bedeutungsvoll und bedeutungslos wie alle anderen Schatten im unendlichen Raum. Mit einem Ruck wandte ich mich um und schritt langsam über den Platz. Erst das harte Knirschen des Kieses unter meinen Füssen erlöste mich von dieser in ihrer Grenzenlosigkeit bedrohlichen Vorstellung.
Noch immer hatte ich kein Feuer. Ich näherte mich der Remise, trat zwischen die hier deponierten Maschinen, wo es nach Metall, geschnittenem Gras und Öl roch, und stiess unversehens mit dem Knie an einen Eisenträger, den ich in der Dunkelheit nicht gesehen hatte. Fluchend und mich über meine Unbeholfenheit ärgernd, zog ich mich zurück und hinkte einige Schritte weiter in Richtung eines schmalen, in der Dämmerung kaum sichtbaren Pfads, der das Tal hinaufführte.
Ich hielt inne, drehte mich um – und erblickte an der Wand des Schuppens einen roten Lichtpunkt. Kein Geräusch war zu hören, doch hinter dem glühenden Punkt erkannte ich einen konturlosen, schwach leuchtenden Fleck, – ohne Zweifel ein Gesicht. Jemand musste am Boden sitzen. Und rauchen.
«Setz dich zu mir!», hörte ich eine zarte, doch leicht heisere weibliche Stimme.
Beim Nähertreten sah ich eine dunkel gekleidete Gestalt. Sie hockte auf einem breiten, runden Scheit und lehnte mit dem Rücken an die Holzwand der Remise. Es war die bleiche, hagere, mädchenhaft wirkende Frau, die mir schräg gegenüber wortlos am Tisch gesessen war und als einzige mehr in ihrem Teller herumgestochert als wirklich gegessen hatte.
Ich liess mich neben sie nieder und zog meine Schachtel aus der Tasche. Bevor ich nach Feuer fragen konnte, hielt sie mir ihre brennende Zigarette hin. Wir rauchten und schwiegen. Immer mehr Sterne begannen zu funkeln, während rund um uns die Landschaft unterschiedslos in schwarzem Schatten lag. Einzig die Glut unserer Zigaretten war zu sehen, und die Beine von Julietta – so hiess sie, wie mir plötzlich wieder einfiel -, die in roten Strümpfen steckten und vage mitglommen.
II
AM NÄCHSTEN Morgen erwachte ich zeitig. Der Tag war schon angebrochen. Ich lauschte dem Rauschen des Bachs und dem fernen Bimmeln von Kuhglocken, bis die warmen Klänge der Metallröhren ertönten und ich kurz danach ein Klopfen an der Tür vernahm. Fred schaute herein und machte mich darauf aufmerksam, dass ich ohne Hast aufstehen und mich draussen auf dem Platz vor dem Haus einfinden solle. Er erkundigte sich, ob ich daran gedacht hätte, wie in der Einladung erwähnt, bequeme Sportkleidung und geeignete Turnschuhe einzupacken. Schon war er wieder verschwunden.
Während ich mich frisch machte, wiederholte sich von Zeit zu Zeit die beschwingend nach oben strebende Klangfolge des Glockenspiels. Ich zog das Paar Sportschuhe, welches ich vor wenigen Tagen gekauft hatte, aus meiner Tasche. Schon bei ihrem Kauf hatte ich mit bangem Gefühl an die Stunde gedacht, in der ich diese brandneuen, dick besohlten, grell gelb-weissschwarzen Sportschuhe – unauffälligere waren trotz ausgiebigen Suchens nicht aufzutreiben gewesen – würde anziehen müssen. Wenigstens war die baumwollene Trainingsbekleidung, die ich ebenfalls zum ersten Mal trug – ich hatte noch nie in meinem Leben freiwillig Sport betrieben – in dezentem Grau gehalten und lediglich auf der Brust mit einem kleinen grünen Tennisschläger bestickt.
Draussen auf dem Flur konnte ich es mir nicht verkneifen, durch das Fenster einen raschen Blick auf den Platz hinunter zu werfen, um zu erkunden, wie die anderen gekleidet waren und ob ich mit meinem Dress aus der Reihe tanzen würde. Meine Befürchtungen erwiesen sich allerdings als völlig unnötig; alle steckten in irgendwelchen mehr oder weniger bunten Trainings- oder Sportanzügen, nur Irene, die uns offenbar wieder anleitete, trug eine schlichte Baumwollbluse und weite Physiotherapiehosen in hellbeiger Farbe.
Unten in der Diele traf ich Gerhardt, der eben einen Schlägel mit langem Griff und grossem rundem Kopf hinter die Klangröhren stellte. Ich folgte ihm auf den Platz hinaus, wurde aber nochmals ins Haus zurückgeschickt, um mir einen geeigneten Bergstock zu holen, von denen eine ganze Anzahl in einem alten Butterfass neben der Eingangstür steckte. Es waren kräftige Stöcke unterschiedlicher Länge aus hellem Holz in der Art desjenigen, den Gerhardt am Vortag mit sich geführt hatte. Unten liefen sie in eine Stahlspitze aus, während oben ein Metallgriff in Form eines kurzen Pickels von kaum mehr als Handlänge und eine breite Schlaufe aus kräftigem Leder befestigt waren. Erst später erfuhr ich, dass Gerhardt das Modell selbst entworfen hatte und die Stöcke von einer Werkstätte eigens für das Haus fertigen liess.
Es war ein wunderschöner Morgen; reine und frische, doch keineswegs kalte Luft wehte vom Hang herab. Die Sonne schien direkt auf den Kiesplatz und die gelben Backsteinwände der Halle, und selbst die verwitterten Schindeln des Hauses leuchteten.
Frühbewegung wurde diese spezielle Gymnastik genannt, die vor allem im Beugen, Dehnen und Strecken des ganzen Körpers, im Kreisen von Armen und Beinen, in kräftigendem Wippen und Kniebeugen bestand und immer wieder von Lockerungen der Glieder unterbrochen wurde. Ab und zu, vor allem bei den langsamen Rotations- und Neigebewegungen, wurde der Stock zu Hilfe genommen; er diente auch beim Balancieren und Hüpfen auf einem Bein oder beim Üben des Gleichgewichts. Den Abschluss bildeten einige Übungen zu zweit, bei denen zum Beispiel der Stock waagrecht gehalten wurde, während der Partner oder die Partnerin mit voller Kraft vorwärts stossen oder seitlich oder rückwärts ziehen musste.
«Gar nicht schlecht!», meinte Irene am Ende, als wir dem Haus zustrebten. «Du hast dich gut gehalten. Das Frühstück hast du dir jedenfalls verdient.»
Im Speisesaal erwartete uns wiederum ein reich gedeckter Tisch, diesmal mit Milch, Schokolade, Tee, verschiedenen, frisch duftenden Brötchen, kleinen Butterröllchen, die in Eiswasser schwammen, Honig, Marmeladen in Porzellanschalen und etlichen Käsesorten. Alles war lecker und sauber angerichtet; kein schlappes, vorgeschnittenes Brot, keine pasteurisierten Käsescheiben in Plastikverpackung, wie ich es seit Jahren gewohnt war.
Die Leiter assen mit uns; Fred zwinkerte mir wohlwollend zu. Ihm schien das Frühstück ausgesprochen zu munden; er hatte die verschiedensten Konfitürenschüsselchen um seinen Teller versammelt und roch erst ausgiebig an jedem, bevor er sich schöpfte. Immer wieder lehnte er sich genüsslich zurück, die Teetasse in der Hand, und plauderte angeregt in alle Richtungen. Gegen den Schluss des Frühstücks tippte er auf meinen Unterarm und bedeutete mir, nach dem Essen für einen Moment zu ihm zu kommen; wo er zu finden sei, wisse ich ja. Ich solle mich auf keinen Fall beeilen – es sei wirklich genügend Zeit vorhanden.
«Kein Anlass, sie zu kontrollieren», bemerkte er schmunzelnd beim Aufstehen.
Als ich ihn kurz danach in seinem Raum aufsuchte und wieder in den Ledersessel gewiesen wurde, erklärte er: «Du trägst immer noch deine Armbanduhr. Keine Sorge; die normalste Sache auf der Welt. Leider.» Er hatte seinen Körper nach vorn geneigt und mit den Ellbogen auf den grossen Schreibtisch gestützt; den rechten Zeigefinger liess er um die einzelnen Blättchen des Bonsais kreisen.
Mir war nicht klar, worauf er hinauswollte, und ich schaute ihn fragend an.
«Wir im Haus zur Quell, wir haben uns Zeit genommen. Und über die Zeit nachgedacht. Zeit ist Lauf und Ablauf der Existenz, ist Grundbedingung des Lebens. Zeit will gelebt und erlebt werden. Wie aber wird in aller Welt gemeinhin mit der Zeit verfahren? Sie wird gepackt und vom Leben getrennt; sie wird zur Sache, zum Objekt, wird millionenfach gemessen und gestückelt. Warum? Ganz einfach: um sie zu beherrschen. Denn mit dem Messen und Beherrschen der Zeit werden auch die Menschen, wird das Leben schlechthin beherrscht, werden Arbeit und Freizeit und Essen und Schlafen und Sex und alles andere eingeteilt – und verfügbar gemacht. Hast du einmal nachgezählt, wie oft du jeden Tag auf die Uhr schaust?»
Ich schüttelte den Kopf. Tagsüber unzählige Male; abends nie.
«Bei uns ist die Zeit keine Ware. Wir messen sie nicht und bestimmen keinen Preis dafür. Unsere Zeit teilt nicht ein, sondern verbindet. Ausdruck dafür sind die Klänge der Röhrenglocken im Treppenhaus. Es sind keine geistlosen Taktgeber, die uns durch den Tag hetzen, sondern harmonische Klänge der Zeit, welche die Intervalle unseres Lebens, unserer Arbeit, unserer Einkehr und Besinnung anzeigen und uns darin vereinen.»
Die Einrichtung überzeugte mich. Ich hasste Uhren seit jeher, und Elouise kam mir in den Sinn – nur Braggenbass, der Chef, nannte sie so, ich hatte ihr Frau Plummer zu sagen -, Sekretärin und Wachhund im Institut, die jeweils penetrant beiläufig auf die Uhr schaute, wenn ich mich morgens hastig an ihr vorbeidrückte, um zu meinem Tisch hinten im Archiv zu gelangen, wo man mich vor Jahren einquartiert hatte.