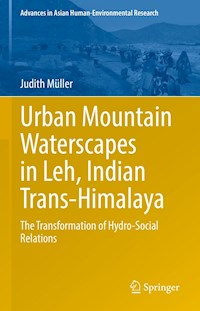15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vindobona Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Meine zweite Brustkrebsdiagnose hat mich schlagartig wachgerüttelt! Wohin, um die wahre Seele zu sein, als die ich vor 43 Jahren geboren wurde? Ohne die Begleitung aus der geistigen Welt und ohne meinen Kraftbaum wäre es wohl nicht gelungen, aus dem Strudel aus gesellschaftlichen, anerzogenen und selbst auferlegten Mustern auszubrechen, die uns krank machen können. Und erst die unverhohlene Innenschau offenbart die Möglichkeit zur Befreiung von tiefsitzenden Glaubenssätzen. Mit dem ersten mutigen Schritt und der Hilfe des Zufalls, der nie einer ist, beginnt eine spannende Reise zum Mittelpunkt der Seele, die den alten Ballast schonungslos zutage fördert. Ein nicht immer leichter, aber unglaublich befreiender Weg zum eigenen Selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 Vindobona Verlag
in der novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-903579-40-8
ISBN e-book: 978-3-903579-77-4
Lektorat: naku
Umschlagfotos: Judith Müller, Camerapassion | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: Vindobona Verlag
www.vindobonaverlag.com
Widmung
Für die Liebe meines Lebens und die drei wundervollen Seelen, die mich als ihre Mama gewählt haben
Zurück auf meinem Weg
Es ist Sonntag, der 18. Februar 2024, als ich mich hinsetze und beginne, diesen lang gehegten Traum in Angriff zu nehmen. Irgendwann einmal ein Buch zu schreiben, dieser Gedanke begleitet mich tatsächlich seit meiner Kindheit. Was den Inhalt angeht, hätte ich mich damals wohl für witzigere und leichtere Themen entschieden, doch schreibt das Leben mit unserer Hilfe ja oft die abenteuerlichsten Geschichten.
Wo stehe ich heute an diesem grauen, eher kühlen Funkensonntagnachmittag? Und wo steht meine Seele? Sie haben richtig gelesen, auch wenn so manchem diese Frage wohl erst einmal merkwürdig erscheinen mag. Ich selbst stehe mitten im Leben: Anfang vierzig, glücklich verheiratet, drei wundervolle Kinder, ein kleines Paradies, das ich mein Zuhause nennen darf, eine Arbeit, die mich erfüllt und viel Zeit für alles andere lässt, zwei Haustiere, da fehlt fast nichts. Fast. Denn vor gut drei Monaten gab es diesen einen Moment, der so vieles veränderte. Der mich selbst veränderte – und vor allem meine Seele.
Es war Ende November des vergangenen Jahres, ein ganz normaler Wochentag – die Kinder schon außer Haus und mein Mann bereits bei der Arbeit –, als ich nur noch rasch duschen wollte, um mich dann um die Dinge zu kümmern, die ich im Kopf für diesen Tag geplant hatte. Nur schnell sollte es gehen, doch als ich mich kurz abtrocknen und anschließend anziehen wollte, blieb mir fast mein Herz stehen. Ich nahm in meiner linken Brust eine Verhärtung wahr, nein, das war unmöglich. Ich legte meine Hand noch einmal darauf und spürte, es war real. Es war wieder real. Und es zog mir fast den Boden unter den Füßen weg. Pure Angst stieg in mir auf, denn genau dasselbe hatte ich schon einmal erlebt, vor siebzehn Jahren, in der anderen Brust. Die Bilder von damals bahnten sich ihren Weg in meinen Kopf, kurz vor Weihnachten des Jahres 2006 hatte mir meine damalige Frauenärztin die Diagnose gestellt: Brustkrebs. Da ich zu der Zeit auch noch mit meinem ersten Kind schwanger war, wurde ich sofort in die Klinik nach Innsbruck überwiesen. Drei Tage später wurde ich dort aufgenommen und bekam von den Ärzten zu hören, dass sie alles tun werden, um mir zu helfen, dass sie allerdings nicht garantieren könnten, dass mein Baby überleben wird. Es gibt keine Worte auf der Welt, die auch nur annähernd beschreiben könnten, was in diesem Moment in mir passiert ist. Wie ferngesteuert schaltete ich ab und ließ alles über mich ergehen. Zwei Tage vor Weihnachten wurde mir die Brust komplett abgenommen, zwei Wochen später dann mit der Chemotherapie begonnen und im April, einen Monat vor dem errechneten Geburtstermin, sollte mein Kind per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden, damit danach mit der stärkeren Chemotherapie und der Bestrahlung weitergemacht werden konnte. Der einzige Grund, warum ich das damals durchstehen konnte, war dieses Leben in mir, auf das ich mich konzentrierte; es gab keine andere Option für mich, als dass wir das beide überleben würden, denn ohne dieses Baby hatte ich keinen Grund mehr, zu kämpfen. So dachte ich in dieser entsetzlichen Zeit tatsächlich und das sollte mich viele Jahre später wieder einholen.
Kurz vor dem geplanten Kaiserschnitttermin sagten mir die Ärzte, dass mein Kind nach der Geburt direkt in den benachbarten Trakt der Klinik gebracht werde, da es noch einige Tage zur Beobachtung auf die Intensivstation müsse. Schließlich wisse man doch nicht genau was die Chemotherapie und die lange Operation während der Schwangerschaft ausgelöst haben könnten. Und ich wäre die ersten Tage aufgrund des Kaiserschnitts und der Chemotherapie zu schwach, um selbstständig dorthin zu kommen und es zu besuchen. Als ich an diesem Abend in meinem Krankenzimmer lag, konnte ich nicht mehr aufhören zu weinen, weil allein die Vorstellung daran, mein Baby nach der Geburt tagelang in fremden Händen, statt in meinen Armen zu wissen, mir schlicht das Herz zerriss. Ob es die Verzweiflung war oder ob es einfach tief aus meinem Inneren kam, kann ich heute nicht mehr sagen, aber ich hörte mich plötzlich selbst sprechen, in den leeren Raum hinein flüsterte ich: „Ich habe dich nie um etwas gebeten, aber jetzt brauch ich dich! Du wirst deine Gründe gehabt haben und ich kann dir verzeihen, weil es für dich in dem Moment keinen anderen Ausweg gab und du nicht anders konntest, als uns zurückzulassen, aber ich bitte dich, lass mich jetzt nicht im Stich! Hilf deinem Enkelkind und mir, das gut zu überstehen!“ Ich sprach mit meinem Vater, der sich das Leben genommen hat, als ich vier Jahre alt war. Ich sprach mit ihm und er war da. Ich spürte es an der Wärme und der Geborgenheit, die sich in diesem Augenblick im ganzen Zimmer ausbreitete. Und dann fiel ich in einen tiefen und ruhigen Schlaf wie schon lange nicht mehr.
Am Morgen wurde ich geweckt, denn ich stand als Zweite auf dem OP-Plan. Ich bekam eine Rückenmarksanästhesie, damit ich die Geburt meines Babys in wachem Zustand miterleben konnte. Und dann, um 8:37 Uhr, war sie da. Ich durfte sie kurz sehen: ein wunderschönes kleines Bündel mit ganz vielen schwarzen Haaren. Dann wurde sie in den Nebenraum zur Untersuchung gebracht, um anschließend – statt auf die Intensivstation im Nebengebäude – in ein Wärmebettchen direkt neben meinem Bett gelegt zu werden. Eine Stunde später lag sie in meinen Armen und die Ärzte konnten sich selbst nicht genau erklären, wie es ihr so gut gehen konnte. Aber es war so. Und die Erklärung behielt ich für mich.
Dieses Erlebnis brachte mich zum Nachdenken. Ich spürte in dieser Nacht etwas, das größer war als das, was wir täglich vor Augen haben, und dieses Gefühl war mir keineswegs neu. Schon in meiner Jugend hatte ich eine Zeit, in der ich Intuitionen und kleinere Erlebnisse hatte, die sich mit dem bloßen Verstand nicht erklären ließen. Ich spürte bereits damals immer wieder einmal dieses „Größere“ in meinem Leben und was das für ein vertrautes Gefühl in mir auslöste. Allerdings gab es nur wenige Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich darüber sprach, denn ich merkte schnell, dass das ein Thema war, bei dem man öfter schräg angeschaut wurde, als dass es Zustimmung fand. Für jemanden, der sich von klein auf aus dem Unterbewussten heraus lieber anpasste und das Eigene möglichst versteckte oder erst gar nichts Eigenes zuließ, um akzeptiert und geliebt zu werden, war das natürlich das Schlimmste, das passieren konnte. Und so verdrängte ich das damals gleich wieder und schnitt meine Seele regelrecht davon ab.
Doch nun war es mit der Geburt meiner ersten Tochter wieder in mein Leben zurückgekehrt. Oder war es bereits mit dieser Krankheit wieder zurückgekommen? Es dauerte eine Weile, bis ich mich mit dieser Überlegung auseinandersetzte. Als frischgebackene Mama, die außerdem in den ersten Monaten nach der Geburt noch Chemotherapie und Bestrahlung über sich ergehen lassen musste, blieb zum einen keine Zeit dafür und zum anderen passte es auch überhaupt nicht in meinen Alltag und meine damalige Strategie, die da – wie gehabt – war: anpassen, so sein, wie ich meinte, dass andere mich haben wollten, und das Eigene lieber mal zur Seite schieben. Erst als ich dann, nachdem alles überstanden war, mit einer Gesprächstherapie begann, drängte sich auch dieses Thema wieder zurück an die Oberfläche. Neben vielen Dingen, die meine Kindheit betrafen, wie alte Glaubenssätze durch den frühen Tod meines Vaters, daraus resultierende Verhaltensmuster und die Sache mit dem kaum vorhandenen Selbstwertgefühl, fing auch dieser Bereich an, mein Interesse auf sich zu ziehen. Bald spürte ich für mich ganz klar, dass es einen Zusammenhang geben musste, nämlich, dass ich meiner Seele jahrelang nicht hatte zuhören wollen und darum mein Körper schlussendlich reagierte. Ich kam für mich zu der tiefen Überzeugung, dass es an der Zeit war, etwas zu ändern, mich zu verändern, damit ich die sein konnte, die ich wirklich war, um damit gleichzeitig etwas zum Weg meiner vollständigen Heilung beizutragen. Doch wie leicht, meinen Sie, ist es für sein Umfeld und für einen selbst, etwas zu ändern, wenn man jahrelang ein Mensch war, der nie eine eigene Meinung vertreten hat, weil er wahrscheinlich nicht mal eine hatte, der sich dem Gegenüber angepasst hat, um gemocht und anerkannt zu werden und so gut wie nie eine Bitte abgelehnt hat, damit keiner schlecht über ihn denkt? In der so schon überfordernden Situation, in der ich mich befand, fast unmöglich, denn der Anfang hier musste erst einmal sein, mich selbst kennenzulernen und herauszufinden, wer ich war. Versuchen wollte ich es trotzdem, zumindest in kleinen Schritten. Doch wenn man in einem gewohnten System beginnt, etwas zu wandeln, bedeutet das auch Veränderungen für alle Beteiligten in diesem System und das kann dazu führen, dass sich plötzlich alles in so verschiedene Richtungen entwickelt, dass es keine Gemeinsamkeiten mehr gibt. So war es schließlich tatsächlich in Bezug auf meine Beziehung und obwohl mir das ziemlich schnell klar war, brauchte ich mehr als einen Anlauf, um es mir wirklich einzugestehen. Das schlechte Gewissen meiner Tochter gegenüber, jede Menge Schuldgefühle und die Frage, was andere über mich denken könnten, bremsten mich ein. Und doch machte ich schlussendlich diesen Schritt und es war seit Langem etwas, bei dem ich mich an erste Stelle setzte und mich selbst wichtig nahm, damit ich weiter den Weg zu mir selbst finden konnte.
In den folgenden Jahren baute sich für und um mich ein wundervolles Leben auf. Ich lernte meinen Mann kennen, wir bekamen noch zwei weitere Kinder, heirateten, kauften uns ein Haus und hatten auch finanziell die Möglichkeit, das Leben zu genießen. Beruflich ließ mich der innere Wunsch nicht los, von der Buchhaltung in einen sozialen Bereich zu wechseln, lange fehlte mir aber der Mut dazu – bis ich dann vor einigen Jahren in einer lokalen Zeitung eine Anzeige über den Informationsabend zum Befähigungskurs für Hospizbegleiter las. Mein erster Impuls war ein Zusammenzucken, vereinte dieser Begriff doch zwei Dinge, die mich zum einen berührten und zum anderen abschreckten. Seit einiger Zeit schon arbeitete der Begriff der Trauerbegleitung in mir, denn eine zufällig gesehene Dokumentation ließ mich nicht mehr los. Immer wieder nahm ich mir vor, das Ganze in Angriff zu nehmen, mich zu informieren, ob es das bei uns gibt und was für Ausbildungen man dafür benötigen würde. Doch Sterbe- und Krankenbegleitung? Traute ich mir das zu? Das war überhaupt inzwischen wieder – oder vielleicht auch immer noch – so eine Sache, das mit dem Selbstvertrauen, das mit dem Selbstwert. Wo war die Einstellung geblieben, dass ich wertvoll und liebenswert bin, genau so, wie ich bin, dass ich mich öffnen kann, mich zeigen darf, echt und authentisch, ohne irgendwas verstecken zu müssen? Bewusst oder unbewusst spürte ich, dass sich die letzten Jahre über wieder dieses alte Denken und Verhalten eingeschlichen hatte, dass ich mich selbst erneut von meinem ureigenen inneren Weg gedrängt und das ursprüngliche Muster der Anpassung und der fehlenden oder zumindest geringen Selbstliebe den Platz in mir eingenommen hatte.
Im Nachhinein sehe ich dafür sogar ein eindeutiges Beispiel. Gut ein Jahr zuvor, es war ein schon recht warmer Frühlingstag, bekam ich am Nachmittag plötzlich leichte Bauchschmerzen. Eigentlich wollte ich mich ein paar Stunden später mit einer Freundin treffen, sagte das dann aber kurzfristig ab, irgendwie fühlte ich mich nicht wohl. Ich dachte, ich hätte vielleicht etwas Falsches gegessen, wobei die am Abend dazugekommenen Schweißausbrüche gar nicht dazu passten. Ohne weiter darüber nachzudenken, legte ich mich ins Bett, konnte aber kein Auge zutun. Ich hatte Schmerzen, wie ich sie noch nicht kannte, wusste nicht, ob ich mich übergeben oder lieber einfach gleich sterben sollte. Damit niemand aufwachte, ging ich aus dem Zimmer, legte mich in einen anderen Raum, in dem ich vor Qual aufschrie und tatsächlich einen kurzen Augenblick darüber nachdachte, die Nummer der Rettung zu wählen. Doch wie würden sich die Kinder erschrecken, was wäre in der Nachbarschaft los? Kann man sich vorstellen, solche Gedanken gegen seine eigene Gesundheit abzuwägen? Heute sehe ich, wie dumm und gefährlich das war, doch damals war dies tatsächlich das, was in meinem Kopf vorging. Und ich sage, was ich aus tiefstem Herzen genau so empfinde: In dieser Nacht war wohl mehr als ein Schutzengel an meiner Seite, der mich am Vormittag danach dann noch zu meinem Hausarzt und anschließend ins Krankenhaus begleitete, wo mir gesagt wurde, dass mein Blinddarm bereits durchgebrochen sei und ich sofort operiert werden müsse.
Wäre dies ein Moment gewesen, sich anzuschauen, was da in mir passierte, auf welchem Weg ich mich befand? Wäre dies ein Moment gewesen, genau hinzusehen, wo meine Seele stand? Meine Antwort ist ein klares Ja. Heute würde ich sogar noch weiter gehen und es als verpasste Chance bezeichnen – die verpasste Chance, meiner Seele zuzuhören, was sie mir zu sagen hat.
Der Artikel aus der Zeitung ließ mich nicht mehr los und so bat ich um ein Gespräch, bei dem herausgefunden werden sollte, ob ich für das Ehrenamt als Hospizbegleiterin geeignet wäre. Das war ich und schon die erste Begegnung mit der zuständigen Koordinatorin bereicherte mich sehr, was sich auch durch den gesamten Kurs ziehen sollte. Die Themen, die Berührungspunkte mit sich selbst und die aus dieser Zeit neu entstandenen Freundschaften sind noch heute ein großes Geschenk für mich.
Und doch gab es auch in dieser Zeit – gut ein Jahr nach meiner Blinddarmoperation – ein Erlebnis in Bezug auf meine Gesundheit, das mich kurzzeitig aus der Bahn warf. Es waren viele Wochen vergangen, in denen ich vor dem Spiegel stand und versuchte, diesen Fleck auf meiner Stirn irgendwie zu überschminken, bevor ich endlich zum Handy griff und einen Termin bei meinem Hautarzt vereinbarte. Der brauchte gute zwei Sekunden für die Diagnose: „Das ist Krebs!“, meinte er, drehte sich um und lief wieder zu seinem Schreibtisch. Während es mir den Boden unter den Füßen wegzog und ich das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen, fuhr er ganz gelassen fort: „Es ist weißer Hautkrebs, nicht gefährlich, muss aber weg. Wir vereinbaren einen Termin für die OP in der Praxis meines Kollegen.“ Immer noch war ich wie gelähmt und doch drangen diese Worte irgendwie zu mir durch. Wie ferngesteuert verließ ich die Praxis, setzte mich ins Auto und konnte nur noch weinen. Pure Panik überfiel mich, dieses Wort hatte mich komplett umgehauen. Für einen kleinen Moment wurde mir bewusst, was da noch alles in mir sein musste, dass so etwas möglich war. Was da noch alles verdrängt in mir schlummern musste, dass mich allein dieses Wort so in Panik versetzen konnte. Es war ein kleiner Moment, der wieder verstrich – ein kleiner Moment, der vielleicht auch eine Chance hätte sein können.
Nachdem ich den Kurs für Hospizbegleiter abgeschlossen hatte und in dieses Ehrenamt eintauchte, war es, wie wenn ein stillgelegtes Feuer in mir entfacht würde. Ich spürte immer deutlicher, dass ich in meinem Beruf als Buchhalterin, den ich die letzten zwanzig Jahre mehr oder weniger gern ausgeübt hatte, nun völlig fehl am Platz war. Da kam mir der Zufall – der wohl keiner war – gerade recht, als ich auf der Suche nach etwas ganz anderem die Stellenausschreibung meines jetzigen Arbeitsplatzes im Internet entdeckte. Doch nach der ersten Euphorie überrollte mich auch gleich ein schlechtes Gewissen, denn die Arbeitszeiten waren so ganz anders als die, die ich im Moment hatte. Da sollte ich nämlich nicht jeden Vormittag, wenn die Kinder eh aus dem Haus sind, meiner Tätigkeit nachgehen, sondern nachts und am Wochenende. Es waren zwar nicht viele Dienste, aber es waren Zeiten, in denen die Kinder zu Hause sein würden und ich nicht. Dass es allerdings Zeiten waren, zu denen die Kinder dafür ihren Papa mal ganz für sich allein haben und wir somit weder in den Ferien noch sonst auf irgendjemand anderen angewiesen sein würden, ließ ich vorerst hinter dem schlechten Gewissen stehen – hatte es unsere Gesellschaft doch sogar in der sonst so modernen Welt noch geschafft, dieses Bild irgendwo aufrechtzuerhalten. Oder aber ich selbst war einfach noch zu sehr in dem gefangen, was im Außen von mir als Frau und Mutter erwartet werden könnte, dass ich diesen Gedanken überhaupt zuließ. Aus heutiger Sicht war es wohl eindeutig das. Denn da war er mal wieder, der alte Begleiter in mir, der mir zuflüsterte, dass ich genügen und mich anpassen musste, um auch wirklich geliebt zu werden. Erst als ich dann meinem Mann davon erzählte und er einfach nur herzlich lachte, weil das mit den Arbeitszeiten für ihn nicht eine Sekunde lang ein Problem darstellte, hatte ich den Mut, mich zu bewerben. Ein paar Tage danach hatte ich den Job und bin heute, gut eineinhalb Jahre später, noch froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Auch wenn die Überzeugung, dass ich das auch wirklich darf und kann, damals leider noch nicht aus mir selbst gekommen ist.
Anschließend startete ich mit meinem neuen Job, meinen drei Kindern und meinem Mann glücklich und motiviert ins Jahr 2023.
Im ersten Halbjahr machten wir so viele Urlaube wie noch nie in so kurzer Zeit. Erst waren wir im Skiurlaub, dann ein verlängertes Wochenende in Tirol, später ein paar Tage zum Wandern in der Schweiz und einen Teil der Sommerferien verbrachten wir alle zusammen am Gardasee. Es war eines um das andere wunderschön und sehr entspannt. Und als Highlight in diesen Monaten fuhr ich im Juli mit einer lieben Freundin von mir zu unserem insgesamt fünften Konzert meiner Lieblingssängerin Pink. Als wir im Zug nach Wien saßen, sprachen wir unter anderem über verschiedene Bücher, die wir in letzter Zeit gelesen hatten, und meine Freundin empfahl mir „Das Kind in dir muss Heimat finden“ von Stefanie Stahl. Ich hatte schon davon gehört, war zu der Zeit allerdings mehr in Stimmung für leichtere Lektüre, drum schob ich das erst mal zur Seite. Es sollte mich zu gegebener Zeit allerdings wieder einholen.
Kurz nach den Sommerferien bekam eines meiner Kinder bei einer Routineuntersuchung eine Diagnose, mit der wir nicht gerechnet hatten. Es wurde ein Gewächs festgestellt, das zwar nicht gefährlich war, aber auf jeden Fall operativ entfernt werden musste. Die zuständige Ärztin erklärte uns, dass das bereits seit Jahren im Körper herangewachsen sein musste und es für sie unerklärlich war, wie das bisher nicht bemerkt werden konnte. Nach dieser Aussage hörte sich mein Gedankenkarussell nicht mehr auf zu drehen. Was war ich für eine Mutter, dass ich das übersehen konnte? Wo war meine Aufmerksamkeit gewesen, dass mir das nicht aufgefallen war? Ich wurde überrollt von Schuldgefühlen, obwohl die Ärztin damit sicher nicht mich gemeint hatte, aber das kam zu dem Zeitpunkt nicht bei mir an. Diese innere Überzeugung, dieser alte Glaubenssatz in mir, nicht richtig zu sein, so wie ich bin, nicht zu genügen, hatte mich wohl in dieses alte Muster fallen lassen – in den Zustand des sich nach dem Außen Richtens, des Funktionierens, sodass ich meinen inneren mütterlichen Instinkt nicht wahrgenommen hatte. Zum Glück verlief die Operation sehr gut und unser Kind war nach zwei Tagen bereits wieder zu Hause und erholte sich schnell. Meine Selbstvorwürfe und meine Schuldgefühle verabschiedeten sich aber leider nicht, sondern schnitten mich nur noch weiter von mir selbst ab.
Und dann – gut einen Monat später – zog es mir und unserer gesamten Familie komplett den Boden unter den Füßen weg. Denn die Seele eines unserer Kinder schrie so laut und verzweifelt, dass wir es fast verloren hätten. Es gibt keine Worte, die auch nur annähernd beschreiben können, was damals in mir vorging. Selbst wenn ich sagen würde, es hat mich innerlich komplett zerrissen oder es war ein Schmerz, wie ich ihn noch nie vorher gespürt habe, würde das noch nicht im Geringsten erklären, wie es wirklich in mir ausgesehen hat. Bei meinem Mann und mir kamen die Wellen des Schuldbewusstseins und der Selbstzweifel abwechselnd, und jeder versuchte, den anderen da rauszuholen, indem wir uns sagten, dass das jetzt weder unserem Kind noch uns weiterhilft. Aber wirklich abstellen konnten wir es nicht. Denn was war es denn, wodurch Kinder am meisten lernten? Wir als Erwachsene konnten ihnen noch so oft erzählen, es sei richtig und wichtig, alle Gefühle zuzulassen, zu zeigen und zu leben, wenn wir es ihnen selbst nicht genau so vormachten, sondern unser innerstes Eigenes versteckten und uns anpassten – woran sollten sie sich dann orientieren? Diese und so viele andere Gedanken gingen mir zu der Zeit durch den Kopf, doch eines kehrte in diesen schrecklichen Tagen endlich zu mir zurück: mein mütterlicher Instinkt und der bedingungslose Wille, darauf zu hören.
In den darauffolgenden Wochen wurde mir immer klarer, dass nicht nur unser Kind Hilfe brauchte, sondern auch ich anfangen musste, wieder auf meinen Weg und zurück zu mir zu finden. Doch wie sollte ich beginnen? Welche Themen waren die ersten, die ich in Angriff nehmen sollte? Noch heute denke ich mit einem Lächeln an den Moment, in dem ich zur Antwort auf diese Frage geführt wurde. Manche mögen es Zufall nennen, doch an Zufälle glaubte ich noch nie. Ich bekam die Antwort in einem kleinen Esoterikladen in unserer Stadt, den ich an diesem Tag zum ersten Mal betrat. Der Grund für meinen Besuch dort war, für und mit unserem Kind einen Kraftstein auszusuchen, der es auf seinem Weg der Heilung begleiten sollte. So sahen wir uns um zwischen all den Schätzen, die es hier gab, und mittendrin stand ein kleiner Tisch, auf dem vier oder fünf Bücher ausgelegt waren. Mein Blick fiel sofort auf das Buch von Stefanie Stahl „Das Kind in dir muss Heimat finden“, das mir meine Freundin im vergangenen Sommer auf unserer Zugfahrt nach Wien empfohlen hatte. Damit sollte also die Reise zurück zu mir selbst beginnen. Ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, kaufte ich das Buch und begann das spannende und schlussendlich sehr befreiende Abenteuer, mein Schattenkind zu akzeptieren und anzunehmen und in die Wahrnehmung und Kraft meines Sonnenkindes einzutauchen.
Und dann wurde es November. Meine erste Reaktion war eine SMS an eine befreundete Ärztin von uns, die mir umgehend antwortete, dass ich bereits am übernächsten Tag gleich in der Früh zum Ultraschall in ihre Praxis kommen sollte. Was sie sah, veranlasste sie dazu, mir eine Überweisung an eine Spezialpraxis auszustellen und mich direkt dorthin zu schicken. Aufgrund meiner Vorgeschichte und wahrscheinlich auch, weil ich meine aus Verzweiflung und Panik geweinten Tränen in dem Moment einfach nicht mehr stoppen konnte, wurde ich sofort drangenommen. Der Arzt sprach von einer „verdächtigen Struktur“ und rief gleich im Krankenhaus an, um einen Termin für eine Biopsie, also eine Entnahme einer Gewebeprobe, zu vereinbaren. Schon drei Wochen später, ein paar Tage vor Weihnachten, sollte diese stattfinden.
Nachdem ich mit meinem Mann darüber gesprochen hatte, musste ich einfach nur raus. Ich brauchte Luft, konnte kaum mehr atmen, Bilder von damals holten mich ein, alte Emotionen überrollten mich und ich konnte einfach nicht aufhören zu weinen. Ich schnappte mir unsere Hündin und ging spazieren – auch