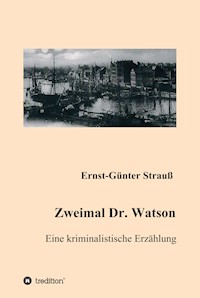
3,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die vorliegende kriminalistische Erzählung basiert auf den bekannten Romanhelden von A. C. Doyle, Sherlock Holmes und Dr. Watson. Sie verbindet historisch belegbare Hintergründe und Handlungsorte mit fiktiven Geschehnissen und Personen. Die Handlung spielt im Jahre 1904, Handlungsort ist schwerpunktmäßig die Förde- und Kriegsmarinestadt Kiel. Ein Hilferuf aus dem Kaiserreich erreicht den im Ruhestand befindlichen Meisterdetektiv, der seinen Freund, Dr. Watson, auf Grund seiner Kontakte zum Kieler Pathologen, Dr. Kramer, zur Aufklärung eines Erpressungsversuchs an die Ostseestadt entsendet. Opfer ist der letzte Deutsche Kaiser, Wilhelm II, der sich im Rahmen eines Kaisermanövers einen leidenschaftlichen Seitensprung erlaubt haben soll und nun von der "Kieler Miss Love" erpresst wird. Historischer Hintergrund ist ein tatsächlich belegter Vorfall, der von der Familie Bismarck geklärt werden musste. Parallel dazu wird das Schicksal des Bruders von Professor Moriarty aufgegriffen, der als Agent einer südamerikanischen Macht zwecks Industriespionage nach Kiel geschickt wird, um die neuesten Forschungsergebnisse zum U-Boot-Bau an sich zu bringen. Beide Abenteuer brechen über Dr. Watson herein. Für den Leser beruht die Erzählung auf den Hinterlassenschaften der Kaiserlichen Marine, die ihren Weg bis in die Aktenschränke des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR gefunden haben und auf fiktive, bisher unveröffentlichte Manuskripte und Notizen von Dr. Watson. Diese werden zusammengefasst und teilweise aus Sicht des Autors, teilweise aus der Sicht von Dr. Watson und Sherlock Holmes geschildert. Im Anhang findet sich eine umfangreiche Zusammenstellung begleitender Literatur für detaillinteressierte Leser.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ernst-Günter Strauß
Zweimal Dr. Watson
Eine kriminalistische Erzählung
© 2021 Ernst-Günter Strauß
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-26345-1
Hardcover:
978-3-347-26346-8
e-book:
978-3-347-26347-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für die Überlassung des Covermotivs (alte Gruß-aus-Kiel Karte des Kieler Hafens von etwas 1899, Ausschnitt) gilt unser Dank dem Kieler Stadtarchiv/Stadt- und Schifffahrtsmuseum.
Ernst-Günter Strauß, geboren 1951 in Hildesheim; im selben Jahr Auswanderung der Familie in die USA, 1961 Rückkehr nach Deutschland. Nach Abschluss einer Lehre als Bankkaufmann, Abendgymnasium, Abitur und Umzug 1978 nach Kiel. Dort Studium an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Ur- und Frühgeschichte, Geologie und Volkskunde) Promotion 1989 (Dissertation „Studien zur Fibeltracht der Merowingerzeit“). Danach wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Landesmuseen in Schleswig und Dresden. 1996 berufliche Umorientierung (kaufm. Betriebsassistent). Ab 2000 Angestellter und Büroleiter der Handball-Bundesliga GmbH in Dortmund und Köln, seit 2018 im Ruhestand. Erste kriminalistische Erzählung, erschien 2001, Karin Fischer Verlag, Aachen „Dr. Watson hält einen Vortrag“.
Vorwort
Anstoß für eine Folgegeschichte von „Dr. Watson hält einen Vortrag“ war ein Zeitungsartikel der „Zeit“ vom 23.5.2001, den mir mein früherer Studienkollege und lieber Freund, Dr. Bernd Habermann, mit der Bemerkung zusandte „das ist doch etwas für Dich“ - danke Bernd! Natürlich war das etwas für mich und Anlass, den Autor des Artikels um weitere Informationen anzuschreiben. Dr. Volker Ullrich wies mich freundlicher Weise auf die Otto-von Bismarck-Stiftung in Friedrichsruh hin. Hier konnte mir Dr. Michael Epkenhans die inhaltliche Aufarbeitung des Artikels bestätigen und auf eine eventuell vorhandene Akte im geheimen Staatsarchiv hinweisen, die er selbst aber nicht eingesehen habe. Beiden gebührt für ihre freundlichen Antworten und Literaturhinweise mein herzlichen Dank.
Jetzt hatte ich einen ersten Einstieg in eine neue Handlung, die aber über die Affaire der „Mss Love“ hinaus gehen und den Leser wieder zurück in den Reichskriegshafen Kiel führen sollte. Was bietet sich da mehr an als die Einbindung der Marine und der Kieler Werften in das Geschehen? Fragen zu einzelnen Themenbereichen stellte ich an das Militärische Forschungsamt in Potsdam. Für die Antwort zu Fragen der militärischen Ausbildung in der Marine danke ich Korvettenkapitän Sander-Nagashima und für zahlreiche Literaturhinweise zu Werften, Vorschriften zur Geheimhaltung auf militärischen Anlagen / Industriespionage wie auch zu Manövern im Kaiserreich Major Dr. Peter Popp. Wie stand es um die Geheimdienste jener Zeit im Deutschen Reich und in Groß Britannien? Hier bedanke ich mich für die ergiebigen Literaturhinweise von Dr. Christopher Nehrning vom Deutschen Spionagemuseum, Berlin.
Von besonderem Interesse für mich war ein Einblick in den transatlantische Schiffsverkehr in der Zeit der Jahrhundertwende. Hier bedanke ich mich für die ausführliche Angaben bei der Hapag-Lloyd AG, Hamburg, die mir Erika Sagert zusammenstellte und mit denen ich versucht habe, das Gefühl für eine Schiffsreise in dieser Zeit zu gewinnen. Nützlich waren mir dabei auch meine wenigen Erinnerungen an eigene transatlantische Überfahrten meiner Kindheit.
Bei der Aufarbeitung der vielen Hinweise wurde mein Interesse für immer mehr Details geweckt, was zum einen ausufernde Neugierde erzeugte, so dass ich Gefahr lief, mich zu verzetteln, zum anderen es erforderlich machte, mich stringent auf die Bereiche zu konzentrieren, die für eine Romanfassung und deren Handlung erforderlich waren.
Letztlich habe ich versucht, die Handlung aus „Dr. Watson hält einen Vortrag“ weiter zu führen.
Dr. Ernst-Günter Strauß, 2021 Kiel
Einleitung
Zu meinem Bedauern sind nun schon fast zwanzig Jahre vergangen seit ich eine erste bescheidene Auswertung von Unterlagen, die mir von einem guten Freund aus der Hinterlassenschaft des früheren Ministeriums für Staatssicherheit der ehemaligen DDR zugeleitet worden waren, veröffentlicht hatte. Sie betrafen die Geschehnisse während des Aufenthaltes des allseits bekannten Dr. John Watson in Kiel, dem Kriegsmarinehafen an der Ostsee. Dr. Watson war einer Einladung zu einem Vortrag an der Kieler Christian-Albrechts-Universität gefolgt und in der quirligen Marinestadt in die Aufklärung zweier mysteriösen Todesfälle und den folgenreichen, sich anschließenden Ereignissen verwickelt worden.
Ich rufe in Erinnerung den blaugrauen verblichenen und verstaubten Pappkarton mit Schwarz-Weiß-Rotem Band und Wappenaufdruck aus der Zeit der Kaiserlichen Marine, der sich immer noch in meinem Besitz und wohlverwahrt im Bankschließfach befindet. Nach wie vor bin ich den akribischen Beamten dankbar, die vor mehr als hundert Jahren alles gesammelt, abgeheftet und registriert haben, was ihnen in die Finger kam und was ihnen auf irgend eine Art und Weise wichtig erschien.
Mein Dank gilt auch meinem langjährigen Freund aus der damaligen „Gauck-Behörde“, der mir sozusagen „unter der Hand“ und an allen Sicherheitsvorkehrungen vorbei diesen Pappkarton zugeleitet hatte.
Vor seiner nun bereits einige Jahre zurückliegenden Pensionierung erhielt ich von ihm aus Berlin weitere, kuriose Archivfunde, darunter kleinere Aktenstücke und ein an eine Asservatenkiste erinnerndes Paket zur schriftstellerischen Auswertung. Dabei handelt es sich weitgehend um behördlichen Schriftverkehr und Aktennotizen aus den Jahren zwischen 1900 und 1904, die teils aus dem Bereich des Marinegeheimdienstes, des Auswärtigen Amtes sowie aus Akten- und Schriftstücke der Kieler Polizei stammen.
Der Kontakt zu meinem Berliner „Informanten“ hat sich zwischenzeitlich auf rein private und gelegentliche Besuche beschränkt, häufig verbunden mit kulturellem Programm in der Bundeshauptstadt; das Programm während der Gegenbesuche seinerseits in Kiel konzentriert sich meist auf maritime Ausflüge, gern während der Kieler Woche.
Meine eigenen beruflichen Aufgaben – ich muss zugeben, Ursache einer wesentlich länger als geplanten Schaffenspause – haben mich lange davon abgehalten, die bereits seit den ersten Jahren des neuen Jahrtausends vorliegenden, für mich fast schon albtraumhaften ca. 70 Seiten Text mit Überlegungen, Stichworten und zusammenhanglosen Schilderungen als Nachfolgeerzählung endlich auszuwerten und zusammen zu fassen. Mit dem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand habe ich mich dazu durchgerungen, diese Fragmente neu zu überblicken, zu ordnen und mühsam aufeinander abzustimmen, in der Hoffnung, dass die nachfolgende kriminalistische Erzählung ebenso positiv von den Lesern aufgenommen wird wie die Berichte zu den Ereignissen um Dr. Watsons Vortrag im Jahre 1895.
Ich überspringe dabei eine Reihe durch zahlreiche weitere Unterlagen dokumentierten Jahre, aus denen mir ebenfalls unveröffentlichte Unterlagen vorliegen und beginne die Erzählung mit den Notizen Dr. Watsons aus dem Jahre 1904, die ich der Einfachheit halber in Erzählform zusammenfasse und wiedergebe. Dabei bin ich der Meinung, dass Handlungen und politische Umstände Anknüpfungspunkte zu unserer Zeit durchaus widerspiegeln, schaut man auf die weltweiten Tätigkeiten von Industrie und Wirtschaft, jetzt als „Globalisierung“ bezeichnet, wie auch gewisse Aktivitäten verschiedener Geheimdienste der letzten Jahre.
Unter diesen Unterlagen befinden sich eine brisante, handgeschriebene Postkarte, Schiffsbuchungen, Eisenbahn-Billetts, technischen Zeichnungen und Berechnungen, eine kleine Papiertüte mit zerkrümelten Tabakresten und ein Messer besonderer Art. Der Zusammenhang dieser Objekte wird sich im Laufe der Erzählung dem Leser erschließen, der die Mühe auf sich nimmt und die Handlung bis zum Schluss verfolgt.
Dr. Watson
Aus dem Grammophon dringen die Läufe einer virtuos gespielten Klaviersonate von Beethoven und füllen die Stille meines Arbeitszimmers. Ich blicke durch das Fenster in den Regen und sinne in den trüben Nachmittag, erfreut über die positiven Seiten eines warmen und trockenen Zimmers. Nichts drängt meine Gedanken, und ich lasse ihnen freien Lauf, unterstützt durch die wohltuende Musik. Die Stimmung ruft in mir die Erinnerung an Zeiten wach, in denen die Ereignisse sich förmlich überschlugen, damals, 1904, als ein Telegramm nach dem anderen immer neue und überraschende Nachrichten übermittelte, unterstützt durch umständliche, mit Voranmeldung geführte Gespräche über Telefon mit meinem Freund Sherlock Holmes, zu jener Zeit durchaus nicht so selbstverständlich und so einfach wie heute. Ja, damals liefen viele Ereignisse plötzlich und unerwartet zusammen. Vielleicht ist dies der Grund, warum ich die Geschehnisse des Jahres 1904 bislang noch nicht zu Papier gebracht habe. Selbst mit einem gewissen zeitlichen Abstand wirken sie mir immer noch verwirrend, erst recht für einen Außenstehenden, so unglaublich, dass es unmöglich erscheint, die Zufälligkeiten plausibel erscheinen zu lassen – und doch war es so.
Am Anfang meiner Erinnerung steht die der Times entnommene Anzeige zum Ableben des aus meinen früheren Berichten bekannten Professors Moriarty, die ich sorgfältig aufbewahrt habe.
Was für ein Text!
Es war einfach unerträglich und so nicht hinnehmbar! Ist man über die Hintergründe aufgeklärt, so steigt mir heute noch die Zornesröte ins Gesicht bei der Lektüre dieser Veröffentlichung, die sich auch in anderen Londoner Massenmedien fand.
„Professor Moriarty – ein verdientes Mitglied unserer Gesellschaft! ….“
Diese Meldung war ein Schandfleck am Denkmal meines Freundes Sherlock Holmes, von dem ich über die Machenschaften dieses üblen und durch und durch verruchten Menschen aufgeklärt worden war. Ich erinnere mich genau an das erste Mal, als dieser Name mir zu Ohren kam. Es war im April des Jahres 18911, als Holmes völlig überraschend in meine Praxis stürmte, im Gesicht gezeichnet von einer entsetzlichen Angst. So hatte ich ihn noch nie erlebt. Die drohende Gefahr ließ ihn die sonderbarsten Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, die ich erst im Nachhinein begriff. Zu diesem Zeitpunkt erfuhr ich erstmals von der Existenz dieses Phantoms der Verbrecherwelt – Professor Moriarty.
Holms schilderte mir damals seine erste persönliche Begegnung mit diesem Mann. Völlig überraschend war, wie ich nun weiß, das Oberhaupt der übelsten kriminellen Organisation in London und vermutlich auch in weiten Teilen des Königreichs, in der kleinen Wohnung in der Bakerstreet erschienen. Ich selbst war zu jener Zeit bereits verheiratet und hatte meinem Freund die gemeinsame Bleibe zur alleinigen Nutzung überlassen.
Holmes beschrieb mir den „Professor“ als groß und schlank. Ohne Bart und mit tiefliegenden Augen, mit kahler Stirn und leicht vorgebeugter Körperhaltung; diese Erscheinung trug, zusammen mit der Kenntnis über seine versteckte kriminelle Tätigkeit, zu einem Bild des Schreckens bei, das jedoch vor der Öffentlichkeit geschickt versteckt und daher nicht wahrgenommen werden konnte.
Die bei diesem Zusammentreffen Holmes gegenüber ausgestoßenen Drohungen seitens des Professors waren tödlicher Ernst. Ihnen zu trotzen zeigte mir, welchen Mut mein geschätzter Freund aufbrachte, gegen dieses verderbliche, krakenähnlich organisierte Verbrechersyndikat vorzugehen.
Holmes hatte den Professor schon länger durchschaut und niemals unterschätzt. In enger Zusammenarbeit mit einigen wenigen führenden Beamten von Scotland Yard - auch unter den Beamten der Polizei hatte Moriarty seine bestochenen Zuträger - wurde über einen längeren Zeitraum der geheime Plan zu seiner Ergreifung entworfen. Endlich, die Gelegenheit war einmalig und alle Vorbereitungen getroffen. Die Londoner Polizeiführung hatte sich den Erkenntnissen und Beweisführungen Holmes angeschlossen und ein Netz gesponnen, in dem das Oberhaupt der Londoner Unterwelt sich verstricken sollte.
Nachdem seitens der Polizei alles präzise geplant und organisiert worden war, entschloss sich Holmes zu verreisen in der festen Meinung, dass sein persönliches Eingreifen vor Ort nicht erforderlich sein würde, vielleicht aber auch, um Moriarty in Sicherheit zu wiegen. Das war leider weit gefehlt. Nur teilweise gelang der große Schlag. Zwar fielen dem Zugriff der Polizei einige hochkarätige und lang gesuchte Subjekte in die Hand, aber, vergleichbar einem Medusenhaupt, dessen abgeschlagene Schlangenköpfe nachwuchsen, dem Professor gelang die spektakuläre Flucht vor dem Arm des Gesetzes.
Durch den sich noch in Freiheit befindlichen Verbrecheroberhaupt und seine vielseitigen Verbindungen war konsequenter Weise das Leben von Sherlock Holmes aufs äußerste gefährdet, denn Moriarty wusste genau, wer hinter der Aktion der Polizei stand und wer über seine übelsten Machenschaften bis in das Kleinste genau informiert war. Diese Kenntnis war Ursache der tödlichen Bedrohung meines Freundes, wobei auch meine Person durchaus nicht außerhalb der Gefährdung stand.
Die dramatischen Umstände unserer fluchtähnlichen und konspirativ vorbereiteten Abreise aus London sind mir noch gut im Gedächtnis, besonders die geschickte Verkleidung meines Freundes als italienischer Priester. Aber selbst durch diese Vorsichtsmaßnahmen konnte der hartnäckige und verbrecherische Verfolger Moriarty nicht entscheidend abgeschüttelt werden.
War seine Organisation der Polizei weitgehend in die Maschen gegangen, gelang dem Genie des Schreckens letztendlich die Flucht aus England. Wir dagegen waren zuvor kreuz und quer durch Europa gereist und erhielten die Nachricht von der gelungenen Flucht Moriartys aus dem Königreich bei der Zeitungslektüre in einem Straßburger Café. Holmes hatte zunächst darauf bestanden, dass ich nach London zurückkehre, um nicht ebenfalls in großer Gefahr zu sein. Angesichts meiner Verbundenheit mit seiner Person war es mir jedoch unmöglich, meinen Freund in seiner bedrohlichen Lage allein zu lassen. So waren wir, wie einigen Eingeweihten vielleicht noch bekannt ist, nach Frankreich weitergereist, die Rhone aufwärts und über Genf, in die Schweiz zum Gemmi-Paß, wo wir bei einer Bergwanderung in der Nähe des Daubensees fast einem Anschlag erlegen waren – so die feste Ansicht Holmes.
Unser Aufenthalt danach in dem pittoresken schweizer Dörfchen Rosenlaui sollte, wie sich später zeigte, tragisch enden. Von dort nahmen wir die Wanderung zu den berühmten Reichenbachfällen auf, wo sich die allseits bekannte Tragödie mit dem Zusammentreffen dieser beiden schicksalhaft verbundenen Männer - der geniale Verbrecher und der fähigste Kämpfer für Recht und Gesetz - ereignete.
Geblieben waren mir die letzten Zeilen und der Stock meines aufrechten Freundes, die ich bis heute sorgfältigst aufbewahre.
Drei Jahre gingen danach ins Land, in denen ich mich in alter Gewohnheit um die in der Presse geschilderten und leider immer zahlreicher werdenden Verbrechen in unserer Stadt bemühte und die dort veröffentlichten Fakten fein säuberlich zusammentrug – ganz als ob der große Detektiv noch am Leben wäre und sie jeden Moment von mir abfordern könnte.
Mag es noch so grotesk wirken, aber nach seinem plötzlichen Erscheinen an jenem Abend am Oxfordende der Park Lane erwies sich diese Arbeit als nicht vergebens.
Während ich diese Zeilen zu Papier bringe, kommen mir seine damaligen ersten Worte beim sich Erkennengeben, sein freundschaftliches, fast liebevolles „Mein lieber Watson“ wieder in das Gedächtnis, genauso wie der fast körperliche Schmerz, den mir der Schreck seines plötzlichen Wiederdaseins zufügte2.
1. In der Schilderung des Abenteuers „The Adventure of the Empty House“ geht aus den Aufzeichnungen von Dr. Watson hervor, dass die schrecklichen Ereignisse an den Reichenbachfällen im Jahre 1881 stattfanden. Hier ist auf die widersprüchliche Schilderung in der Episode „The Adventure of the Final Problem“ hinzuweisen, wo die tragischen Ereignisse an den Reichenbachfällen genau 10 Jahre später, nämlich 1891 stattfanden, ein Datum, das am ehesten den wahren Zeitpunkt des Geschehens wiedergibt. (Anm. des Autors)
2. Doyle 1984, 339 ff., The Adventure of the Empty House
Moretti
Als ihn die Nachricht vom Tode seines älteren Bruders erreichte, waren bereits einige Monate vergangen. Der Postweg in das ferne Ägypten war lang, beschwerlich und sehr unsicher. Die häufigen Überfälle der letzten Splittergruppen des Mahdi taten ein weiteres, um die Truppen Ihrer Majestät von der Außenwelt und vom Nachschub abzuschneiden. Colonel James Moriarty3 entnahm dem Telegramm, dass sein Bruder in den Schweizer Alpen, nahe dem Ort Reichenbach zu Tode gekommen war. Nähere Umstände des Unglücks wurden nicht genannt.
Die beiden Brüder Moriarty waren sich seit ihrer Jugend stark verbunden. Gemeinsam hatten sie ihr Studium absolviert, danach jedoch völlig unterschiedliche Laufbahnen eingeschlagen. James Moriarty gefiel sich im roten Rock. Er absolvierte die Royal Military Academy in Sandhurst und stieg, Rang um Rang in der Militärhierarchie empor. Einsätze während der Kämpfe in Ägypten gegen die vordringen Nachfolger des Mahdi bei Wadi Halfa unter Oberst Josceline Wodehouse und anschließend in der Schlacht von Toski bei den 20th Hussars sowie bei weiteren Einsätzen der Britischen Besatzungsarmee in Ägypten trugen zu seiner zähen körperlichen Konstitution bei. Seine charakterliche Einstellung hatte sich jedoch bereits in seiner Jugend ausgeprägt und bestimmte den Umgang mit seinen Untergebenen wie auch das Verhältnis zu seinen Vorgesetzten. Hier waren sich beide Brüder sehr ähnlich. Sie nutzten geschickt ihr seriöses, bürgerliches Erscheinungsbild, um sich ihren Weg durchs Leben zu bahnen und, wenn nötig, sich mit zwielichtigen Gestalten zu verbünden, wobei es mit der Gesetzestreue nicht so genau genommen wurde. Der „Professor“, so wurde der ältere der beiden Bruder von Kindheit an genannt, hatte sich dabei als besonders geschickt hervorgetan. Seiner schulischen Ausbildung geschuldet, verbunden mit einem hervorragender Verstand, fiel er bereits mit einundzwanzig Jahren mit einem bahnbrechenden mathematischen Aufsatz in wissenschaftlichen Kreisen auf. Das hatte ihm eine Professur an einer kleinen englischen Universität eingebracht. Die bürgerliche Fassade fing jedoch bald an zu bröckeln. Machenschaften an der Grenze zur Legalität führten dazu, dass er diese Stelle später aufgeben und seine wissenschaftliche Fassade als Privatier fortsetzen musste. Dank seiner vielen Kontakte zur Londoner Unterwelt war es ihm bereits parallel zu seiner Lehrtätigkeit möglich gewesen, eine kriminelle Organisation aufzubauen, die vor Erpressung und Mord nicht zurückschreckte. Verschwiegen und extrem hierarchisch angelegt wusste nur ein sehr kleiner Kreis aus der Führungsebene der Organisation, wer wirklich an ihrer Spitze stand.
Beide Brüder waren nicht verheiratet, der strenge Militärdienst sowie die wissenschaftliche Karriere hatten dem immer im Weg gestanden. Gemeinsam erwarben die Brüder in England einen kleinen aber kostbaren Landsitz, auf den sie sich gelegentlich zurückziehen konnten; James weniger, denn bis zu seiner Pensionierung musste er den Anforderungen der Krone zur Verfügung stehen während der „Professor“ seinen Nebentätigkeiten in London von seinem Lehrstuhl aus geschickt nachgehen konnte. Obendrein diente der Landsitz und der damit verbundene ehrbare Schein der Verschleierung seiner tatsächlichen Machenschaften, wenn er hier seine „Studien“ fortsetzte und in der Öffentlichkeit als seriöser und integrer Wissenschaftlicher hoch geachtet wurde.
Einige Monate später war die Rebellion in Ägypten niedergeschlagen, aber der Dienst in Ägypten erforderte seine Anwesenheit noch geraume Zeit, bevor Colonel Moriarty nach langer Überfahrt wieder englischen Boden betrat. Neben den üblichen Geschäften hatte er sich fest vorgenommen, die Umstände vom Ableben seines Bruders zu erkunden. Das fiel ihm nicht leicht, denn Professor Moriarty war ein sehr agiler Mann gewesen, der extrem auf die Sicherung und Verschleierung seiner verschiedenen Geschäfte gegen Außenstehende geachtet hatte. Seine in der Öffentlichkeit wahrgenommene berufliche Tätigkeit beschränkte sich auf die eher bescheidene Arbeit als Wissenschaftler – hier lag, sichtbar für Jedermann, sein Augenmerk auf der mathematischen und der archäologischen Forschung. Seine versteckten privaten Aktivitäten jedoch, das wusste James Moriarty, waren vielseitig, streng verdeckt und für Außenstehende nicht zu erkennen.
James Moriarty reiste zunächst zum gemeinsamen Landsitz. Die Geschäfte seines Bruders hatten sich seit seinem Ableben eigenständig weiterentwickelt, einige sogar verselbständigt. Art und Umfang dieser „Geschäfte“ waren dem Colonel nur vage bekannt. Sie fanden jedoch in weiten Bereichen seine Zustimmung, zumal er in erheblichem Maße finanziell davon profitierte. Für jeden Außenstehenden waren die beiden Brüder stets ehrenwerte Mitglieder der Gesellschaft gewesen. Der Professor jedoch hatte weit gestreute geschäftliche Beziehungen mit Subjekten finsterster Art. Daraus flossen erhebliche finanzielle Mittel auf seine privaten Konten, die er nur zu einem kleinen Teil in England unterhielt. Der Großteil seines Vermögens lagerte auf schweizer wie auch deutschen Banken.
Aus der Schweiz lagen Berichte und Urkunden zum Tode seines Bruders vor, die James Moriarty zunächst sichtete und dabei auf einen ihm nicht unbekannten Namen stieß: Sherlock Holmes. Dieser Mann hatte, wie er wusste, es bereits in der Vergangenheit gewagt, die Geschäfte des Professors zu stören, ja sogar zu durchkreuzen. Wie er den Unterlagen entnehmen konnte, war dieser Mann zur gleichen Zeit in Reichenbach gewesen und ebenfalls dort tödlich verunglückt. Die Aufzeichnungen seines Bruders deuteten darauf hin, dass der Professor dort eine endgültige Entscheidung mit seinem Kontrahenten gesucht hatte vermutlich fand dieses Treffen keinen Sieger.
Die Verbitterung über den Tod seines Bruders saß tief und fest. Zwei Aspekte spielten bei seinen Überlegungen für die Zukunft eine Rolle. Zum einen die innere familiäre Verbundenheit mit seinem Bruder, zum anderen die nun sich selbst überlassene Organisation, das Schattendasein seines Bruders, die zum Vorteil ihrer beider finanziell so erfolgreich tätig war. Bislang hatte er noch keinen konkreten Einblick in diese Organisation gehabt, denn sein Bruder war peinlichst darauf bedacht gewesen, dass keine schriftlichen Unterlagen darüber existierten.
Aber schon in den ersten Tagen seines Aufenthaltes auf dem Lande nahmen verschiedene Personen, vorwiegend aus London, Kontakt mit ihm auf, fragten vorsichtig zu den unterschiedlichsten Dingen nach. Einige Telegramme ließen ihn erkennen, dass der Einstieg in das Erbe seines Bruders recht kompliziert werden würde. Er musste in der nächsten Zeit zu einer Entscheidung kommen: die Fortführung und Führung dieser dunklen Organisation oder der Verzicht auf ihre Leitung.
Er entschied sich für einen Kompromiss. Bei der Kontaktaufnahme mit den früheren „Geschäftspartnern“ seines Bruders wurde ihm klar, dass er bei weitem nicht die Fähigkeiten hatte, um dieses Netzwerk in seinem Innersten straff und mit der notwendigen Durchsetzungskraft zusammenzuhalten. So beschloss er, die Organisation sich selbst zu überlassen, nahm für sich jedoch in Anspruch, die Verbindungen eines kleinen Segmentes aufrecht zu erhalten und sich zunutze zu machen.
In der Öffentlichkeit suchte er nach Möglichkeiten, das Andenken an seinen Bruder so darzustellen, dass er auch nach dem Tode ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft blieb - die dunklen Machenschaften erhielten eine entsprechend moralisch saubere Fassade. Hierbei nahm es sich von Vorteil, gute Verbindungen zur Presse, besonders zu den Boulevard-Blättern, aufzubauen. Die flinken Jungs aus den Redaktionen in der Fleetstreet waren immer knapp bei Kasse und nicht zimperlich, wenn es um eine Aufbesserung derselben ging. Die Dinge konnte man, so sagten sie, stets von verschiedenen Seiten aus sehen, und einem Freund mit großzügigem Geldbeutel war man gern zu Diensten.
Nur wenigen Lesern erschien der in verschiedenen Zeitungen veröffentlichte Nachruf auf den verstorbenen Professor Moriarty merkwürdig. An der kleinen englischen Universität schwieg man beflissentlich, um seinen eigenen guten Ruf zu wahren und hütete sich, Widerspruch gegen die vorgebrachten Verdienste während seiner dortigen Tätigkeit zu erheben. Die später noch viel intensiver entwickelten Verbindungen Moriartys zur Londoner Unterwelt waren sowieso in dem ehrwürdigen elisabethanischen Ziegelbau nicht bekannt.
„Nachruf und zum Gedenken an Professor Dr. Moriarty
London, 1891
In tiefer Trauer und bestürzt ob der tragischen Umstände nahmen kürzlich seine Kollegen und Mitarbeiter Abschied von einem aus ihrer Mitte. Professor Moriarty war bei einer Bergwanderung in den Schweizer Alpen abgestürzt und tödlich verunglückt.
Schon in frühen Jahren erwarb sich Professor Moriarty internationale Aufmerksamkeit durch seine Untersuchungen zu binominalen Theorien. Auf seinem beruflichen Lebensweg galt seine
Aufmerksamkeit dem universitären Lehrbetrieb. Unaufhörlich engagierte sich Professor Moriarty bei den täglichen Lehrveranstaltungen und hatte darüber hinaus auch stets ein offenes Ohr und eine hilfreiche Hand für gestrauchelte und hilflose Menschen in unserer Gesellschaft. Zu diesem Zweck gründete er eine internationale Organisation, die die notwendigen finanziellen Mittel für wohltätige Zwecke requirierte und der er in den letzten Jahren vorstand.
Unermüdlich hatte sich der Verstorbene für diese karitative Organisation eingesetzt, ohne dabei die Pflichten und Aufgaben seines Lehramtes zu vernachlässigen.
Wir gedenken seiner in aufrichtiger Verehrung und Bewunderung
Colonel James Moriarty“
Der zweite entscheidende Entschluss für James Moriarty war, sich aus dem Militärdienst zurückzuziehen. Genauer gesagt, es wurde ihm nahegelegt, seinen Abschied zu nehmen.
Etwa drei Wochen nach seiner Rückkehr nach England erschienen auf seinem Landsitz drei Herren, ein Major in Uniform und zwei Zivilbeamte und baten um eine Unterredung, in deren Verlauf hinter verschlossenen Türen Colonel James Moriarty vor die Wahl gestellt wurde, entweder selbst seinen Abschied zu nehmen oder sich einem langwierigen juristischen Prozess zu stellen, bei dem seine Rolle in der Organisation seines Bruders aufgeklärt werden würde. Entrüstet über „Unterstellungen und Verdächtigungen nebulöser und zwielichtiger Personen“ - hier spielte er auf die Rolle des Detektivs Sherlock Holmes an - sah er sich gezwungen, sich dieser aus seiner Sicht äußerst üblen Kampagne gegen seine Person und gegen das ehrenwerte Andenken seines verstorbenen Bruders zu beugen. Ja, in diesem Land, das seinen aufopfernden Dienst über viele Jahre hin nun mit Undank lohnte, wolle er nicht länger bleiben. Empört forderte er die Vertreter des Kriegsministeriums auf zu gehen.
Damit war für ihn klar, dass über kurz oder lang für ihn kein Verbleiben mehr in England sein würde, was aber kein großes Problem darstellte. Weltgewand und durch seine häufigen Auslandsdienste geprägt, nutzte er, nicht zuletzt mit Hilfe der Organisation seines verstorbenen Bruders, Verbindungen in ganz England wie auch in fernen Teilen des Erdballs. Seine finanzielle Lage war durchaus gesichert – allein, er sann auf Wiedergutmachung und Rache an dem System, das ihn auf so schimpfliche Weise um seine Verdienste gebracht hatte.
Trotzdem vergingen noch einige Jahre im Königreich bis er alles Notwendige mit Banken und Anwälten geregelt hatte. Voller Unternehmungsgeist buchte er eine Schiffspassage nach Südamerika.
3. James Moriarty, Bruders des berüchtigten „Professor Moriarty“ belegt in: Doyle 1984, 315 ff.„The Adventure of the Final Problem“ dort „My hand has been forced, however, by the recent letters in which Colonel James Moriarty defends the memory of his brother, and I have no choice but to lay the facts before the public exactly as they occurred“Der Vorname des Professors bleibt bei A. Conan Doyle ungenannt (im Gegensatz zu Wikipedia bzw. Weinstein 2008, 99 ff., wo der Professor als James Moriarty bezeichnet wird). Ausführliches zur Person des Professors in Doyle 1984, 315 ff. „The Final Problem“ und Doyle 1979 115 ff. „The Valley for Fear“, ferner erwähnt in Doyle 1984 339 ff. „The Empty House“, „The Norwood Builder“, „The Missing Three-Quarter“, Doyle 1979, „The Illustrous Client“ und „His Last Bow“. (Anmerkung des Autors)
Kaisermanöver
Ein feuchter, kühler Septembermorgen bricht an. Über die lange Verbindungsbrücke zum Schweriner Schloss fährt ein schwerer schwarzer Geländewagen und hält vor dem prächtigen Eingangsportal. Der Motor rasselt vor sich hin während der uniformierte Chauffeur aussteigt und die Karosse prüfend umrundet, um dann seine Haltung zu straffen und die rechten Türen aufzureißen. Die großen Flügeltüren des Schlosses öffnen sich und Seine Majestät verlässt das Gebäude, hinter ihm sein Adjutant und ein weiterer Generalstabsoffizier. Mit schnellen Schritten trippeln sie zwei, drei Stufen hinab zum wartenden Wagen. Trotz der frühen Tageszeit, es ist kurz nach vier Uhr morgens, sind die Herren erstaunlich gesprächig und steigen gelenkig ein. Der Wagen ruckt an und holpert über das Kopfsteinpflaster der langen Schlossallee, um dann nach links Richtung Nordwesten abzubiegen. Die Herren sind auf dem Weg ins Manöver.
Am Tag zuvor hatte es noch mächtig geschüttet, bis in den späten Nachmittag hinein. Zum Glück nahm der sandige Boden das Wasser schnell auf. Trotzdem war dies kein Wetter nach dem Sinn der Soldaten, die sich bereits seit einigen Tagen im Gelände aufhielten. Sie hatten, wie gelernt und oft geübt, ihre Zelte aufgeschlagen, und mit dem darin verteilten trockenen Stroh kehrte eine gewisse Gemütlichkeit und bessere Stimmung zurück.
Der Regen hatte erst spät am Nachmittag nachgelassen. Ausrüstungsgegenstände mussten danach getrocknet und gereinigt werden, Stiefel geputzt, Gewehre geölt. Die Feldküchen nahmen am Nachmittag ihre Arbeit auf und versorgten die Mannschaften und Offiziere zum Abend hin mit gehaltvoller heißer Suppe und Brot. Die gesamt Manöversituation erstreckte sich über die abgeernteten Getreidefelder des kleinen Ortes Grevesmühlen und weiter, fast bis an den Schweriner See. Es war Kaisermanöver4.
Mit dem Anbruch des neuen Tages nehmen die Dinge ihren Lauf: ein Zahnrad greift in das nächste – Wecken, Aufstehen, Frühstücken, Antreten und Abmarsch der verschiedenen Abteilungen in die vorgegebenen Stellungen. Auf der einen Seite die „Roten“ mit einer Kavallerie-Division und drei an den Flanken anschließenden Infanterieabteilungen, die 17., 41. und 18. Division. Am rechten Flügel steht die 37. Brigarde. Diese liegt, hinter einer beobachtenden Vorpostenlinie, etwa fünf km östlich der gegnerischen „Blauen“, vertreten durch das Gardekorps.
Für den heutigen Tag ist der Angriff von Blau geplant – unter der Führung Seiner Majestät. Der Vormarsch der 3. Garde-Infanterie-Division beginnt um 6.30 Uhr entlang des kleinen Flüsschens Stegenitz zwischen den Orten Groß Echsen und Moltenow.
Nördlich bis zum Ort Mühlen-Eichsen schließt sich die 1. Garde-Infanterie-Division an, während die 2. Garde-Infanterie-Division nördlich auf der Linie Rüting-Testdorfer Steinfort vorgeht. Die Garde-Kavallerie steht noch im Raum Dietrichshagen.
Rot fängt den Angriff auf der Linie Friedrichshagen-Bobitz-Dambeck auf.
Auf einem hochgelegenen Geländerücken liegt die 17. Infanterie-Division in Stellung, Die Soldaten in ihren blauen Waffenröcken und den Pickelhauben, mit schilfgrünem Tuch geschützt, entfachen ein wahres Feuerwerk mit ihren Platzpatronen, das so heftig ist, dass die angreifende Garde-Kavallerie zurückgeschlagen wird und der geplante Angriff sich gar nicht erst entwickelt werden kann.
Währenddessen sind hinter den Infanterielinien, östlich der Höhen bei Bobitz mehrere Artilleriebatterien in Stellung gegangen. Von hier aus kann man den lange vor Antritt der Bewegungen installierten Nachrichtenballon von Blau erkennen. Die Beobachtung des Geländes und der sich bewegenden Truppenteile ist an diesem Tag, nach dem heftigen Regen des Vortages, nicht einfach. Die sonst so verräterischen Staubwolken bei Truppenverschiebungen bleiben auf Grund des feuchten Bodens aus.
Weniger glücklich ist die Aktion von Rot mit seinem Nachrichtenballon. Dieser wird zum einen zu spät gesetzt, zum anderen fängt er unglücklicherweise Feuer und explodiert, wobei ein Bedienungsmann sich schwer verletzt.
Der Oberschiedsrichter, Prinz Albrecht von Preußen, hat seinen Beobachtungsstand auf der Höhe von Bobitz, von wo aus der beste Blick auf das Geschehen möglich ist. Um 8 Uhr beginnt das Artillerieduell auf 3000 m Entfernung zwischen Rot und Blau. Die Schiedsrichter bemerken, dass sich Blau als überlegen zeigt. Mangelnde Deckung bei Rot, Einsicht auf Protzen und Bespannung, hätten im Ernstfall hier zu einer Katastrophe für Rot geführt. Dieses Gefecht wertet das Schiedsgericht für Blau.
Weiter südlich entwickelt sich der Kampf zwischen der 18. Infanterie-Division von Rot und der 3. Garde-Infanterie-Division von Blau. Der Angriff der Leibgardehusaren in echelonierter.5 Form beginnt das Gefecht, bevor die Garde-Infanterie unter Trommelwirbel vorrückt. Hier beweist sich die Standfestigkeit der Infanterie auf Seiten von Rot, die den Angriff erfolgreich abwehren kann. Das nachrückende Gardekorps, unter Führung Seiner Majestät, verstärkt den Angriff weiter, so das sich Rot letztlich doch gegen Wismar zurückziehen muss.
Über dem ganzen Gelände weht der beißende Geruch und Rauch des Pulvers.
Die zahlreich vertretenen Zuschauer kommen an diesem Manövertag zur Gänze auf ihre Kosten, zumal sich das Geschehen von den umliegenden Geländehöhen aus ausgezeichnet verfolgen lässt. Gegen 9.00 Uhr trifft die Kaiserin zu Pferd und in Begleitung einer ihrer Hofdamen im Kommandostand von Rot ein, um sich über das Geschehen zu informieren. In Begleitung einer Eskorte reitet sie dann zu Blau hinüber. „Im schwarzen Reitkleid mit Zylinderhut wurde sie von einem prächtigen Schwarzbraunen getragen“, notiert die lokale Presse.
Für viele Zuschauer ist jedoch die Abfahrtstelle der Hofzüge an der Haltestelle Bobitz gegen Ende des Manövertages der interessanteste Ort. Hier kann man die Herrschaften aus Mecklenburg und Berlin aus nächster Nähe in Augenschein nehmen, danach auch die Kaiserin, die sich vor der einsetzenden Abendkühle mit einem gelben Mantel schützt und dann in den Hofzug des Kaisers steigt. Viele Herrschaften waren auch aus Lübeck angereist und kehren jetzt mit diesem Sonderzug dorthin zurück, zusammen mit Vertretern der Presse.
Seine Majestät findet sich hier am späten Nachmittag ein, wo er seinen Bruder, Prinz Heinrich, antrifft. Zusammen mit Lord Lonsdale und seinem Begleiter, Oberst French, sowie weiteren hochrangigen ausländischen Militärs entwickelt sich noch vor der Rückfahrt eine angeregte Unterhaltung.
Während die Hauptakteure des Tages sich für die Nacht biwakmäßig einrichten, sind die Herrschaften auf der Rückreise in ihre angenehmeren Quartiere. Adel, hohe Militärs und handverlesene Gäste sind ins Schweriner Schloß geladen und dinieren diesen Abend in angenehmer Atmosphäre als Gäste des Kaisers. Natürlich steht das heutige Manövergeschehen im Mittelpunkt der Gespräche der Herren und Offiziere, die sich nach dem Speisen in den intimeren Rauchsalon zurückziehen, um die Konversation unter sich zu pflegen. Im Umfeld des Kaisers scharen sich mehrere Militärs, um dessen Ansicht über das heutige Manöver zu hören, gleichzeitig kommt es an einem in der Ecke stehenden kleinen Rauchtisch zu einem vertraulichen Zwiegespräch zwischen zwei hochrangigen Hofbeamten und dem Austausch einer wichtigen Neuigkeit.
„Ich habe aus London Nachricht erhalten. Man wird uns helfen, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen allerdings. Zunächst müssten alle bisherigen Erkenntnisse auf den Tisch.“
„Das dürfte doch wohl kaum möglich sein. Schon gar nicht gegenüber einem Engländer. Bedenken Sie das hohe Risiko einer womöglich zusätzlich kompromittierender schriftlichen Mitteilung. Wenn diese in falsche Hände geriete!“
„Dann dürfte daraus nichts werden.“
„Aber er muss!“
„Nicht so laut, wir dürfen kein Aufsehen erregen. Es gibt noch weitere Komplikationen: es wird nur über einen vertraulichen Kurier erfolgen können, und – es müssen, wie gesagt, alle Tatsachen und Hintergründe, alle bisher erfolgten Maßnahmen präzise geschildert werden. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Der Mann ist der einzige, der uns, besser noch ‚Ihm‘, helfen könnte. Es geht um sein Ansehen und das des Reiches. Es darf keinen neuen Skandal geben, und es muss möglichst schnell geschehen!“
„Dann soll der Bismarck das in die Hand nehmen.“
„Auf keinen Fall! Zum einen ist er schwer erkrankt, zum anderen hat sich sein verstorbener Bruder vor Jahren die Finger an einer ähnliche Affaire verbrannt, und daher wird er den Teufel tun, jetzt seinen Kopf hinzuhalten.“6
„Davon habe ich nichts gewusst.“
„Das konnten Sie auch nicht. Das Geheimnis wurde gut bewahrt. Nur weil ich damals in Hanau als junger Beamter Dienst tat und Wilhelm Bismarck dort Landrat war, wurde ich als Kurier eingesetzt und in einige Details eingeweiht. Heute ist die ganze Affaire nicht mehr aktuell und von keiner Brisanz, im Gegensatz zu der jetzt anliegenden Geschichte.“
„S.M. neigt anscheinend zu solchen kleinen peinlichen Affairen.“
„Das kann man wohl sagen. Vielleicht hängt das mit den Manövern zusammen. Jedenfalls war es damals auch ein Kaiser-Manöver, bei dem von Arnim unserem Allergnädigsten Thronprinzen behilflich war und ihn mit der charmanten „Miss Love“ in der Nähe von Straßburg zusammenbrachte. Ich habe nie verstanden, warum S.M. im Nachhinein der Dame glühende Liebesbriefe zukommen ließ. Ja, er hat sie sogar nach Potsdam nachkommen lassen. Als er sich dann aber um die Kosten seines Abenteuers drückte, wandte sich die Dame an ihren Freund Bill Bismarck und drohte sogar, das Ganze öffentlich zu machen, sollte sie nicht mindestens ihre Kosten und ein wenig mehr für ihre Umstände erstattet bekommen. S.M hat alles starrköpfig abgestritten, anscheinend aber den Bismarcks nie verziehen, dass sie um diese Geschichte wussten. Sie haben damals sogar die erforderliche Summe selbst aufgebracht, um dem Kaiser den Rücken freizuhalten; dafür aber alle Originalunterlagen später selbst unter Verschluss genommen. Da sind sie gut aufgehoben. Wie gesagt, das liegt nun schon mehr als sechzehn Jahre zurück, sollte aber trotzdem nicht in die Öffentlichkeit gelangen.“
„Selbstverständlich nicht, schon gar nicht unter Berücksichtigung der neuen Affaire.“
„Ja, die jetzige Dame in Kiel scheint ebenfalls an einer größeren Summe interessiert zu sein und S.M. weigert sich standhaft, überhaupt die Dame zu kennen. Nun existiert aber in diesem Fall eine Liebeserklärung, sogar mit Photo und handschriftlich. Deren Veröffentlichung wäre mehr als aufsehenerregend, vor allem im Ausland und ein Futter für die Skandalpresse. Daher auch meine Bedenken gegen unsere englische Hilfe.“
„Das versteh ich wohl, kann Ihnen aber versichern, dass unser Gewährsmann äußerst verschwiegen und honorig ist, gerade wenn es um Aufträge von hochgestellten Persönlichkeiten aus dem In- oder Ausland geht. Es gibt eine Empfehlung aus einem ähnlich gelagerten Fall aus dem Jahre '91, den er auch grandios gelöst hat. Ich nehme an, dass es ihm hier auch gelingen wird.“
„Wann wird er hier eintreffen? Die Zeit drängt ein wenig, ebenso wie das liebe Fräulein.“
„Ich deutete schon an: er kann nicht selbst kommen, er hat bereits einen vertrauten Mitarbeiter auf den Weg geschickt.“
„Einen Mitarbeiter! Das kann ja wohl nicht wahr sein!“
Die Lautstärke des Gespräches drohte, die anderen Herren im Zimmer aufmerksam werden zu lassen.
„Beruhigen Sie sich, es handelt sich dabei um den langjährigen Partner und Freund, der ihm in vielen diskreten Fällen eine unersetzliche Hilfe gewesen ist. Er ist mit Sicherheit genauso verschwiegen wie der Detektiv selbst.“
„Ich hoffe das, auch in Ihrem Interesse. Es darf hier nichts schief gehen. Verstehen Sie! Garnichts! Am besten wäre es, wenn das kompromittierende Beweisstück unauffällig dem lieben Fräulein abgenommen werden könnte. Das müsste sich doch auch ohne fremde Hilfe bewerkstelligen lassen.“





























