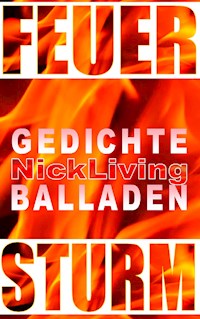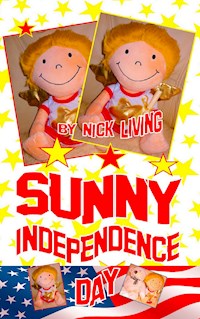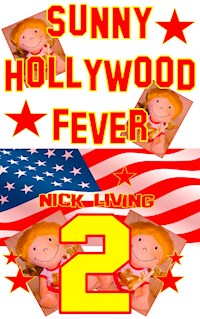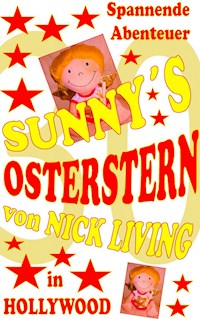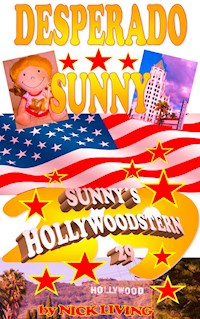Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es sind so manche Unabänderlichkeiten, die gewisse Lebensveränderungen in sich bergen. Da drohen Lawinen, da erscheinen Schneemenschen, da weist letztlich Mutters Licht den rechten Weg nach Hause. Immer müssen Menschen mit unvorhergesehenen Dingen zurechtkommen, ohne zu wissen, ob sie es schaffen. Doch bleibt bei jeder Geschichte letztlich immer wieder offen, wie es weitergeht. Denn auch im wirklichen Leben stehen wir oft vor Entscheidungen, die unser Leben irgendwie beeinflussen. Dann bleiben Fragen: Finden wir den besten Weg? Resignieren wir oder sind wir am Ende morgen schon ein König?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Das schönste Geschenk
Das alte Ehepaar
Die Gedenktafel
Das alte Auto
Zwischenfall
Fische
Schneemenschen
Der Schornsteinfeger
Hillis Wunder
Mutters Licht
Das Beste im Leben
Die alte Schreibmaschine
Engel der Träume
Babyklappe
Schokoladenweihnachtsmann
Die Quelle
Jobsuche
Krimi
Verkauf
Bist du noch da?
Schiffsreise
Lawine
Lederjacke
Der Schatz
Die Kutsche
Gesangsunterricht
Nachtspaziergang
Der Ring
Das Wichtigste auf dieser WeltSind stets das Leben und die KraftIst Hoffnung, die uns sicher hältUnd Liebe, die uns leidend macht
Das schönste Geschenk
Es war im Sommer 69. Ich lebte von meinem Mann getrennt – er arbeitete im Ausland, ziemlich weit weg. Sicher, es war schwer, den Jungen allein groß zu ziehen. Ich arbeitete damals in Chemnitz als Säuglings-und Kinderkrankenschwester in drei Schichten. Auch wenn wenig Zeit blieb, unternahm ich so oft ich konnte etwas mit meinem Sohn. Stundenlang gingen wir spazieren. Und als ich ihm das lang ersehnte Fahrrad schenkte, konnte er unterwegs sein und mit seinen Freunden baden fahren. Meine Mutter half mir in dieser schweren Zeit wo sie nur konnte. Mit vereinter Kraft kamen wir über die Runden. Und obwohl die damalige DDR viel für junge Mütter tat, musste man doch zusehen, wie man die Dinge unter einen Hut bekam. In diesem Sommer jedenfalls war es besonders schön. Es war ein wunderschöner Som-mer am Meer. Ein FDGB-Ferienplatz, der kaum Wünsche offen ließ. Meinem Sohn gefiel es am Meer. Er war und ist eine regelrechte Wasserratte. Doch bereits auf der Heimreise hatte ich immer wieder diese bohrenden Schmerzen im Oberbauch. Ich konnte es mir einfach nicht erklären. All diese wundervollen Tage am Meer. Die Wanderungen, das Schwimmen – ich hatte nie etwas bemerkt. Und nun? Pit, mein damals achtjähriger Sohn durfte nichts von alledem mitbekommen. Darauf achtete ich sehr. Doch in der Nacht, als wir im Schlafwagen in die Heimat zurück fuhren, konnte ich vor Schmerzen kein Auge zu tun. Nervös lief ich den langen Gang vor dem Abteil auf und ab. Der Schaffner fragte mich, ob er mir helfen könnte. Doch ich winkte nur ab und zwang mir dabei ein verkrampftes Lächeln aufs Gesicht. Irgendwie musste es gehen! Natürlich fielen mir seine besorgten Blicke aufwieder und wieder kam er aus seinem Dienstabteil und rollte bedenklich mit den Augen. Am nächsten Morgen, längst hatte ich den Frühstücksbeutel aus der Reisetasche gekramt und die Thermoskanne mit Früchtetee auf die Ablage unterm Fenster abgestellt, weckte ich meinen Sohn. Verschlafen schaute er mich an. „Wir sind bald da. Komm, Du musst noch etwas frühstücken.“, sagte ich leise. Die Schmerzen hatten merkwürdigerweise etwas nachgelassen. Auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof half mir der Schaffner aufopferungsvoll, die schweren Koffer aus dem Abteil zu tragen. „Kann ich sonst noch was für Sie tun, junge Frau?“, meinte er nur. Ich verneinte. „Na denn, kommen Sie gut heim.“
Pit sprang schon übermütig auf dem Bahnsteig herum und zählte die einfahrenden Züge. Ich war glücklich, ihm wieder einen schönen Urlaub ermöglicht zu haben. Doch plötzlich kehrten die Schmerzen zurück. Sie wurden stärker und stärker. Zeitweise wurde mir so schlecht, dass ich die Koffer absetzen musste, um tief durch zu atmen. Und da waren auch diese quälenden Ängste. Was, wenn ich nicht mehr in der Lage wäre, mich um meinen Sohn zu kümmern? Was, wenn ich plötzlich… Ich konnte diesen Gedanken nicht zu Ende denken, denn ich spürte bereits, wie die ersten Tränen aus den Augen rannen. Hastig zog ich ein Zellstofftaschentuch aus der Tasche und wischte mir heimlich die Augen trocken. Hoffentlich hatte Pit nichts bemerkt. Doch der schien bester Laune und hatte bereits einen kleinen Eisstand im Visier. Nur nicht an die Schmerzen denken, so zwang ich mich, du musst deinen Jungen groß bekommen! Du hast für ihn da zu sein! Du MUSST!
Die Bahnfahrt bis in unsere kleine Stadt schien sich mein Körper an die drastischen Befehle zu halten. Doch als wir endlich daheim auf dem kleinen Bahnhof ankamen, hielt ich es vor Schmerzen einfach nicht mehr aus. Ich drückte Pit zwanzig Pfennig in die Hand und bat ihn, bei Evi und Kurt, meiner Schwester und meinem Schwager, anzurufen. Sie besaßen ein Fahrzeug und sollten uns vom Bahnhof abholen. Es dauerte nicht lange bis sie kamen. Sie bemerkten sofort, dass mit mir etwas nicht stimmte. Ich wollte es ihnen erklären. Doch dazu kam ich nicht mehr. Mir wurde übel und taumelig. Ich spürte, wie ein leichtes Taubheitsgefühl durch meine Gliedmaßen fuhr und mir die Kräfte nahm. Große Angst machte sich breit, vor allem die Angst um meinen Sohn. Was sollte nur aus ihm werden, wenn ich kein Geld mehr verdienen konnte? Niemals wollte ich ihn in irgendein Heim geben. Ich musste doch für ihn da sein. Evi rief den Notarzt an. Frau Dr. Müller kam sofort. Sie war eine gute Freundin und ihre Praxis lag nicht sehr weit entfernt. Wenigstens kein fremder Arzt, dachte ich nur. Plötzlich bekam ich keine Luft mehr. Ich röchelte nur noch und ein schneidender Schmerz zuckte durch meinen Leib. Die Sinne schwanden mir, ich fiel und fiel, endlos tief. Ich sah viele Etappen meines Lebens an mir vorüber ziehen, sah die Geburt meines Sohnes.
Und am Ende eines seltsamen Tunnels erkannte ich ein weißes, warmes, wunderbares Licht. Rasch kam es näher, alle Schmerzen vergingen und mir wurde leicht, so unendlich leicht. Unter mir breitete sich die Erde aus, eine Szenerie wie in einem ScienceFiction-Film. Ich sah, wie sich Ärzte über eine leblose Frau beugten, wie die Frau beatmet wurde, wie ein kleiner Junge weg geführt wurde – ich wusste damals nicht, dass ich mich selber sah. Das weiße Licht war plötzlich so nah, dass ich es beinahe greifen konnte, da flackerte plötzlich ein greller Blitz auf und abrupt wurde es schwarz um mich herum! Nur eine leise Stimme sang aus der Ferne:
Oh Du wundervolles Leben, DuGabst mir viel, doch niemals RuhGabst mir meinen lieben SohnGabst mir Kraft als schönsten Lohn
Oh Du wundervolles Leben, achHalte meine Sinne wachDenn mein Sohn braucht mich so sehrLass nicht zu, dass ich verlier
Wenn´s Dich gibt, Du lieber Gott,mach gesund mich, mach mich flottMeine Zeit, ich spüre es,ist nicht um – muss leben jetzt!
Als ich erwachte, fiel mein Blick auf ein kleines geöffnetes Fenster gegenüber von meinem Bett. Ich versuchte, mich aufzurichten, doch es gelang mir nicht. Kraftlos fiel ich in die weißen Kissen zurück. Ich riss die Augen auf, wollte irgendetwas sehen, doch ich war einfach zu müde. Immer wieder fielen mir die scheinbar schweren Augenlider zu. Aus der Ferne vernahm ich eine Stimme. Sie rief fortwährend meinen Namen: „Hallo Frau Vogt! Aufwachen! Frau Vogt, hören Sie mich?“
Mühsam gelang es mir endlich, meine Augen einen winzigen Spalt zu öffnen. Schemenhaft erkannte ich weit über mir das Gesicht einer jungen Frau. Ihre dunklen Haare hoben sich unnatürlich grell von ihrer weißen Bekleidung ab. Sie lächelte mich an. Ich glaubte, im Himmel angekommen zu sein. War das ein Engel? „Wo bin ich?“, hörte ich mich wispern. Mit beruhigender Stimme sagte die junge Frau: „Sie sind im Krankenhaus. Und sie haben die Operation gut überstanden. Ich bin Schwester Ina.“ Ungläubig starrte ich die Schwester an. Ich glaubte wohl noch immer, im Himmel zu sein. Doch so langsam kehrten die Erinnerungen zurück. Und seltsam verwirrt säuselte ich: „Operation? Was für eine Operation, und wo ist mein Sohn?“
Ich erholte mich schnell. Pit war bei meiner Mutter, die sich rührend um ihn kümmerte. Später erfuhr ich, dass ich zusammen gebrochen war. Die Ärztin brachte mich umgehend ins Krankenhaus. Dort wurde mir die Gallenblase entfernt. Außerdem diagnostizierte man eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse bei mir. Der behandelnde Arzt offerierte mir, dass dieses Leiden nicht besser werden würde. Im Gegenteil, ich müsste nun erstrecht sehr stark auf meine Gesundheit achten. Ich durfte nicht mehr alles essen und brauchte etliche Medikamente. Insgesamt sechs Wochen lag ich im Krankenhaus. Nur an den Besuchstagen sah ich meinen Sohn, den meine Mutter jedes Mal mit brachte. Es brach mir damals fast das Herz, ihn so traurig zu sehen. Evi und Kurt brachten mir alle drei Tage frisches Obst, obwohl ich es eigentlich noch gar nicht essen durfte. Alle waren sehr bemüht und sorgten sich sehr. Doch es wollte einfach nicht aufwärts gehen mit mir. Eines Nachts starb Irene, mit der ich all die lange Zeit im Zimmer lag. Sie litt an der gleichen Krankheit. Ihre Bauchspeicheldrüse hatte einfach aufgehört zu funktionieren. Ich mochte sie sehr, und dieses Erlebnis brachte mich beinahe an den Rand der Verzweiflung. Es warf mich um Wochen zurück. Ich weinte sehr viel in dieser Zeit. Manchmal hörte ich meinen Sohn, wie er vor dem Fenster meines Krankenzimmers stand und nach mir rief: Hallo Mami, bist Du da? Wie geht’s Dir?“ Ich schleppte mich dann zum Fenster, nur um ihn zu sehen. Das gab mir wieder die nötige Kraft, um weiter durchzuhalten. Denn oft wusste ich nicht, wie lange ich all das noch ertragen könnte. In einer der folgenden Nächte wurde ich von einem lauten Geräusch aus meinem leichten Schlaf gerissen. Es musste von draußen kommen. Ich hob mich umständlich aus dem Bett und wankte zum Fenster. Draußen fielen dicke Flocken vom Himmel und vor dem Haus stand eine sehr hohe Tanne. Ihre Zweige wurden vom Wind immer wieder an die Scheiben geweht. Ich legte mich zurück ins Bett, wollte weiterschlafen. Da fiel plötzlich ein helles Licht, welches über der Tanne zu schweben schien, auf mein Bett. Ich erschrak, dachte im ersten Moment, jemand würde mit einer Taschenlampe vor meinem Fenster herum spielen. Doch wer sollte um diese Zeit mit einer Taschenlampe in ein Krankenzimmer leuchten? Ich blinzelte in den Lichtstrahl hinein. Doch so sehr ich mich auch mühte, ich konnte nicht erkennen, woher es wirklich kam. Mir blieb nichts weiter übrig, als noch einmal aufzustehen und den Vorhang herüberzuziehen. Dann würde ich wenigstens nicht mehr so geblendet. Als ich am Fenster stand, schaute ich noch einmal hinauf zu dem mysteriösen Licht. Es kam geradewegs aus den Wolken. Mit ganzer Kraft traf mich der vermeintliche Lichtkegel. Doch was war das? Obwohl es recht kühl im Zimmer war, wurde mir plötzlich warm, angenehm warm. Wie genannt starrte ich in das Licht. Es wurde nicht nur wärmer. Auch fühlte ich mich in diesem Augenblick stark, so stark wie nie vorher. Wie kam das nur? Instinktiv faltete ich meine Hände und sprach ein Gebet. Dabei dachte ich immerzu an meinen Sohn, der jetzt vielleicht schlaflos in seinem Bettchen lag und an seine Mami dachte. Plötzlich verlosch das Licht. Ich wollte noch eine Weile am Fenster bleiben, vielleicht kehrte es ja zurück. Doch die Kälte zwang mich schließlich, mich wieder ins Bett zurückzulegen. In dieser Nacht hatte ich einen seltsamen Traum. Ich sah mich, wie ich plötzlich aus mir selbst emporwuchs. Ich sah mich mit meinem Sohn und meiner Familie unterm Tannenbaum sitzen. Wir umarmten uns und feierten Weihnachten. Es war ein wunderschöner Traum. Alles schien so real. Ich glaubte, alles würde wirklich geschehen, ich hoffte es so sehr. In den folgenden Tagen besserte sich mein Zustand zusehends. Schließlich konnte ich aus dem Krankenhaus entlassen werden. Mein Sohn und meine Mutter holten mich ab. Weinend fielen wir uns in die Arme. All die schwere Zeit, all das Leid schienen wie weggefegt. Und mir wurde mein sehnlichster Wunsch erfüllt- ich durfte meinen Sohn wieder an mein Herze drücken. Ich durfte mit ihm sprechen und ihn streicheln, so wie früher. Auch mein Arzt kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Er gestand mir, so etwas noch nie erlebt zu haben. Und ich konnte mein Glück einfach nicht fassen.
Was ist´s nur für Freude - ach, was für ein TagKann´s nicht beschreiben, was ich auch sagZu spüren, zu fühlenEs geht wieder gutDie Lieben zu sehen, das macht so viel Mut
Die Nächte, die Sorgen, all das ist vorbeiIm Herz, in der Seele bin ich wieder freiIch wollt nur noch weinen vorFreud und vor GlückVoll Dank kann ich sagen: Ins Leben zurück!
Am Heiligabend desselben Jahres war ich wieder zu Hause. Ich besorgte eine wunderschöne Kiefer. Und wie an jedem Weihnachtsfest putzten mein Sohn und ich den Baum einen Tag vor dem Fest an. Am Heiligen Abend waren wir dann alle zusammen. Es war mein schönstes Geschenk, wieder gesund geworden zu sein. Es war das allerschönste Geschenk, zusammen mit meinem Sohn und mit meiner Familie das Weihnachtsfest erleben zu können. Von dem seltsamen Erlebnis mit dem Licht hatte ich niemandem erzählt. Es blieb mein Geheimnis. War es das Licht oder meine eigene Kraft, die mich so stark werden ließ? Ich denke, es war wohl beides zusammen. In den folgenden Nächten beobachtete ich eine helle Sternschnuppe, die zwischen all den Myriaden von Sternen und unzähligen Wünschen der Menschen geheimnisvoll über das Dach unseres Hauses huschte und mir sagte, Du bist stark und wirst es schaffen…
Das alte Ehepaar
Während meines Studiums hatte ich mich in einem kleinen Haus am Stadtrand eingemietet. Das Haus lag am Ende einer schmalen Straße und befand sich vor einem großen Waldstück. Es war ein idyllischer Ort, der nur leider ein bisschen weit von der Uni entfernt lag. Aber es war das preiswerteste Angebot, welches ich finden konnte. Allerdings war es auch die spannendste und unfassbarste Zeit meines Lebens, die ich dort verlebte. Das alte Ehepaar, Marga und Kurt, welches mir das kleine Zimmer vermietete, lebte sehr zurückgezogen in dieser abgelegenen Gegend. Sie erschienen mir ein bisschen wunderlich und trugen beide seltsame silberne Ketten mit großen bunten Steinen um den Hals. Die beiden waren nicht mehr sehr gut zu Fuß und weil sie sich wegen ihrer kleinen Rente nicht jedes Mal einen Boten leisten konnten, der ihnen die Einkäufe erledigte, erklärte ich mich bereit, ihnen die nötigsten Einkäufe in der Stadt zu erledigen. Dafür durfte ich sogar meinen Computer an deren Telefonanlage anschließen und jeden Tag eine Stunde im Internet surfen. Eines Tages fiel mir auf, dass mich der ziemlich unangenehme Sohn der Nachbarsfamilie argwöhnisch beobachtete. Immer, wenn ich von der Uni kam, passte er mich ab und gab zweifelhafte Kommentare von sich. Ich hatte ihm nichts getan, aber er schien mich aus irgendeinem Grunde zu hassen. Immer wieder hatte er meinen Wagen attackiert, in dem er die Reifen zerschnitt oder den ohnehin beschädigten Lack mit weiteren unschönen Kratzern verunstaltete. Obwohl ich ihn einmal dabei ertappte, ihn warnte, dass zu unterlassen, ließ er es nicht. Ich konnte mir einfach keinen Reim darauf machen, warum er das tat. Und weil dieser Typ einfach keine Ruhe gab, erzählte ich das den beiden Alten. Allerdings kam ich mir irgendwie schuldig dabei vor, denn ich wollte sie nicht mit meinen Schwierigkeiten belasten. Sie sollten keinen Ärger wegen mir bekommen. Doch Marga winkte ab. Sie meinte, dass sie schon Schlimmeres gehört hätte und ich mir keine Sorgen machen müsste. Außerdem ergänzte sie noch, dass es gut wäre, es ihr gesagt zu haben. Sie spendierten mir sogar vier neue Reifen, was mir besonders unangenehm war. Als ich am nächsten Tag wieder sehr spät von der Uni kam, vermisste ich den aufdringlichen Kerl. Auch an den darauf folgenden Tagen wurde ich nicht belästigt und mein Wagen wurde in Ruhe gelassen. Ich freute mich natürlich darüber. Dennoch stutzte ich, als eines Tages die Polizei vor dem Nachbargrundstück hielt. Kurt erzählte mir mit einem merkwürdigen Unterton, dass der Nachbarssohn verschwunden sei. Seit Tagen wäre er vermisst und man könnte sich keinen Reim darauf machen, wo er sei. Man hatte lediglich eine Blutlache im Keller des Anwesens finden können. Mir lief ein eiskalter Schauer über den Rücken und ich wusste nicht so genau, ob ich weiter in dieser verlassenen Gegend bleiben wollte. Vielleicht sollte ich mir doch eine teurere Bleibe in der Stadt suchen? Marga jedoch wollte davon nichts wissen. Mit einer seltsamen Gelassenheit tat sie die ganze Angelegenheit ab. Vielmehr meinte sie, dass die Nachbarn ohnehin nicht sehr freundlich seien und sie immer aufpassen mussten, dass sie den Gartenzaun nicht demolierten.
Immerhin sei das schon einige Male geschehen. Weil die beiden so lax mit dieser Sache umgingen, machte auch ich mir keinerlei Gedanken mehr um das Verschwinden des Nachbarssohnes. Trotzdem bemerkte ich, dass die Nachbarn von Tag zu Tag immer aggressiver wurden. Sie beschimpften Kurt und Marga über den Gartenzaun und warfen diverse Gegenstände auf deren Grundstück. Eines Abends schien es Marga satt zu haben. Sie stand am Zaun und stritt sich lautstark mit der Nachbarin. Diese sparte nicht mit diversen Kraftausdrücken und Marga hatte ihre liebe Not, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Was sie dann aber von sich gab, ließ mir keine Ruhe. Gerade wollte die Nachbarin zu einer neuerlichen Hasstirade ausholen, da brüllte Marga mit unerwartet rauer Stimme: „Halt den Mund! Oder Du wirst nie mehr etwas sagen können, das schwöre ich Dir!“ Kaum hatte sie das der erschrockenen Nachbarin an den Kopf geworfen, wandte sie sich ab und verschwand im Haus. Ich hatte alles von meinem Zimmer, welches sich unterm Dach befand, beobachtet.
Die Nachbarin stand noch einige Zeit wild gestikulierend am Zaun, verschwand dann aber ebenfalls. In der darauf folgenden Nacht konnte ich vor Nervosität einfach nicht schlafen. Einerseits stand mir am nächsten Tag eine schwierige Klausur bevor und andererseits gingen mir Margas Worte nicht mehr aus dem Sinn. Was hatte sie nur damit gemeint: Oder Du wirst nie mehr etwas sagen? Gegen Mitternacht gelang es mir, endlich die Augen zu schließen und es sah so aus, als ob ich einschlafen könnte. Doch dieses Gefühl währte nicht sehr lange. Denn ich wurde von einem merkwürdigen Geheul aufgeweckt. Sofort fuhr ich hoch und schaltete die kleine Nachtischlampe ein. Das Fenster zum Hof stand offen und ich glaubte, dass dieses Geheul von dort kam. Ich stand auf und schaute durch die Gardine hinaus. Doch ich konnte einfach nichts erkennen. Ich schaltete das Licht wieder aus und erhoffte mir, auf diese Weise etwas mehr zu sehen. Aber da war nichts, nur ein außergewöhnlich großer Hund sprang in Richtung des Nachbargrundstückes über den Zaun. Ich tröstete mich damit, dass vielleicht dieser große Hund so laut geheult hatte. Am nächsten Morgen berichtete ich den beiden Alten von meiner nächtlichen Beobachtung. Die zwei wurden sehr schweigsam und warfen sich einen viel sagenden Blick zu. Doch dann waren sie so wie immer und Marga fragte mich lächelnd, ob ich ihnen wieder etwas aus der Stadt mitbringen könnte. Natürlich bejahte ich das und fuhr wenig später in die Uni. Dort hatte mich irgendjemand bei einem meiner Dozenten denunziert. Der Dozent, der mich ohnehin schon lange auf dem Kieker hatte, bestellte mich in sein Büro und befragte mich zu einer diversen schwarzen Nebenbeschäftigung. Ich wusste nicht, was er meinte und sagte ihm, dass ich nach der Uni lediglich für meine Wirtsleute Besorgungen in der Stadt erledigen würde. Doch der Dozent schien sich nicht beeindrucken zu lassen und fuhr mich unhöflich an, dass ich die Wahrheit sagen müsste, sonst würde er mich anzeigen. Ich wusste nicht, was dieser plötzlich Ausbruch bedeutete, konnte nur ahnen, dass mich irgendjemand loswerden wollte. Vermutlich war ich irgendjemand zu gut und sollte nun von der Uni gemobbt werden. Der Dozent gab mir eine Galgenfrist bis zum nächsten Tage. Sollte ich bis dahin nichts von meiner angeblichen Schwarzarbeit gesagt haben, würde er mich sofort bei der Polizei anzeigen. Natürlich konnte ich ihm sagen was ich wollte, er war derart aufgehetzt, dass es sinnlos war, dem Ganzen etwas entgegen zu setzen. Etwas eingeschüchtert fuhr ich in meine Unterkunft zurück. Marga merkte sofort, dass irgendetwas mit mir nicht stimmte. Sie fragte mir regelrecht Löcher in den Bauch und schließlich berichtete ihr von meinem unschönen Erlebnis. Ich erzählte ihr von dem wütenden Dozenten, der mich augenscheinlich loswerden wollte oder sollte. Marga reagierte wieder mit dieser sonderbaren Gelassenheit. Sie verzog nicht einmal ihr Gesicht, als sie meinte, dass