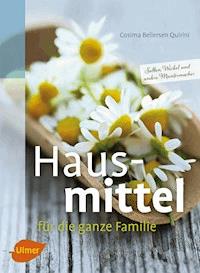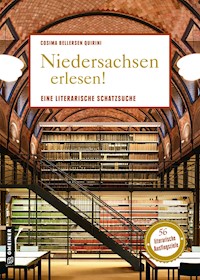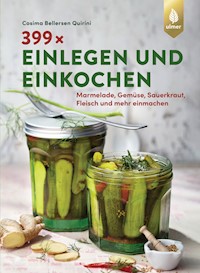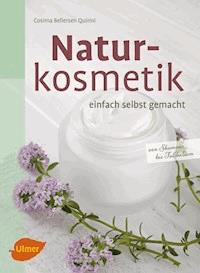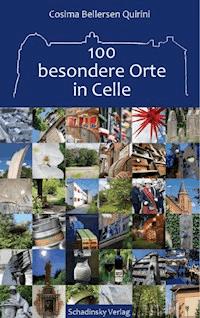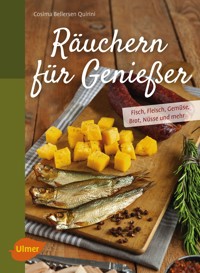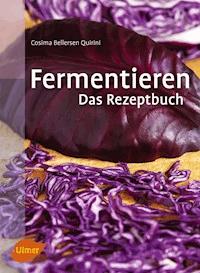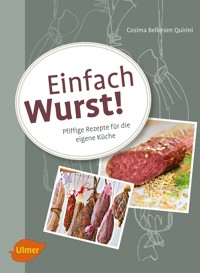Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Kultur erleben im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Geschichte wurde lange Zeit ohne Frauen geschrieben. Doch welche Möglichkeiten gab es für sie, sich trotzdem bemerkbar zu machen und aus dem eng gefassten Gefüge herauszutreten? Der vorliegende Band gibt Einblick in das Leben von 77 Frauen, die auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Niedersachsen gelebt und gearbeitet haben. Sie alle haben sich mit ihren Ideen, Begabungen und Überzeugungen, ihrer Tatkraft und ihrem Mut in einer Zeit hervorgetan, in der dies meist kaum möglich war. Doch ihr Tun wirkt teils bis in die heutige Zeit nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cosima Bellersen Quirini
77 Frauenspuren in Niedersachsen
Impressum
Ausgewählt durch Claudia Senghaas
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild - ullstein bild
ISBN 978-3-8392-6216-0
Widmung
Für meine Töchter
Vorbemerkung
Liebe Leserin, lieber Leser, Leben und Wirken von Frauen in der Geschichte gehören zu unserem kulturellen Erbe. Frauengeschichte und Frauenkultur müssen jedoch in der Erinnerungskultur in unseren Städten und Regionen und nicht zuletzt im Land noch fester verankert werden. Ausgehend von dieser kultur- und frauenpolitischen Überzeugung hat der Landesfrauenrat Niedersachsen e.V. 2008 die Initiative frauenORTE Niedersachsen ins Leben gerufen.
Hierbei werden erstmals Stadt-, Regional- und Landesgeschichte aus der Perspektive historischer Frauenpersönlichkeiten betrachtet. Erzählt wird von ihren Leistungen, die sie auf politischem, kulturellem, sozialem, wirtschaftlichem und/oder wissenschaftlichem Gebiet vollbracht haben. Darüber hinaus wird beleuchtet, wie dieses Wirken die Kultur-, Sozial- und Landesgeschichte nachhaltig beeinflusste.
Wir freuen uns sehr, dass sich Cosima Bellersen Quirini zusammen mit dem Gemeiner Verlag auf Spurensuche begeben hat. Gern haben wir die Autorin und den Verlag in ihren Bemühungen unterstützt, ein breites Spektrum interessanter Frauenpersönlichkeiten in diesem Buch zu präsentieren. 27 der dargestellten Frauen werden im Rahmen unserer Initiative gewürdigt, die aktuell an 42 Standorten in Niedersachsen sichtbar wird.
Weitere Informationen unter www.frauenorte-niedersachsen.de
Ich wünsche Ihnen viel Freude und neue Erkenntnisse beim Lesen.
Marion Övermöhle-Mühlbach
Vorsitzende des Landesfrauenrates Niedersachsen e.V.
*
Geschichte wurde lange Zeit ohne Frauen geschrieben, die als Gestalterinnen der Gesellschaft Jahrhunderte lang nur wenig Beachtung fanden und somit für eine zeitgenössische Erfassung und Dokumentationen kaum existent waren. Gewiss, einige fanden Erwähnung, doch es war vor allem Männern vorbehalten, »die Welt zu bewegen und Geschichte zu schreiben« und damit auch in die historischen Darstellungen einzugehen. Etwa 50 Prozent der Menschheit waren stets – und sind noch immer – Frauen. Nur von der weiblichen Hälfte der Bevölkerung wissen wir heute noch viel zu wenig. Wie lebten die Frauen und Mädchen? Wie sah ihr Alltag aus? Welche Möglichkeiten hatten sie, sich bemerkbar zu machen?
In neuerer Zeit rücken vermehrt weibliche Biografien in den wissenschaftlichen Fokus und bilden ein spannendes Forschungsfeld, welches den Themen Frauengeschichte und Frauenkultur ein neues Bewusstsein verschafft. Zu den Frauen, die einst auf zahlreichen Gebieten von sich reden machten, muss das Wissen um ihr Wirken geschärft werden und das Kapitel um ihr Tun, ihre Ideen und Ideale, für die sie seit Jahrhunderten einstehen und unermüdlich kämpfen, immer wieder aufgeschlagen, in den Vordergrund gerückt und neu geschrieben werden, damit nichts davon verloren geht.
So soll der vorliegende Band mit 77 biografischen Texten einen Blick auf einige jener Frauen auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Niedersachsen werfen, die sich in einer Zeit hervorgetan haben, in der dieses kaum möglich war, und die trotzdem aus ihrem eng gefassten Gefüge heraustraten.
Ihnen, wie vielen weiteren Frauen, gebührt ein großer Platz in der literarischen wie historischen Darstellung – und zwar ganz ebenbürtig direkt neben den Männern.
Celle, im Juni 2019
Cosima Bellersen Quirini
Die Autorin und der Verlag danken der Initiative »frauenORTE Niedersachsen« für die Unterstützung dieses Buchprojektes.
Inhalt
Impressum
Widmung
Vorbemerkung
Inhalt
Adolphine Luise Cooper Hildesheim
Agnes KarllEmbsen
Agnes und Leonie Meyerhof Hildesheim
Agnes von Dincklage Obernkirchen
Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel Wolfenbüttel
Anita Augspurg Verden
Anne Kistner Hannover
Antje Brons Emden
Bertha Krupp von Bohlen und Halbach Nordhorn
Caroline Ernst Oldenburg
Caroline HerschelHannover
Caroline von Linsingen Emmerthal
Catharina Helena Dörrien Hildesheim
Catherine Nobbe Rinteln an der Weser
Charlotte von Veltheim Helmstedt
Charlotte Kestner Hannover
Claire Waldoff Hannover
Clara Rilke-Westhoff Fischerhude
Dora Garbade Ganderkesee
Dorothea von Schlözer Göttingen
Edith Stein Göttingen
Éléonore Desmier d’Olbreuse Celle
Eleonore Prochaska Dannenberg (Elbe)
Elisabeth Maske Lüneburg
Elisabeth von Brandenburg Hann. Münden
Elise Bartels Hildesheim
Elsa Sophia von Kamphoevener Hameln
Else Wex Celle
Emilie Winkelmann Hannover
Emmy Noether Göttingen
Eva Lessing Jork
Fanny Moran-Olden Cloppenburg
Felicitas Rose Müden (Aller)
Frieda Duensing Diepholz
Friederike Riedesel Wolfenbüttel
Grete Gillet Nienburg/Weser
Grethe WeiserHannover
Greten Handorf Cuxhaven
Hannah ArendtHannover
Hedwig Bollhagen Hannover
Hedwig Kettler Hannover
Helene Charlotte von Bothmer Isernhagen
Helene Hartmeyer Rotenburg (Wümme)
Helene Lange Oldenburg
Hermine und Helene Edenhuizen Krummhörn
Hildegard Braukmann Großburgwedel
Iris Anna Runge Hannover
Johanna Stegen Lüneburg
Johanna Charlotte Unzer Helmstedt
Juliane zu Schaumburg-Lippe Bückeburg
Katharina von Hoya Wienhausen
Katharina von Kardorff-Oheimb Goslar
Lale Andersen Langeoog
Lou Andreas-SaloméGöttingen
Lisa Hausmann-Löns Hannover
Lisa Korspeter Celle
Luzie Uptmoor Lohne
Maria von Jever Jever
Maria Aurora von Königsmarck Agathenburg
Marianne Flügge-Oeri Clausthal-Zellerfeld
Marta Astfalck-Vietz Nienhagen
Mary Wigman Hannover
Mathilde Vaerting Messingen
Odilie von Ahlden Mariensee
Paula Modersohn-Becker Worpswede
Recha Freier Norden
Ricarda Huch Braunschweig
Roswitha von Gandersheim Bad Gandersheim
Sara Ann Delano Celle
Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg Ahlden
Sophie Lissitzky-Küppers Hannover
Sophie Löwe Oldenburg
Sophie von der Pfalz-Simmern Hannover
Sue Ryder Großburgwedel
Sibylle von Schieszl Wolfsburg
Vicki Baum Hannover
Wilhelmine Siefkes Leer
Bildnachweis
Adolphine Luise CooperHildesheim
Der evangelische Missionsdienst gilt heute als vergleichsweise fortschrittliche Einrichtung in Sachen Unabhängigkeit für Frauen im 19. Jahrhundert. Hier war es teilweise möglich, ein Betätigungsfeld zu finden, das Frauen ein gewisses Maß an Selbstständigkeit, Freiheit und eigenes Einkommen sicherte. Einer dieser Vereine war auch der 1850 in Berlin gegründete »Frauenverein für China«, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hatte, chinesischen Mädchen ein Heim und auch eine Ausbildungsmöglichkeit zu geben.
Die Pastorentochter Adolphine Luise Cooper, genannt Luise und im April 1849 als älterer Zwilling in Oppeln bei Neuhaus (Oste) geboren, hatte nicht nur den Wunsch nach Unabhängigkeit, sondern auch »ein herzliches Verlangen, dem Herrn unter den Heiden zu dienen«. Der Verein bot ihr beides – und so wurde die tiefgläubige Luise, bei der nicht nur die väterliche Toleranz, Herzenswärme, Streitbarkeit und Frömmigkeit, sondern auch das unruhige, weltoffene Wesen ihres englischen Großvaters, der einst als Arzt und Kaufmann viel gereist war, durchschlug, im nicht mehr ganz jungen Alter von 35 Jahren – vermutlich vorweg im Henriettenstift Hannover zur Diakonisse ausgebildet – im April 1884, als ihr Vater verstorben war, als Missionsschwester in das Findelhaus Bethesda nach Hongkong entsandt. Mit Mut, Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen kümmerte sie sich dort um blinde chinesische Mädchen, denen wegen ihrer Behinderung je nach Alter Tötung, Aussetzung, Ausstoßung, Verkauf, Prostitution oder Sklaverei drohte. Doch nach nur zwei Jahren war der Traum wieder vorbei: Luise, die bereits als Kind recht kränklich war (ihre Zwillingsschwester starb schon mit fünf Jahren), musste schweren Herzens in die deutsche Heimat zurückkehren, um ihr schweres Magenleiden zu kurieren. Mit ihrer Mutter und ihren Schwestern zog sie nach Hildesheim.
Der Wunsch zu helfen blieb. Luise Cooper gründete aus der Ferne ein Asyl für blinde Chinesinnen und im Jahr darauf in Hildesheim den Frauenmissionsverein, der mit der Fertigung und dem Verkauf von Handarbeiten die Arbeit in Asien unterstützte. Sie blieb bis zum Jahr 1926 Vorsteherin der Einrichtung. Zudem hielt sie Vorträge und veröffentlichte Texte, um auf das Los der Mädchen aufmerksam zu machen. Sie verstarb mit 82 Jahren im Dezember 1931 in Hildesheim. Die Hildesheimer Blindenmission besteht bis heute und betreibt die von ihr einst ins Leben gerufenen Blindenausbildungswerke sowie augenärztliche Dienste in China, Hongkong, Taiwan, Indonesien, Myanmar und auf den Philippinen. Eine Straße in ihrer Wahlheimat Hildesheim ist nach ihr benannt.
Agnes KarllEmbsen
»Krankenpflege ist eine Kunst, die wie jede andere vor allen Dingen eine Reihe angeborener Eigenschaften und Anlagen bedingt, ohne die auch die beste technische Schulung keinen Wert hat.« Das sind auch heute noch bedeutsame Worte einer zielstrebigen und mutigen Frau, die ihr Leben den Kranken widmete und als große Reformerin und Begründerin der modernen Krankenpflege gilt. Das Motto von Agnes Karll, im März 1868 in Embsen geboren, lautete: Per aspera ad astra – auf rauen Wegen zu den Sternen. Doch es forderte einige Umwege, bis sie den richtigen Pfad zu ihren ganz persönlichen Sternen fand.
In dem kleinen Ort, südlich von Lüneburg gelegen, verbrachte Agnes Karll ihre Kindheit und Jugend, bis sie mit der Idee, Lehrerin zu werden, nach Schwerin ging. Für die Lehrerinnenprüfung noch nicht alt genug, entschied sich die junge Niedersächsin daraufhin für eine Ausbildung zur Erzieherin und Privatlehrerin. Doch bald dämmerte es Agnes: Das Lehren war nichts für sie. Sie ging nach Hannover, absolvierte eine Ausbildung zur Krankenpflegerin und arbeitete danach in Göttingen und Berlin. Zeitweise war sie auch in Amerika unterwegs, wo sie sich über die dort übliche Art der Krankenpflege informierte. Fortan sollte sie zahlreiche internationale Kontakte pflegen. In jener Zeit begann sie auch damit, sich vermehrt berufspolitisch zu engagieren. Im Januar 1903 gründete Agnes Karll die »Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen Deutschlands sowie der Säuglings- und Wohlfahrtspflegerinnen«, heute »Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe«. Aus zunächst 30 Mitgliedern bestehend, erfuhr der Verband mit dem Lazaruskreuz im Logo rasch Zuwachs – nur ein Jahr später konnten bereits 300 Mitglieder gezählt werden, 1926 waren schon 3.200 verzeichnet. Damals war das Berufsbild der Krankenschwester kaum umrissen, es fehlte eine geordnete Ausbildung ebenso wie geregelte Arbeitszeiten, eine tarifliche Vergütung und Altersrente. Agnes Karll schuf hier umfassend Abhilfe. Wenige Jahre später wurde sie in London zur Präsidentin des Weltbundes der Krankenpflegerinnen und zum Ehrenmitglied der Oberinnen-Vereinigung in Großbritannien und Irland berufen, 1913 war sie eine der ersten Frauen, die als Dozentin an der Leipziger Frauenhochschule tätig sein durfte, 1926 leitete sie einen nationalen Kongress zur Krankenpflege in Düsseldorf. Sie schrieb zudem Teilkapitel zu dem umfassenden Lehrbuch »Geschichte der Krankenpflege«.
Agnes Karll starb 1927 mit 58 Jahren. Am Geburtshaus in Embsen erinnert heute eine kleine, unscheinbare Gedenktafel an die »deutsche Florence Nightingale, nach der in Deutschland heute einige Kliniken, Institutionen und Straßen benannt sind.
Agnes und Leonie MeyerhofHildesheim
Die eine erwarb sich einen Namen als Bildhauerin und Malerin, die andere schrieb unter einem Pseudonym und erreichte damit große literarische Geltung. Die Rede ist von den Schwestern Agnes und Leonie Meyerhof aus Hildesheim, die durch ihre jeweilige Kunst Berühmtheit erfuhren.
Agnes Meyerhof kam 1856 als Kind der Kaufmannsfamilie Magnus und Carolina Meyerhof, geborene Schwabe, zur Welt. Sie besuchte eine Höhere-Töchter-Schule und, angeregt durch die Mutter, erhielt das Mädchen bereits in recht frühen Jahren Zeichenunterricht. Einer ihrer Lehrer vor Ort war der Bildhauer Friedrich Küsthardt. Ihr Weg führte sie zur weiteren künstlerischen Ausbildung nach Frankfurt am Main, die Stadt, die ihr fortan Lebensmittelpunkt bleiben sollte. Hier arbeitete Agnes jahrzehntelang als Kunstmalerin. Sie liebte besonders Tier- und Pflanzenmotive. Einige ihrer Werke sind heute im Frankfurter Städel-Museum zu finden. Als Jüdin wurde Agnes Meyerhof vom NS-Schicksal nicht verschont. 86-jährig wurde sie am 19. August 1942 von Frankfurt Richtung Theresienstadt deportiert und verstarb nur drei Tage später.
Leonie war das jüngste der fünf Meyerhof-Kinder und kam 1860 zur Welt. Sie besuchte ebenfalls die Töchter-Schule und erhielt früh Zeichenunterricht, dichtete als Kind schon eigene kleine Verse und interessierte sich für Philosophie, Kunst- und Literaturgeschichte. Nach dem Tod ihrer Mutter verzog sie, zusammen mit dem Vater, zunächst nach Frankfurt am Main, wo neben Agnes auch die älteste Schwester lebte. Nach dem Tod des Vaters verlegte Leonie zwischenzeitlich ihren Wohnsitz nach München und Berlin, bis sie an den Main zurückkehrte. Sie war als Schriftstellerin, Bühnenautorin, Literaturkritikerin – unter anderem bei der »Frankfurter Allgemeinen« – und Frauenrechtlerin tätig. Dabei hinterfragte sie, teils unter dem Pseudonym Leo Hildeck, in ihren Texten auf humorvolle Weise das tradierte Frauenbild – was ihr einen großen Leserkreis bescherte. Bekannt wurde sie mit ihrem Lustspiel »Sie hat Talent«. Es folgten unter anderem Novellen, Zeitungskritiken und schließlich der Roman »Töchter der Zeit« (1903) sowie das »Frauenbrevier für männerfeindliche Stunden« (1907), welches sich besonders gut verkaufte. Große Beachtung erfuhr zur damaligen Zeit Meyerhofs Werk »Frauenschicksale«, worin diese Stellung für eine neue Sexualethik bezieht, weswegen ein großer Diskurs über den damals neu gegründeten »Bund für Mutterschutz« ins Rollen kam.
Das Schicksal ihrer Schwester blieb Leonie Meyerhof erspart. Sie verstarb bereits im August 1933 in Frankfurt. Die Stadt Hildesheim erinnert heute mit dem Leonie-Meyerhof-Ring an die vielseitige Tochter ihrer Stadt.
Agnes von Dincklage Obernkirchen
So manche adlige Frau gilt heutzutage als Pionierin in Sachen Frauenbildung, so auch Agnes Freiin von Dincklage, die mehr als drei Jahrzehnte lang die Leiterin der Landfrauenschule in Obernkirchen nahe Bückeburg innehatte und das ländliche Bildungssystem für Frauen maßgeblich mitgeprägt hat. Sie führte die Schule durch unstete und teils schwierige Zeiten wie etwa die Wirtschaftskrise oder den Nationalsozialismus bis 1944, als die Schule geschlossen wurde. Im Oktober 1945 wurde diese wieder geöffnet und 1971 endgültig geschlossen. Unter Agnes’ Ägide entwickelte sich die Anstalt zu einer Fachschule mit allerbestem Ruf. Ihr Renommee erreichte viele berühmte Familien, und so gingen einige junge Frauen mit klangvollem Namen bei ihr ein und aus, etwa Prinzessin Friederike Luise von Hannover, die spätere griechische Königin, die Stieftöchter des deutschen Kaisers Wilhelm II. oder die Enkelin des berühmten Musikers Richard Wagner.
Agnes von Dincklage entstammt dem westfälischen Uradel und wurde im Mai 1882 in Lingen an der Ems in eine kinderreiche Familie hineingeboren. Mit Privilegien wie Titel, Namen und Bildung ausgestattet, galt ihr eine wohlsituierte Zukunft als Gutsfrau sicher, doch es sollte anders kommen: Agnes entschied sich im Alter von 26 Jahren, ihrer älteren Schwester Therese in ein Damenstift zu folgen. Hier zeigten sich bald ihre außerordentlichen Fähigkeiten und sie wurde mit wichtigen Ämtern betraut. 1918 übernahm sie die Leitung der dem Stift angegliederten Landfrauenschule im Dienste des Reifensteiner Verbandes, in jenen Zeiten einer der größten Schulträger privater Mädchen- und Frauenbildungsstätten. Das Symbol der Schule bildete ein Mistelzweig. Die Mädchen nannten sich MAIDen – die Buchstaben standen für Mut, Ausdauer, Idealismus und Demut. Sie wurden unter anderem in Backen, Kochen und Einmachen, Nutztierhaltung, Wäschepflege, Kinder- und Säuglingspflege, aber auch in Wohlfahrt, Rechts- und Wirtschaftskunde unterrichtet.
Von ihren »Maiden« wurde Agnes von Dincklage liebevoll als Tante Lilly tituliert. Sie galt als Seele des Hauses und Mitte der Gemeinschaft in Obernkirchen. Bei ihrem Abschied 1949 hieß es, »sie regierte königlich und diente demütig«. Mit ihrer christlichen Nächstenliebe und ihrem innovativen Denken, mit außerschulischen Aktivitäten wie Wandern und Singen, mit Charakterstärke und politischem Rückgrat hat sie der Schule eine ganz besondere Prägung gegeben.
Agnes Freiin von Dincklage verstarb im Sommer 1962 mit 80 Jahren. Nicht umsonst ist heute auf einer Gedenktafel ihr zu Ehren im Innenhof des Klosters das Zitat »Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein« zu lesen.
Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel Wolfenbüttel
Mit dem Namen Anna Amalia verbindet man vor allem die berühmte Bibliothek in Weimar, doch die Namensgeberin derselben ist ein Spross aus dem Hause Braunschweig-Wolfenbüttel und somit eine waschechte Welfenprinzessin und Niedersächsin. Sie wurde im Oktober 1739 als fünftes der insgesamt 13 Kinder von Herzog Karl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel und seiner Gemahlin Philippine Charlotte von Preußen geboren und erhielt eine ihrem Stand sehr angemessene Ausbildung nicht nur in Politik, Geografie, Sprachen und Religion, sondern auch in Musizieren, Malerei und Tanz. Mit 16 Jahren wurde Anna Amalia mit dem zwei Jahre älteren Herzog Ernst August II. Constantin von Sachsen-Weimar und Eisenach vermählt. Pflichtgemäß gebar sie rasch den ersehnten Thronfolger. Doch bald darauf verlor sie ihren Mann, der nach vierwöchiger Krankheit an »Auszehrung« verstarb – er erlebte die Geburt seines zweiten Sohnes nicht mehr.
Die junge Herzogin blieb verwitwet und übernahm als Vormund fortan die Regierungsgeschäfte für ihren ersten Sohn Karl August, wobei ihr oft genug ein starker Wind entgegenwehte. Sie sorgte dafür, dass unter anderem die Dichter Wieland und Goethe die Prinzen erzogen, schob verschiedene Reformen an und manövrierte das kleine Herzogtum umsichtig auch durch schwierige Zeiten, etwa den Siebenjährigen Krieg. Doch sie hatte auch noch eine andere Seite: Sie war eine gesellige Frau, kannte aus ihren Kinder- und Jugendjahren das ausgeprägt kulturelle Leben aus Wolfenbüttel, einst eines der wichtigsten politischen und kulturellen Zentren Norddeutschlands. Häufig weilten daher Gäste an ihrem Hof in Weimar, vor allem Künstler und Gelehrte. Anna Amalia reiste aber auch gern, liebte das Theater, lernte neben Zeichnen zahlreiche Sprachen und war schriftstellerisch tätig. Für die Weimarer Bibliothek, die erst seit 1991 ihren Namen trägt, und deren Ausbau, den noch ihr verstorbener Mann initiiert hatte, ließ sie 1766 ein fürstliches Wohnhaus umbauen – und machte die Büchersammlung für die Öffentlichkeit zugänglich. Heute zählt auch ihre private Bibliothek mit etwa 5.000 Bänden dazu, einer der größten Bestände deutscher Fürstinnen des 18. Jahrhunderts. Darunter ist, eher ungewöhnlich für die Zeit der Herzogin, eine umfangreiche Sammlung an Frauenliteratur zu finden – verfasst über, von oder für Frauen.
1807 verstarb Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel in Weimar, doch im Wolfenbütteler Schloss sind noch immer die Spuren der Welfin zu entdecken, etwa ihr Geburtszimmer. Sie schuf mit ihrem Musenhof die Grundlage für die Entwicklung ihrer Wahlheimatstadt zu einem kulturellen Zentrum.
Anita Augspurg Verden
»Das Recht der Frauen ist in den Händen der Männer meist übel gewahrt.«
Das sind Worte von Anita Augspurg, eine der bekanntesten Frauenrechtlerinnen in Deutschland. Sie war wild entschlossen, diesbezüglich grundlegend neue Fakten zu schaffen und etwas zu ändern – und wurde für ihren großen Einsatz in der Frauenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt.
Gebürtig ist die Juristentochter aus Verden an der Aller, wo sie 1857 als jüngste Tochter in eine liberal gesinnte Familie hineingeboren wurde – alle Kinder durften sich unter der Obhut der Eltern vergleichsweise frei entwickeln. In der niedersächsischen Kleinstadt verbrachte sie ihre Schulzeit, bevor sie sich zunächst in Berlin zur Lehrerin ausbilden ließ, dazu ihre schauspielerischen Ambitionen umzusetzen begann und schließlich eine Ausbildung zur Fotografin absolvierte. Dank eines Erbes war sie finanziell abgesichert und eröffnete 1887 in München ein Fotoatelier. Sie war zudem eine der Mitbegründerinnen der »Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau« (als »Verein für Fraueninteressen« noch immer existent) – und bekannt wegen ihrer öffentlich gelebten Beziehungen zu Frauen, ihrem klaren Bekenntnis zur Frauenbewegung, ihrer verwegen kurz geschnittenen Haare und den Männerhosen, welche sie oft trug. Doch das war ihr alles noch nicht genug, sie wollte mehr »am sich vollziehenden Wandel der Dinge in Staat und Gesellschaft mitwirken« und schrieb sich in Zürich für Jura ein – ihrerzeit eine der wenigen Universitäten für Frauen in Europa. 1897 schloss Anita Augspurg, nunmehr 40 Jahre alt, nach nur acht Semestern mit ihrer Promotion ab. Sie gilt somit als erste deutsche promovierte Juristin.