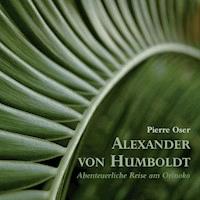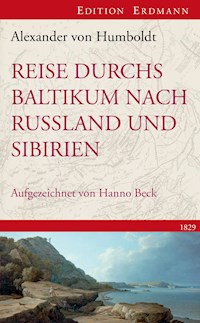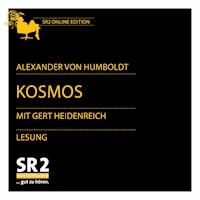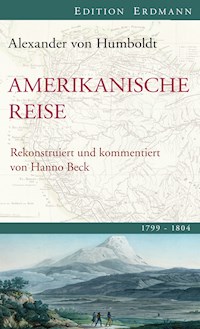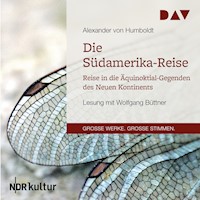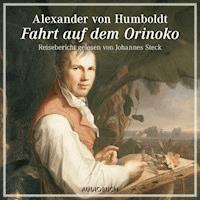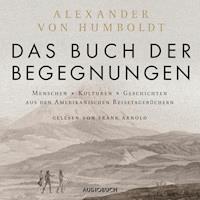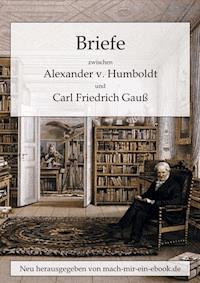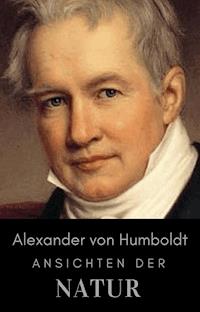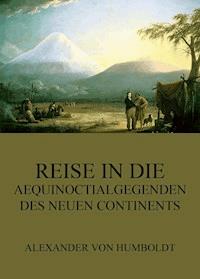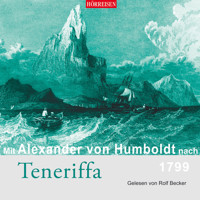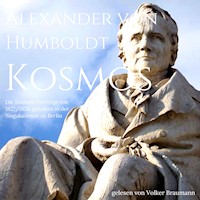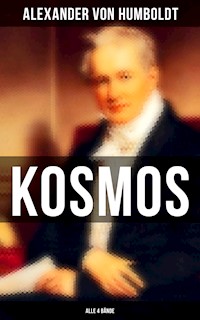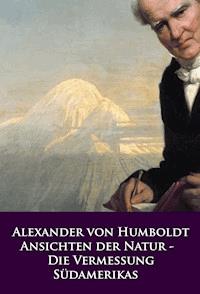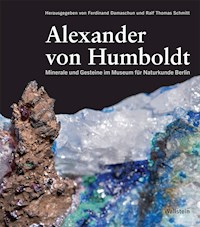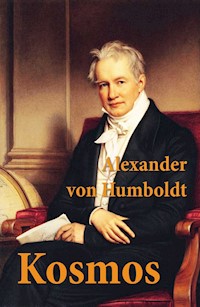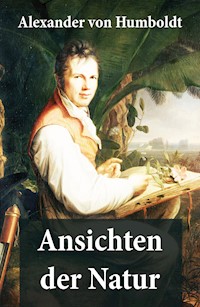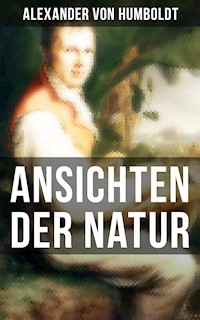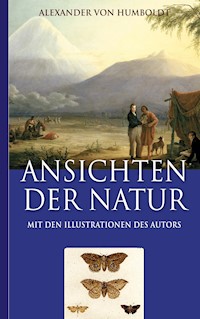
Alexander von Humboldt: Ansichten der Natur (Mit den Illustrationen des Autors) E-Book
Alexander von Humboldt
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Alexander von Humboldt: Ansichten der Natur | Mit 20 zeitgenössischen Illustrationen, zum Teil von Humboldt selbst angefertigt | Neu editiert, mit aktualisierter Rechtschreibung und einem Vorwort des Herausgebers | »Ansichten der Natur« ist - man würde heute sagen - ein »Best of«, des erst zwanzig Jahre später komplett erscheinenden Hauptwerks über seine Südamerika-Reise. Humboldt schrieb es, kurz nach der Rückkehr von der fünfjährigen Expedition, im Jahre 1806. Voll der Eindrücke dieser Reise, mit prall gefüllten Notizbüchern - aber noch ohne seine Reiseergebnisse komplett ausgewertet zu haben. Viele der Texte sind vor Ort, im südamerikanischen Dschungel, entstanden, akribisch notiert in ein Tagebuch, und später ins Buchmanuskript übertragen. So gesehen ist es Humboldts authentischster und zeitnahster Reisebericht, und er selbst nannte »Ansichten der Natur« sein Lieblingsbuch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort des Herausgebers
Über dieses Buch
Über Alexander von Humboldt
Humboldts Vorrede zur ersten Ausgabe
Vorrede zur zweiten und dritten Ausgabe
Vorrede zur dritten Ausgabe
Über die Steppen und Wüsten
Über die Wasserfälle des Orinoco bei Atures und Maipures
Das nächtliche Tierleben im Urwalde
B
ILDTAFEL
Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse
Über den Bau und die Wirkungsart der Vulkane in den verschiedenen Erdstrichen
Die Lebenskraft oder der rhodische Genius
Das Hochland von Cajamarca, der alten Residenzstadt des Inka Atahualpa
Von Humboldt beschriebene »aus rankenden Pflanzen geflochtene Brücke«, aus dem Kapitel ›Über die Wasserfälle des Orinoco‹.
VORWORT DES HERAUSGEBERS
»Was gegen die Natur ist, ist (...) ohne Bestand.«
Alexander von Humboldt
»Wir brauchen eine angemessene Gleichzeitigkeit,
eine Balance zwischen Strenge und Phantasie.«
Gregory Bateson
NATÜRLICH KONNTEN SICH Alexander von Humboldt (1769–1859), der große deutsche Naturforscher, und Gregory Bateson (1904–1980), der geniale amerikanische Anthropologe, nie begegnen. Wenn man aber beide kennt, fallen einem erstaunliche Parallelen auf. Beiden war es ein Anliegen, ja ein immanenter Zwang, die Erscheinungen des Lebens nicht isoliert zu betrachten. Keine abgeschlossene Fachwissenschaft zu schaffen, die von anderen Themenfeldern nicht berührt wird. Sondern das genaue Gegenteil: Brücken zu bauen, Verbindungen herzustellen und Parallelen zu ziehen, zwischen scheinbar Getrenntem, und doch zutiefst Verbundenem. Bei Bateson nannte man das später systemisch-kybernetisches Denken. Alexander von Humboldt war der Pionier dieser Arbeitsweise.
Die Basiswissenschaften Humboldts waren die Geologie und Geographie – sie brachten ihn in Gegenden, ließen ihn Forschungsgegenstände aufsuchen, an denen er sich dann ganz entfalten konnte. Diese Terrains sah er als Biotope, in denen alles wechselwirkt. Warum hört an einem bestimmten Breitengrad in einer bestimmten Höhe der Baumbewuchs auf? Wie kann jene Pflanze in einer staubtrockenen Wüste überleben? Warum bündeln sich in den Tropen die Lebensformen der Flora und Fauna in so exorbitanter Weise? Dieser Art Fragen ging Humboldt – als erster ›ganzheitlich‹ denkender Wissenschaftler – nach.
Dabei hielt er sich nicht an etablierte Regeln der Wissenschaft seiner Zeit, sondern er erfand neue, er entwarf Szenarien, Kategorien und Schemata, ja er phantasierte und spekulierte gelegentlich – um dem Grund der Dinge näher zu kommen. Dieser weite Blick ist es, dieser Mut, Neues zu entdecken, der ihn weit über den Durchschnitt seiner damaligen Forscherkollegen hinaushob. Das ist es auch, was wir heute noch an Humboldt so schätzen, und warum wir ihn zu Recht zu den ganz großen Namen zählen.
Der Historiker Karl Schlögel schreibt: »Was einen bis heute an Alexander von Humboldt fasziniert, ja, den Atem verschlägt, ist eine an die Grenzen gehende Weltzugewandtheit, ja Weltsüchtigkeit, die, wenn man ihr nachgibt, den Routinebetrieb der Wissenschaften und Wissensproduktion in Frage zu stellen droht. (...) Alexander von Humboldt ist bei aller olympischen Klassizität ein wildes Tier der Erfahrung, fast ein Künstler, der die Regeln des Spiels selber entwirft. Für ihn gab es nichts, was nicht interessant war.«
Für Humboldt war die Wissenschaft Leidenschaft, er richtete sein Leben danach aus. Er fror, hungerte, lief sich die Füße blutig, er opferte sein gesamtes Vermögen dafür. In Südamerika besteigt er 1802 den Sechstausender Chimborazo bis auf eine Höhe von 5761 Meter und stellt dabei einen Höhenrekord auf. In London steigt er ein Vierteljahrhundert später, 1827, mit einer neu entwickelten Taucherglocke auf den Grund der Themse. Von ihrer Südamerika-Reise brachten er und sein Reisegefährte Aimé Bonpland rund 60.000 Pflanzen, etwa 6.300 davon unbekannt, zurück in die alte Heimat. An seiner großartigen und Standards setzenden Reisebeschreibung ›Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents‹ schrieb Humboldt rund 20 Jahre – auf Französisch. Sein auf Deutsch erschienenes, und ab 1845 veröffentlichtes Spätwerk ›Kosmos‹ wird zur verlegerischen Sensation: In den Buchhandlungen »wurden Schlachten geschlagen«, so Verleger Georg von Cotta, »um in den Besitz des Werkes zu kommen«. Von der ersten Auflage des ›Kosmos‹ werden mehr als 80.000 Exemplare verkauft.
Ja, Humboldt setzte in vielen Dingen Maßstäbe, an denen sich bis heute nur die wenigsten Wissenschaftler messen können.
ÜBER DIESES BUCH
›ANSICHTEN DER NATUR‹ ist – man würde heute vielleicht sagen – ein ›Best of‹, des erst zwanzig Jahre später komplett erscheinenden Hauptwerkes über die Südamerika-Reise. Humboldt schrieb es, kurz nach Rückkehr von der fünfjährigen Expedition, im Jahre 1806. Voll der Eindrücke dieser Reise, mit prall gefüllten Notizbüchern – aber noch ohne seine Reiseergebnisse komplett ausgewertet zu haben. Viele der Texte sind vor Ort, im südamerikanischen Dschungel, entstanden, akribisch notiert in ein Tagebuch, und später ins Buchmanuskript übertragen. So gesehen ist es Humboldts authentischster und zeitnahster Reisebericht. Gleichwohl bereits im Original mit einem umfangreichen Appendix und zahlreichen, zum Teil ausufernden Fußnoten versehen. Diese sind hier der besseren Lesbarkeit halber weggelassen. Trotzdem stellt das Buch, durch die Vielzahl lateinischer Pflanzennamen und sonstiger Fachausdrücke durchaus Ansprüche an den Leser. – Humboldt selbst nannte ›Ansichten der Natur‹ sein ›Lieblingsbuch‹.
ÜBER ALEXANDER VON HUMBOLDT
Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt wird am 14. September 1769 in Berlin geboren – im Schein des Messier’schen Kometen, der seine Bahn am Himmel zieht. Sein Vater ist der preußische Offizier und königliche Kammerherr Alexander Georg von Humboldt. Seine Mutter Marie Elisabeth entstammt einer französischen Hugenottenfamilie, die den Namen Colomb, französisch für Columbus, trägt.
Es ist eine der größten Epochen der Geschichte: Eine gewaltige Aufbruchsstimmung in der Wissenschaft an der Scheide vom 18. zum 19. Jahrhundert – verbunden mit Namen, die bis heute von Bedeutung sind: Linné (1707–1778) hatte bereits sein Klassifizierungssystem der Pflanzen entwickelt, Kant (1724–1804) lehrte Philosophie, die Namen von Lessing (1729–1781), Fichte (1762–1814) und Goethe (1749–1832) kennt jeder. Washington (1732–1799) vollbrachte in Amerika eine der größten politischen Leistungen der Weltgeschichte, Lamarck (1744–1829) vertrat seine Lehre über die Entwicklung der Arten, Cuvier (1769–1832), der im gleichen Jahr wie Humboldt geboren ist, wurde zu einem der Väter der Wissenschaft über die Tierwelt, Euler (1778–1850) und Gauß (1777–1855) trieben die Mathematik voran, Laplace (1749–1827) die Astronomie, Gay-Lussac (1778–1850) die Physik, Lavoisier (1743–1794) und Davy (1778–1829) die Chemie, Leopold von Buche (1774–1853) die Geologie. Und auch Napoleon Bonaparte wird im gleichen Jahr wie Humboldt geboren.1
Nach dem Wunsch der Eltern sollte Humboldt Jurist werden, doch seine Neigung zu den Naturwissenschaften setzt sich durch. Im Jahre 1788 beginnt er an der Universität Berlin Technologie, Pflanzenkunde, und – um die klassischen griechischen Naturwissenschaftler im Original lesen zu können – auch die griechische Sprache zu studieren. 1789 setzt er sein Studium in Göttingen fort, und lernt in Mainz Georg Forster (1754–1794) kennen – James Cooks wissenschaftlicher Begleiter auf dessen zweiter Weltumseglung –, der ihn stark beeinflussen sollte. Im Jahre 1790 reist Humboldt in Gesellschaft von Forster durch Holland, Belgien, England, Frankreich und das Rheintal (siehe Forsters Buch: ›Ansichten vom Niederrhein‹).
Im Jahr 1791 tritt Humboldt als Bergbauingenieur in den Staatsdienst ein, wo er schnell Karriere macht und wichtige Erfahrungen sammelt. Doch als 1797 seine Mutter stirbt und er das mütterliche Erbteil erhält, beschließt er, seine finanzielle Freiheit zu nutzen und auf wissenschaftliche Expedition zu gehen. In Paris lernt Humboldt 1798 den französischen Arzt und Botaniker Aimé Bonpland kennen, der ihm auf seiner großen Südamerika-Reise ein kongenialer Reisepartner sein wird. Am 5. Juni 1799 brechen die beiden von La Coruña (Spanien) aus mit dem Segelschiff Pizarro in die Neue Welt auf. Sie bereisen das Gebiet der heutigen Staaten Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Kuba und Mexiko. Es ist die erste Reise dieser Zeit, die aus rein wissenschaftlichen Gründen unternommen wird.
Die Erkenntnisse der Reise sind zahllos. Humboldt gelingt zum Beispiel die geographische Ortsbestimmung des Casiquiare, der umstrittenen Gabelteilung (Bifurkation) des Orinoco. Er registriert die Abnahme der magnetischen Feldstärke vom Pol zum Äquator und misst die Temperaturen des später nach ihm benannten Humboldtstroms. Daneben erforscht er die Sprachen, Kultur und Kunst der Indianer.
Nach seiner Rückkehr, 1806, lebt er in Paris – denn das provinzielle und politisch reaktionäre Berlin ist ihm zuwider –, und wertet über die nächsten zwei Dekaden die Ergebnisse seine Reise aus, was in den berühmten auf Französisch verfassten 30-bändigen Reisebericht ›Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent: fait en 1799, 1800, 1801, 1803 et 1804‹ (›Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents‹) mündet. Erst als sein Vermögen vollständig aufgebraucht ist – auch die Produktion der prächtig gestalteten Bände ist ein Zuzahlgeschäft – kehrt er nach Berlin in den Staatsdienst zurück.
Am 6. Mai 1859 stirbt Alexander von Humboldt, 90-jährig, in seiner Wohnung in der Oranienburger Straße in Berlin, und wird am 11. Mai im Familiengrab in Tegel beigesetzt. Nicht nur die älteste und zweitgrößte Universität seiner Heimatstadt trägt heute seinen Namen, sondern z. B. geographische Wegmarken, Pflanzen- und Tierarten, sowie zahllose Bildungseinrichtungen in Deutschland und überall auf der Welt.
© Armin J. Fischer (Hrsg.), 2022, 2014
HUMBOLDTS VORREDE ZUR ERSTEN AUSGABE
SCHÜCHTERN ÜBERGEBE ICH dem Publikum eine Reihe von Arbeiten, die im Angesicht großer Naturgegenstände, auf dem Ozean, in den Wäldern des Orinoco, in den Steppen von Venezuela, in der Einöde peruanischer und mexikanischer Gebirge entstanden sind. Einzelne Fragmente wurden an Ort und Stelle niedergeschrieben und nochmals nur in ein Ganzes zusammengeschmolzen. Überblick der Natur im Großen, Beweis vom Zusammenwirken der Kräfte, Erneuerung des Genusses, welchen die unmittelbare Ansicht der Tropenländer dem fühlenden Menschen gewährt, sind die Zwecke, nach denen ich strebe. Jeder Aufsatz sollte ein in sich geschlossenes Ganzes ausmachen, in allen sollte ein und dieselbe Tendenz sich gleichmäßig aussprechen.
Diese ästhetische Behandlung naturhistorischer Gegenstände hat, trotz der herrlichen Kraft und der Biegsamkeit unserer vaterländischen Sprache, große Schwierigkeiten der Komposition. Reichtum der Natur veranlasst Anhäufung einzelner Bilder, und Anhäufung stört die Ruhe und den Totaleindruck des Gemäldes. Das Gefühl und die Phantasie
ansprechend, artet der Stil leicht in eine dichterische Prosa aus. Diese Ideen bedürfen hier keiner Entwicklung, da die nachstehenden Blätter mannigfaltige Beispiele solcher Verirrungen, solchen Mangels an Haltung darbieten.
Mögen meine Ansichten der Natur, trotz dieser Fehler, welche ich selbst leichter rügen als verbessern kann, dem Leser doch einen Teil des Genusses gewähren, welchen ein empfänglicher Sinn in der unmittelbaren Anschauung findet. Da dieser Genuss mit der Einsicht in den inneren Zusammenhang der Naturkräfte vermehrt wird, so sind jedem Aufsatz wissenschaftliche Erläuterungen und Zusätze beigefügt.2
Überall habe ich auf den ewigen Einfluss hingewiesen, welchen die physische Natur auf die moralische Stimmung der Menschheit und auf ihre Schicksale ausübt. Bedrängten Gemütern sind diese Blätter vorzugsweise gewidmet. »Wer sich herausgerettet aus der stürmischen Lebenswelle«, folgt mir gern in das Dickicht der Wälder, durch die unabsehbare Steppe und auf den hohen Rücken der Andenkette. Zu ihm spricht der weltrichtende Chor:
Auf den Bergen ist Freiheit! Der Hauch der Grüfte
Steigt nicht hinauf in die reinen Lüfte;
Die Welt ist vollkommen überall,
Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual.
1 Diese Zusammenstellung stammt von Humboldt-Kenner Dr. Jenõ Cholnoky [1870–1950], Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.
2 Anmerkung: Humboldt hat den ›Ansichten der Natur‹ umfangreiche ›Erläuterungen und Zusätze‹ beigegeben, die sich in vielen Fällen zu eigenen Abhandlungen ausweiten und nur noch in losem Zusammenhang mit den sieben Essays, den ›Naturgemälden‹ der amerikanischen Tropen, stehen; sie sind in dieser Ausgabe der Lesbarkeit halber weggelassen.
VORREDE ZUR ZWEITEN UND DRITTEN AUSGABE
DIE ZWIEFACHE RICHTUNG dieser Schrift (ein sorgsames Bestreben, durch lebendige Darstellungen den Naturgenuss zu erhöhen, zugleich aber nach dem dermaligen Stande der Wissenschaft die Einsicht in das harmonische Zusammenwirken der Kräfte zu vermehren) ist in der Vorrede zur ersten Ausgabe, fast vor einem halben Jahrhundert, bezeichnet worden. Es sind damals schon die mannigfaltigen Hindernisse angegeben, welche der ästhetischen Behandlung großer Naturszenen entgegenstehen. Die Verbindung eines literarischen und eines rein szientifischen Zweckes, der Wunsch, gleichzeitig die Phantasie zu beschäftigen und durch Vermehrung des Wissens das Leben mit Ideen zu bereichern, machen die Anordnung der einzelnen Teile und das, was als Einheit der Komposition gefordert wird, schwer zu erreichen. Trotz dieser ungünstigen Verhältnisse hat das Publikum der unvollkommenen Ausführung meines Unternehmens dauernd ein nachsichtsvolles Wohlwollen geschenkt.
Die zweite Ausgabe der Ansichten der Natur habe ich in Paris im Jahr 1826 besorgt. Zwei Aufsätze: Ein ›Versuch über den Bau und die Wirkungsart der Vulkane in den verschiedenen Erdstrichen‹ und die ›Lebenskraft oder der rhodische Genius‹, wurden damals erstmals beigefügt. Schiller, in jugendlicher Erinnerung an seine medizinischen Studien, unterhielt sich während meines langen Aufenthalts in Jena gern mit mir über physiologische Gegenstände. Meine Arbeit über die Stimmung der gereizten Muskel- und Nervenfaser durch Berührung mit chemisch verschiedenen Stoffen gab oft unseren Gesprächen eine ernstere Richtung. Es entstand in jener Zeit der kleine Aufsatz von der Lebenskraft. Die Vorliebe, welche Schiller für den ›rhodischen Genius‹3 hatte, den er in seine Zeitschrift der Horen aufnahm, gab mir den Mut, ihn wieder abdrucken zu lassen. Mein Bruder berührt in einem Briefe, welcher erst vor Kurzem gedruckt worden ist [Wilhelm von Humboldts Briefe an eine Freundin T. II. S. 39], mit Zartheit denselben Gegenstand, setzt aber treffend hinzu: »Die Entwicklung einer physiologischen Idee ist der Zweck des ganzen Aufsatzes. Man liebte in der Zeit, in welcher derselbe geschrieben ist, mehr, als man jetzt tun würde, solche halbdichterische Einkleidungen ernsthafter Wahrheiten.«
3 Bezieht sich auf die griechische Insel Rhodos, ein Zentrum antiker Kultur
VORREDE ZUR DRITTEN AUSGABE
Es ist mir noch im achtzigsten Jahre die Freude geworden, eine dritte Ausgabe meiner Schrift zu vollenden und dieselbe nach den Bedürfnissen der Zeit ganz umzuschmelzen. Fast alle wissenschaftlichen Erläuterungen sind ergänzt oder durch neue, inhaltreichere ersetzt worden.4
Ich habe gehofft, den Trieb zum Studium der Natur dadurch zu beleben, dass in dem kleinsten Raume die mannigfaltigsten Resultate gründlicher Beobachtung zusammengedrängt, die Wichtigkeit genauer numerischer Angaben und ihres sinnigen Vergleichs untereinander erkannt und dem dogmatischen Halbwissen wie der vornehmen Zweifelsucht gesteuert werde, welche in den sogenannten höheren Kreisen des geselligen Lebens einen langen Besitz haben.
Die Expedition, die ich in Gemeinschaft mit Ehrenberg und Gustav Rose auf Befehl des Kaisers von Russland im Jahre 1829 in das nördliche Asien (in den Ural, den Altai und an die Ufer des Kaspischen Meeres) gemacht, fällt zwischen die Epochen der 2. und 3. Ausgabe meines Buches. Sie hat wesentlich zur Erweiterung meiner Ansichten beigetragen in allem, was die Gestaltung der Bodenfläche, die Richtung der Gebirgsketten, den Zusammenhang der Steppen und Wüsten, die geographische Verbreitung der Pflanzen nach gemessenen Temperatureinflüssen betrifft.
Die Unkenntnis, in welcher man so lange über die zwei großen schneebedeckten Gebirgszüge zwischen dem Altai und Himalaja, über den Thian-schan und den Kuen-lün, gewesen ist, hat bei der ungerechten Vernachlässigung chinesischer Quellen die Geographie von Inner-Asien verdunkelt und Phantasien als Resultate der Beobachtung in viel gelesenen Schriften verbreitet.
Seit wenigen Monaten sind fast unerwartet der hypsometrischen Vergleichung der kulminierenden Gipfel beider Kontinente wichtige und berichtigende Erweiterungen zugekommen. [...] Die von früheren Irrtümern befreiten Höhenbestimmungen zweier Berge in der östlichen Andenkette von Bolivia, des Sorata und Illimani, haben dem Chimborazo seinen alten Rang unter den Schneebergen des Neuen Kontinents mit Gewissheit noch nicht ganz wiedererteilt, während im Himalaja die neue trigonometrische Messung des Kinchinjinga (26.438 Pariser Fuß) diesem Gipfel den nächsten Platz nach dem nun ebenfalls trigonometrisch genauer gemessenen Dhawalagiri einräumt.5
Alexander von Humboldt
Berlin, im März 1849
4 Anmerkung: In dieser Ausgabe zu Gunsten der Lesefreundlichkeit weggelassen, red.
ÜBER DIE STEPPEN UND WÜSTEN
— ÜBERSICHT —
Küstenkette und Bergtäler von Caracas. Der See Tacarigua. – Kontrast zwischen der üppigen Fülle des organischen Lebens und der baumlosen, pflanzenarmen Ebene. – Räumliche Eindrücke. Die Steppe als Boden eines alten Binnenmeeres. Gebrochene, etwas höher liegende Schichten, Bänke. – Allgemeinheit der Erscheinungen, welche die Bodenfläche darbietet: Heideländer von Europa, Pampas und Llanos von Südamerika, afrikanische Wüsten, nordasiatische Steppen. – Verschiedener Charakter der Pflanzendecke. Tierleben. Hirtenvölker, welche die Welt erschüttert haben.
Naturgemälde der südamerikanischen Ebenen und Grasfluren. – Ihre Ausdehnung und ihr Klima, Letzteres bedingt durch den Umriss und die hypsometrische Gestaltung des Neuen Kontinents. – Vergleich mit Afrikas Ebenen und Wüsten. – Ursprünglicher Mangel des Hirtenlebens in Amerika. – Nahrung, welche die Palme Mauritia darbietet; schwebende Hütten auf Bäumen. Guaraunen.
Die Llanos sind seit der Entdeckung von Amerika bewohnbarer geworden. Außerordentliche Vermehrung wilder Rinder, Pferde und Maultiere. – Schilderung der Zeit der Dürre und der Regenzeit. Anblick des Bodens und des Himmelsgewölbes. Leben der Tiere; ihre Leiden, ihre Kämpfe. Biegsamkeit, mit welcher die aneignende Natur gewisse Tiere und Pflanzen begabt hat. – Jaguar, Krokodile, elektrische Fische. Ungleicher Kampf der Gymnoten und der Pferde.
Rückblick auf die Erdstriche, welche die Steppen und Wüsten begrenzen. – Wildnis der Waldregion des Orinoco und Amazonasstromes. – Menschenstämme durch wunderbare Verschiedenheit der Sprache und der Gesittung getrennt, ein mühevoll lebendes, immer entzweites Geschlecht. In Felsen eingegrabene Bilder beweisen, dass auch diese Einöden einst der Sitz untergegangener Kultur waren.
AM FUßE des hohen Granitrückens, welcher im Jugendalter unseres Planeten, bei Bildung des antillischen Meerbusens, dem Einbruch der Wasser getrotzt hat, beginnt eine weite, unabsehbare Ebene. Wenn man die Bergtäler von Caracas und den inselreichen See Tacarigua, in dem die nahen Pisangstämme sich spiegeln, wenn man die Fluren, welche mit dem zarten und lichten Grün des tahitischen Zuckerschilfes prangen, oder den ernsten Schatten der Kakaogebüsche zurücklässt, so ruht der Blick im Süden auf Steppen, die scheinbar ansteigend, in schwindender Ferne, den Horizont begrenzen.
Aus der üppigen Fülle des organischen Lebens tritt der Wanderer betroffen an den öden Rand einer baumlosen, pflanzenarmen Wüste. Kein Hügel, keine Klippe erhebt sich inselförmig in dem unermesslichen Raume. Nur hier und dort liegen gebrochene Flözschichten von zweihundert Quadratmeilen Oberfläche bemerkbar höher als die angrenzenden Teile. Bänke nennen die Eingeborenen diese Erscheinung, gleichsam ahnungsvoll durch die Sprache den alten Zustand der Dinge bezeichnend, da jene Erhöhungen Untiefen, die Steppen selbst aber der Boden eines großen Mittelmeeres waren.
Noch gegenwärtig ruft oft nächtliche Täuschung diese Bilder der Vorzeit zurück. Wenn im raschen Aufsteigen und Niedersinken die leitenden Gestirne den Saum der Ebene erleuchten oder wenn sie zitternd ihr Bild verdoppeln in der untern Schicht der wogenden Dünste, glaubt man den küstenlosen Ozean vor sich zu sehen. Wie dieser erfüllt die Steppe das Gemüt mit dem Gefühl der Unendlichkeit und durch dies Gefühl, wie den sinnlichen Eindrücken des Raumes sich entwindend, mit geistigen Anregungen höherer Ordnung. Aber freundlich zugleich ist der Anblick des klaren Meeresspiegels, in welchem die leichtbewegliche, sanft aufschäumende Welle sich kräuselt; tot und starr liegt die Steppe hingestreckt wie die nackte Felsrinde eines verödeten Planeten.
In allen Zonen bietet die Natur das Phänomen dieser großen Ebenen dar; in jeder haben sie einen eigentümlichen Charakter, eine Physiognomie, welche durch die Verschiedenheit ihres Bodens, durch ihr Klima und durch ihre Höhe über der Oberfläche des Meeres bestimmt wird.
Im nördlichen Europa kann man die Heideländer, welche, von einem einzigen, alles verdrängenden Pflanzenzuge bedeckt, von der Spitze von Jütland sich bis an den Ausfluss der Schelde erstrecken, als wahre Steppen betrachten, aber Steppen von geringer Ausdehnung und hochhügliger Oberfläche, wenn man sie mit den Llanos und Pampas von Südamerika oder gar mit den Grasfluren am Missouri und Kupferfluss vergleicht, in denen der zottige Bison und der kleine Moschus-Stier umherschwärmen.
Einen größeren und ernsteren Anblick gewähren die Ebenen im Innern von Afrika. Gleich der weiten Fläche des Stillen Ozeans hat man sie erst in neueren Zeiten zu durchforschen versucht; sie sind Teile eines Sandmeeres, welches gegen Osten fruchtbare Erdstriche voneinander trennt oder inselförmig einschließt, wie die Wüste am Basaltgebirge Harudsch, wo in der dattelreichen Oasis von Siwa die Trümmer des Ammon-Tempels den ehrwürdigen Sitz früher Menschenbildung bezeichnen. Kein Tau, kein Regen benetzt diese öden Flächen und entwickelt im glühenden Schoß der Erde den Keim des Pflanzenlebens. Denn heiße Luftsäulen steigen überall aufwärts, lösen die Dünste und verscheuchen das vorübereilende Gewölk.
Wo die Wüste sich dem Atlantischen Ozean nähert, wie zwischen Wadi Nun und dem Weißen Vorgebirge, da strömt die feuchte Meeresluft hin, die Leere zu füllen, welch durch jene senkrechten Winde erregt wird. Selbst wenn der Schiffer durch ein Meer, das wiesenartig mit Seetang bedeckt ist, nach der Mündung des Gambia steuert, ahndet er, wo ihn plötzlich der tropische Ostwind verlässt, die Nähe des weit verbreiteten wärmestrahlenden Sandes.
Herden von Gazellen und schnellfüßige Strauße durchirren den unermesslichen Raum. Rechnet man ab die im Sandmeere neuentdeckten Gruppen quellenreicher Inseln, an deren grünen Ufern die nomadischen Tibbos und Tuaryks schwärmen, so ist der übrige Teil der afrikanischen Wüste als dem Menschen unbewohnbar zu betrachten. Auch wagen die angrenzenden gebildeten Völker sie nur periodisch zu betreten. Auf Wegen, die der Handelsverkehr seit Jahrtausenden unwandelbar bestimmt hat, geht der lange Zug von Tafilet bis Tombuktu oder von Murzuk bis Bornu: Kühne Unternehmungen, deren Möglichkeit auf der Existenz des Kamels beruht, des Schiffs der Wüste, wie es die alten Sagen der Ostwelt nennen.
Diese afrikanischen Ebenen füllen einen Raum aus, welcher den des nahen Mittelmeeres fast dreimal übertrifft. Sie liegen zum Teil unter den Wendekreisen selbst, zum Teil denselben nahe, und diese Lage begründet ihren individuellen Naturcharakter. Dagegen ist in der östlichen Hälfte des alten Kontinents dasselbe geognostische Phänomen mehr der gemäßigten Zone eigentümlich.
Auf dem Bergrücken von Mittelasien zwischen dem Goldberge oder Altai und dem Kuen-lün von der Chinesischen Mauer an bis jenseits des Himmelsgebirges und gegen den Aralsee hin, in einer Länge von mehreren tausend Meilen, breiten sich, wenn auch nicht die höchsten, doch die größten Steppen der Welt aus. Einen Teil derselben, die Kalmücken- und Kirgisen-Steppen zwischen dem Don, der Wolga, dem Kaspischen Meere und dem chinesischen Dsaisang-See, also in einer Erstreckung von fast 700 geographischen Meilen, habe ich selbst zu sehen Gelegenheit gehabt, volle dreißig Jahre nach meiner südamerikanischen Reise. Die Vegetation der asiatischen, bisweilen hügeligen und durch Fichtenwälder unterbrochenen Steppen ist gruppenweise viel mannigfaltiger als die der Llanos und Pampas von Caracas und Buenos Aires. Der schönere Teil der Ebenen, von asiatischen Hirtenvölkern bewohnt, ist mit niedrigen Sträuchern üppig weißblühender Rosazeen, mit Kaiserkronen (Fritillarien), Tulpen und Cypripedien geschmückt.
Wie die heiße Zone sich im Ganzen dadurch auszeichnet, dass alles Vegetative baumartig zu werden strebt, so charakterisiert einige Steppen der asiatischen gemäßigten Zone die wundersame Höhe, zu der sich blühende Kräuter erheben: Saussureen und andere Synanthereen, Schotengewächse, besonders ein Heer von Astragalus-Arten. Wenn man in den niedrigen tatarischen Fuhrwerken sich durch weglose Teile dieser Krautsteppen bewegt, kann man nur aufrecht stehend sich orientieren und sieht die waldartig dichtgedrängten Pflanzen sich vor den Rädern niederbeugen. Einige dieser asiatischen Steppen sind Grasebenen, andere mit saftigen, immergrünen, gegliederten Kalipflanzen bedeckt, viele fernleuchtend von flechtenartig aufsprießendem Salze, das ungleich, wie frischgefallener Schnee, den lettigen Boden verhüllt.
Diese mongolischen und tatarischen Steppen, durch mannigfaltige Gebirgszüge unterbrochen, scheiden die uralte, langgebildete Menschheit in Tibet und Hindostan von den rohen, nordasiatischen Völkern. Auch ist ihr Dasein von mannigfaltigem Einfluss auf die wechselnden Schicksale des Menschengeschlechts gewesen. Sie haben die Bevölkerung gegen Süden zusammengedrängt, mehr als der Himalaja, als das Schneegebirge von Sirinagur und Gorka den Verkehr der Nationen gestört und im Norden Asiens unwandelbare Grenzen gesetzt der Verbreitung milderer Sitten und des schaffenden Kunstsinns.
Aber nicht als hindernde Vormauer allein darf die Geschichte die Ebene von Inner-Asien betrachten. Unheil und Verwüstung hat sie mehrmals über den Erdkreis gebracht. Hirtenvölker dieser Steppe: Die Mongolen, Geten, Alanen und Usün haben die Welt erschüttert. Wenn in dem Lauf der Jahrhunderte frühe Geisteskultur gleich dem erquickenden Sonnenlicht von Osten nach Westen gewandert ist, so haben späterhin, in