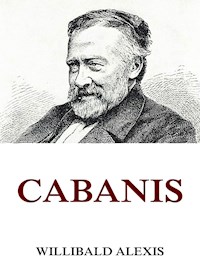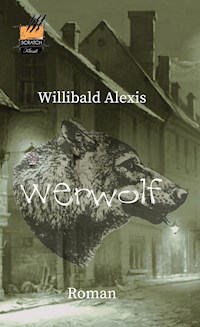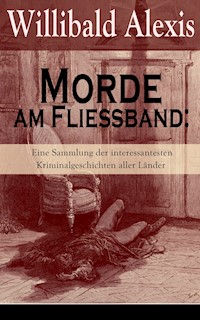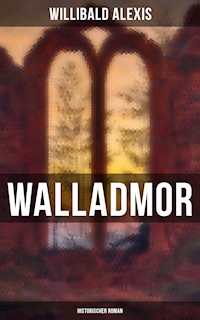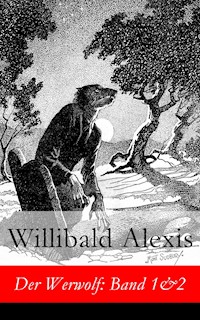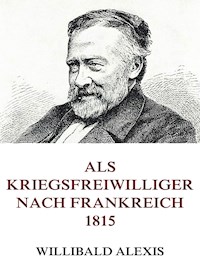
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
1815 nahm Alexis als Freiwilliger an den Befreiungskriegen teil; als Mitglied des Regiments Kolberg belagerte er einige Ardennen-Festungen und berichtet von diesen Ereignissen in "Als Kriegsfreiwilliger nach Frankreich."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Als Kriegsfreiwilliger nach Frankreich 1815
Willibald Alexis
Inhalt:
Willibald Alexis - Biografie und Bibliografie
Zur Einführung
Als Kriegsfreiwilliger nach Frankreich 1815.
Als Kriegsfreiwilliger nach Frankreich, W. Alexis
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849604738
www.jazzybee-verlag.de
Willibald Alexis - Biografie und Bibliografie
Eigentlich Georg Wilhelm Heinrich Häring, bekannter Romandichter, geb. 29. Juni 1798 in Breslau, gest. 16. Dez. 1871 in Arnstadt, entstammte einer französischen Refugiésfamilie aus der Bretagne, die ihren französischen Familiennamen Hareng ins Deutsche übersetzt hatte, besuchte das Werdersche Gymnasium in Berlin, machte als Freiwilliger den Feldzug von 1815 mit, widmete sich hierauf in Berlin und Breslau juristischen Studien und wurde Auskultator und Kammergerichtsreferendar in Berlin. Bald entsagte er jedoch der juristischen Laufbahn und widmete sich ausschließlich der schriftstellerischen Tätigkeit, wobei er mitten im Gewirr publizistischer Vielgeschäftigkeit große poetische Pläne festhielt und künstlerisch gestaltete. 1856 hatte H. das Unglück, bald nach seiner Übersiedelung nach Arnstadt in Thüringen, wo er sich ein anmutiges Heim gegründet, von einem Gehirnschlag getroffen zu werden, von dem er sich nie wieder vollständig erholte. Seine eigentliche literarische Tätigkeit begann H. mit einem idyllischen Epos in Hexametern: »Die Treibjagd« (Berl. 1820), dem zwei Novellen: »Die Schlacht bei Torgau und der Schatz der Tempelherren« (das. 1822), folgten. Aus einer Wette im Freundeskreis ging ein dreibändiger Roman: »Walladmor« (Berl. 1823–24, 3 Bde.), hervor, eine kecke Mystifikation, indem der Verfasser das Werk für eine Schöpfung Walter Scotts ausgab und damit überall Glauben fand. Der Roman wurde ins Englische und mehrere andre Sprachen übersetzt. Unter derselben Maske erschien auch der Roman »Schloß Avalon« (Leipz. 1827, 3 Bde.), dem die »Geächteten« (Berl. 1825) vorausgegangen waren. Bald aber trat H. mit selbständigern Produkten auf, in denen sich Anklänge an Scott und Tieck mit seinen eignen, von der jungdeutschen Bewegung beeinflußten Reflexionen mischten, ohne daß der Objektivität der Darstellung dadurch Eintrag geschah. Unter seinen »Gesammelten Novellen« (Berl. 1830–31, 4 Bde.) und »Neuen Novellen« (das. 1836, 2 Bde.) sind einzelne, wie »Venus in Rom« und »Acerbi«, vortrefflich in Ausführung und Darstellung. Sein eigenstes Gebiet, das der historischen Romandichtung mit dem Hintergrund märkisch-preußischer Geschichte, betrat H. zuerst in seinem umfangreichsten Werke: »Cabanis« (Berl. 1832, 6 Bde.; 7. Aufl. 1893), einem charakteristischen Bild aus der Zeit Friedrichs d. Gr. Aber bereits mit dem Roman »Das Haus Düsterweg« (Leipz. 1835) schien H. wieder in andre Bahnen einzulenken. Als Reiseschriftsteller trat er in seiner »Herbstreise durch Skandinavien« (Berl. 1828, 2 Bde.), den »Wanderungen im Süden« (das. 1828) und den »Wiener Bildern« (Leipz. 1833) auf, welch letztere in Preußen verboten, während umgekehrt seine »Schattenrisse aus Süddeutschland« (Berl. 1834) von den Liberalen angefeindet wurden. Seine »Zwölf Nächte« (Berl. 1838, 3 Bde.) leiden an einer gewissen Nüchternheit und Breite des Räsonnements, die der sonst trefflichen Darstellung Eintrag tun. Sein »Urban Grandier« (Berl. 1843, 2 Bde.) war als Nachtgemälde des Fanatismus von Interesse. Zwischen der Folge seiner historischen Romane erschienen noch: »Der Zauberer Virgilius« (Berl. 1851), »Märchen aus der Gegenwart« (das. 1852) und das Bruchstück eines unvollendet gebliebenen Zeitromans, das Idyll »Ja, in Neapel« (das. 1860). Für die Bühne schrieb H. in früherer Zeit die Lustspiele: »Der Prinz von Pisa« und »Die Sonette« (1828), das Drama »Ännchen von Tharau« (1829) und den Fastnachtsschwank »Der verschwundene Schneidergesell« (1841). Auch gab er »Balladen« (Berl. 1836) und mit E. Ferrand und A. Müller »Babiolen« (Leipz. 1837, 2 Bde.) heraus. Die längere Zeit geführte Redaktion des »Berliner Konversationsblattes«, womit 1830 »Der Freimütige« verbunden wurde, gab er 1835 auf. Das von ihm mit Hitzig begonnene Werk »Der neue Pitaval« (Leipz. 1842–63, Bd. 1–33) behauptet unter allen für ein größeres Publikum bestimmten Sammlungen von Kriminalgeschichten den Vorrang. Seine eigentliche Bedeutung in der neuern deutschen Literatur errang aber Willibald Alexis lediglich mit den vortrefflichen historischen Romanen, zu denen »Cabanis« der Vorläufer gewesen war. Nacheinander erschienen: »Der Roland von Berlin« (Leipz. 1840, 3 Bde.; 6. Aufl. 1902), der die letzten Kämpfe des altmärkischen Bürgertums gegen den neuaufstrebenden Hohenzollernstamm im 15. Jahrh. zum historischen Hintergrund hat; »Der falsche Woldemar« (Berl. 1842, 3 Bde.; 5. Aufl. 1893), der die denkwürdigste Episode der mittelalterlichen Geschichte der Mark Brandenburg behandelt; der Doppelroman »Die Hosen des Herrn von Bredow« (das. 1846–48, 5 Bde.; 14. Aufl. 1900), in zwei Abteilungen: »Hans Jürgen und Hans Jochem« und »Der Werwolf« (in 3 Büchern, 7. Aufl. 1899), welche die Zeit des Kurfürsten Joachim I. und der Reformation zum Hintergrund haben; »Ruhe ist die erste Bürgerpflicht« (das. 1852, 5 Bde.; 5. Aufl. 1898), die traurigste Zeit Preußens vor der Katastrophe von Jena darstellend; »Isegrimm« (das. 1854, 3 Bde.; 5. Aufl. 1899), aus den Tagen der Erhebung und des Aufschwunges nach 1806, und endlich »Dorothe« (das. 1856, 3 Bde.; 4. Aufl. 1896), welcher Roman wiederum in die letzte Zeit des Großen Kurfürsten zurückgreift. Alle diese Romane, obschon nicht völlig von prosaischen Elementen frei, erheben sich doch in der Hauptsache durch die Fülle charakteristischer Gestalten sowie durch die Wiedergabe der Zeitstimmung und die Schilderung märkischer Landschaften, aus denen die Eigentümlichkeiten der Menschen erwachsen, zu wahrhaft poetischer Bedeutung. Härings »Gesammelte Werke« erschienen in 20 Bänden (Berl. 1374), die »Vaterländischen Romane« besonders in 8 Bänden (zuletzt das. 1884); seine »Erinnerungen« gab M. Ewert heraus (das. 1899). Vgl. Julian Schmidt, Neue Bilder aus dem geistigen Leben unsrer Zeit (Leipz. 1873); G. Freytag in den »Gesammelten Werken«, Bd. 16 u. 23; Ad. Stern, Zur Literatur der Gegenwart (das. 1879).
Zur Einführung
Wahrlich, wir leben in einer unvergeßlich großen Zeit! »Wir können nun zu jeder Stunde sterben,« dürfen wir mit Ernst Moritz Arndt uns wieder rühmen, »wir haben auch in Deutschland das gesehen, weswegen es allein wert ist zu leben: daß Menschen in dem Gefühl des Ewigen und Unvergänglichen mit der freudigsten Hingebung alle ihre Zeitlichkeit und ihr Leben darbringen können, als seien sie nichts.« Wie im heiligen Jahre 1813 strömten auch jetzt wieder aus allen Winkeln unsres Vaterlands aus allen Schichten unsres Volks Freiwillige sonder Zahl zu den Waffen: Knaben und Männer, Jünglinge und Greise, und wieder war »das Schönste bei diesem heiligen Eifer und fröhlichen Gewimmel, daß alle Unterschiede von Ständen und Klassen, von Altern und Stufen vergessen und aufgehoben waren, daß jeder sich demütigte und hingab zu dem Geschäft und Dienst, wo er der brauchbarste war, daß das eine große Gefühl des Vaterlandes und seiner Freiheit und Ehre alle andern Gefühle verschlang«. Und doch welch tiefe Kluft im Vaterlandsempfinden des Deutschen von heute und von vor hundert Jahren tut sich vor unsern Blicken auf, wenn wir die nachstehenden Erinnerungen eines Kriegsfreiwilligen jener Tage lesen! Gewiß: Alexis zog, ein Jüngling näher dem Knaben, erst 1815 mit nach Frankreich; aber »es war noch der kräftige Nachhall desselben mächtigen Impulses«, sagt er selbst. Er hat seine Erinnerungen erst rund ein Vierteljahrhundert später auf Grund seiner Briefe und Tagebuchaufzeichnungen niedergeschrieben - sie erschienen 1844-46 in Theodor Hell-Winklers Taschenbuch »Penelope« -, und die Ueberlegenheit und Skepsis des reifen Mannes, den die Zeit der Reaktion verbittert hat, spricht oft genug nur zu laut aus ihnen. Aber auch der Sechzehnjährige vermochte sich nicht immer jenem Unmut zu verschließen, der selbst einen Theodor Körner aus dem russischen Hauptquartier zu Reichenbach (28. Juli 1813) einmal bekennen läßt: »Daß doch nichts die Begeisterung so abkühlt als die ruhige, genaue Beobachtung! Wenn eine so heilige Sache einem ordentlichen Herzen je zu verleiden wäre ...«
Gerade dieser grelle Kontrast im Vaterlandsempfinden gibt den in erster Linie kulturhistorisch zu wertenden Erinnerungen heut einen besondern Reiz; dies, und daß sie ein geborener Dichter schrieb, der das Kleinste scharf und im rechten Zusammenhange gesehen hat. Jene Kriegszeit in den Ardennen: dieses Auf und Nieder der Stimmung, dieses wilde Lagerleben und wieder märchenhaft stille Dasein im völlig von der Welt abgeschiedenen Dorfquartiere ist für Alexis nicht nur eine strenge Schule des Lebens, sondern weit mehr noch eine reiche Schule der Dichtung gewesen. Die »volle, gläubige Begeisterung« aber, die den Jüngling vor hundert Jahren zu den Waffen trieb, sie hat ihren reinsten und stärksten Ausdruck in den vaterländischen Romanen des Mannes gefunden, die nicht zum geringsten Teile in uns unsern heutigen höheren Begriff vom Vaterlande, seiner Freiheit und Ehre reifen ließen.
Als Kriegsfreiwilliger nach Frankreich 1815.
Der Aufruf und der Aufstand der Freiwilligen im Jahre 1815 in Preußen war nur eine Nachdröhnung der Volkserhebung im Jahre 1813. Gentz bewies, nach den ihm sehr unangenehmen Wartburggeschichten, daß die Freiwilligen damals überflüssig gewesen wären. Die Massen Linientruppen, welche Preußen, Österreich mit dem wieder vereinigten Deutschland zusammenbringen konnten, hätten in Verbindung mit den Heeren und Schiffen der englischen und russischen Alliierten das Werk allein zu Ende geführt. Ich weiß nicht, ob man preußischerseits 1819 auf diese diplomatische Rüge geantwortet hat; aber 1815 schien auch der preußischen Regierung das Volk und seine Teilnahme noch notwendig, es war noch der kräftige Nachhall desselben mächtigen Impulses. In den Schulen war nur eine Stimme. Wer konnte, sollte und mußte mit, darüber war keine Frage. Wen schwache Gesundheit, Eltern oder Vormünder nicht fortließen, wurde bedauert oder verhöhnt. Es war gewiß Spielerei mit im Spiel; wo aber fehlt die auch bei den ernstesten Fragen! Und sollte die Jugend, wo sie ihr als Tugend geboten wurde, nicht freudig zugreifen! Es war ein wonniges Gefühl, schon halb in militärischer Kleidung, mit rotgestreiften Beinkleidern oder gar mit der grünen, wohlkleidenden Jägeruniform, in die Klassen zu gehen. Wie staunten die andern jüngern Schüler den künftigen Helden an, wenn er, die kleine Mappe, die alten Klassiker unterm Arm, stolz durch ihre Reihen schritt! Wie anders, mit welchem Selbstgefühl blickte er den Lehrer auf dem Katheder an, der wohl von Aufopferung fürs Vaterland sprach, aber er blieb zu Haus, und wir opferten uns; er redete von den großen Taten unsrer Väter, wir wollten sie vollbringen. Seine Autorität war nur noch eine prekäre; in wenig Tagen gehorchten wir einer andern. Er hatte uns nichts mehr zu gebieten; das war schon ein Heldengefühl.
Gentz mag von dem kühlen Standpunkte aus, von dem er die Sache ansah, Recht gehabt haben. Materiell war der Volksaufstand nicht mehr nötig; es war wenigstens nicht mehr nötig, daß der Beamte sein Amt, der Meister sein Handwerk, der Gatte die Gattin verließ, und daß sechzehnjährige Knaben von den Bänken in Prima und Sekunda forteilten, um das Vaterland zu retten. Wenn es noch das zu retten galt, so reichte die bewaffnete Macht aus. Die ideelle Macht war von beiden Seiten schon gebrochen. Napoleon focht bei Waterloo für seine Sache; aber er mußte ihr einen andern Namen geben, um die Nationalbegeisterung in Frankreich dafür zu erwecken. Daß es für Deutschland nicht mehr um die geträumte Freiheit und nationale Einheit sich stritt, hatten die Verhandlungen des Wiener Kongresses verraten.
Nur nicht uns sechzehn- und siebzehnjährigen Jünglingen. Wir träumten noch, wir waren noch berauscht; noch fühlte man nichts von Nachwehen. Die begeisterten Reden unsrer Lehrer, die Nachklänge der Fichte-, Schleiermacher-, Arndtschen wissenschaftlichen Kriegsberedsamkeit, von allen Kathedern hallend, Körners und Schenkendorfs Lieder, die Erzählungen der älteren Jünglinge, die 1813 und 1814 mit geblutet und mit gesiegt, alles das erhielt den Rausch lebendig. Wir schwelgten in Fouques Nordlandssagen, in seinem gründlichen Neufranzosenhaß. Die Ideen des Turnertums waren mächtig, auch außerhalb der Hasenheide. Der Plumpsack, der dort jedem, welcher durch ein Fremdwort die deutsche Sprache entweihte, drei Streiche versetzte, ging auch moralisch in der jungen Gesellschaft um. Jahns Deutschtümlichkeit war uns kein Phantom, sondern eine Wahrheit, und wir hofften noch zuversichtlich auf die Realisierung unsrer Ideen von einem deutschen Volkstume, wenn wir auch über das Wie? weder mit andern noch mit uns im reinen waren.
Dennoch war auch schon da in die preußische Jugend ein Mißklang gedrungen. Ganz war es uns nicht entgangen, daß die Diplomatie der Nationalbegeisterung ein Schnippchen geschlagen hatte, und daß andre das ernten wollten, was das Volk durch Opfer und Tapferkeit errungen hatte. Aber wir bewegten uns noch in einem engen Formelkreise. Die gespenstischen Wörter: Aristokratie, Bureaukratie und Hierarchie, die uns seitdem erschreckten, lagen damals außerhalb desselben; und das Wort Tyrannei, das gründlich gehaßteste, kannten wir zwar, aber wir waren viel zu loyal, um es auf andre anzuwenden, als auf den Franzosenkaiser Napoleon. Unsre natürliche Freiheitsliebe war mit dem Franzosenhaß identifiziert. In den Intrigen, die auf dem Wiener Kongresse spielten, sahen wir nichts als eine Rückkehr zu der alten französischen Diplomatie, der wir nicht sowohl ihre Tendenzen als ihre unvolkstümlichen Formen vorwarfen. Mit höchster Entrüstung betrachteten wir Deutsche es namentlich, daß so viel deutsches Blut auf deutscher Erde geflossen war, und doch wurde der Friede in französischer Sprache geschlossen. So viele der wunderbarsten Begriffe von Volkstum hatten wir uns eingepfropft – zu denen aber Fürsten, Könige und womöglich auch ein Kaiser gehörten – und doch verhandelte und handelte man nicht aus einem Volksrat heraus oder offen königlich für das Volk, sondern aus den Kabinetten zu den Kabinetten, heimlich, schriftlich und in französischer Sprache! Wie paßte das zu den herrlichen, kernigen Aufrufen an das Volk, zu den Proklamationen, die immer an Karl und Wittekind gemahnt hatten!
Die Stimmung in der Jugend war durchaus ernst und religiös; christlich und durch die Vermittlung der Romantik sogar etwas katholisch. Nichts von lasziver Beimischung und ironischer Betrachtungsweise; diese hat erst der nachfolgende Druck in der deutschen Jugend hervorgebracht. Von der Seite fürchteten wir keine Reaktionen, wie uns der Ausdruck überhaupt fremd war. Nur die geheime, fremde, französische Hofsitte, das nicht deutsche Galakleid der Etikette, die gleisnerischen Schranzen, die vornehmen Riccauts de la Marliniere, die wir überall wieder durch die Türritzen dringen sahen, waren uns verhaßt. Daß ein Talleyrand sogar, in dem wir den leibhaftigen Bösen mit dem Klumpfuß sahen, in Wien mitsprechen, das große Wort führen durfte; daß Kaiser Alexander, nach dem herrlichen, heiligen Kampfe, mit Franzosen und Französinnen schön tun konnte, und die deutschen Fürsten vergingen nicht in edler Entrüstung! Deutsche Aristokraten von Schrot und Korn, die gewußt hätten, geschickt die Sache anzufangen, hatten einen guten Teil der deutschen gärenden Jugend damals noch für sich gewinnen können ...
Wir waren christlich romantisch, aber auf diesem Wege schon etwas fatalistisch gestimmt. Gottes Gerichte wirkten immer unmittelbar ein. Napoleons Rückkehr von Elba, die Zersprengung des Wiener Kongresses war ein sichtlicher Fingerzeig, daß Gott mit diesem Frieden in französischer Sprache nicht zufrieden war. Es mußte aufs neue losgehen, ein letzter Akt, eine letzte Schlacht geschlagen werden, um einen andern Frieden in andrer Sprache, mit anderem Geiste und anderen Bedingungen zu schließen. Elsaß und Lothringen mußten wenigstens wieder deutsch werden; vielen aber mochte die dunkle Idee von der Zerstörung des neuen Babels, von dem Untergänge von Paris vor Augen schweben. Ein guter, glorreicher Ausgang war uns sicher; der Zauber war ja längst gebrochen, es kam nur darauf an, den Zauberer zu zermalmen, damit er nicht noch einmal spuke. So, voll sicheren Vertrauens auf den Ausgang, voll Überzeugung von der erneuten Notwendigkeit des Volksaufstandes, von der göttlichen Mission, der wir folgten, schwuren wir Jüngeren zu den Fahnen.
Die Wirklichkeit forderte rasch genug nach solchen Träumen ihr Recht. Aus Büchern und Knabenspielen, aus der Mutter Obhut und den gebildeten Kreisen des bürgerlichen Lebens plötzlich mit sechzehn Jahren in das Treiben und unter die Gesänge und Scherze einer ausgelassenen Soldateska versetzt zu sein, ist eine eigene Sache. Ich hatte mir eingebildet, die Freiwilligen wären im allgemeinen wie ich. Da glühte in allen derselbe heilige Franzosenhaß; dieselbe Entrüstung über den verpfuschten, halben Frieden und eine wenigstens ähnliche Begeisterung für deutsche Volkstümlichkeit. Wenn ich auch zweifelte, daß alle Fouqué gelesen hätten, so mußten sie doch Goethe und Schiller und den Straßburger Münster und die deutsche Geschichte kennen. Sie alle konnte nur Haß und Liebe in die Reihen der Vaterlandsverteidiger geführt haben. Im Jahre 1813 hätte ich mich nicht getäuscht. Die freiwilligen Jäger waren damals die Elite der preußischen Jugend, alle mehr oder minder poetische Abdrücke von Theodor Körner. Die Studierenden, Künstler, jüngeren Beamten, Ökonomen bildeten in ihren Kompagnien große Hetärien, wo unter den Beschwerden der Märsche, im Getös der Waffen, Gesang, Scherz, geistige Erregung, gesellige Erinnerungen das Zelt- und Feldleben angenehm machten. Alle verstanden sich; aus der Heimat, der Schule hatten sie hundert Anknüpfungspunkte, und Poesie und Kunst warfen mannigfache Lichtstrahlen in die beschwerdevolle Wirklichkeit. Die Kameradschaften hatten die edelsten Züge aufopfernder Liebe hervorgebracht. Die Todmüden, vor Erschöpfung Taumelnden, in dunkeln morastigen Hohlwegen, auf dem Rückzug, Feindesstimmen hinter ihnen, vor ihnen, im Augenblick, wo sie sich in der Verzweiflung hinstrecken wollen, geschehe was da sei; in dem Augenblick stimmt ein Kamerad eine Melodie aus einer bekannten Oper an, eine Parodie auf ihre Zustände, und der grelle Gegensatz des Damals und Jetzt wirkt so erschütternd auf das Zwerchfell und den Mut anregend, daß die Lebenskräfte zurückkehren, die andern in den Gesang einstimmen und die Kameraden sich wieder zum Marsche zusammenscharen. So half damals die Poesie der Wirklichkeit. Es war ein poetisches Leben dieses erste Jägerleben; in Körners Liedern haben wir das beste Symbol der damaligen Stimmung.
Anders war es 1815. Ich sprach von einer Soldateska, in die ich trat. Allerdings hatten die Freiwilligen, welche sich beim Morgengrauen zu den ersten Exerzierübungen auf dem Dönhoffsplatze stellten, Elemente in sich, welche an »Wallensteins Lager« erinnerten. Die Freiwilligkeit hatte schon den Preußischen Normalleisten angezogen. Es war nicht gerade eine gezwungene Freiwilligkeit, aber ein moralischer Zwang war eingetreten. Bekanntlich hatten die Freiwilligen des Jahres Dreizehn, fast allein aus den gebildeten, wohlhabenden Ständen, sich alle selbst equipiert. Aus eignen Mitteln wurden Jägeruniform, Lederzeug, Tornister, Mantel, Hirschfänger und Büchse angeschafft. Auf die Uniformität sah man nicht mit zu großer Ängstlichkeit. Die reitenden Jäger hatten sich ihre Pferde selbst gekauft. Die Einzelnen, die Familien, hatten große Opfer gebracht. Ähnliches ist nie in der neuern Geschichte vorgekommen; wenn auch die Eitelkeit bei den »Opfern am Altar des Vaterlandes« mit ihr Spiel trieb, so waren diese Opfer doch allgemein, durch alle Stände, Provinzen, gleichmäßig verbreitet; und wenn man Preußens erschöpften Zustand, die Verarmung durch den Krieg, das Aussaugesystem der Franzosen, die gebotenen Abgaben zur Führung des Krieges in Anschlag bringt, außerordentlich. Reiche Familien rüsteten außer ihren eigenen Söhnen noch die ärmeren Bekannten aus. Bemittelte und Unbemittelte steuerten zusammen, um dürftigen Jünglingen Waffen und Kleidung zu verschaffen. Die Universitäten, Gymnasien sammelten unter sich, um ihre ärmeren Kommilitonen auszurüsten. Unerschöpflich war namentlich der Eifer der Frauen. Auch der Zug darf nicht der Vergessenheit übergeben werden, als ein junges Mädchen, die nichts geben konnte, ihr langes, schönes Haar abschnitt, und den Erlös dafür beim Friseur zur Bewaffnung der Freiwilligen darbrachte.
Auch im Jahre 1815 rüsteten die Freiwilligen, welche die Mittel dazu hatten, sich selbst aus; auch da wurden von Einzelnen und Familien Opfer gebracht. Wir erhielten dafür nie einen andern Ersatz, als den das eigene Gefühl uns gewährte. Aber, fürchtete man, daß die Opferlust geringer sein, und die Zahl derer, welche sich unter die freiwilligen Jäger stellten, unbedeutender ausfallen würde, als man des moralischen Eindrucks wegen wünschte? Genug, der Staat versprach alle die als Jäger auf seine Kosten auszurüsten, welche in den Jahren 1813 und 1814 in irgendeiner Truppe gedient und sich jetzt wieder unaufgefordert zum Dienst stellen würden. Die Lust an dem gerühmten, freieren Leben der Jäger lockte viele an, die im früheren Sinne nicht dahin gehörten. Die Arbeit in der Werkstatt, die Monotonie hinter dem Ladentische und an dem Schreibtische war von vielen schwer ertragen worden, welche in einem zweijährigen Kriegsleben zwar an Beschwerden, aber auch an Müßiggang und beständigen Wechsel sich gewöhnt hatten. Der Aufruf konnte ihnen nicht erwünschter kommen. Mehrere hörte ich hoch und teuer schwören, daß sie nie wieder in den armseligen frühern Zustand zurückkehren wollten. Kriege mußte es ja doch immer geben. Wie mancher wartete noch immer, daß Napoleon auch von Helena losbrechen werde, und griff auf die falsche Nachricht nach der alten Jägerbüchse, die ihm als trostreiche Erinnerung an der Wand hing.
Andre lockte das Versprechen, daß nach dem hergestellten Frieden jeder Freiwillige vorzugsweise bei der Anstellung in Zivilämtern bedacht werden solle. Welches Mißvergnügen, wie viel Lebensverstimmungen und moralische Zerrissenheiten hat dies gewiß aufrichtig gemeinte Versprechen später hervorgerufen! Es war unmöglich, allen Erwartungen zu genügen. Das Bürgertum wäre verzehrt worden, wenn der Staat für alle, welche gedient hatten, Ämter schaffen sollte. Ich weiß nur zu viel traurige Beispiele, wohin die erweckte Arbeitsscheu, die Lust am Herumtreiben und die gespannten Erwartungen, die nie befriedigt werden konnten, viele geführt haben. Ein lieber Schulkamerad, der sich nicht wieder an die zu früh verlassenen Studien gewöhnen konnte, verdumpfte gänzlich. Mutlosigkeit und Trunk richteten andre zugrunde, nicht die Schlechtesten. Noch steht mir lebhaft ein Austritt aus meiner spätern juristischen Laufbahn vor Augen. Im Kriminalgericht beschäftigt, ziehe ich an der Klingel, um in einer Untersuchung wegen Diebstahls, die ich von einem Kollegen geerbt, den Verhafteten vortreten zu lassen. Der Name in den Akten war mir schon auffällig; als der Unglückliche eintrat, sah ich einen mir wohlbekannten Kriegskameraden, mit dem ich oft in stürmischen Nächten auf Vorposten stand, mit dem ich oft am selben Feuer gekocht und mich gewärmt hatte. Er gehörte damals nicht zu den schlechtesten Kameraden. Ich eilte, die peinliche Untersuchung los zu werden. Zum Glück hatte er in seinem Inquirenten nicht seinen Zeitgenossen erkannt.
In diesem bunten Gemisch der neuen Freiwilligen konnte man leicht die, welche aus Staatsmitteln dazu gemacht wurden, heraus erkennen. Aber der grobe, grüne Kommißrock und die schwere Muskete statt der feineren Uniform und der zierlichern Büchse waren nur ein äußeres Unterscheidungszeichen, das nicht immer mit der moralischen Unterscheidung zusammentraf. Ich habe wackere, treffliche, auch gebildete Kameraden unter den ersteren kennen und schätzen gelernt. Die Sprache lehrt, auch unter gleichmäßig Uniformierten zuerst und bald den Menschen kennen. Zu kameradschaftlichem Zusammenleben war, solange wir in Berlin die ersten Übungen vornahmen, keine Gelegenheit; aber aus den ersten Unterhaltungen lernte ich viel, wovon ich keine Ahnung hatte. Wird man sich verwundern, daß ein sechzehnjähriger Neuling, der aus dem mütterlichen Hause nur in geistesverwandte Kreise gekommen war, über diese Sprache, Scherze, Lieder erschrak! Ich befand mich in einer neuen Welt, und die war höchst unbehaglich, zurückstoßend. Aber wie schnell übt die Gewohnheit ihre Macht. Das Pferd scheut vor den Eseln. Fouqué erzählte mir, wie vielen Verdruß seiner ritterlichen Natur die Erfahrung bereitet, daß die edlen Rosse seiner Schwadron, als er in einem Ort lag, wo die Esel zu Hause waren, sich schon in den ersten Wochen an die Kameradschaft gewöhnt hatten. Ja, sie wieherten sich an, wenn sie sich begegneten, die Rosse ohne Scheu vor ihren noch edlern Reitern.
Soldaten denken, sprechen, scherzen, und – phantasieren überall ähnlich und über dasselbe Thema. Nur unter den Berliner Freiwilligen war eine Ausnahme. Die Ausstrahlungen des vornehmen, gebildeten Lebens haben, wie bekannt genug ist, hier die Masse berührt und über die Roheit einen Firnis von Bildung gebreitet, den wenigstens Jünglinge wie ich nicht sogleich heraus erkennen konnten.
Aufgeschnappte Theaterphrasen, absprechende Urteile, vornehme Redensarten, Sentenzen in der sogenannten Sprache der Bildung hingeworfen, konnten mich über meine Umgebung täuschen. Doch nicht auf lange. Es waren viele gebildete junge Leute unter den pommerschen Jägern des berühmten »Regiments Kolberg«, in das ich eingetreten war; aber als Neulinge traten sie schüchtern hinter den Veteranen zurück, man lernte sich erst später kennen. Die, welche den vorigen Feldzug mitgemacht hatten, führten, wie sich das von selbst versteht, das Wort; sie waren die Lauten, wir die Stillen. Wie schwanden meine Illusionen! Weshalb ging dieser mit, warum war jener nicht zurückgeblieben! Der aspirierte auf eine Schreiberstelle in einem Bureau, aber er mußte vorher gedient haben. Jener konnte es im elterlichen Hause nicht aushalten; oder er hatte überhaupt kein Haus und keinen Winkel, wo er hatte bleiben können. Ein andrer hoffte auf eine reiche Braut, wenn er als Sieger heimkehrte. Alle waren voll Franzosenhaß, wie ich; aber ich leugne nicht, daß die Hoffnung auf gute Quartiere in Frankreich bei diesem Hasse mitspielte. Sie wollten dort, wie die Franzosen in ihrem Hause, wirtschaften.
Zeihe man mich keiner unpatriotischen Gesinnung, oder daß ich den deutschen Enthusiasmus, der die Freiwilligen hervorrief, verkleinern wolle. Ich schreibe nur Züge aus der allgemein menschlichen Natur, die, wenn große Aufregungen vorüber sind, ihren Bodensatz von Gemeinheit deutlicher zeigt. Die Mehrzahl der Freiwilligen aus dem Befreiungskriege waren als Offiziere in die Linie oder Landwehr eingetreten; nur ein geringer Rest derselben ergriff wieder die Jägerbüchse. Woher die andre Überzahl der Gedienten kam, habe ich bereits angegeben. Der jüngere, frischere Zuwuchs mußte sich erst entwickeln, und er tat es, oft im schönsten kameradschaftlichen Sinne. Ich ward Zeuge und beteiligt bei Zügen von Güte und Selbstvergessen, wie sie eben nur im Felde und unter Gefahren, wo die ursprüngliche Natur wieder siegreich über die angewöhnte heraustritt, zum Vorschein kommen werden. Nur geistige Erhebung, Begeisterung und Bewußtsein durfte man von unsern Freiwilligen im ganzen nicht erwarten. Die wir dieser Eigenschaften teilhaftig waren, wir waren noch halbe Knaben, und in welcher Art die Begeisterung sich äußerte, davon werde ich später ein Beispiel geben.
Endlich waren alle bekleidet, bewaffnet und notdürftig einexerziert; wobei ich bemerke, daß mir, der ich nicht musikalisch bin, die Signale der Blasinstrumente sehr schwer zu fassen wurden. Es ging mir indessen nicht allein so, und ich tröstete mich mit der Versicherung, die Veteranen mir gaben, daß im Gefecht nicht viel darauf ankäme; unter dem Donner der Kanonen und in der Hitze des Tirailleurgefechtes höre man nicht auf die Hornmusik. Jeder springe, schieße, laufe und wende sich, wie es ihm gut dünke, und wo er was zu treffen glaube. Eine treffliche Erklärung von einem Treffen, an die ich später recht lebhaft durch eine ähnliche erinnert wurde, die Immermann in seinem »Auge der Liebe« einen Feldherrn der Not seinen Hauptleuten geben läßt. Wir waren noch nicht Soldaten, als wir abgingen; wir dienten nur als Symbole des allgemeinen Willens: den Sturm und Drang von Dreizehn fortzusetzen. Um den leuchten zu lassen, beeilte man sich, uns, wie wir waren, an den Rhein zu schaffen.
Es war ein schöner, es ward ein heißer Maitag, als wir am frühen Morgen auf dem Lustgarten standen, um ins Feld zu ziehen. Soviel ich mich entsinne, sangen wir nicht: »Frisch auf Kameraden!« oder »Der Sturm bricht los!« Entweder drückte uns der Abschied von den Lieben im Hause oder der Anfang der militärischen Disziplin. Auch gab es auf dem Versammlungsplatze selbst noch mannigfache Abschiedsszenen. Die jüngeren Freunde und Schulkameraden, die nicht so glücklich waren, mit ziehen zu können fürs Vaterland, ließen es sich nicht nehmen, den glücklichen Freunden zum letztenmal die Hand zu schütteln, auf Sieg, frohes Wiedersehen und Treue in Leben und Tod uns den Bruderkuß zu geben, und wer irgend konnte, begleitete uns noch auf dem Marsche. Man leistete den Scheidenden alle möglichen Liebesdienste, holte ihnen zu trinken, besorgte Grüße, trug, wo es sich tun ließ, ihre Sachen.
Den freiwilligen Jägern war, in Rücksicht auf ihre Jugend und zartere Konstitution, der Vorzug schon im vorigen Kriege zugestanden worden, daß ihre Tornister ihnen nachgefahren würden. Ein Vorzug, der uns dem Neide und Spotte der nicht so begünstigten Landwehrmänner aussetzte und oft nichts half. Denn wo kein Vorspann zu erhalten war, mußten wir die ungewohnte Bürde auf die Schultern nehmen, und das gewöhnlich auf den beschwerlichsten, angreifendsten Märschen. Die humane Berücksichtigung war übrigens auch eine weise. Ein Teil der halben Knaben, die bis da nur leichte Schulmappen getragen, würde, wenn nicht unter der Last erlegen, doch schwerlich in gesundem Zustande bis Frankreich gekommen sein. Außer der schweren Armierung, den Mantel über die Schultern gehängt, noch den schweren Tornister, mit seinen die Schultern oder noch schlimmer die Brust pressenden Riemen auf langen Marschen im Sonnenbrand und Staub zu tragen, dazu gehört eine andre Schule, als aus der wir kamen. Wir gewöhnten uns in der Folge daran; aber ich, wie mehrere andre junge Leute, entgingen den Wirkungen nicht, welche eine zu schwere Belastung und Einschnürung auf den noch im Wachstum befindlichen Körper hervorbringt. Beschwerden aller Art lernt eine ursprünglich gesunde Natur ertragen; aber ein zurückgehaltener Wuchs, eine blaßgraue Gesichtsfarbe stellte sich bei vielen als Folge ein. Erst weit später verwand ich beide durch Fußreisen ohne Gepäck und mit Freiheit und durch die reine Bergluft, die ich durch Monate in den norwegischen Gebirgen einatmete.
Mein Tornister war unter allen, welche auf die Wagen geladen wurden, der schwerste. Mir selbst verbarg der junge Freund, welcher bei dem Geschäfte zusah, die Wahrnehmung, die für mich buchstäblich eine sehr drückende werden mußte. Wer da weiß, was ein Tornister fassen kann, und was er bei einem Soldaten, der in den Krieg geht, fassen muß, wird sich freilich darüber nicht verwundern, wenn er hört, daß die mütterliche und schwesterliche Fürsorge zu den Hemden, Jacken, Schuhen, Bürsten, Tüchern noch Schokolade, Tafelbouillon, nützliche Anweisungen und sonst viel Gutes und Wohlgemeintes hinzugefügt hatte; alles auf den Umstand berechnet, daß der Tornister immer gefahren werde. Ich selbst war der Meinung, daß im Kriege auch der geistige Mensch Nahrung haben müsse, und außer einer Karte und Schreibpapier hatte ich ein Buch mitgenommen. Über die Wahl eines solchen war großer Zweifel gewesen, da weder von meinen Lehrern noch Angehörigen jemand wußte, welche Lektüre zum Kriege am besten passe. Einige stimmten für das Neue Testament; aber das konnte man allenfalls an jedem Orte finden. Ein gelehrter Anverwandter für den Horaz, weil er so sehr dünn sei, und in dem rohen Leben die Neigung für klassische Studien erhalten dürfte. Aber ich war kein Klassiker, sondern ein Romantiker und wählte die Nibelungen, weil sie eine deutsche Nationallektüre waren, vom Kriege handelten, und in der Zeuneschen Ausgabe, die ich wählte, auch nur dünn waren. Sie haben mich durch Deutschland und Frankreich begleitet, und ich brachte sie wieder in die Heimat zurück; ehrlich gesagt ziemlich so, wie ich sie mitgenommen hatte. Der Krieg der Sachsen und Burgunder schien doch ebensowenig wie der der Burgunder und Hunnen zu unserm mit den Franzosen zu passen. Ein andrer Kamerad hatte Schlegels Epigramme gegen Kotzebue mit. Ob er sie mehr gelesen, als ich die Nibelungen, weiß ich nicht. Aber er war ein noch viel stärkerer Romantiker als ich, verwandt mit einem der Koryphäen der Schlegel-Tieckschen Periode und gab mir in der Romantik noch Unterricht. Daß ich Kotzebue gelesen und mir einiges von ihm gefallen hatte, hielt er für ein bedenkliches Zeichen, und ließ es an Anweisungen nicht fehlen, wie ich diesen schlechten Geschmacksrest von mir abschütteln könne. Der eifrige Kamerad weilt längst - nicht im Kriege gefallen - unter den Geistern der Seligen, die ihm sagen werden, worin Kotzebue fehlte, und ob die Romantiker auf dem rechten Wege nach dem Höchsten waren, das wir auf dieser Erde erreichen.
Ein großes Staubmeer hüllte uns ein, sobald wir aus dem Potsdamer Tore die Chaussee betreten hatten. Der Abschied sollte uns erleichtert werden, indem der Staub die Rückblicke auf Stadt und Gegend verbot. Die Ordnung, wenigstens Reih und Glied, hörten sogleich auf, die Bekannten suchten sich; ein freundliches Gespräch trat ein. Unsre Freunde aus der Stadt, die uns begleiteten, gingen bunt unter und mit uns. Diese Zwanglosigkeit beim Marsch, auf die ich nicht gerechnet, erschien mir als ein froher Anfang; es war aber nichts Besonderes, indem es bei allen Militärmärschen nicht anders hergeht. Reih und Glied sind bei einem langen Marsche auf der Landstraße, wo Wagen, Reiter, Fußgänger oft unterbrechen, dieser und jener verweilen muß, auch bei Preußischer Disziplin nicht innezuhalten. Um gute Sänger, einen beliebten Erzähler oder Lustigmacher drängt sich alles. Solche Lustigmacher sind unschätzbar in einer Kompagnie, sowohl für die Soldaten als für die Offiziere. Auch in den untersten Sphären der militärischen Disziplin gilt das »Meus agitat molem.« Es bedarf moralischer Impulse, um einen Bajonettangriff zu wagen, und um einen Zug Soldaten auf dem Marsche in Ordnung zu halten. Sogenannte Marodeure (so wird jeder genannt, der zurückbleibt) wird es bei jedem Marsche geben, so oft auch der Kommandeur zurückreitet, anfeuert, droht und drängt; der eigene Vorteil rät aber schon, sich nicht gehen zu lassen, sondern womöglich bei den Vordersten zu bleiben; denn die Zurückbleibenden müssen sich doppelt anstrengen, und kommen oft erst an die Rastplätze, wenn die andern geruht haben und wieder aufbrechen. Daher oft ein Hasten und Drängen, zumal beim Anfang eines Marsches zu den Ersten zu gehören, was auch wieder sein Unangenehmes hat.
Ich bin ein tüchtiger Fußreisender geworden, und noch jetzt ist eine Fußreise meine Lust; aber als ich Soldat wurde, war es weder meine Lust, noch meine Stärke. Der Aufruf der Freiwilligen 1813, der möglicherweise auch mich dereinst treffen konnte, hatte mich zuerst angeregt, meine sehr geschonten Kräfte zu prüfen. Ich hatte es aber kaum weiter gebracht als bis zu Lustwanderungen nach Charlottenburg, Tegel und andern Vergnügungsorten um Berlin. Vielleicht hatte ich einmal das entfernte Potsdam erreicht. Ein entsetzlicher Gedanke heut: fünf bis acht Stunden sich in der Monotonie der Chaussee von Berlin bis Potsdam zu bewegen, während die Eisenbahn in drei viertel Stunden uns, noch zu langsam, dahin trägt. Was aber bedeutet eine Fußwanderung in leichter Kleidung, leicht geschuht und in frischer Luft, gegen einen Marsch dahin, mit Büchse und Patronentasche und unter dem Staube, den Hunderte vor und hinter uns aufregten!