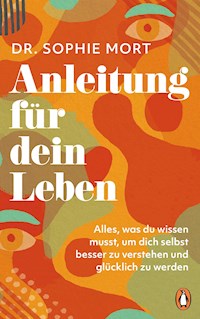
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Der Bestseller aus Großbritannien: Dr. Sophie Mort erklärt, wie du Probleme überwindest und mit dir und deinem Leben glücklich wirst
Geht es dir manchmal nicht gut, aber du weißt nicht, wer dir helfen könnte? Kämpfst du mit Gefühlen wie Unsicherheit, Angst und Einsamkeit? Fragst du dich, warum du in deinen Beziehungen immer die gleichen Fehler machst? Dann ist dieses Buch genau das Richtige für dich. Dr. Sophie Mort, Psychotherapeutin mit langjähriger Berufserfahrung, hilft dir, dich selbst besser kennenzulernen, dich so zu akzeptieren, wie du bist, und ein glückliches Leben zu führen.
Das Buch bietet
• psychologische Lebenshilfe für alle, die ihre Gefühle und ihr Verhalten besser verstehen wollen;
• schrittweise Selbsthilfe durch leicht umsetzbare Drei-Stufen-Methode: Probleme benennen, Verhaltensmuster erkennen und echte Veränderungen herbeiführen;
• jede Menge Tipps, Methoden und Techniken, die man in Krisensituationen leicht anwenden kann.
Wie funktioniert das Buch?
Wenn Patient*innen eine Therapie beginnen, stellen sie immer wieder die gleichen drei Fragen: Wie konnte es nur so weit kommen? Was hält mich gefangen? Und wie kann es weitergehen? Deshalb orientiert sich der Aufbau des Buches daran, diese Fragen in exakt der erwähnten Reihenfolge zu beantworten.
Teil Eins: Wie konnte es so weit kommen?
Der erste Teil des Buches hilft dir dabei zu verstehen, wie du dich zu dem Menschen entwickelt hat, der du bist. Er beginnt mit dem Moment, in dem du auf die Welt gekommen bist.
Teil Zwei: Was hält mich gefangen?
In diesem Abschnitt geht es darum, die ganz normalen Verhaltensmuster, schlechten Angewohnheiten und ungünstigen Kreisläufe zu erkennen, in denen du vielleicht gefangen bist und die möglicherweise hinderlich für dich sind.
Teil Drei: Wie kann es weitergehen?
Der letzte Teil des Buches enthält eine Erste-Hilfe-Toolbox mit vielen sofort anwendbaren therapeutischen Techniken wie Achtsamkeit, Selbstfürsorge, Tagebuchschreiben, Atem- und Entspannungsübungen.
»Anleitung für dein Leben« ist das Buch, von dem wir alle uns wünschen, wir hätten es schon viel früher gelesen! Weil es Einblicke in das eigene Ich eröffnet und uns dabei hilft, mit uns selbst glücklicher zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Ähnliche
Zum Buch:
Geht es dir manchmal nicht gut, aber du weißt nicht, wer dir helfen könnte? Kämpfst du mit Gefühlen wie Unsicherheit, Stress, Angst und Einsamkeit? Fragst du dich, warum du in deinen Beziehungen immer die gleichen Fehler machst? Dann ist dieses Buch genau das Richtige für dich. Dr. Sophie Mort, Psychotherapeutin mit langjähriger Berufserfahrung, hilft dir, dich selbst besser kennenzulernen, deine Probleme zu benennen, Verhaltensmuster zu durchbrechen und dich so zu akzeptieren, wie du bist. Darüber hinaus gibt sie dir jede Menge Methoden und Tipps an die Hand, die du in Krisensituationen leicht anwenden kannst. »Anleitung für dein Leben« ist das Buch, von dem wir alle uns wünschen, wir hätten es schon viel früher gelesen: weil es uns hilft, echte Veränderungen anzustoßen und ein glückliches Leben zu führen.
Zur Autorin:
Dr. Sophie Mort hat einen Bachelor in Psychologie, einen Master in Neurowissenschaften und hat in Klinischer Psychologie promoviert. Sie ist eine der wenigen Psycholog*innen weltweit, die die Psychologie aus dem Therapieraum herausholen: Seit 2018 teilt sie ihr Wissen in ihrem Blog, auf Instagram und per Online-Beratung und hat so bereits Tausenden vor allem junger Menschen geholfen, ihr emotionales Wohlbefinden zu verbessern. Sophie Mort gehört zu den Initiator*innen der Achtsamkeits-App Happy Not Perfect und ist eine in der Presse international gefragte Expertin. »Anleitung für dein Leben« ist ihr erstes Buch und wurde bei Erscheinen in Großbritannien direkt zu einem Bestseller.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
DR. SOPHIEMORT
Anleitung für dein Leben
Alles, was du wissen musst, um dich selbst besser zu verstehen und glücklich zu werden
Aus dem Englischen von Franka Reinhart und Karin Schuler
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel A Manual for Being Human. What makes us who we are, why it matters and practical advice for a happier life bei Gallery UK, einem Imprint von Simon & Schuster UK Ltd, London.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © der Originalausgabe 2021 by Sophie Mort
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München,
nach einem Entwurf von Matthew Johnson/S&S Art Department
Coverillustration: © Matthew Johnson/S&S Art Department
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN978-3-641-29177-8V003
www.penguin-verlag.de
What caused people distress was not so much their own mistakes, inadequacies and illnesses as the powers and influences that bore down upon them from the world beyond their skin.
David Smail
Dieses Buch richtet sich an alle, die neugierig auf ihre Mitmenschen, auf Psychologie und auf Psychotherapie sind – an Leute, die keinen Zugang zu therapeutischer Behandlung haben, genauso wie an jene, die sich schon länger in Therapie befinden.
Ich habe es für all diejenigen geschrieben, die nach Erklärungen für ihre Emotionen suchen. Sowohl für Menschen, die sich selbst gern besser verstehen wollen, als auch für solche, die unter seelischem Schmerz leiden und die niemanden haben, der ihnen helfen könnte, ihr Erleben zu deuten. Ich möchte mit meinem Buch all meine Abonnent*innen ansprechen, mit denen ich täglich auf Instagram tausendfach in Kontakt stehe und die den Mut haben, über elektronische Schranken hinweg von ihren Nöten zu berichten. Oftmals fehlt ihnen ansonsten jegliche Begleitung, um ihre Erfahrungen zu verstehen und einzuordnen.
Inhalt
Einführung: Wie entstehen psychische Probleme?
TEILEINS
Wie konnte es so weit kommen?
1. Bezugspersonen, Geschwister und unser familiäres Umfeld
2. Die Schulzeit
3. Werbung, Medien, sozialeNetzwerke
4. Stolz und Vorurteil
5. Lebensereignisse
TEILZWEI
Was hält euch gefangen?
6. Emotionen, Gedanken und Vorannahmen
7. Die 4F-Reaktionen: Fight-Flight-Freeze-Fawn
8. Bewältigungsstrategien, die alles nur noch schlimmermachen
9. Der innere Kritiker und negative Selbstdialoge
10. Moderne Liebe
TEILDREI
Wie kann es weitergehen?
11. Übungen zur Erdung
12. Atemübungen und Entspannungsmethoden
13. Achtsamkeit
14. Journaling
15. Selbstmitgefühl
16. Lebe nach deinen Werten
17. Finde deine Gemeinschaft und werde einTeil von ihr
18. Therapeutische Begleitung
Anhang
Vermeidung Schritt für Schritt überwinden
Danksagung
Anmerkungen
Einführung: Wie entstehen psychische Probleme?
Hallo, mein Name ist Dr. Soph,
ihr könnt mich Soph oder Sophie nennen.
Ich bin klinische Psychologin.
Bis vor ein paar Jahren habe ich in einem Londoner Krankenhaus gearbeitet, in einem Team zur mobilen Betreuung von erwachsenen Patienten mit Hirnverletzungen. Eines Tages fuhr ich gerade von einem Termin bei einer neuen Patientin wieder los, als mir etwas klar wurde. Ich erkannte, dass ich seit acht Jahren in den verschiedensten Bereichen meiner Tätigkeit bei neuen Patient*innen immer wieder das Gleiche erlebte: Menschen in großer seelischer Not stehen unfassbar lange auf einer Warteliste (manchmal über ein Jahr), ohne dass sie je über die elementarsten Grundlagen der Psychologie aufgeklärt wurden, wie sie für Psycholog*innen ganz selbstverständlich sind.
Mir wurde bewusst, dass ich die ersten Sitzungen mit neuen Klienten ausnahmslos damit zubrachte, ihre Erfahrungen von Stigmen zu befreien und ihnen zunächst psychologisches Basiswissen zu vermitteln.
Solche Informationen hätten ihre Ängste und ihren Schmerz zum Teil bereits erheblich lindern können, während sie auf einen Therapieplatz warteten.
An jenem Morgen hörte ich in den Nachrichten, dass die Zahl der Menschen, die psychologische Hilfe benötigen, immer mehr steigt und das Gesundheitswesen große Mühe hat, diesen Ansturm zu bewältigen. Außerdem wurde berichtet, dass sich die psychische Gesundheit zunehmend verschlechtert – nicht nur in Großbritannien, sondern weltweit.
Dabei musste ich an die vielen Fragen denken, die ich in meinem Freundeskreis, meiner Familie und meiner Instagram-Community immer wieder zu hören bekam: Warum geht es mir so schlecht? Wie konnte es nur so weit kommen? Was soll ich jetzt machen? An wen kann ich mich wenden? Diese Fragen habe ich früher ebenfalls gestellt. Und genau sie waren auch der Grund, warum ich Psychologie studiert habe.
Und plötzlich ging mir ein Licht auf.
Es gibt einen simplen Grund, warum viele Menschen so mit sich selbst kämpfen und ringen: Wir haben es schlichtweg nicht gelernt, uns selbst zu verstehen.
Uns wird nicht beigebracht, unsere Gefühle zu deuten oder schon als Kinder oder Jugendliche zu erkennen, wer wir eigentlich sind. Stattdessen fürchten wir uns davor und empfinden mentale Probleme jeglicher Art als beschämend. Statt einfache und wirkungsvolle Strategien zur Bewältigung zu erlernen, erwartet man in der Regel von uns, dass wir uns nichts anmerken lassen, »artig sind«, uns »zusammenreißen«, oder suggeriert uns, dass alles doch »nicht weiter schlimm« sei.
Statt uns zu ermutigen, uns so anzunehmen, wie wir nun einmal sind, mit allen Makeln und Schwächen, verlangt man von uns, eine bestimmte Rolle zu spielen, die wir nach außen hin jederzeit zu präsentieren haben. Dadurch verbergen wir unser wahres Empfinden – sogar vor uns selbst.
Das hat zur Folge, dass wir ausgesprochen schlecht darauf vorbereitet sind, die Belastungen des Lebens zu bewältigen und uns mit unserem emotionsgeladenen Ich zu arrangieren.
Wenn wir aber nicht darauf vorbereitet sind, uns selbst zu verstehen, sieht es schlecht für uns aus: Wir sind unausweichlich mit psychischen Belastungen konfrontiert, aber wir verfügen nicht über die geeigneten Mittel, um darauf zu reagieren. Stattdessen tun wir so, als wäre alles in bester Ordnung. Wir beschäftigen uns anderweitig und vergraben uns in Arbeit. Wir greifen auf Sex, Alkohol, Drogen oder Netflix zurück, was uns aufmuntert, allerdings nur kurzfristig. Diese Formen der Ablenkung lösen jedoch weder unsere Probleme, noch bringen sie uns voran. Stattdessen tragen sie nur dazu bei, das Unvermeidliche eine Zeitlang aufzuschieben, bis uns die nächste Welle von seelischem Stress überrollt.
Dann machen wir uns Vorwürfe, weil wir so empfinden, fühlen uns dadurch noch schlechter und geraten so in einen Teufelskreis.
Somit sind psychische Störungen nahezu vorprogrammiert.
Doch damit soll Schluss sein! An dem Tag, als ich das erkannte, griff ich sofort zum Stift und listete die ganzen Themen auf, die ich in den ersten Sitzungen mit meinen Patienten üblicherweise abarbeite. Aus diesen Notizen ist das vorliegende Buch entstanden. Es enthält Antworten auf all die Fragen, die mir immer wieder aufs Neue gestellt werden.
Diese Informationen, die sonst meist hinter verschlossenen Praxistüren, im akademischen Elfenbeinturm und in alten, verstaubten Lehrbüchern verhandelt werden, möchte ich euch hiermit zugänglich machen.
Sollten euch diese Fragen meiner Patienten, Freundinnen, Angehörigen genauso beschäftigen wie mich, wird dieses Buch euch dabei helfen, Antworten zu finden. Es enthält all das, was ihr braucht, um wirklich zu verstehen, wer ihr seid und was euch wirklich ausmacht.
Worum geht es in diesem Buch?
Es handelt sich hier keineswegs um ein trockenes und langweiliges Psychologie-Kompendium (keine Sorge, die lese ich für euch), sondern um einen Leitfaden für das menschliche Erleben. Dieses Buch enthält eine Fülle von psychologischen Konzepten aus den verschiedensten Traditionen, darunter auch meine eigenen Ansätze und Tipps, die ihr direkt anwenden könnt. Wir beginnen bei unseren frühesten Erfahrungen und bewegen uns dann weiter bis ins Erwachsenenleben.
Wollt ihr zum Beispiel wissen, welchen Einfluss eure Kindheit darauf hatte, wer ihr heute seid? Und auf die Beziehung zu euch selbst und anderen Menschen? Fragt ihr euch, warum es Erlebnisse aus dieser Zeit gibt, die doch eigentlich längst abgeschlossen sein sollten, euch aber irgendwie nicht so recht loslassen? Dann findet ihr hier die Erklärung dafür. Überlegt ihr manchmal, welche Auswirkungen die sozialen Medien oder manche Werbebotschaften, mit denen ihr tagtäglich konfrontiert seid, auf euer seelisches Wohlbefinden haben? Wollt ihr wissen, was eure Gefühle überhaupt sind, wo sie herkommen und wie man sie in den Griff bekommt, wenn sie zu heftig werden? Ich gebe euch nützliche Hinweise, wie ihr zu einem gesünderen Umgang mit all diesen Facetten des Lebens finden könnt. Möchtet ihr gern an euch selbst glauben und euch so annehmen können, wie ihr seid? Wenn ihr all das mit Ja beantwortet, dann seid ihr hier genau richtig.
Dieses Buch erklärt euch, wie ihr durch eure Umwelt geformt wurdet. Und dass sich gelegentlich eher die Gesellschaft ändern müsste als ihr. Es vermittelt euch wichtige Grundlagen, um eure Lebenserfahrungen und Emotionen zu verstehen und darüber hinaus hilfreiche Methoden für einen Weg der Heilung – was auch immer dieses Wort für euch bedeutet.
Wenn Patienten eine Therapie beginnen, stellen sie mir – in unterschiedlichen Varianten – immer wieder die gleichen drei Fragen: Wie konnte es nur so weit kommen? Was hält mich gefangen? Und wie kann es weitergehen? Deshalb orientiert sich der Aufbau des Buches daran, diese Fragen in exakt der erwähnten Reihenfolge zu beantworten.
Teil Eins: Wie konnte es so weit kommen?
Der erste Teil des Buches soll euch dabei helfen zu verstehen, wie ihr euch zu dem Menschen entwickelt habt, der ihr seid. Außerdem geht es darum, Probleme zu erkennen, die mit eurer Vergangenheit sowie gegenwärtigen Lebensereignissen zusammenhängen und häufig zu psychischen Belastungen führen. Dieser Teil beginnt mit dem Moment, als ihr auf die Welt gekommen seid.
Teil Zwei: Was hält euch gefangen?
Im nächsten Abschnitt geht es darum zu betrachten, wie ihr aktuell agiert: die ganz normalen Verhaltensmuster, schlechten Angewohnheiten und ungünstigen Kreisläufe, in denen ihr vielleicht gefangen seid und die möglicherweise hinderlich für euch sind.
Teil Drei: Wie kann es weitergehen? Dein neuer Werkzeugkasten mit hilfreichen Methoden und Techniken
Der letzte Teil des Buches enthält wissenschaftlich bestätigte Methoden, die ihr sofort anwenden könnt. Eine Reihe von schnellen Tipps findet ihr im ganzen Buch, die meisten jedoch in Teil Drei.
Dieses Buch liefert keine schnellen Lösungen
Es ist nicht für akute Krisen gedacht und soll auch keinesfalls ein Ersatz für eine professionelle psychologische Beratung sein. Es eignet sich auch nicht als Diagnoseinstrument und enthält keine konkreten Diagnosen. Dieses Buch ist vielmehr dazu gedacht, die Grundlagen menschlichen Erlebens zu vermitteln und zu erläutern. Es bietet Einblick ins eigene Ich aus der Perspektive einer Therapeutin und stattet euch mit Werkzeug aus, das euch dabei helfen soll, euch selbst besser zu verstehen und das zu überwinden, was euch zu schaffen macht und gefangen hält.
In diesem Buch geht es nicht nur um Heilung, sondern auch darum, euch selbst wirklich kennenzulernen, damit ihr euer Leben möglichst unbeschwert genießen könnt. Wichtig ist dabei auch die Stärkung von Gemeinschaft, um miteinander Kräfte zu bündeln und zusammen die Stimme gegen Strukturen und Lebensereignisse zu erheben, die uns daran hindern, wahrhaft Mensch zu sein.
Wie man dieses Buch benutzt
Auf den nachfolgenden Seiten findet ihr Theorien, in denen ihr euch eventuell auf Anhieb wiederfindet, und andere, bei denen dies wohl nicht der Fall sein wird.
Um euch den persönlichen Zugang zu erleichtern, habe ich jedes Kapitel mit Fragen versehen, die ihr jeweils beim Lesen beantworten könnt. Solche Fragen würde ich euch in Therapiesitzungen stellen, wenn ihr meine Klienten wärt. Und diese Fragen stelle ich mir auch selbst, um zu verstehen, warum ich etwas gerade so empfinde oder mich auf eine bestimmte Weise verhalten habe. Sie geben euch die Möglichkeit, euch mit euren Erfahrungen bewusst auseinanderzusetzen.
Nehmt euch also einen Stift, Textmarker oder Ähnliches, womit ihr die Passagen im Buch hervorheben könnt, die euch besonders wichtig sind. Wenn ihr das Buch mit euren individuellen Anmerkungen verseht, könnt ihr jederzeit wieder auf die Stellen zurückgreifen, die für euch relevant sind. Je länger ihr bei einem Thema bleibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr es wirklich verinnerlicht. Ihr könnt also ruhig alles vollkritzeln. Legt euch am besten auch ein Notizbuch daneben. Die im Buch gestellten Fragen lassen sich oftmals nicht auf Anhieb beantworten. Manches wird erst nach und nach klar, sodass es empfehlenswert ist, die eigenen Gedanken kontinuierlich festzuhalten.
In den einzelnen Kapiteln verweise ich immer wieder auf andere Bücher, die mir am Herzen liegen – falls ihr von bestimmten Themen gar nicht genug bekommen könnt.
Wichtig ist es, dass ihr beim Lesen auf euch selbst achtet. Nehmt euch Zeit. Es kann sein, dass ganz unerwartete Gefühle hochkommen, denn wir tauchen tief ein in eure Vergangenheit und Gegenwart. Sollten bestimmte Aspekte oder Fragen bei euch bedrückende Gedanken oder Gefühle auslösen, rate ich euch, das Buch für einen Moment oder auch länger beiseitezulegen und eine Atemübung (siehe Kapitel 12) oder eine andere Methode zur Selbstberuhigung aus Teil Drei auszuprobieren. Lest erst weiter, wenn ihr so weit seid – das Buch wartet geduldig auf euch.
Hier kommt eine Triggerwarnung
In diesem Buch kommen schwerwiegende Themen zur Sprache, wie etwa Mobbing, Diskriminierung oder Tod. Jedem Kapitel stelle ich einen Hinweis voran, welche sensiblen Themen darin gegebenenfalls vorkommen, damit ihr selbst entscheiden könnt, ob ihr weiterlesen möchtet.
Und falls ihr gerade mit Belastungen zu kämpfen habt, bitte denkt immer daran: Falls sie euch zu sehr quälen, sprecht mit jemandem darüber. Sucht euren Hausarzt oder eine psychiatrische Ambulanz auf. Für Notfälle steht rund um die Uhr ein Krisentelefon zur Verfügung – ihr seid nicht allein.
Das war die Triggerwarnung, seid ihr bereit?
Los geht’s.
Dr. Soph xx
TEILEINS
Wie konnte es so weit kommen?
Emotionen, Beziehungen und ein negatives Selbstbild – die drei wichtigsten Themen, die Menschen in eine Therapie führen. Ich sollte dieses Buch deshalb vielleicht damit beginnen, euch zu erklären, was Emotionen sind, wie man Beziehungen am besten angeht und wie man positiv über sich selbst denkt.
Wir alle haben jeweils zutiefst persönlich auf diesen Gebieten zu kämpfen. So ist zum Beispiel die Weise, in der wir unsere Emotionen wahrnehmen, fest in unseren genetischen Voraussetzungen verankert, sie hängt davon ab, wie stabil unsere frühen Erfahrungen im Leben waren, was man uns in Bezug auf Emotionen beigebracht hat, wie wir als kleine Kinder getröstet wurden und mit welchen Belastungen wir fertigwerden müssen.
Wenn ihr wirklich verstehen wollt, wer ihr seid und warum ihr womöglich Probleme habt, müssen wir ganz am Anfang ansetzen.
Bevor wir lernen, wie man mit diesen zutiefst menschlichen Erfahrungen umgeht, begeben wir uns auf eine Reise durch das Leben. Wir setzen uns mit den beiden größten Einflüssen auseinander, die uns und unsere jeweiligen Schwierigkeiten prägen: mit der Umwelt, in der wir aufwuchsen, und mit den Lebensereignissen, mit denen wir konfrontiert waren.
Im ersten Teil dieses Buches möchte ich mit euch diese beiden Einflüsse näher erkunden. Die ersten vier Kapitel behandeln die Aspekte unseres Umfelds, die erwiesenermaßen unsere Biologie, unsere Gehirnentwicklung, unsere Emotionen, Glaubensüberzeugungen und Verhaltensweisen prägen: die frühe häusliche Umgebung, die Schulzeit, die Medien und die allseits präsente Werbung sowie die strukturelle Ungleichheit. Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf Lebensereignisse, die uns zusetzen und uns aus der Spur bringen.
Wenn ihr genau verstehen wollt, wie ihr zu der Person geworden seid, die ihr heute seid, und welche Momente in eurem Leben in euch das Gefühl geweckt haben, traurig, ängstlich oder nicht gut genug zu sein, empfehle ich euch, die Kapitel nacheinander durchzuarbeiten.
Wichtig ist allerdings, dass ihr wisst …
Wir kommen nicht als unbeschriebenes Blatt auf die Welt.
Geschwister sind nicht gleich, selbst wenn sie am selben Ort aufwachsen. Der Kognitionspsychologe Steven Pinker erklärt das etwas sarkastisch so, dass ja auch euer Haustier und euer Kind nicht beide sprechen lernen, egal, wie viel Zeit ihr aufwendet, um es ihnen beizubringen und sie in derselben Umgebung aufzuziehen.
Der Prozess, der bestimmt, wer wir sind, kommt in Gang, bevor wir geboren werden. Unsere DNA ist mutmaßlich für 20 bis 60 Prozent unseres Temperaments verantwortlich – dafür, wie kontaktfreudig, emotional, tatkräftig, ablenkbar und beharrlich wir sind. Allerdings hat das Gehirn eines reifgeborenen Babys, wenn es zur Welt kommt, erst ein Drittel seiner späteren Größe, und die Entwicklung ist erst mit Mitte zwanzig abgeschlossen. Ähnlich wie Architekten Entwürfe dem Terrain anpassen, das sie bebauen wollen, habt ihr und euer Gehirn euch entwickelt und sich eurer speziellen Umgebung angepasst.
Nicht nur eure Familie hat euch geprägt, sondern die Summe aller eurer frühen Erlebnisse und Erfahrungen. Schule, Freundschaften, die Medien, die ihr konsumiert habt, die Gesellschaft und die Kultur, in der ihr aufgewachsen seid, und die Lebensereignisse, denen ihr ausgesetzt wart – all das hat eine Rolle gespielt.
Vielleicht habt ihr euch zu einem schüchternen, kontaktarmen Menschen entwickelt. Dafür kann es eine Million Gründe geben. Vielleicht war es schon genetisch festgelegt. Vielleicht habt ihr aber auch gelernt, dass Schüchternheit »angemessen« ist (das richtige Verhalten für jemanden wie euch). Oder niemand hat euch beigebracht, wie man sich in Gesellschaft verhält, sodass ihr euch dabei unwohl fühlt. Entsprechend seid ihr vielleicht nur in bestimmten Situationen schüchtern, etwa, wenn euer Herz schneller schlägt und ihr keinen klaren Gedanken fassen könnt, sobald ihr jemanden kennenlernt, in den oder die ihr euch verlieben könntet.
Es gibt auch viele Gründe, weshalb ihr vielleicht schnell in die Luft geht. Es könnte in eurer DNA verankert sein. Oder ihr seid in einem stressbelasteten Umfeld aufgewachsen und habt gelernt, immer in höchster Alarmbereitschaft zu sein (um auf eine wütende Bezugsperson oder eine plötzliche Veränderung zu Hause zu reagieren). Oder man hat euch nicht beigebracht, mit euren Emotionen umzugehen, sodass sie hin und wieder überkochen.
Es kann aber auch gar nichts mit eurer Vergangenheit zu tun haben. Vielleicht habt ihr eine Menge auf dem Schirm und stoßt an die Grenzen eurer Belastbarkeit. Plötzlich reicht eine Kleinigkeit, und ihr rastet aus.
Ich kann euch nicht sagen, welche Anteile eures Verhaltens genetisch festgelegt sind. Aber ich kann die wichtigsten Faktoren darstellen, die die Menschen vom ersten Atemzug an formen.
Mit diesen Informationen im Hinterkopf lade ich euch ein, dieses Buch zu lesen und mit dem Gelesenen kritisch umzugehen. Glaubt bitte nicht, dass es alles erklärt oder dass alles, was ihr tut, eine tiefe psychologische Bedeutung hat.
Bestimmt ist manches, das ihr tut, mit eurer Erziehung verbunden, aber es gibt sicher auch Dinge, die euch einfach Spaß machen oder die ihr aus einer Augenblickslaune heraus tut.
1. Bezugspersonen, Geschwister und unser familiäres Umfeld
* Triggerwarnung: Achte auf dich, während du dies liest. Wenn du Angst hast, von deinen Gefühlen überwältigt zu werden, mach eine Pause, atme tief durch und komm zurück, wenn du dich wieder gefasst hast. Das ist nichts, wofür du dich schämen müsstest.
Bei uns überleben nicht die Stärksten, sondern die, um die man sich kümmert.
Louis Cozolino
Ihr habt das erste Mal tief Luft geholt und dann losgeschrien. Kein Wunder! Bei der Geburt habt ihr den warmen, weichen, nährstoffreichen Bauch eurer Mutter verlassen und seid in eine blendend helle, laute und kalte Welt hineingekommen. Plötzlich wart ihr verletzlich und in einer fremden Umgebung, in der andere für eure Sicherheit sorgen mussten. Mit dem Schreien habt ihr den Schleim aus eurer Lunge gedrückt und dafür gesorgt, dass eure Bezugspersonen euch wahrnahmen.
Ihr brauchtet Menschen, um euch am Leben zu erhalten. Dabei ging es um mehr als Nahrung und Schutz. Ihr brauchtet Menschen, um eine Verbindung herzustellen und um euer hyperaktives Angstsystem zu beruhigen, das durch diese unbekannte Welt ständig getriggert wurde. Und ihr brauchtet sie, um von ihnen etwas über die Welt zu lernen und euer Nervensystem (die Hirnstrukturen, die auf Stress reagieren) zu entwickeln.
Die Bindung zu euren frühesten Bezugspersonen half euch, eure Gehirnentwicklung und euer Nervensystem zu formen, gab euch ein erstes Verständnis für Emotionen und lieferte ein Vorbild für Beziehungen, das ihr auch jetzt noch verwendet, um andere zu verstehen.
Auch wenn ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt, da die ersten Erinnerungen meist erst im Alter von dreieinhalb Jahren einsetzen, beeinflusst euch das, was damals geschehen ist, wahrscheinlich noch heute – es beeinflusst, wie stark ihr eure Gefühle wahrnehmt, ob ihr sie versteht, wie ihr andere Menschen versteht und mit ihnen interagiert und mit wem ihr zusammen seid oder euch anfreundet (aber dazu kommen wir erst in Kapitel 10).
Sicher, beruhigt, gesehen und geborgen
Ein Baby will vor allem seiner Bezugsperson nahe sein. In diesem Buch verwende ich immer den Begriff »Bezugsperson« statt Elternteil oder Eltern, da nicht jede/jeder von seinen leiblichen Eltern aufgezogen wird. »Bezugspersonen« sind alle verantwortlichen Erwachsenen und Betreuer oder Betreuerinnen des Kindes.
Eine gute Nachricht: Babys können vielleicht noch nicht viel tun, aber sie sind keine passiven Betreuungsempfänger. Sie können Fürsorge auslösen. Denkt nur an das Mienenspiel und die süßen kleinen Bewegungen – das Baby manipuliert euch positiv so, dass ihr für es da sein wollt.
Babys lernen, sich so schnell wie möglich ihrer Umgebung anzupassen, indem sie schreien und auf die Reaktion ihrer Bezugsperson reagieren. Sie passen sich an, um sicherzustellen, dass man sie nicht alleinlässt, egal, was passiert. Der Rest ist Sache der Bezugsperson.
Daniel Siegel, Professor für Psychiatrie an der School of Medicine der Universität von Kalifornien in Los Angeles, spricht davon, dass sich Babys und Kinder sicher, gesehen, beruhigt und geborgen fühlen müssen.
Sicher
Babys und Kinder müssen an einem sicheren Ort aufwachsen, mit Bezugspersonen, die ihnen nicht gefährlich werden.
Wenn ihr in Sicherheit aufwachst, lehren eure ersten Erfahrungen euch, dass die Welt ein sicherer Ort sein kann und dass auch die Menschen nicht gefährlich sein müssen. Euer sich entwickelndes Gehirn lernt, dass es ohne Bedrohung nicht ständig in höchster Alarmbereitschaft sein muss.
Wenn ihr inmitten von Gefahr, Gewalt oder Vernachlässigung aufwachst, passt sich euer Gehirn an, damit ihr überlebt. Vielleicht hält es euch in einem Zustand der Angst und Hypervigilanz (erhöhte Wachsamkeit gegenüber möglichen künftigen Bedrohungen). Vielleicht pumpt es euch mit Adrenalin voll, damit ihr vor Gefahr flüchten oder sie bekämpfen könnt, oder es stumpft euch ab, damit ihr Gefahren, denen ihr nicht entkommen könnt, ertragt.
Um sich zu entwickeln, brauchen Menschen Aufmerksamkeit wie Pflanzen das Sonnenlicht.
Beruhigt
Selbst in einem sicheren Umfeld können alle neuen Erfahrungen für ein Baby beängstigend sein. Die ersten Eindrücke von Licht, Hunger, Schmerz, Kälte oder lauten Geräuschen sind bedrohlich, weil sie unbekannt sind. Wenn etwas gefährlich wirkt, schreit und strampelt das Baby. Wenn ein Erwachsener kommt, um es zu beruhigen, entspannt es sich (früher oder später). Diese wunderbare Fähigkeit, mit Hilfe des ruhigen Nervensystems einer anderen Person das eigene zu beruhigen, die sogenannte Ko-Regulierung, ist auch der Grund, weshalb wir selbst als Erwachsene die Menschen umarmen, die uns am Herzen liegen. Sie kann unsere seelische Verfassung deutlich verbessern.
Wenn dieselbe Erfahrung wieder auftritt, fühlt sich das Baby weniger verängstigt; es hat gelernt, dass es nicht in Gefahr ist, und vor allem, dass andere Menschen für es da sein werden, falls wieder eine potenzielle Gefahr auftauchen sollte.
Gesehen
Es ist wichtig, dass ein Erwachsener die Notlage eines Babys oder Kindes sieht – nicht nur, um es zu beruhigen, sondern auch, um die Gefahr für das Kind einzuordnen.
Man kann sich das so vorstellen, dass eine Bezugsperson wie eine Vogelmutter agiert. Wisst ihr, dass Vögel Würmer sammeln, sie fressen und sie dann wieder hochwürgen, um die Vogeljungen mit vorverdauter Nahrung zu füttern? Etwas Ähnliches sollten unsere Bezugspersonen mit unseren Gefühlen und Erfahrungen in unserer Kindheit tun. Sie lassen uns unsere inneren Welten verstehen, indem sie uns erklären, was in und um uns vorgeht.
Dadurch lernen wir, was uns belastet, was bestimmte Empfindungen bedeuten und was wir tun können, um uns zu beruhigen oder unsere Bedürfnisse in Zukunft zu befriedigen. Zum Beispiel:
»Oh, du weinst, weil dir kalt sein muss. Mach dir keine Sorgen, Mama ist da. Ich kuschel dich in eine Decke ein und nehme dich in den Arm, um dich zu wärmen.«
Das Baby lernt: Dieses Gefühl ist »Kälte«. Decken und andere Menschen können dich wärmen. Es fühlt sich vielleicht beunruhigend an, aber ich bin nicht in Gefahr. Wenn ich schreie, wird mir jemand helfen. Wenn es das nächste Mal passiert, muss ich keine Angst haben.
»Du hast dir das Knie aufgeschlagen, es schmerzt jetzt, aber es heilt wieder. Lass uns zusammen ein Pflaster draufkleben und etwas Schönes tun, damit du dich wieder besser fühlst.«
Das Kind lernt: Dieses Gefühl ist »Schmerz«. Ich empfinde es, weil ich ein paar Schrammen habe. Es geht vorbei und wird heilen. Ich bin nicht in Gefahr. Beim nächsten Mal muss ich nicht solche Angst haben; ich kann es verstehen und weiß, was ich tun muss.
»Du bist enttäuscht, weil ich dir gesagt habe, dass du die Süßigkeiten, die du haben willst, nicht bekommst. Es ist okay, enttäuscht zu sein. Möchtest du im Garten herumtoben, um die Emotion herauszulassen? Oder wollen wir schmusen?«
Das Kind lernt: Dieses Gefühl ist »Enttäuschung«. Es tritt auf, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Es ist in Ordnung, sich so zu fühlen. Ich habe Möglichkeiten, damit umzugehen.
Als Kinder brauchen wir unsere Bezugspersonen auch, um zu verstehen, wie sie sich uns gegenüber verhalten, etwa: »Ich war sauer. Es tut mir leid. Ich hatte einen anstrengenden Tag und wollte dich nicht anschnauzen. Es ist nicht dein Fehler.«
Das Kind lernt: Wenn Erwachsene ausrasten, sind sie wütend. Das kann passieren, wenn sie viel zu tun haben. Erwachsene können sich entschuldigen, wenn etwas falsch läuft, und sie verfügen über Wege, mit ihren Emotionen umzugehen, die auch ich ausprobieren kann. Und, ganz wichtig: Es war nicht mein Fehler.
Je häufiger Kinder solche Erfahrungen machen, desto besser werden sie darin, sich selbst zu verstehen, und im Laufe der Zeit lernen sie, sich selbst zu beruhigen. Sie üben sich auch darin, andere zu verstehen und die Anzeichen bestimmter Emotionen in den Gesichtern der Menschen zu erkennen.
Manchmal kommen Klientinnen und Klienten zu mir, die mit ihren Emotionen überfordert sind, weil man ihnen einfach nie beigebracht hat, sie zu verstehen. Deshalb haben sie nicht die Worte, um ihre Erfahrungen zu beschreiben.
Aber es ist nie zu spät, das zu lernen.
Versuch zu verstehen, wie du dich fühlst
Kurztipp 1: Wenn du deine Gefühle nicht ganz verstehst, solltest du versuchen, sie zu beschreiben. Wenn du irgendeine Form von emotionaler Veränderung (Stress, Wut, innere Leere) wahrnimmst, schreib deine körperlichen Empfindungen auf: »Mein Brustkorb ist eng«, »Ich könnte heulen«, »Ich fühle nichts«. Benenne die Emotionen, die diese Empfindungen erklären könnten, und notiere auch, was gerade in deinem Leben passiert – »Ich hatte einen Streit«, »Jemand hat über mich gesprochen«. Mit der Zeit wirst du erste Muster erkennen. Du wirst allmählich verstehen, wann und warum du dich so fühlst, und auch, was dir hilft, dich besser zu fühlen. In Kapitel 14 findest du genauere Hinweise zum sogenannten Journaling, mit dem du dir deine Gefühle von der Seele schreiben kannst, ohne dass andere das bewerten. Und Kapitel 6 wird dir helfen, deine Emotionen besser zu verstehen.
Kurztipp 2: Wenn du Mühe hast, andere Menschen zu verstehen, und dich fragst, was sie wohl denken oder fühlen, versuche einmal, ihre Bewegungen zu spiegeln. Kopiere ihre Gesten, ihre Haltung, ahme ihren Gesichtsausdruck nach. Das aktiviert deine Spiegelneuronen und gibt dir vielleicht einen Eindruck davon, wie dein Gegenüber sich fühlt. Spiegelneuronen sind Gehirnzellen, die die Erlebnisse anderer Menschen spiegeln und uns das Gefühl geben, diese auch selbst zu erleben. Bist du jemals zusammengezuckt, wenn du gesehen hast, wie sich jemand den Zeh angestoßen hat, und hast das Gesicht verzogen, als sei dir selbst das passiert? Das waren die Spiegelneuronen! Wenn du die Gesten anderer kopierst, signalisierst du ihnen damit, dass du mit ihren Erfahrungen im Einklang bist.
Geborgen
Babys und Kinder brauchen Beständigkeit.
Als kleine Kinder mussten wir wissen, dass wir uns auf unsere Verbindung zu unseren Bezugspersonen verlassen konnten – dass sie da sein würden, wenn wir sie brauchten, und sich auf unsere Bedürfnisse einstellen würden.
Unsere Bezugspersonen mussten in nichts davon perfekt sein.
Jedes Mal, wenn man als Erwachsene(r) einem Kind erklärt, welche Emotion es da wohl gerade wahrnimmt und warum es so fühlt, macht man diesem Kind ein Geschenk: Man schenkt ihm die Sprache, die es brauchen wird, um sich selbst und seine inneren Erfahrungen zu verstehen. Das wird ihm sein Leben lang helfen.
Fehler zu machen und sich über etwas zu ärgern, sind zutiefst menschliche Erfahrungen, und selbst wenn uns das als Kinder vielleicht nicht richtig bewusst ist, unsere Bezugspersonen sind auch nur Menschen. Wirklich wichtig war in jenen Momenten, dass sie sich die Zeit nahmen, uns zu erklären, was geschah, uns dann zu beruhigen und den Bruch zu heilen.
Wenn wir sahen, dass unsere Bezugspersonen von Zeit zu Zeit Fehler machten, dass sie damit fertigwurden und uns darüber hinweghalfen, zeigte uns das sogar, dass es unvermeidlich, aushaltbar, menschlich ist, manchmal Mist zu bauen, und dass wir aus unseren Fehlern lernen können.
Wenn ihr euch als Baby sicher, beruhigt, gesehen und geborgen gefühlt habt, entwickelte sich daraus allmählich eure ganz eigene und erste Fertigkeit, Stress zu bewältigen: ein internalisiertes Bild eurer Bezugsperson. Bei psychischem Stress konntet ihr dieses Bild heraufbeschwören und euch schnell damit beruhigen, weil ihr davon ausgehen konntet, dass diese Person immer für euch da war.
Im Laufe der Zeit konntet ihr euch allmählich von eurer Bezugsperson wegbewegen. Sie wurde euer »sicherer Hafen«, ein Ort, von dem aus ihr die Welt erkunden und weitere Erfahrungen außerhalb ihrer schützenden Umarmung sammeln konntet.
Diesen Erkundungsdrang kann man bei allen kleinen Kindern wahrnehmen. Sie schauen ihre Bezugsperson an und bewegen sich dann langsam von ihr weg (vielleicht in einen anderen Bereich des Zimmers oder zu einem anderen Kind hin). An einem bestimmten Punkt kehren sie plötzlich um und kommen zurück. Jedes Mal entfernen sie sich etwas weiter, in dem Wissen, dass ihre Bezugsperson da sein wird, um sie zu beruhigen, wenn sie zurückkommen.
Die ersten Menschen in eurem Leben haben euch beigebracht, ob ihr euch in der Welt sicher fühlt, ob der Umgang mit anderen Menschen unbedenklich ist, wie wachsam ihr nach Bedrohungen Ausschau halten müsst, wie ängstlich ihr sein müsst, wie ihr eure Erfahrungen deuten und selbst Neues erkunden könnt. Sie gaben euch die Fertigkeiten mit, all diese Situationen zu bewältigen.
Bindungsstile
Wunderbar, wenn du Erfahrungen wie die oben beschriebenen gemacht hast! Bezugspersonen, die ständig auf die Bedürfnisse ihrer Schutzbefohlenen eingehen, sorgen dafür, dass diese einen sicheren Bindungsstil entwickeln, um es in der Sprache der Therapeuten zu sagen.
Dies bedeutet, dass du dich als Erwachsene(r) wahrscheinlich im Umgang mit anderen sicher und entspannt fühlst. Es bedeutet, dass du bereit bist, deine emotionalen Erfahrungen zu teilen, und weißt, wie du dich selbst beruhigen kannst. Dies wiederum bedeutet, dass du dich in Beziehungen geborgen und der Liebe und Unterstützung anderer würdig fühlst. Wahrscheinlich hast du keine größeren Probleme mit der Partnersuche und Freundschaften.
Etwa 50 Prozent aller Menschen konnten diesen Bindungsstil entwickeln. Aber leider hatten wir nicht alle Bezugspersonen, die sich auf jedes unserer Bedürfnisse einstellten.
Es gibt viele Gründe, warum Erwachsene nicht auf die Bedürfnisse eines Babys oder Kindes eingehen. Sie sind vielleicht aktiv grausam und schaden ihm absichtlich. Oder sie versuchen ihr Bestes, haben ihr Kind unendlich lieb, können aber dennoch nicht so präsent sein, dass es sich geborgen fühlt. Vielleicht haben sie zum Beispiel mit ihrer eigenen mentalen oder körperlichen Gesundheit zu kämpfen; vielleicht wiederholen sie die Art, wie sie selbst erzogen wurden, oder vielleicht müssen sie rund um die Uhr arbeiten, um genug Essen auf den Tisch zu bringen, und sind deshalb immer wieder längere Zeit nicht verfügbar.
Egal, warum – manche von uns haben schon früh gelernt, dass Erwachsene nicht immer für uns da sein konnten, dass man sich nicht immer auf sie verlassen konnte. Mehr noch, wir haben vielleicht gelernt, dass sich die Verbindung mit anderen gefährlich anfühlen kann und die Welt deshalb emotional belastet ist.
Menschen, die dies lernen, entwickeln einen unsicheren Bindungsstil und können in Gegenwart von Menschen, die sie nicht kennen oder die sie womöglich ablehnen, ängstlich oder verschlossen sein.
Findest du dich in dieser Beschreibung wieder? Wenn ja, mach dir keine Sorgen – mir geht es genauso. Ich oute mich jetzt, damit du, falls du in diese Kategorie fällst, weißt, dass du nicht allein bist. Du bist eine Person, die sich anpassen musste, um mit den psychischen Belastungen fertigzuwerden, die sich aus dem Aufwachsen in einem solchen Umfeld ergeben. Du bist eine Person, die Wege gefunden hat, dies zu überleben und engen Kontakt zu den Menschen zu suchen, die du brauchtest, um am Leben zu bleiben. Eine unglaubliche Leistung!
Die beiden häufigsten Typen unsicherer Bindung sind: vermeidend (23 Prozent der Bevölkerung) und ängstlich (20 Prozent). Es gibt noch einen weiteren unsicheren Bindungsstil: desorganisiert (2 Prozent der Bevölkerung), der oft entsteht, wenn weder der ängstliche noch der vermeidende Stil funktioniert hat, um Nähe und gleichzeitig Distanz zu der Bezugsperson zu schaffen, und man keinen konstanten Weg finden konnte, um emotional geborgen zu bleiben. Wenn du dich hierin wiederfindest, merkst du vielleicht, dass bei dir im Erwachsenenalter der Drang, anderen nahe zu sein, mit einem überwältigenden Panikgefühl verbunden ist, wenn du andere tatsächlich an dich ranlässt. Da dieser Stil sehr viel seltener vorkommt, wird er hier nicht behandelt. Wenn du mehr Informationen zum desorganisierten Bindungsstil suchst, empfehle ich Die Kraft der Elternliebe. Wie Zuwendung das kindliche Gehirn prägt von Sue Gerhardt.
Vermeidender Bindungsstil: die Katze
Diesen Bindungsstil hast du erworben, wenn eine oder mehrere deiner Bezugspersonen vorhersehbar nicht verfügbar waren, um deine Bedürfnisse zu erfüllen.
Du hast vielleicht einen vermeidenden Bindungsstil, wenn du als kleines Kind gelernt hast, dass niemand kommt, wenn du schreist. Oder wenn du dich, als du älter wurdest, zurückgewiesen oder missachtet fühltest, wann immer du Emotionen oder ein Bedürfnis nach Nähe und Trost zeigtest. Womöglich hat man dir gesagt, du wärst »nur erschöpft« oder müsstest »darüber hinwegkommen«, wenn du über deine Schwierigkeiten sprechen wolltest.
Wenn dir dies passiert ist, hast du in der Kindheit viel Angst erlebt, denn die sichere Bindung, die du gebraucht hättest, um die Bedrohungsaktivität in deinem Gehirn zu dämpfen, fehlte.
Aber du warst klug; du hast dich angepasst, um zu überleben und um dem Menschen, den du in deinem Leben brauchtest, nahe zu bleiben. Du hast die Botschaft bekommen, dass man sich um deine Gefühle nicht kümmert, und so hast du gelernt, jedes Zeichen von Gefühlen oder Bedürfnissen nach emotionaler Unterstützung oder Nähe zu minimieren oder – »besser noch«1 – zu unterdrücken. Sobald eine Emotion oder ein Bedürfnis nach Nähe auftauchte, versuchte dein Gehirn, es zu verdrängen.
Du hast sicher noch weitere Möglichkeiten gefunden, dein Bindungssystem zu deaktivieren. Vielleicht hast du sorgfältig darauf geachtet, Zeit in der Nähe deiner Bezugsperson zu verbringen, ohne aber – aus Angst vor Zurückweisung – einen Kontakt zu initiieren. Vielleicht hast du dich auf Logik statt auf Gefühle konzentriert, dich von deinen Emotionen distanziert und bist parallel dazu sehr selbstständig geworden. Du hast dein Leben selbst organisiert, ohne die Unterstützung anderer.
Leider haben diese Strategien nur den bewussten Ausdruck deiner Angst gedämpft. Im Inneren hattest du noch immer damit zu kämpfen.
Erwachsene mit einem vermeidenden Bindungsstil fühlen sich gewöhnlich extrem selbstständig oder »pseudo-unabhängig«. »Pseudo« deshalb, weil die Selbstständigkeit eigentlich nicht auf einem Wunsch, allein zu sein, beruht, sondern vielmehr auf der Furcht, dass andere womöglich nicht in der Lage sein könnten, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, und diese Furcht ist so überwältigend, dass sie ihre engeren Kontakte herunterfahren und die Menschen von sich fernhalten.
Wenn du dich darin wiederfindest, suchst du vielleicht Freundschaften und Verbindungen, fühlst dich aber überfordert, wenn jemand dich braucht oder dir zu nahekommt. Du fühlst dich vielleicht wie eine Katze – ein Geschöpf, das zu seinen eigenen Bedingungen interagiert. Du kommst näher, wenn du es willst, ziehst dich aber zurück und brauchst Zeit für dich allein, sobald du dich überfordert fühlst. Am wohlsten fühlst du dich wahrscheinlich bei Menschen, die ruhig sind und dir den Raum geben, so zu leben, wie du es willst und brauchst.
Die Bestimmung meines Bindungsstils war ein »Aha«-Moment meiner psychologischen Reise. Plötzlich konnte ich mir meine extreme Selbstständigkeit und andere Verhaltensweisen in Beziehungen erklären.
Vielleicht fällt dir auf, dass du dich anderen manchmal ein bisschen überlegen fühlst. In deinen Augen ist deren »Bedürftigkeit« und Emotionalität etwas Unnötiges, und du bist froh, dass dir das erspart bleibt. Du bist dabei nicht arrogant oder allzu selbstsicher – ganz im Gegenteil. Es ist dein Versuch, dich zu schützen und dein Selbstwertgefühl zu bewahren. Diese Haltung schützt dich vor deiner (vielleicht unbewussten) Angst, dass du niemand bist, für den jemand anderes da sein will oder kann.
Erkennst du, wie die Anpassungen, mit denen ein Kind versucht, sicher zu sein, auch beeinflussen können, wie es als Erwachsener ist?
Ängstlicher Bindungsstil: der Hundewelpe
Ein ängstlicher Bindungsstil entwickelt sich, wenn eine oder mehrere Bezugspersonen sich bei der Erfüllung deiner Bedürfnisse als nicht berechenbar erwiesen, es manchmal ganz richtig und ein anderes Mal total falsch machten.
Du hast vielleicht einen ängstlichen Bindungsstil entwickelt, wenn deine Bezugsperson dir in einem Moment aufmerksam zugehört und deine Bedürfnisse befriedigt hat, aber im nächsten Moment unerwartet abwesend war, emotional oder körperlich. Du hast dich natürlich gefragt, was dieses Verhalten bedeutet (kümmert sich die Person um mich oder nicht?). Oder sie wurde überbehütend, und was immer dir Sorgen machte, war überaus gefährlich. Oder sie forderte dich auf, dich so zu verhalten, dass es ihren Bedürfnissen entgegenkam, zum Beispiel: »Ich habe diese Geburtstagsparty für dich organisiert, also benimm dich und lass mich gut aussehen.« Oder: »Ich habe gerade mit mir selbst zu kämpfen, beruhige mich, ich weiß, dass du deine Freunde treffen willst, aber ich brauche dich jetzt dringender.«
Wie die vermeidende Person lernt auch die Person mit einem ängstlichen Bindungsstil, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass andere Menschen die eigenen Bedürfnisse stillen. Allerdings passt sie sich in anderer Weise an.
Wenn du dich darin wiederfindest: Logik hat dir nicht geholfen zu bestimmen, wann deine Bezugspersonen durchgehend anwesend sein würden, und so hast du gelernt, dass es, um die Beziehung mit deinen Bezugspersonen fortzusetzen, am besten war, ihnen so nah wie möglich zu bleiben und ständig Interaktionen zu initiieren, da du wusstest, dass es früher oder später funktionieren würde. Irgendwann reagierten sie so, wie du das brauchtest. Du bist in das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit gerückt, was vielleicht dazu führte, dass man dich als anhängliches Kind wahrnahm. Das ist keine negative Beschreibung – es war dein sehr kluger Weg, ihnen verbunden zu bleiben.
Du hast vielleicht auch festgestellt, dass du manchmal, wenn deine Bezugspersonen deine Bedürfnisse tatsächlich befriedigten – wenn sie zuhörten oder die richtigen Worte oder Taten fanden, die du gerade brauchtest – , schon so belastet warst, dass ihr Verhalten dich nicht mehr beruhigte. Du sehntest dich verzweifelt danach, doch die kurzen Interaktionen reichten nicht. Deshalb fiel es dir schwer, dich wirklich ruhig und sicher zu fühlen, da du genau wusstest, dass sie wieder verschwinden würden oder dass sie jeden Moment neue Ansprüche stellen konnten.
Diejenigen von uns, die als bedürftig oder arrogant oder verschlossen beschrieben werden, haben im Grunde genau dieselbe Sehnsucht und dieselbe Angst: die Sehnsucht nach einer tiefen menschlichen Verbindung und die Angst, dass kein Mensch wirklich für uns da sein will oder kann. Wir unterscheiden uns nur darin, wie wir versuchen, uns in der Welt zu schützen.
Als Erwachsene(r) setzt du vielleicht große Hoffnungen in andere Menschen. Du stellst sie vielleicht auf ein Podest, siehst nur das Beste in ihnen und manchmal das Schlimmste in dir, da deine frühen Erfahrungen dein Selbstwertgefühl beeinträchtigt haben. Manchmal hast du vielleicht das Gefühl, von anderen im Stich gelassen zu werden, da du oft an sie denkst und überlegst, was du ihnen Gutes tun könntest, aber feststellen musst, dass dieses Verhalten nicht immer erwidert wird. Wenn du dich in dieser Beschreibung erkennst, kann es hilfreich sein, daran zu denken, dass Menschen je nach Bindungsstil ihre Fürsorge anders zeigen. Wenn jemand nicht ständig an dich denkt, heißt das noch lange nicht, dass du ihm oder ihr egal bist.
Am wohlsten fühlst du dich bei Menschen, die dir echte, beständige Fürsorge und Unterstützung entgegenbringen: Menschen, die für dich da sind. Du merkst vielleicht, dass du dich in der Gesellschaft solcher Menschen zentriert und ruhig fühlst, dass sie dich nicht ängstigen oder beunruhigen. Die distanzierten Menschen in deinem Leben rühren eher an jene ersten Gefühle und Versuche, Kontakt aufzunehmen.
In Kapitel 10 werde ich dir erklären, wie sich diese Stile in unserem Leben als Erwachsene äußern, wie sie unsere Beziehungen, besonders bei der Partnersuche, beeinflussen und wie du zu einem sichereren Bindungsstil kommen kannst.
Entdecke deinen Bindungsstil
Kurztipp: Wenn du deinen Bindungsstil noch nicht kennst, mach im Internet ein Bindungstypen-Quiz.
Geschwister
Es sind nicht nur unsere Bezugspersonen, die unsere ersten Lebensjahre beeinflussen. Wenn ihr Geschwister habt, haben auch diese Beziehungen eure Persönlichkeit geprägt.
Geschwister können ein Geschenk für unsere Entwicklung sein. Sie bieten Gesellschaft, eine Chance zu lernen, wie man teilt, Kompromisse schließt, Geheimnisse bewahrt, und viele Gelegenheiten, das Verhalten in Konfliktsituationen und die eigene Durchsetzungskraft zu üben.
Mal ehrlich, habt ihr gewusst, dass Geschwister im Alter zwischen zwei und vier Jahren im Durchschnitt alle neuneinhalb Minuten miteinander streiten?2 Ich zweifle keine Sekunde daran. Mein Bruder brüllte immer mal wieder »Wadenzwicker!« und jagte mich dann durchs Haus. Danke dafür, David!
Man hat auch herausgefunden, dass die Geburtenfolge der Geschwister einen Einfluss auf die emotionale Entwicklung hat. Das erstgeborene Kind hat die volle Aufmerksamkeit seiner Bezugspersonen, wenn es zur Welt kommt. Dann kommt das nächste und stößt es vom Thron – das ist oft ein echter Schock, weil es jetzt die Bezugspersonen teilen muss und mehr Verantwortung übertragen bekommt. Erstgeborene werden oft gelobt, weil sie so verantwortungsbewusst sind und ihr(e) Geschwister unterstützen, was heißt, dass sie häufig in die Rolle des Ernsthaften und Reiferen in der Familie hineinwachsen, beruflich Führungsaufgaben anstreben und sich wohlfühlen, wenn sie das Sagen haben.
Dann konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf das nächste Kind, bis … noch eines kommt.
Viele mittlere Kinder berichten, dass sie weniger Zuwendung genossen haben, als sie sich gewünscht hätten. Sie sind nicht das erste Kind, dem man zuhört oder seinem Alter entsprechend Verantwortung überträgt, und nicht das jüngste, das gewöhnlich die meiste Aufmerksamkeit erhält. Mittlere Kinder passen sich oft daran an, indem sie Beziehungen außerhalb der Familie entwickeln. Sie sind häufig gut darin, Kontakte zu knüpfen, und werden zum Friedenswahrer der Familie, zur loyalen Unterhändlerin, die Kompromisse aushandelt und zwischen den älteren und den jüngeren Familienmitgliedern vermitteln kann. Wenn du ein mittleres Kind bist, findest du dich darin wieder?
Beim dritten Kind sind die Bezugspersonen gewöhnlich schon ein bisschen entspannter. Entweder, weil sie erschöpft sind oder weil sie jetzt wissen, dass Kinder robuster sind, als sie sich früher vorzustellen wagten.
Das jüngste Kind kann sich daher meist mehr erlauben, weil die Regeln lockerer werden. Das führt manchmal zu Unmut bei den anderen Geschwistern – »Das ist nicht fair! Als ich so alt war wie du, durfte ich das nicht!« Um damit umzugehen, setzt der oder die Jüngste oft Charme und Humor ein, um die älteren Geschwister zu entwaffnen und Teil der Gruppe zu bleiben. Jüngste Kinder gelten daher gewöhnlich als freche Draufgänger, Glückskinder, und das kann sich bis ins Erwachsenenalter fortsetzen.
Unabhängig davon, wo in der Hackordnung ihr euren Platz hattet, müsst ihr immer daran denken, dass Geschwister ständig um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern konkurrieren. Sie schießen sich auf das ein, was sie gut können, und präsentieren sich ihren Eltern stolz wie Pfauen. Deshalb nehmen Geschwister oft Rollen ein, etwa: der Kluge, die Sportskanone, der Clown.
Wenn eure Bezugspersonen bestimmte Aktivitäten besonders lobten – wenn etwa Lernerfolge mehr zählten als Kreativität oder andersherum oder das Befolgen von Regeln wichtiger war als Spontaneität und Eigenständigkeit oder andersherum – , dann habt ihr euch vielleicht angestrengt, um in dieser Aktivität der oder die Beste zu sein. Oder wenn ihr den Eindruck hattet, dass eure Bezugspersonen eines oder alle eure Geschwister vorzogen, fühltet ihr euch vielleicht ein bisschen »nicht ganz so gut« oder gar ausgeschlossen. Das waren dann sicher schlimme Zeiten!
Ich habe mit vielen Menschen gearbeitet, die sich als Erwachsene keiner Gruppe richtig zugehörig fühlten und sich immer als außenstehend und von der beliebtesten Person in der Gruppe nicht gemocht wahrnahmen. Viele von ihnen hatten diese Erfahrung erstmals mit ihren Geschwistern gemacht, als sie spürten, dass ihre Eltern die anderen lieber hatten. Schon in der Kindheit hatten sie begonnen, sich als Außenseiter zu sehen, und als Erwachsene fühlten sie sich wieder so, wenn sie unter Stress standen.
Und leider haben meine Patienten und Patientinnen recht. Die Forschung zeigt, dass Bezugspersonen sich oft einem ihrer Kinder näher fühlen und dass das Gefühl, dass man nicht der Liebling ist oder dass jemand anders es ist, unser Selbstwertgefühl beeinflussen kann, selbst wenn wir schon längst erwachsen sind.3
Allerdings erraten Kinder auch später, als Erwachsene, nicht immer richtig, welches ihrer Geschwister in der Familie bevorzugt wurde. Forschungen haben sogar ergeben, dass erwachsene Kinder nur in weniger als der Hälfte der Fälle (44,6 Prozent, um genau zu sein)4 richtig lagen, wenn sie sagen sollten, wen ihre Mutter lieber hatte, und lediglich 39 Prozent zutreffend beantworten konnten, auf wen ihre Mutter besonders stolz war!5
Genauso sieht es mit vielen unserer Kindheitserfahrungen aus – nicht nur das, was wir erlebt haben, beeinflusst uns, sondern auch, welchen Sinn wir daraus gezogen haben. Manchmal aber liegen wir bei der Deutung unserer Erfahrungen falsch.
Fragen an dich: Bist du mit Geschwistern aufgewachsen? Was brachten sie in dein Leben? Welche Aspekte deines Verhaltens haben sich daraus ergeben? Wo in der Geschwisterreihe war dein Platz? Wie hast du dich daran angepasst? Welche Rolle hast du in der Familie übernommen? Eine, die ich oben erwähnt habe, oder eine andere? Bist du ein Einzelkind? Wie war das für dich? Wie fühlst du dich, wenn du darüber sprichst?
Ich werde alles tun, um dich in meiner Nähe zu behalten
Ich hoffe, ich habe diese Botschaft rübergebracht: Babys und Kinder sind klug. Sie passen sich ständig an, um die Verbindung zu ihren Bezugspersonen aufrechtzuerhalten. Die Verhaltensweisen, die wir in jenen frühen Jahren annehmen, bilden oft das Fundament unserer Persönlichkeit und unseres Handelns als Erwachsene. Und manche von uns haben sich stärker angepasst als andere. So tun Kinder, die Angst davor haben, im Stich gelassen, bestraft oder nicht akzeptiert zu werden, oft alles, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Sie ignorieren ihre eigenen Wünsche, setzen die Bedürfnisse anderer an die erste Stelle und sagen Ja zu allem, was man von ihnen fordert, in der Hoffnung, dass sie akzeptiert, geliebt und geschützt werden, wenn sie alles richtig machen.
Andere Kinder bewältigen diese Erfahrung vielleicht, indem sie perfektionistisch werden (man kann sogar gleichzeitig Perfektionist sein und anderen gefallen wollen), und hoffen, dass ihre Bezugspersonen mit ihnen zufrieden sind, wenn sie nur alles richtig machen. Solche Verhaltensweisen können einem Kind ein Gefühl der Kontrolle in einer unsicheren Welt geben.
Kinder, denen man nicht zuhört oder die festgestellt haben, dass weder Perfektion noch der Wille, anderen zu gefallen, hilft, lernen vielleicht, dass sie die nötige Aufmerksamkeit nur dann bekommen, wenn sie wütend werden und/oder laut schreien. Sie steigern diese Verhaltensweisen, bis sie so viele Regeln gebrochen haben, dass jemand kommt, um sie zu stoppen. Bezugspersonen verstehen so etwas selten. Wenn es dir so ergangen ist, wurdest du vielleicht als »böse« abgestempelt, als unbeherrscht oder schwierig bezeichnet, während du eigentlich nur (unbewusst) das Gefühl hattest, dass eine wütende Interaktion besser war als gar keine. Wenn Kinder sich auf diese Weise anpassen, begleiten diese Verhaltensweisen sie gewöhnlich bis in ihr Erwachsenenleben.
Ich hatte eine erwachsene Klientin, die überaus gesellig war und als »Stimmungskanone« ihres Freundeskreises und jeder Party galt. Sie fluchte wie ein Kutscher und war für ihre derbe und unorthodoxe Art bekannt und beliebt. In ruhigen Zeiten fühlte sie sich tief verbunden, geliebt und bereit, stets ihr wildes, ungefiltertes Selbst zu sein. In stressigen Zeiten jedoch merkte sie, dass sie sich »paranoid« fühlte (ihre Worte). Sie war sicher, dass ihre Freunde und Freundinnen sich plötzlich von ihr abwenden würden. Sie begann sich zu überlegen, was sie wohl denken mochten. »Ich weiß, sie sagen, dass sie sich amüsieren und dass das Essen, das ich auf den Tisch gebracht habe, lecker war, aber was ist, wenn sie das nur sagen und es gar nicht meinen?«, »Ist das Lächeln, mit dem sie mich eben begrüßt haben, echt oder falsch?«, »Möchten sie wirklich hier sein, oder ertragen sie mich nur?« Diese Ängste gingen auch mit einem starken Bedürfnis einher, es allen recht zu machen und sich perfekt zu verhalten. Das Fluchen verschwand. »Bitte«, »danke«, »Entschuldigung« – das waren die Worte, die sie plötzlich besonders häufig benutzte.
Den größten Teil unseres Lebens verbringen wir damit, die Muster zu wiederholen, die wir als Kinder angenommen haben – um uns geborgen zu fühlen und den Erwachsenen nahe zu sein, die uns aufzogen.
Was meine Klientin da durchmachte, war nachvollziehbar. Sie war mit Bezugspersonen aufgewachsen, deren Stimmungen stark schwankten – in einem Moment war sie das Goldkind, das nichts falsch machen konnte, und dann plötzlich wurde sie ignoriert, angebrüllt oder musste als Sündenbock für alles herhalten, was in der Familie schieflief, sie wurde für jedes nicht ganz perfekte Verhalten gerügt. Um damit klarzukommen, entwickelte sie eine Superkraft, wenn es darum ging, diese Stimmungsumschwünge vorauszuahnen. Und sie passte ihr Verhalten an, um ihren Bezugspersonen möglichst alles recht zu machen, sodass sie wieder gute Laune bekamen. Jetzt verfiel sie, wenn sie gestresst war, neuerlich in diese frühe Art, mit Stress umzugehen, und begann, Bedrohungen vorherzusehen, die es gar nicht gab. Um sich das Leben leichter zu machen, musste sie ihre Bewältigungsstrategien neu aufstellen, sodass sie zu ihrem gegenwärtigen Leben passten. Wichtig waren vor allem Achtsamkeit und Mitgefühl mit sich selbst.
Bevor ihr womöglich glaubt, dass all unsere Verhaltensweisen unter Stress mit unserer Kindheit zu tun haben, muss ich euch daran erinnern, dass Kinder sich nicht nur aus diesen Gründen anpassen. Manche Kinder wollen es von Natur aus allen recht machen, manche sind von Natur aus Perfektionisten und manche von Natur aus Rebellinnen. Manche wurden jedes Mal gelobt, wenn sie sich von diesen Seiten zeigten, und verlegten sich einfach auf dieses Verhalten, wie wir alle es tun, wenn jemand uns sagt, dass wir etwas gut gemacht haben. Manche bekamen auch zu hören, dass man ein gewisses Verhalten von ihnen erwartete. Einem Freund von mir, der asiatische Wurzeln hat und zur ersten Generation seiner Familie in Großbritannien gehört, wurde von Kindesbeinen an eingeimpft, dass er perfekt sein müsse, um mit den weißen Kindern in Großbritannien mithalten zu können.
Wenn ihr euch mit einer der hier vorgestellten Beschreibungen identifiziert, solltet ihr nicht davon ausgehen, dass diesen Verhaltensweisen etwas Dunkles oder Verborgenes zugrunde liegt. Ihr seid vielleicht einfach so, oder man hat euch gesagt, dieses Verhalten sei richtig und wichtig. Es geht vielmehr darum, wie stark ihr das Bedürfnis spürt, es auch als Erwachsene auszuleben, und in welchem Ausmaß – wenn überhaupt – es euer Leben beeinflusst.
Wenn euer Perfektionismus nützlich ist und nicht so stark, dass er in den Burn-out führt, ist das kein Problem. Wenn euer Bedürfnis, es allen recht zu machen, einfach für stabilere Beziehungen sorgt, ist das auch ganz wunderbar. Wenn das laute Brüllen euch in einem Job hilft, in dem alle darum kämpfen, gehört zu werden – großartig!
Wenn diese Verhaltensweisen allerdings eure Beziehungen beeinträchtigen oder euch in die Erschöpfung treiben, müsst ihr vielleicht darüber nachdenken, sie aufzugeben. Mir ist durchaus bewusst, dass sich dies beängstigend anfühlen kann, besonders wenn ihr glaubt, dass ihr diese lange gepflegten Verhaltensweisen braucht, damit ihr geliebt und nicht allein gelassen werdet. Versucht daher nicht, solche Verhaltensweisen plötzlich abzulegen. Haltet einfach fest, wo und warum sie wohl begonnen haben, erkennt, dass sie euch geholfen haben, euch an die Welt anzupassen, in der ihr aufgewachsen seid, und gewöhnt euch dann allmählich eine neue Fähigkeit aus Teil Drei dieses Buches an. Kapitel 8 (Bewältigungsstrategien, die alles nur noch schlimmer machen) beschäftigt sich ausführlicher mit dem Perfektionismus und dem Bedürfnis, es allen recht zu machen, sodass ihr euch wirklich sicher fühlen und die alten Verhaltensweisen über Bord werfen könnt.
Kannst du mit diesem Wissen im Hinterkopf irgendwelche Verhaltensweisen erkennen, die du womöglich in den ersten Jahren deines Lebens angenommen hast? Hat bei dir etwas geklingelt, als du die Beschreibungen oben gelesen hast, oder warst du:
• der Vermittler in deiner Familie, der zwischen sich streitenden Bezugspersonen sitzt und versucht, ihre Auseinandersetzungen zu entschärfen.
• die Beschützerin – die Person, die ihre Geschwister oder andere Familienmitglieder vor Auseinandersetzungen in der Familie oder körperlichen Schäden bewahrte.
• der Clown – der herumkasperte und sich die Verbindung zu anderen sicherte oder Spannungen auflöste, indem er die Menschen zum Lachen brachte.
• die Helferin – die eine Bezugsperson unterstützen musste, die Suchtmittel nahm.
• das Goldkind – das klingt großartig, weil du damit der »Held« der Familie warst, mit einem starken Verantwortungsgefühl. Aber wenn du mal versagt hast, war es eine Katastrophe.
Oder hat man von dir als Kind erwartet, dass du dich wie ein Elternteil verhältst? Manchmal müssen Kinder Erwachsenenrollen einnehmen, bevor sie dazu in der Lage sind – sie müssen zum Beispiel die Bezugsperson eines anderen Familienmitglieds werden. Sie müssen kochen, putzen, auf ihre Geschwister aufpassen, sich selbst und ihre Geschwister zum Arzt und zur Schule schicken, oder sie sind der- oder diejenige, der oder die eine Bezugsperson in emotional schwierigen Zeiten unterstützt.
Wenn du dich in dieser Beschreibung wiederfindest, ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass du heute, als Erwachsene(r), nicht gern spielst, da du diese wichtige Phase der Kindheit verpasst hast. Vielleicht verlangst du von dir selbst, dass du immer weißt, wie eine Aufgabe zu erledigen ist, auch wenn gar nicht klar ist, was erwartet wird – wie früher, als du dir nichts anmerken lassen durftest und einfach dafür sorgen musstest, dass alles funktionierte.
Okay, puuh, wir sind fast durch mit den ersten Lebensjahren. Wie geht es dir? Habe ich dich mit Informationen überschüttet oder bist du noch dabei? Eine Sache möchte ich dir noch mitteilen, und dann empfehle ich dir, das Buch zur Seite zu legen und dich ein paar Minuten zu bewegen.
Die »Guten« und die »Bösen«
In ihren ersten Lebensjahren können Kinder die Vorstellung von »gut« und »böse« beziehungsweise »schlecht« nicht zusammenbringen: »gute Mama«, »böse Schwester«, »guter Hund«, »böser Fußboden« (der mein Knie blutig gemacht hat). Alles muss das eine oder das andere sein. Denkt nur an die Märchen, die ihr als Kind gehört oder im Fernsehen gesehen habt. Auch dort gab es »die Guten« und »die Bösen«.
Kinder glauben, dass ihre Bezugsperson »gut« ist. Wenn eine Bezugsperson ihren Bedürfnissen nicht gerecht wird, deuten Kinder das oft so, dass sie »die Bösen« oder die »Schlechten« sind, dass es ihr Fehler ist. Ihr Denken ist noch nicht so differenziert, und deshalb verstehen sie nicht, dass Bezugspersonen ihnen manchmal nicht gerecht werden, weil sie gestresst sind oder Geld verdienen müssen oder weil sie einen vermeidenden oder ängstlichen Bindungsstil haben.
Selbst Kinder, die von ihren Bezugspersonen schlecht behandelt werden, lieben sie gewöhnlich weiterhin, aber es kann passieren, dass sie sich selbst nicht mehr lieben. Manchmal glauben sie, dass sie verdient haben, was ihnen widerfährt. Wenn du dich hier wiederfindest, garantiere ich dir, dass du es nicht verdient hast. Du hättest es besser verdient. Du bist gut und liebenswert.
Wenn du dies als Elternteil liest und denkst: »Oh Gott, was, wenn mein Kind denkt, dass es schlecht ist? Was kann ich tun?« Mach dir keine Sorgen. Die Lösung ist einfach. Versuche, deinen Kindern nahezubringen, dass sie geliebt werden, dass sie nicht verantwortlich sind für schwierige Zeiten (etwa eine Scheidung), und zeige ihnen immer wieder, dass selten etwas einfach nur »gut« oder »schlecht« ist. Zum Beispiel: »Süßigkeiten können gute Laune machen, und es kann schön sein, sie mit Freunden zu teilen, aber Süßigkeiten können auch schlecht für deine Zähne sein. Sie sind beides.«
»Der Hund macht sein Geschäft manchmal im Haus, stimmt’s? Und das ist schlecht, oder? Aber er tut so viele lustige Dinge, und er lässt sich von uns knuddeln, also ist er doch ein Guter, oder?«
Bring deinem Kind bei, dass es vielleicht etwas Schlechtes oder Böses tun kann, dass das aber nicht heißt, dass es selbst schlecht oder böse ist.
Fragen an dich: Wer waren die wichtigen Menschen in deiner Kindheit? Hattest du eine Gruppe von Bezugspersonen oder mehrere Gruppen? Glaubst du, dass dein erstes Lebensjahr eher ruhig verlief? (Mir ist klar, dass du das kaum wissen kannst, wenn du nicht gerade in einem Krisengebiet aufgewachsen bist oder weißt, dass du in dieser Zeit zu Hause von Vernachlässigung oder Gewalt betroffen warst.) Was ist mit den folgenden Jahren? Was hast du beim Heranwachsen über Gefühle gelernt? Hat man sie akzeptiert? Hat man sie beruhigt? Und wenn ja, wie? Hast du dich als Teil von etwas gefühlt? Als angenommen? Oder hattest du das Gefühl, am Rande zu stehen und dich womöglich ändern zu müssen, um dich einzufügen? In welcher Hinsicht hast du dich angepasst? Welchen Bindungsstil hast du entwickelt? Hast du versucht, es allen recht zu machen, oder eine andere Strategie eingesetzt, um die Liebe und Unterstützung zu erlangen, auf die du in deiner Familie hofftest? Welches Bild von dir selbst hast du aus diesen Jahren mitgenommen? Was war das Beste an dir? Was wurde gelobt? Wer war deine größte Hilfs- und Inspirationsquelle? Wer oder was gab dir das Gefühl, gesehen und geborgen zu sein?
Die neuen Regeln
Ich glaube, ein Grund dafür, dass viele von uns in ihrem Leben mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, liegt darin, dass man uns nicht die richtigen Informationen gegeben hat, die uns hätten helfen können, uns selbst zu verstehen und zu wissen, dass wir ganz okay sind. Deshalb möchte ich euch am Ende jedes Kapitels ein paar neue Vorstellungen schenken, die ihr euch zu eigen machen könnt. Hier kommt der erste Schwung:
• Du bist eine einzigartige Mischung aus deiner DNA und deiner Lebenserfahrung. Wer du heute bist, wie empfindlich du auf Stress reagierst, wie leicht es dir fällt, deine Gefühle zu verstehen, was du von anderen erwartest und wie du im Umgang mit anderen agierst – all das ist zum Teil in deiner DNA festgelegt und zum Teil durch die Umgebung bestimmt, in der du aufgewachsen bist.
• Alle Menschen haben dieselben Bedürfnisse: Überleben und Kontakte, Liebe und Akzeptanz. Selbst jene von uns, die nach außen hin scheinbar keine Liebe und Akzeptanz wollen. Selbst jene von uns, die keine Bindungen zu haben scheinen, die der Arbeit einen höheren Stellenwert einräumen als dem Kontakt zu anderen, denen Status und Kontrolle und Perfektion wichtiger sind als Beziehungen, sind oft an diesen Punkt gekommen, weil man ihnen beigebracht hat, dass sie so Anerkennung oder größtmögliche soziale Akzeptanz erreichen können.
• Wir brauchen Liebe, aber wir brauchen auch Grenzen. Kinder brauchen Fürsorge, sie brauchen Raum, um Fehler machen zu können, und sie brauchen jemanden, die oder der ihnen zeigt, wo die Grenzen eines akzeptablen Verhaltens liegen. Kinder fühlen sich geborgen, wenn sie wissen, dass es Regeln und Grenzen gibt und dass jemand auf sie aufpasst.
• Als Kind hast du dich wahrscheinlich enorm angestrengt, um die Aufmerksamkeit zu erlangen, die du brauchtest und verdientest. Es gab sicher Verhaltensweisen, die du als Kind angenommen hast, um dich sicher zu fühlen, und einige davon sind bestimmt heute noch sichtbar. Du kannst überaus stolz sein auf die Art, wie du dich damals angepasst hast, selbst wenn du sie heute nicht mehr unbedingt wertschätzt.
• Du hast als Kind Liebe und Fürsorge verdient, ohne das beweisen zu müssen. Du verdienst beides auch heute noch.
• Es ist möglich, dass zwei auf den ersten Blick gegensätzliche Dinge zur gleichen Zeit wahr sind.





























