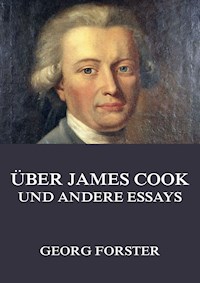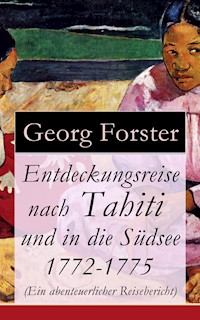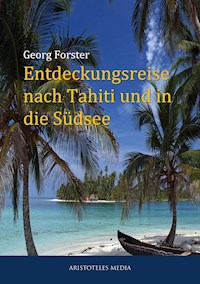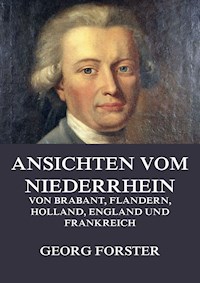
Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich E-Book
Georg Forster
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
In den Ansichten vom Niederrhein verbindet Georg Forster die Schilderung der Reise, die er mit dem 21jährigen Alexander von Humboldt unternahm, mit Reflexionen über geologische Theorien (Neptunismus und Plutonismus) und über gesellschaftliche Verhältnisse und deren Zusammenhang mit geographischer Breite und Menschenschlag (Vergleich: Köln - Neapel) sowie mit kunstgeschichtlichen Betrachtungen, Berichten über die aktuellen Aufstände in den österreichischen Niederlanden (dem heutigen Belgien), mit Darstellungen über technische Abläufe bei Maschinen und Werftarbeiten, mit der Kritik der Kommunalverfassung von Aachen und mit persönlichen Bekenntnissen und Betrachtungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 790
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich
Georg Forster
Inhalt:
Georg Forster – Biografie und Bibliografie
Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich
Erster Theil
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
Zweiter Theil
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
Dritter Theil
Ansichten vom Niederrhein, G. Forster
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849613884
www.jazzybee-verlag.de
Georg Forster – Biografie und Bibliografie
Reisender und Reiseschriftsteller, geb. 27. Nov. 1754 in Nassenhuben bei Danzig, gest. 10. Jan. 1794 in Paris, folgte seinem Vater nach Saratow und nach England. Mit 17 Jahren begleitete er ihn als Botaniker 1772 auf der zweiten Reise Cooks. Hierauf lebte er eine Zeitlang in England, war 1778–84 Lehrer der Naturgeschichte an der Ritterakademie in Kassel, folgte dann einem Ruf nach Wilna, worauf er sich mit Therese Heyne, der Tochter des Göttinger Professors Heyne, vermählte. Von dem Leben in Wilna nicht befriedigt, übernahm er 1788 das Amt eines Bibliothekars beim Kurfürsten von Mainz, war aber auch mit den dort herrschenden Zuständen unzufrieden und schloß sich 1792 an die Mainzer Klubbisten an. 1793 nach Paris gesandt, um die Vereinigung des linken Rheinufers mit Frankreich zu erwirken, sah sich F. nach der im Sommer 1793 erfolgten Eroberung von Mainz durch die deutschen Heere heimatlos, während ihm zugleich der Anblick der Pariser Zustände seine republikanischen Ideale zerstörte. In die Reichsacht erklärt und von Weib und Kindern verlassen, wollte F. nach Indien gehen und betrieb das Studium der morgenländischen Sprachen, als ihn der Tod ereilte. Er veröffentlichte: »A voyage round the world« (Lond. 1777, 2 Bde.; deutsch u. d. T.: »Beschreibung einer Reise um die Welt in den Jahren 1772–1775«, Berl. 1778–80, 2 Bde.); »Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich im April, Mai und Juni 1790« (das. 1791–1794, 3 Bde.; neu hrsg. von Büchner, Leipz. 1868, und, mit Forsters Briefen, von Leitzmann, Halle 1893); »Kleine Schriften, ein Beitrag zur Länder- und Völkerkunde, Naturgeschichte und Philosophie des Lebens« (Berl. 1789–97, 6 Bde.). Auch übersetzte F. die »Sakuntala« des Kalidasa (nach der englischen Übersetzung von Jones) und zahlreiche andre Werke. F. gehört zu den klassischen Schriftstellern Deutschlands; namentlich in den »Ansichten vom Niederrhein« prägt sich sein musterhafter Stil, seine geist- und gemütvolle Auffassung von Kunst, Literatur, Politik und Leben am deutlichsten aus, aber auch seine andern Schriften bekunden überall den scharfen Beobachter von Natur- und Völkerleben. Peschel nennt F. den ersten Schriftsteller, der Sinn und Gefühl für landschaftliche Schönheiten erweckt hat, wie er auch überaus anregend auf Alex. v. Humboldt wirkte. Seine Gattin Therese, später mit Forsters Freund Huber verheiratet (s. Huber 4), gab seinen »Briefwechsel, nebst Nachrichten von seinem Leben« (Leipz. 1829, 2 Bde.) heraus; seinen »Briefwechsel mit S. Th. Sömmerring« veröffentlichte Hettner (Braunschw. 1877). Forsters »Sämtliche Schriften«, herausgegeben von seiner Tochter, mit einer Charakteristik Forsters von Gervinus, erschienen in 9 Bänden (Leipz. 1843). Eine Auswahl seiner kleinern Schriften gab Leitzmann (Stuttg. 1894), »Lichtstrahlen aus Forsters Briefen« Elisa Maier (Leipz. 1856) heraus. Vgl. Leitzmann, Georg F. (Halle 1893); Moleschott, Georg F., der Naturforscher des Volkes (3. Ausg., das. 1874); H. Klein, Georg F. in Mainz (Gotha 1863). Heinrich König (s.d.) behandelte Forsters Leben in dem Roman »Die Klubbisten in Mainz« und in »Forsters Leben in Haus und Welt«.
Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich
Erster Theil
I
Boppart, den 24. März
Ich war eben im Begrif, unserer Philosophie eine Lobrede zu halten, als mir einfiel, daß im Grunde wenig dazu gehört, sich in ein Schicksal zu finden, welches Deinem Reisenden noch Feder, Tinte und Papier gestattet. Behaglicher wäre es allerdings gewesen, Dir alles, was ich jetzt auf dem Herzen habe, aus Koblenz und in der angenehmen Erwartung einer süßen Nachtruhe zu sagen; dafür aber sind Abentheuer so interessant! Ein gewöhnlicher Reisender hätte das Ziel seiner Tagefahrt erreicht: wir sind drei Stunden Weges diesseits desselben geblieben.
Es war einmal Verhängniß, daß es uns heute anders gehen sollte, als wir erwartet hatten. Statt des herrlichen gestrigen Sonnenscheins, mit dessen Fortdauer wir uns schmeichelten, behielten wir einen grauen Tag, dessen minder glänzende Eigenschaften aber, genau wie man in Romanen und Erziehungsschriften lehrt, das Nützliche ersetzte. Denn weil der Zauber einer schönen Beleuchtung wegfiel und der bekannten Gegend keine Neuheit verleihen konnte, so blieb uns manche Stunde zur Beschäftigung übrig. Auf der Fahrt durch das Rheingau hab' ich, verzeih es mir der Nationalstolz meiner Landsleute! eine Reise nach Borneo gelesen und meine Phantasie an jenen glühenden Farben und jenem gewaltigen Pflanzenwuchs des heißen Erdstrichs, wovon die winterliche Gegend hier nichts hatte, gewärmt und gelabt. Der Weinbau giebt wegen der krüppelhaften Figur der Reben einer jeden Landschaft etwas Kleinliches; die dürren Stöcke, die jetzt von Laub entblößt, und immer steif in Reih' und Glied geordnet sind, bilden eine stachlichte Oberfläche, deren nüchterne Regelmäßigkeit dem Auge nicht wohl thut. Hier und dort sahen wir indeß doch ein Mandel- und ein Pfirsichbäumchen und manchen Frühkirschenstamm mit Blüthenschnee weiß oder röthlich überschüttet; ja selbst in dem engeren Theile des Rheinlaufs, zwischen den Bergklüften, hing oft an den kahlen, durch die Rebenstöcke verunzierten Felswänden und Terrassen ein solches Kind des Frühlings, das schöne Hofnungen auf die Zukunft in uns weckte.
Nicht immer also träumten wir uns in den ewigen Sommer der Palmenländer. Wir saßen stundenlang auf dem Verdeck, und blickten in die grüne, jetzt bei dem niedrigen Wasser wirklich erquickend grüne, Welle des Rheins; wir weideten uns an dem reichen mit aneinander hangenden Städten besäeten Rebengestade, an dem aus der Ferne her einladenden Gebäude der Probstei Johannisberg, an dem Anblick des romantischen Mäusethurms und der am Felsen ihm gegenüber hangenden Warte. Die Berge des Niederwalds warfen einen tiefen Schatten auf das ebene, spiegelhelle Becken des Flusses, und in diesem Schatten ragte, durch einen zufälligen Sonnenblick erleuchtet, Hatto's Thurm weiß hervor, und die Klippen, an denen der Strom hinunterrauscht, brachen ihn malerisch schön. Die Noh, mit ihrer kühnen Brücke und der Burg an ihrem Ufer, glitt sanft an den Mauern von Bingen hinab, und die mächtigeren Fluthen des Rheins stürzten ihrer Umarmung entgegen.
Wunderbar hat sich der Rhein zwischen den engen Thälern einen Weg gebahnt. Kaum begreift man auf den ersten Blick, warum er hier (bei Bingen) lieber zwischen die Felswände von Schiefer sich drängte, als sich in die flachere Gegend nach Kreuznach hin ergoß. Allein bald wird man bei genauerer Untersuchung inne, daß in dieser Richtung die ganze Fläche allmälig steigt, und wahrer Abhang eines Berges ist. Wenn es demnach überhaupt dem Naturforscher ziemt, aus dem vorhandenen Wirklichen auf das vergangene Mögliche zu schließen; so scheint es denkbar, daß einst die Gewässer des Rheins vor Bingen, durch die Gebirgswände gestaucht und aufgehalten, erst hoch anschwellen, die ganze flache Gegend überschwemmen, bis über das niveau der Felsen des Bingerlochs anwachsen und dann unaufhaltsam in der Richtung, die der Fluß noch jetzt nimmt, sich nordwärts darüber hinstürzen mußten. Allmälig wühlte sich das Wasser tiefer in das Felsenbett, und die flachere Gegend trat wieder aus demselben hervor. Dies vorausgesetzt, war vielleicht das Rheingau, ein Theil der Pfalz, und der Bezirk um Mainz bis nach Oppenheim und Darmstadt einst ein Landsee, bis jener Damm des Binger Felsenthals überwältigt ward und der Strom einen Abfluß hatte.
Der stärkere Wein, den das Rheingau hervorbringt, wächst nicht mehr jenseits der Enge von Bingen. Die Richtung des Flusses von Morgen gegen Abend durch das ganze Rheingau giebt den dortigen Rebenhügeln die beste Lage gegen den Stral der mittäglichen Sonne, und die Gestalt des östlichen Gebirges, das auf seiner Oberfläche beinahe ganz eben ist, trägt vieles zur vorzüglichen Wärme dieses von der Natur begünstigten Thales bei. Der Nord- und der Ostwind stürzen sich, wenn sie über jene erhabene Fläche herstreichen und an den Rand derselben kommen, nicht geradezu hinab, sondern äußern ihre meiste Kraft erst auf der entgegengesetzten Seite des Flusses; das Thal unmittelbar unter dem Berge berühren sie kaum. Was für Einfluß die mineralischen Bestandtheile des Erdreichs und die Verschiedenheit der Gebirgslager auf die Eigenschaften des Weins haben können, ist noch nicht entschieden. Je weniger man über diesen Punkt weiß und bestimmt wissen kann, desto weiter treibt die grübelnde Hypothesensucht ihr Spiel damit. Hier darf sie sich keck auf ihre empirische Weisheit berufen; denn sie kann sich vor Widerlegungen wenigstens so lange sicher stellen, als man nicht Erfahrung gegen Erfahrung aufzuweisen hat. So viel ist indessen immer an der Sache, daß, wo alle übrige Umstände völlig gleich sind, und nun doch eine Verschiedenheit im Erzeugniß bemerklich wird, die Ursache davon in der Beschaffenheit des Bodens gesucht werden darf. Bekanntlich entspringen auf jenem östlichen Gebirge mehrere, zum Theil heiße Quellen, von denen einige Schwefel, andere Vitriolsäure und Eisen enthalten. Man hat mich auch versichern wollen, daß ein Kohlenflöz sich unter dem Hügel von Hochheim erstrecke und dem dort wachsenden vortreflichen Weine der Domdechanei seinen berühmten edlen Geschmack und sein Feuer gebe. Ich erinnere mich hierbei, daß der Schnee am Gehänge dieses Rebenhügels gegen Mainz eher, als vor dem entgegengesetzten Thore, schmilzt. Der Unterschied war mir und Andern oft in wenigen hundert Schritten so auffallend, daß sogar die Lufttemperatur, unter völlig gleichen Umständen, dem Gefühle merklich verschieden vorkam. So wie man das abendliche Thor von Hochheim verläßt, um nach Mainz zu gehen, glaubt man in einem milderen Klima zu seyn. Ich würde freilich diesen Unterschied dem Winde zuschreiben, der auf der Ebene von dem Altkönig her frei und ohne Widerstand hinstürmen und die Kälte der oberen Luftregion herunterführen, oder besser, die zum Gefrieren erforderliche schnelle Verdünstung befördern kann. Allein Andere schreiben die wärmere Temperatur des Weinberges den darunter liegenden Kohlen zu. Wahr ist es, eine Kohle, wie überhaupt jeder Brennstoff, fühlt sich unter einerlei Umständen viel wärmer an, als ein Stück Kalkstein oder Schiefer; und dieses Gefühl beweiset, daß wirklich aus der Kohle in den berührenden Körper mehr Wärmetheilchen übergehen: nicht minder gewiß ist es auch, daß die brennbaren Mineralien bei einer gewissen Lufttemperatur unaufhörlich Wärme ausströmen. Wie, wenn der Weinstock besonders vor andern Gewächsen organisirt wäre, von dieser Ausdünstung begünstigt zu werden? Das Beste zur Vergeistigung des Traubensaftes thut zwar die Sonne; ihr Licht, das von den schwammigen Früchten eingesogen und in ihrer Flüßigkeit fixirt wird, würzt und versüßt die Beere. Daher bleiben auch unsere Weine gegen die griechischen, italienischen, spanischen, ja sogar gegen die ungarischen und französischen so herbe, daß sie bei den Ausländern und dem Frauenzimmer wenig Beifall finden. –
Für die Nacktheit des verengten Rheinufers unterhalb Bingen erhält der Landschaftkenner keine Entschädigung. Die Hügel zu beiden Seiten haben nicht jene stolze, imposante Höhe, die den Beobachter mit Einem mächtigen Eindruck verstummen heißt; ihre Einförmigkeit ermüdet endlich, und wenn gleich die Spuren von künstlichem Anbau an ihrem jähen Gehänge zuweilen einen verwegenen Fleiß verrathen, so erwecken sie doch immer auch die Vorstellung von kindischer Kleinfügigkeit. Das Gemäuer verfallener Ritterfesten ist eine prachtvolle Verzierung dieser Scene; allein es liegt im Geschmack ihrer Bauart eine gewisse Ähnlichkeit mit den verwitterten Felsspitzen, wobei man den so unentbehrlichen Kontrast der Formen sehr vermißt. Nicht auf dem breiten Rücken eines mit heiligen Eichen oder Buchen umschatteten Berges, am jähen Sturz, der über eine Tiefe voll wallender Saaten und friedlicher Dörfer den Blick bis in die blaue Ferne des hüglichten Horizonts hinweggleiten läßt, – nein, im engen Felsthal, von höheren Bergrücken umschlossen, und, wie ein Schwalbennest, zwischen ein paar schroffen Spitzen klebend, ängstlich, hängt hier so mancher zertrümmerte, verlassene Wohnsitz der adelichen Räuber, die einst das Schrecken des Schiffenden waren. Einige Stellen sind wild genug, um eine finstre Phantasie mit Orkusbildern zu nähren, und selbst die Lage der Städtchen, die eingeengt sind zwischen den senkrechten Wänden des Schiefergebirges und dem Bette des furchtbaren Flusses, – furchtbar wird er, wenn er von geschmolzenem Alpenschnee oder von anhaltenden Regengüssen anschwillt – ist melancholisch und schauderhaft.
In Bacharach und Kaub, wo wir ausstiegen und auf einer bedeckten Galerie längs der ganzen Stadtmauer hin an einer Reihe ärmlicher, verfallener Wohnungen fortwanderten, vermehrten die Unthätigkeit und die Armuth der Einwohner das Widrige jenes Eindrucks. Wir lächelten, als zu Bacharach ein Invalide sich an unsere Jacht rudern ließ, um auf diese Manier zu betteln; es war aber entweder noch lächerlicher, oder, wenn man eben in einer ernsthaften Stimmung ist, empörender, daß zu St. Goar ein Armenvogt, noch ehe wir ausstiegen, mit einer Sparbüchse an das Schif trat und sie uns hinhielt, wobei er uns benachrichtigte: das Straßenbetteln sei zu Gunsten der Reisenden von Obrigkeitswegen verboten. Seltsam, daß dieser privilegirte Bettler hier die Vorüberschiffenden, die nicht einmal aussteigen wollen, belästigen darf, damit sie nicht auf den möglichen Fall des Aussteigens beunruhigt werden!
In diesem engeren, öderen Theile des Rheinthals herrscht ein auffallender Mangel an Industrie. Der Boden ist den Einwohnern allerdings nicht günstig, da er sie auf den Anbau eines einzigen, noch dazu so ungewissen Produktes, wie der Wein, einschränkt. Aber auch in ergiebigeren Gegenden bleibt der Weinbauer ein ärgerliches Beispiel von Indolenz und daraus entspringender Verderbtheit des moralischen Charakters. Der Weinbau beschäftigt ihn nur wenige Tage im Jahr auf eine anstrengende Art; bei dem Jäten, dem Beschneiden der Reben u.s.w. gewöhnt er sich an den Müßiggang, und innerhalb seiner Wände treibt er selten ein Gewerbe, welches ihm ein sicheres Brodt gewähren könnte. Sechs Jahre behilft er sich kümmerlich, oder anticipirt den Kaufpreis der endlich zu hoffenden glücklichen Weinlese, die gewöhnlich doch alle sieben oder acht Jahre einmal zu gerathen pflegt; und ist nun der Wein endlich trinkbar und in Menge vorhanden, so schwelgt er eine Zeitlang von dem Gewinne, der ihm nach Abzug der erhaltenen Vorschüsse übrig bleibt, und ist im folgenden Jahr ein Bettler, wie vorher. Ich weiß, es giebt einen Gesichtspunkt, in welchem man diese Lebensart verhältnismäßig glücklich nennen kann. Wenn gleich der Weinbauer nichts erübrigt, so lebt er doch sorglos, in Hofnung auf das gute Jahr, welches ihm immer wieder aufhilft. Allein, wenn man so raisonnirt, bringt man die Herabwürdigung der Sittlichkeit dieses Bauers nicht in Rechnung, die eine unausbleibliche Folge seiner unsichern Subsistenz ist. Der Landeigenthümer zieht freilich einen in die Augen fallenden Gewinn vom Weinbau; denn weil er nicht aus Mangel gezwungen ist, seine Weine frisch von der Kelter zu veräußern, so hat er den Vortheil, daß sich auch das Erzeugniß der schlechtesten Jahre auf dem Fasse in die Länge veredelt, und ihm seinen ansehnlichen Gewinn herausbringen hilft. Man rechnet, daß die guten Weinländer sich, ein Jahr ins andre gerechnet, zu sieben bis acht Procent verinteressiren, des Mißwachses unbeschadet. Es wäre nun noch die Frage übrig, ob dieser Gewinn der Gutsbesitzer den Staat für die hingeopferte Moralität seiner Glieder hinlänglich entschädigen kann?
Der ungewöhnlich niedrige Stand des Rheinwassers war schuld, daß unsere Jacht nur langsam hinunterfuhr. Erst um acht Uhr Abends erreichten wir Boppart beim Mondlicht, das den ganzen Gebirgskessel angenehm erleuchtete. Wir eilten dem besten Wirthshause zu; allein hier fanden wir alle Zimmer besetzt. In einem zweiten sahen wir alle Fenster eingeworfen; von dem dritten schreckte uns die Schilderung der darin herrschenden Unreinlichkeit zurück. Also mußten wir auf gut Glück im vierten einkehren und uns an einer kalten Kammer und einem gemeinschaftlichen Lager genügen lassen. Hier wärmen wir uns jetzt beym Schreiben mit Deinem russischen Thee, und preisen die gütige Vorsorge, die uns damit beschenkte. Ohne ihn darbten wir in dieser Amazonenstadt, wo noch vor wenigen Tagen dreihundert Mann Exekutionstruppen den Muth der Weiber dämpfen mußten, die sich gegen eine mißverstandene Verordnung aufgelehnt und einigen Soldaten blutige Köpfe geschlagen hatten. Die militairische Gewalt hat jetzt die Oberhand über das schöne Geschlecht, das nach einem Paar Gestalten, die an uns diesen Abend vorüberschwebten, zu urtheilen, für ganz andere Kriege gebildet zu seyn scheint.
Ein- für allemal bitte ich jetzt um Deine Nachsicht, wenn ich künftig auf Abschweifungen gerathe, oder nicht so zierlich wie ein Gelehrter, der auf seinem Studierzimmer reiset, frisch nach der That, nur auch von der Spannung des Beobachtens ermüdet, erzähle. So dürftig und desultorisch aber dieser erste Reisebericht ausgefallen ist, verspreche ich mir gleichwohl einen Rückblick auf das etwanige Verdienst, welches ihm unsere unbequeme Lage geben kann. Wir schreiben hier bei einem Lichte, welches von Zeit zu Zeit Funken sprüht und nach jeder solchen Anstrengung dermaßen erschöpft ist, daß uns kaum Hellung genug übrig bleibt, unsere Schriftzüge zu erkennen. Kein lebhafteres Bild von unserem eigenen Zustande, nach einer dreizehnstündigen Wasserfahrt könnte ich Dir jetzt ersinnen. Nach jedem Bemühen einen Gedanken zu Papier zu bringen, verengt sich der Raum zwischen unsern Augenliedern, und ein Nebelflor umhüllt das ewige Lämpchen des innern Sinnes.
II
Andernach
An einem milden Sommermorgen bei Sonnenaufgang müßte es köstlich seyn, sich mitten auf dem See zu befinden, den der Rhein bei Boppart, weil er ringsum von hohen Gebirgen eingeschlossen ist, zu bilden scheint; denn ungeachtet der feuchten Kälte, womit uns der Ostwind die aufsteigenden Nebel entgegenwehte, konnten wir uns doch nicht entschließen, in unserer Kajüte zu bleiben. Die schöngewölbten Berggipfel erheben sich hier mit reichlicher Waldung, welche das Malerische der Gegend, sobald sie mit frischem Laube geschmükt seyn wird, um vieles erhöhen muß.
Die Nähe von Koblenz rief uns bald zum zweitenmal hervor. Hier öfnet sich ein Reichthum der Natur und der Verzierung, den das Ufer des Rheins, seit der Gegend, wo der Fluß die Schweiz verläßt, nirgends zeigt. Schöne Formen von Gebirgsrücken, Baumgruppen und Gebäuden wechseln hier mit einander ab; die Hügel tragen eine dichte Krone von Wäldern; das neue kuhrfürstliche Schloß prangt am Ufer, und der Ehrenbreitstein hängt herrlich und erhaben auf dem jenseitigen Gebirge. Beleuchtung wäre hier wieder ein willkommnes Geschenk gewesen; allein auch heute ward uns diese Spende versagt; unser Morgenhimmel war mit dünnem, grauem Gewölk durchstreift, und uns dämmerte nur ein halbes Licht.
Wir erstiegen den Ehrenbreitstein. Nicht die unwichtige Kostbarkeit dieser Festung; nicht der Vogel Greif, jene ungeheure Kanone, die eine Kugel von hundert und sechzig Pfunden bis nach Andernach schießen soll, aber doch wohl nie geschossen hat; nicht alle Mörser, Haubitzen, Feldschlangen, Zwölf-und Vierundzwanzigpfünder, lange gezogene Röhre, Kartätschenbüchsen, Graupen, und was sonst im Zeughause oder auf den Wällen zu bewundern ist; nicht die weite Aussicht von dem höchsten Gipfel des Berges, wo Koblenz mit dem Rhein und der Mosel landkartenähnlich unter den Füßen liegt – nichts von dem allen konnte mich für den abscheulichen Eindruck entschädigen, den die Gefangenen dort auf mich machten, als sie mit ihren Ketten rasselten und zu ihren räucherigen Gitterfenstern hinaus einen Löffel steckten, um dem Mitleiden der Vorübergehenden ein Almosen abzugewinnen. Wäre es nicht billig, fiel mir dabei aufs Herz, daß ein jeder, der Menschen zum Gefängniß verurtheilt, wenigstens Einen Tag im Jahre mit eigenen Ohren ihr Gewinsel, ihre himmelstürmende Klage vernehmen müßte, damit ihn nicht der todte Buchstabe des Gesetzes, sondern eigenes Gefühl und lebendiges Gewissen von der Rechtmäßigkeit seiner Urtheile überzeugte? Wir bedauern den unsittlichen Menschen, wenn die Natur ihn straft und physisches Übel über ihn verhängt; wir suchen sein Leid zu mildern und ihn von seinen Schmerzen zu befreien: warum darf nicht Mitleid den Elenden erquicken, dessen Unsittlichkeit den Arm der beleidigten Bürgerordnung reizte? Ist der Verlust der Freiheit kein hinreichendes Sühnopfer, und fordert die strenge Gerechtigkeit noch die Marter des Eingekerkerten? Mich dünkt, die Abschaffung der Todesstrafen hat uns nur noch grausamer gemacht. Ich will hier nicht untersuchen, ob ein Mensch befugt seyn könne, einem andern das Leben zu nehmen; aber wenn es Güter giebt, die unantastbar und allen heilig seyn sollen, so ist das Leben gewiß nicht das einzige, welches unter diese Rubrik gehört; auch diejenigen Zwecke des Lebens gehören hieher, ohne welche der Mensch seinen Rang auf der Leiter der Wesen nicht behaupten kann, ohne welche er Mensch zu seyn aufhören muß. Die Freiheit der Person ist unstreitig ein solches, von der Bestimmung des Menschen unzertrennliches und folglich unveräußerliches Gut. Wenn also der bürgerliche Vertrag ein so schreckliches Übel, wie die gewaltsame Beraubung eines unveräußerlichen Gutes, über einen Menschen um die Sicherheit Aller willen verhängen muß, so bleibt zu entscheiden übrig, ob es nicht zwecklose Grausamkeit sey, das Leben durch ewige Gefängnißstrafe in fortwährende Quaal zu verwandeln, wobei es schlechterdings zu keiner andern Absicht, als zum Leiden erhalten wird, anstatt es durch ein Todesurtheil auf einmal zu enden? Die fromme Täuschung, die man sich zu machen pflegt, als ob ein Delinquent während seiner lebenslänglichen Gefangenschaft Zeit gewönne, in sich zu gehen, eine sittliche Besserung anzufangen, sich durch seine Reue mit Gott zu versöhnen und für ein künftiges Leben zu bereiten, würde schnell verschwinden, wenn man sich die Mühe gäbe, die Erfahrung um Rath zu fragen, ob dergleichen Bekehrungen die gewöhnlichen Folgen der ewigen Marter sind? Die finsteren, modernden Gewölbe der Gefängnisse, und die Ruderbänke der Galeeren würden, wie ich fürchte, hierüber schauderhafte Wahrheiten verrathen, wenn man auch nicht, durch richtiges Nachdenken geleitet, schon im voraus überzeugt werden könnte, daß die Bekehrung im Kerker zwecklos seyn müsse, weil sie unfruchtbar bleibt, und daß ein Augenblick wahrer Reue so viel werth sei, als ein in Thränen und Büßungen hingeschmachtetes halbes Jahrhundert. Allein die Furcht vor dem Tode, die nur durch eine der Würde des Menschen angemessene Erziehung gemildert und in Schranken gehalten wird, lehrt den Richter, das Leben in immerwährender Gefangenschaft als eine Begnadigung schenken, und den Verbrecher, es unter dieser Bedingung dankbar hinnehmen. Auch hier wirkt also die Furcht, wie sie sonst immer zu wirken pflegt: sie macht grausam und niederträchtig. Doch den Gesetzen will ich hierin weniger Schuld beimessen, als der allgemeinen Stimmung des Menschengeschlechts. So lange es Menschen giebt, die das Leben ohne Freiheit, an der Kette und im Kerker, noch für ein Gut achten können, so lange bedaure ich den Richter, der vielleicht nicht weiß, welch ein schreckliches Geschenk er dem unglücklichen Verbrecher mit der Verlängerung eines elenden Lebens macht; aber verdenken kann ich es ihm nicht, daß er sich von dem Geiste seines Zeitalters hinreißen läßt. –
Unter den Merkwürdigkeiten des Ehrenbreitsteins zeigte man uns auch das ungenähte Kleid des Heilands. Der ungeziemende Scherz, den ein unvorsichtiger Zuschauer sich darüber erlaubte, erregte bei einem unserer Führer solchen Abscheu, daß er seine heftigen Äußerungen nicht ohne ein krampfhaftes Zucken unterdrücken konnte. War es ächte Frömmigkeit? war es der verzeihliche Aberglaube des Pöbels, was diese Wirkung hervorbrachte? Ich vermuthe, diesmal keines von beiden. Es giebt Menschen, deren Seele die Vorstellung eines schuldigen Respekts so ganz erfüllt, daß sie bei einer Spötterei über den geschmacklosen Gallarock eines Ministers genau dieselbe Angst empfinden würden.
In dem alten, leeren, geräumigen Dikasterialgebäude zu Ehrenbreitstein hat der Kaufmann Gerhardi eine neue Lederfabrik angelegt, wozu ihm der Kuhrfürst von Trier auf fünf oder sechs Jahre Befreiung von allen Abgaben bewilligt hat. In einiger Entfernung von diesem Orte, zu Vallender, zieht eine große Lederfabrik ihre Häute unmittelbar aus Buenos Ayres in Südamerika. So knüpfen der Handel und die Industrie das Band zwischen den entferntesten Welttheilen!
Von Koblenz fuhren wir nach Neuwied, und besahen dort das Brüderhaus der Herrnhuter, nebst den mancherlei Werkstätten dieser fleißigen und geschickten Gesellschaft. Ihre Kirche ist ein einfaches, helles Gebäude, das mir recht gut gefiel. An die Stelle der Agapen oder Liebesmahle der ersten Christen, ist hier ein gemeinschaftliches Theetrinken in der Kirche eingeführt, wozu sich die ganze Gemeine von Zeit zu Zeit versammelt. Meine Vorliebe zum Thee ist es nicht allein, die mich mit diesem Gebrauche versöhnt. Wenn ich schon nicht mitschwärmen mag, so ist mir doch eine Schwärmerei ehrwürdig, sobald sie auf Geselligkeit und frohen Genuß des Daseyns führt. Diese Stimmung läßt sich, wie Du leicht denken kannst, mit der herrnhutischen Einrichtung, welche die unverheiratheten Männer und Weiber mit klösterlicher Strenge von einander trennt, schon nicht so leicht in eine Gleichung bringen. Ich glaube in meiner Erfahrung hinlänglichen Grund zu der Überzeugung zu finden, daß man in der Welt nie stärker gegen das Böse und seine Anfechtungen ist, als wenn man ihm mit offener Stirne und edlem Trotz entgegengeht: wer vor ihm flieht, ist überwunden. Wer steht uns auch dafür, daß, wo der gebundene Wille mit der erkannten Pflicht im Kampfe liegt, die Sünden der Einbildungskraft nicht unheilbarer und zerrüttender seyn können, als die etwanigen Folgen eines gemischten und durch freiwillige Sittsamkeit gezügelten Umgangs! Giebt es nicht wollüstige Ausschweifungen der Seele, welche strafbarer als physische Wollüste sind, da sie den Menschen im wesentlichsten Theile seines Daseyns entnerven? Die lehrreichen Schriften der berühmten Guyon, die freilich wohl in einer ganz andern Absicht gedruckt worden sind, und die Bekenntnisse des wackern Jamerai Düval schildern die Krankheit der Entzückten durch alle ihre verschiedenen Stadien, als eine metaphysische Selbstschändung. Bei einem eingeschränkten Erkenntnißvermögen und einer armen Einbildungskraft sind die Symptome nicht gefährlich, und das Übel bleibt in den Schranken, die ihm die Unerheblichkeit des Individuums anweist. Wenn hingegen diese Seelenepidemie ein gebildetes, edles Wesen ergreift, dann äußern sich Wirkungen, welche Völker vergiften, die bürgerlichen Verhältnisse stören und die Sicherheit des Staats untergraben können. Die Täuschung, womit man sich über den Gegenstand dieser Entzückungen hintergeht, ist so vollkommen, daß die tiefste Tiefe, wohin der menschliche Geist sinken kann, dem Verblendeten die höchste Stufe der Tugend, der Läuterung und der Entwicklung zum seligen Genusse scheint. Genau wie die Entartung des physischen Triebes die Gesetze der Natur beleidigt, eben so muß in einem noch ungleich höheren Grade der Seelenraub strafbar seyn, den man durch jene unnatürliche Vereinigung mit einer Idee, am ganzen Menschengeschlechte begeht. Geistesarmuth ist der gewöhnliche, jedoch von allen gewiß der unzulässigste Vorwand zu dieser Theopornie, die erst in der Einsamkeit und Heimlichkeit angefangen, und dann ohne Scheu öffentlich fortgesetzt wird. Zuerst ist es Trägheit, hernach Egoismus, was den Einfältigen über die natürlichsten Mittel, seinem Mangel abzuhelfen, irre führt. Ist hingegen eine Seele reich und groß? O dann suche sie ein Wesen ihrer Art, das Empfänglichkeit genug besitzt, sie ganz zu fassen, und ergieße sich in ihr! Selten oder nie wird es sich ereignen, daß ein Geist dieser endlichen Erde einzeln und ohne Gleichen steht; – und bliebe nicht diesem Erhabenen selbst, der kein Maaß für seine Größe fände, der göttliche Genuß noch übrig, sich Mehreren theilweise hinzugeben und Allen Alles zu werden? Die Weisheit der Natur ist zum Glück noch mächtiger und konsequenter, als die Thorheit der Menschen, und ehe man es sich versieht, führt sie auch den Schwärmer wieder in das Gebiet des Wirklichen zurück. Bei den Herrnhutern ist überdies dafür gesorgt, daß man sich nicht zu weit aus demselben verlieren kann. Fleiß und Arbeitsamkeit sind kräftige Verwahrungsmittel gegen das Überhandnehmen der Seelenkrankheiten, die sie nur dann begünstigen, wenn allzugroße Anstrengung, allzulanges Einsitzen, allzustrenge Diät die Kräfte des Körpers untergraben. Ein Kennzeichen, woran wir deutlich sahen, daß die Schwärmerei hier sehr erträglich seyn müsse, und daß die guten Leute auf die Weisheit der Kinder dieser Welt nicht ganz und gar Verzicht gethan hätten, war der hohe Preis, den sie auf alle ihre Fabrikate setzten. Ich weiß in der That nicht, wie ich diesen mit ihrem unstreitig sehr musterhaften Fleiße reimen, und wie ich mir die Möglichkeit eines hinlänglichen Debits dabei denken soll.
Andernach erreichten wir noch vor Sonnenuntergang. Ich bemerkte hier jetzt zum zweitenmal eine Nüance im Menschengeschlecht, welche gegen die Bewohner oberhalb dieses Orts merklich absticht; und da meine Reisegefährten die Bemerkung einstimmig bestätigten, so ist es vielleicht minder keck, daß ich sie Dir vorzulegen wage. Unter dem gemeinen Volke nämlich trift man hier und weiter hinabwärts am Rhein etwas regelmäßigere, blondere Gesichter an, wiewohl sich etwas Plumpes, Materielles in die Züge mischt, das dem Niederrhein eigen ist und dem Phlegma im Charakter vollkommen entspricht. Ich will hier nur im Vorbeigehen, und ohne eine bestimmte Anwendung zu machen, den Gedanken äußern, daß die Art der Beschäftigung, in der Länge der Zeit, wenigstens mittelbaren Einfluß auf die Verschiedenheit der körperlichen Bildung und folglich auch des Charakters hat. Armuth zum Beispiel ist unzertrennlich von dem Landvolke, das den Weinstock zu seiner einzigen Stütze wählte, und Armuth wirkt nachtheilig zurück auf die Gestalt. Um Andernach und weiter hinabwärts steht der Weinbau in keinem bedeutenden Verhältnisse zu den übrigen Erzeugnissen des Bodens. Wie aber, wenn, noch ehe Wein in Deutschland gebauet ward, bereits in Sprache, Farbe und Gestalt eine Abschattung zwischen den ober- und niederrheinischen Stämmen bemerkbar gewesen wäre? Dann könnte sie durch die Länge der Zeit und die Verschiedenheit der Lebensart nur noch schneidender geworden seyn. Die weichere, plattere Mundart fällt indeß erst auf, wenn man sich der Gegend von Kölln zu nähern anfängt.
III
Wohin sich das Gespräch der Edlen lenkt,
Du folgest gern, denn Dir wird's leicht zu folgen.
Kölln
Hier, wo der Rhein sich zwischen ebenen Flächen schlängelt, blick' ich wieder nach den Gebirgen zurück, deren letzte Gipfel Bonn gegenüber am Horizont sich noch in schwachen Linien zeichnen.
Mit welchem ganz andern Interesse, als der unwissenschaftliche Reisende daran nehmen kann, hält der Naturforscher die Schau und Musterung über jene Unebenheiten unserer Erde, denen er noch die Spur ehemaliger Umwandlungen und großer entscheidender Naturbegebenheiten ansieht! Auf unserer kurzen Rheinfahrt haben wir oft mit den Pflanzen und den Steinen am Ufer gesprochen, und ich versichere Dich, ihre Sprache ist lehrreicher, als die dicken Bücher, die man über sie geschrieben hat. Soll ich Dir von unseren Unterhaltungen nicht etwas wieder erzählen?
Die Gebirgskette, die sich durch Thüringen, Fulda und die Wetterau bis an den Rhein erstreckt, endigt sich oberhalb Bonn, in dem sogenannten Siebengebirge, welches prallig in mehreren hohen Spitzen und Gipfeln seine Granit- Gneus- und Porphyrmassen emporhebt, auf denen hier und dort andere Kiesel- Thon-und Bittersalzerdige Mischungen, wie Kieselschiefer, Hornschiefer und Basalte, nebst den zwischen ihnen durch verschiedene Verhältnisse der Bestandtheile verursachten Schattirungen von Gestein liegen. Die südlichen Zweige des Hessischen Gebirges setzen über den Rhein fort, und gehen in die Voghesische Kette über. Von Bingen bis Bonn enthalten sie Thon-und Kieselschiefer von mancherlei Gefüge, Härte, Farbe und Mischung, auf welchen man zuweilen große Sandsteinschichten antrift. Im Allgemeinen streichen die Schichten von Abend nach Morgen, und gehen mit einem Winkel von sechzig bis fünf und sechzig Graden nach Süden in die Tiefe.
Ehe uns die Nacht in Andernach überfiel, machten wir noch einen mineralogischen Gang nordwestlich von der Stadt. An einem Hohlwege, gleich unter der Dammerde, zeigte sich ein Bimssteinlager, welches an einigen Stellen mit Schichten von Tras, oder, wie ich es lieber nenne, von zerstörten, zu Staub zerfallenen und dann vermittelst des Wassers wieder zusammengekütteten Bimssteinen, abwechselte. Die Bimssteine sind von weißlicher Farbe, sehr leicht, bröcklich, löchericht, rauh anzufühlen und gewöhnlich in ganz kleinen Stückchen von der Größe einer Erbse und noch kleiner, bis zu zwei Zollen im Durchmesser. In diesen Stückchen finden sich zuweilen kleine Fragmente von Kohlen eingebacken.
Die Erscheinung dieser unbezweifelten Erzeugnisse des Feuers am friedlichen Rheinufer hat schon manchen Gebirgsforscher in Erstaunen gesetzt, welches vielleicht vom ruhigen Wege des Beobachtens abwärts führt. In der Strecke von Andernach bis Bonn glaubten Collini, Hamilton, de Lüc und andere Freunde der Feuertheorie die deutlichsten Spuren ehemaliger feuerwerfenden Schlünde zu sehen. Vulkane dampften und glühten; geschmolzene Lavaströme flossen, kühlten sich plötzlich in dem Meere, das damals alle diese Länder bedeckte, und zerklüfteten sich in säulenförmige Theile; ausgebrannte Steine, und Asche und Kohlen flogen in die Luft, und fielen in Schichten nieder, die man jetzt angräbt und zum Wasserbau nach Amsterdam versendet; kurz, ehe es Menschen gab, die den Gefahren dieses furchtbaren Wohnortes trotzten, und das plutonische Gebiet mit Waizen oder mit Reben bepflanzten, kreis'te hier die Natur, und die Berge wanden sich in gewaltsamen Krämpfen. Ist das nicht prächtig – geträumt? Es kommt ja nur auf uns an, ob wir den Hekla und Ätna, den Vesuv und den Tschimborasso an dem Gestade unseres vaterländischen Rheins erblicken wollen. Wenn die Erscheinungen, die das hiesige Gebirge uns zeigt, Vergleichungen dieser Art begünstigen, wer dürfte uns verbieten, unserer Einbildungskraft die Ergänzung einer Lücke in den Annalen der Erdumwandlung aufzutragen? Über jene Erscheinungen aber ist man bis jetzt noch nicht einig.
Der Bimsstein ist zwar zuverlässig ein Feuerprodukt; allein, daß wir uns ja nicht mit der Folgerung übereilen: es müsse deshalb bei Andernach einst ein Vulkan gelodert haben! Hier ist nirgends eine begleitende Spur von Vulkanen sichtbar; nichts leitet auch nur von fernher auf die Vermuthung, daß diese Schichte, wo sie liegt, im Feuer entstanden seyn könne. Ihre Lage unmittelbar unter der Dammerde scheint sie vielmehr für fremdartig zu erklären. Wer kann nun bestimmen, durch welche Revolutionen und wie viele tausend Meilen weit her, diese Bimssteine hier angeschwemmt sind? welche Fluth sie von weit entlegenen Gebirgen abwusch, um sie hier allmälig abzusetzen? Das Daseyn eines über alle hiesigen Berggipfel gehenden Meeres muß man ja bei der Feuertheorie ebenfalls voraussetzen, um die Möglichkeit der Entstehung des Basalts, nach den Grundsätzen dieser Theorie zu erweisen; folglich verlangte ich hier nichts Neues. Allein, auch ohne dieses Element zu Hülfe zu nehmen – soll denn immer nur das Feuer eines Vulkans im Stande gewesen seyn, hier ein Bimssteinlager hervorzubringen? Konnte nicht etwa ein Kohlenflöz in dieser Gegend in Brand gerathen, ausbrennen und den Letten, der ihm zum Dach und zur Sohle diente, zu einer Bimssteinähnlichen Masse verändern? Es ist in der That zwischen den Substanzen, die man mit dem gemeinschaftlichen Namen Bimsstein belegt, sehr oft ein weiter Unterschied, über den man in der Mineralogie nicht so leichtsinnig, wie bisher, hinwegsehen sollte. Im Grunde hat man den Bimsstein wohl noch nicht anders definirt, als daß er ein sehr leichtes, bröckliches Feuerprodukt sei; denn die unzähligen Verschiedenheiten der Farbe, der Textur und der übrigen äußerlichen Kennzeichen, die ich in Kabinetten an den so genannten Bimssteinen bemerkt habe, ließen keine andere allgemeine Form als diese übrig. Offenbar aber sind darunter Steine von dem verschiedensten Ursprunge begriffen, die nicht einmal immer einerlei Umwandlungsprozeß erlitten haben. So viel ist gewiß, daß der Bimsstein von Andernach nicht zu jener Art gehört, welche die Mineralogen von der Zerstörung des Asbests im Feuer herzuleiten pflegen, und auch nicht, wie der Bimsstein von Tanna, aus kleinen spitzigen Krystallen besteht, sondern, wenn er seine jetzige Gestalt im Feuer erhielt, wahrscheinlich aus Letten verändert worden ist.
Als wir am folgenden Tage unsere Wasserfahrt fortsetzten, kamen wir dem Flecken Unkel gegenüber an die merkwürdigen Basaltgruppen, über deren säulenförmige Bildung schon Trembley erstaunte, ohne jedoch etwas von dem Streite zu ahnden, den man zeither über ihre Entstehung mit so vieler Wärme geführt hat. Bei niedrigem Wasser ragen sie aus diesem hervor, und sind, so weit es sie bedecken kann, mit einem kreideweißen Schlamm überzogen, welcher auch die Thonschieferfelsen bei Bingen bedeckt. Wahrscheinlich macht dieser Schlamm den Rhein so trübe, wenn er von Berggewässern hochangeschwollen ist. Wir wanderten über die Gipfel oder Enden der konvergirenden Säulen, und gingen in den Steinbruch, der jetzt einen Flintenschuß weit vom Ufer hinaufwärts liegt, ob er sich gleich ehemals bis dicht an das Wasser erstreckte. Hier standen die sehr unvollkommen und regellos gegliederten Säulen von ziemlich unbestimmteckiger Form und Mannsdicke, aufrecht auf einem Lager von braunem, thonartigem Gestein voll Höhlen, die zum Theil noch mit verwitterndem Kalkspath angefüllt waren. Die Säulen sind von ziemlich festem Korn, dichtem Bruch, mattschwarz mit schwarzen Schörlpunkten und lauchgrünen Olivinen reichlich angefüllt, die sich zuweilen in faustgroßen Massen darin finden. Außerdem enthalten diese Basalte öfters Wasserkies in dünnen Streifen, desgleichen einen gelbbraunen Tropfstein oder Kalksinter, womit sie durchwachsen sind, und endlich, nach Aussage der Arbeiter, auch klares Wasser in ganz verschlossenen Höhlungen, die zuweilen im Kern einer Säule angetroffen werden.
Das Losbrechen der Säulen sieht gefährlich aus. Es geschieht vermittelst eines spitzen Eisens, das an einem langen Stocke befestigt ist, und das der Arbeiter zwischen die Fugen bringt. Der Sturz ganzer Massen von Säulen hat etwas Fürchterliches, und sobald man merkt, daß sie stürzen wollen, rettet sich ein jeder, um nicht beschädigt zu werden. An vielen Säulen, welche auf diese Art in unserer Gegenwart losgebrochen wurden, bemerkte ich einen weißen, vermuthlich kalkigen Beschlag oder Anflug, dessen Ursprung sich so wenig, wie der Ursprung des bereits erwähnten Sinters, erklären läßt, wenn man anders nicht künftig Kalkarten in der Nähe findet. Doch können auch die Wasser auf sehr langen Strecken Kalktheilchen aufgelöset enthalten und weit mit sich führen, ehe sie dieselben wieder absetzen.
Sowohl auf diesem westlichen, als auf dem entgegengesetzten östlichen Ufer des Rheins, bis in das Siebengebirge hinunter, sind diese Basaltbrüche häufig genug, um für die ganze Gegend Bau- und Pflastersteine zu liefern. Das ehemalige Jesuitenkollegium in Koblenz ist von außen mit Basaltstücken bekleidet, und die Heerstraßen werden damit in gutem Stande erhalten. Was suchen wir also weiter nach den Werkstätten, wo die Natur den Bimsstein von Andernach bereitete, wenn, wie es heutiges Tages bei so manchem Naturforscher für ausgemacht gilt, Basaltberge und erloschene Vulkane völlig gleichlautende Benennungen sind? Können wir noch die Spuren des ehemaligen Brandes vermissen, wo der Basalt sogar, wie hier bei Unkel, auf einer braunen, löcherichten Lava steht? Haben die Basaltberge nicht die charakteristische Kegelgestalt, und ist hier nicht ein Krater vorhanden, den de Lüc zuerst entdeckt hat, und dessen Öfnung er mit der Hand bedecken konnte?
Ich gebe Dir mein Wort, daß der Muthwille des Reisenden, der den ganzen Tag hindurch in frischer Luft und in muntrer Gesellschaft schwelgte, keinen Antheil an dieser Darstellung der vulkanistischen Logik hat. Es ist wahr, daß man unaufhörlich von dem Punkt ausgeht, den man erst beweisen sollte, und dann, wie gewisse Exegeten, zurückbeweiset: Basaltberge sind erloschene Vulkane; also ist der Basalt ein vulkanisches Produkt! oder: Basalt steht auf löcherichter Lava; also ist Basalt feste Lava! oder: Vulkane sind kegelförmige Berge; also sind kegelförmige Basaltkuppen Vulkane! oder endlich: ein Schlund, aus welchem der Rauch und die Flamme des Vulkans emporsteigen und Bimssteine und die Felsstücken herausgeschleudert werden, ist ein Krater; also ist ein Loch auf einem Basaltberge, welches man mit der Hand bedecken kann, ein Krater, und der Basaltberg ein Vulkan! Ohne das geringste von der Sache zu wissen, sieht man ein, daß diese sämmtlichen Schlüsse nichts beweisen, da bald der Obersatz, bald die Folgerung ungegründet ist. De Lüc's Krater lasse ich für sich selbst sprechen. Die Kegelform der Vulkane, die natürlich genug durch die Anhäufung der ausgeworfenen Steine, Erde und Asche entsteht, beweiset nichts für die Entstehung der festen säulenförmig zerklüfteten Basaltkegel, zumal da es auch kegelförmige Kalkberge genug giebt, und wiederum Basaltmassen, die sich in ganz verschiedenen Gestalten zeigen. Die löcherichte Steinart bei Unkel ist darum noch keine Lava, weil sie einigen Laven ähnlich sieht; und nun möchte es um den ersten willkührlich angenommenen Satz, daß Basaltberge Vulkane sind, etwas mißlich stehen. Diejenigen, die sich auf die Urtheile Anderer verlassen, und die Vulkanität des Basalts auf Treu und Glauben annehmen, sollten sich erinnern, daß das nullius in verba nirgends unentbehrlicher ist, als im hypothetischen Theile der Naturgeschichte. Bescheidene Forscher, die der vulkanistischen Vorstellungsart gewogen sind, erkennen dennoch, daß sie nur Hypothese bleibt und vielleicht nie zur Evidenz einer ausgemachten Sache erhoben werden kann. Allein die mineralogischen Ketzermacher, die auch in den Erfahrungswissenschaften die Tyrannei eines allgemein geltenden Symbols einführen wollen, verdammen gern einen jeden, der ihren Träumen nicht eben so viel Glauben beimißt, wie ihren Wahrnehmungen.
Ich bin weit davon entfernt, den Basalt geradezu für eine im Wasser entstandene Gebirgsart zu halten; allein ich gestehe zugleich, daß mir keine von den bisher bekannten Erklärungen Derer, die seinen Ursprung vom Feuer herleiten, Genüge leistet, ja, daß mir insbesondere seine Entstehung in den brennenden Schlünden, die wir Vulkane nennen, völlig widersprechend und unmöglich scheint. Wäre der Basalt vulkanischen Ursprungs, so müßte man die Gebirgsart entdecken können, aus welcher er in seine jetzige Form und Beschaffenheit geschmolzen ward. Aber noch nie hat man in irgend einem Naturalienkabinet oder auf irgend einem Gebirge ein Stück Basalt gezeigt, an welchem sich hätte erkennen lassen, ob es aus Granit, aus Gneus, aus Porphyr, aus Thonschiefer, aus Kalkstein u.s.w. zu Basalt geschmolzen worden sei.
Bei Jacci in Sicilien hat man Basaltsäulen unter einem Lavalager gefunden. Daraus folgt aber nicht, daß beide von gleichem Ursprunge sind. Der Basalt konnte, als ein ursprüngliches Gebirgslager, längst vorhanden seyn, ehe die Lava darüber hinfloß. Hoch hinauf am Ätna liegt ebenfalls Basalt. Nach der vulkanistischen Hypothese wäre dies im Wasser zu Prismen abgekühlte Lava; folglich ging bei seiner Entstehung das mittelländische Meer fast bis an den Gipfel des Ätna. Wohlan! eine solche Wasserhöhe zugegeben, erkläre man nun auch, warum tief am Fuße des Vesuv uralte Laven, unweit von dem jetzigen Stande der Meeresfläche, noch ungebildet geblieben sind, da es nicht einen Augenblick bezweifelt werden kann, daß, jenen hohen Stand der mittelländischen See vorausgesetzt, auch diese Laven von ihr hätten bedeckt werden und folglich säulenförmig zerspringen müssen. Viele wirklich geflossene Laven haben in ihren Bestandtheilen, in ihrer Farbe, und selbst in ihrem Gewebe eine auffallende, unläugbare Ähnlichkeit mit Basalt. Unbegreiflich ist es mir daher, weshalb man nicht eben so leicht hat annehmen wollen, solche Laven wären aus Basalt entstanden, welcher von dem vulkanischen Feuer ergriffen, verändert oder geschmolzen worden sei; als man sich die entgegengesetzte Meinung, Lava verändere sich durch plötzliches Erkalten in Basalt, annehmlich gedacht, ob man gleich noch in keinem Basalt die Steinart nachgewiesen hat, aus welcher die ihm ähnliche Lava geschmolzen worden ist. Mit dem nämlichen Rechte könnte man auch behaupten: alle andere Steinarten, die einer italienischen Lava ähnlich sehen, und deren es so viele giebt, wären im Feuer der Vulkane entstanden. Allein mir kommt es einmal natürlicher vor, daß, je nachdem der Brand in einem Berge einen Granit, einen Gneus, einen Porphyr, einen Thonschiefer, einen Basalt, einen Marmor ergrif, und je nachdem er diese ursprünglichen Steinarten mehr oder weniger veränderte, heftiger oder gelinder, einzeln oder mit andern zugleich durchdrang, – daß, dem gemäß, die Produkte gerade so mannichfaltig verschieden ausfallen mußten, wie man sie wirklich unter die Hände bekommt. Eine der schönsten und vollständigsten Sammlungen von vesuvischen Produkten, welche ich je gesehen habe, die im kuhrfürstlichen Naturalienkabinet von Bonn, enthält meines Bedünkens unverwerfliche Belege für diese Behauptung, die noch überdies durch den Umstand Bestätigung bekommt, daß die Laven aus verschiedenen ächtvulkanischen Gegenden, wie zum Beispiel die isländischen und die santorinischen, von den italienischen sichtbarlich verschieden sind – augenscheinlich, weil die Mischung der Gebirgsart, aus welcher sie entstanden, verschieden war.
Nimmt man endlich noch hinzu, daß die Verwitterung sowohl an Laven, als an ursprünglichen Gebirgsarten völlig ähnliche Wirkungen hervorbringt; so wird es immer unwahrscheinlicher, daß sich etwas Positives über die Frage behaupten lasse: ob die Entstehung unserer Rheinländer dem Feuer zuzuschreiben sei. Porphyr, Porphyrschiefer, Mandelstein nebst den hieher gehörigen Gebirgsarten werden durch die leicht zu bewirkende Auflösung ihrer Feld- und Kalkspathkörner zu leichten löcherichten Massen, welche den schwammigen verwitterten Auswürfen der Vulkane aus Island und aus Italien ähnlich sehen. Aber eine ächte, glasige, geflossene schlackige Lava, die vor allen diesen Namen verdient, eine Lava, wie man sie in Island, am Vesuv, am Ätna findet, wie ich sie auf der Osterinsel, in Tanna, und zuletzt auf der Ascensionsinsel selbst gesehen habe, ist mir weder in den rheinländischen, noch in den hessischen, hannöverischen, thüringischen, fuldischen, sächsischen, böhmischen und karpathischen Basaltbergen vorgekommen.
Alles was ich hier von unsern vermeintlichen Vulkanen am Rhein mit wenigen Worten berühre, findet sich in den beiden Quartanten des Dr. Nose und in den zusammengedrängten Beobachtungen unseres scharfsinnigen Freundes A.v.H. bestätigt. Wenn nun aber der Basalt nicht Lava ist, wie entstand er denn? Aufrichtig gesagt, ich weiß es nicht. Ich kenne weder den Urstoff, noch die chemische Operation, woraus und wodurch die Natur die sämmtlichen Gebirgsarten werden ließ. Wird mir jemand beweisen, daß, ehe es noch Vulkane gab, ein ganz anderer Brand, ein fürchterliches allgemeines Feuer den Basalt in allen fünf Welttheilen erzeugte; wird er mir den Urstoff nennen können, aus welchem dieses Feuer, wie noch keines war, und dem wir folglich nach Willkühr Eigenschaften und Wirkungen beimessen können, den Basalt geschmolzen habe: so will ich das nicht nur geschehen lassen, sondern sogar dieser Meinung beipflichten, sobald sie mehr als ein bloßes Meisterwort, sobald sie gründliche Beweise für sich hat. Bis jetzt wissen wir indeßen noch wenig oder nichts zuverlässiges von der Bildung unserer Erdrinde; denn wir haben von einer weit späteren Bildung, von der Bildung der Pflanzen und Thiere auf diesem Boden, nicht einmal einen Begrif! Wo wir Schichten regelmäßig übereinander liegen sehen, halten wir uns für berechtigt, sie einem allmäligen Niederschlag aus dem Wasser zuzuschreiben. Allein ob alle Kalklager unsers Planeten aus Gehäusen von Würmern entstanden, oder ob das Meer, welches einst die ganze Kugel umfloß, ein von den jetzigen Meeren sehr verschiedenes chaotisches Flüssiges war, worin theils Kalk, theils Thon und Bittersalzerde, unausgeschieden, vielleicht als mögliche Bestandtheile, schwammen – das ist und bleibt unausgemacht. Wir wissen zwar, daß der uralte Granit, bei seiner seltsamen Mischung von Quarz, Feldspath und Glimmer keine Spur von einer geschichteten Entstehung zeigt; aber darum ist noch nicht entschieden, ob auch diese Gebirgsart ein Präcipitat aus jenem elementarischen Meere, oder, wie der große dichterische Büffon will, ein Werk des Sonnenbrandes sei. Vielleicht ist er keines von beiden. Ehe wir dahin gelangen, über die Ereignisse der Vorwelt etwas mehr als schwankende, von allem Erweis entblößte Muthmaßungen in der Naturgeschichte vortragen zu können, müssen wir zuvor in der unterirdischen Erdkunde ungleich wichtigere Fortschritte machen als bisher; wir müssen, wo nicht Maupertuis berühmten Schacht bis zum Mittelpunkt der Erde abteufen, doch wenigstens ein paar Meilen tief unter die Oberfläche, die wir bewohnen, senkrecht hinabsteigen, und von dorther neue Gründe für eine Theorie der Erdentstehung und Umwandlung entlehnen. Bedenkt man aber, mit welchen Schwierigkeiten wir bisher nur wenige hundert Klafter tief in das Innere der Gebirge gedrungen sind, so müssen wir über die Arbeit erstaunen, die nicht uns, sondern den späten Nachkommen des Menschengeschlechtes aufgehoben bleibt, wenn sie vor lauter ewigem Frieden nicht wissen werden, was sie mit ihrer Zeit und ihren Kräften anfangen sollen. –
Ich kann dieses Blatt, das ohnehin so viel Naturhistorisches enthält, nicht besser ausfüllen, als mit ein paar Worten über das schon vorhin erwähnte Naturalienkabinet in Bonn. Von der herrlichen Lage des kuhrfürstlichen Schlosses und seiner Aussicht auf das Siebengebirge will ich nichts sagen, da wir die kurze Stunde unseres Aufenthaltes ganz der Ansicht des Naturalienkabinets widmeten. Die dabei befindliche Bibliothek füllt drei Zimmer. In den reichvergoldeten Schränken steht eine Auswahl brauchbarer, theurer Werke, die eines solchen Behältnisses wohl werth sind. Ich bemerkte darunter die besten Schriftsteller unserer Nation in jedem Fache der Litteratur, ganz ohne Vorurtheil gesammelt. Aus der Bibliothek kommt man in ein physikalisches Kabinet, worin sich die Elektrisirmaschine, der große metallene Brennspiegel und der ansehnliche Magnet auszeichnen. Die Naturaliensammlung füllt eine Reihe von acht Zimmern. Das größte enthält vierfüßige Thiere, Vögel, Amphibien und getrocknete Fische in keiner systematischen Ordnung, theils in Glasschränken, theils im Zimmer umhergestellt, theils hangend an der Decke und mit Kunstsachen vermischt, die nicht alle von gleichem Werth, oder ihres Platzes würdig sind. Die ausgestopften vierfüßigen Thiere sind meistentheils sehr mißgestaltet; ein Tadel, der mehr oder weniger alle Naturaliensammlungen trift. Die Vögel sind weniger verzerrt, und man sieht darunter manche seltene Gattung nebst ihren Nestern und Eiern. Die Decke des Zimmers ist mit verschiedenen Vögeln bemalt, die der Sammlung fehlen. Das Konchylienkabinet hat nicht viele Seltenheiten, Kostbarkeiten und sogar nicht viele Gattungen; es enthält nur die gemeinsten Sorten und eine Menge Dupletten. Desto reicher ist aber die schöne Mineraliensammlung, die zwar keine methodische Ordnung hat, und eben so wenig eine vollständige Folge aufweisen kann, aber gleichwohl, wenn man sie nicht als ein Ganzes beurtheilen will, manches Kostbare enthält, und dem Kenner willkommene und lehrreiche Bruchstücke darbietet, besonders die unvergleichliche vesuvisch-vulkanische Sammlung in einem draußenstehenden Schranke, einen reichen Vorrath von Goldstufen, sehr schönen weißen Bleispath vom Glücksrad am Harz, Eisenglaskopf von den seltensten Configurationen, prächtiges rothes Kupferglas, Flußspathdrusen, Versteinerungen, u. dgl. m. Das Merkwürdigste war mir ein Menschenschedel, der gleichsam aus gelbbraunem Tuff von sehr dichtem, festem Bruch, woran keine Lamellen kenntlich sind, besteht. An einigen Stellen ist die Substanz desselben zolldick, ohne daß man auf dem Schnitte die geringste Spur von Inkrustation erkennen kann. Der halbe Oberkopf ist nämlich bis an die Augenbrauen und hinten bis auf die Hälfte des Hinterhaupts, wie ein Segment ausgeschnitten, so daß man es herausnehmen und inwendig alles besehen kann. Ein Umstand ist dabei sehr auffallend: Die Substanz dieses Schedels hat in ihrer Veränderung fast alle feineren Hervorragungen so bedeckt, und alle Vertiefungen so ausgefüllt, daß man sowohl auf der innern, als auf der äußern Oberfläche nur kleine abgerundete Spuren erblickt; gleichwohl sind die Gelenkflächen des Kopfes und des Unterkiefers allein verschont und in ihrem natürlichen Zustande geblieben. Dies allein beweiset schon, daß dieses seltene Stück nur zur Erläuterung der Lehre von den Krankheiten der Knochen dienen kann, und keinesweges, wie man vorgiebt, ein versteinerter Menschenschedel ist. Solche Versteinerungen sind zwar von andern Thierklassen nicht selten, hingegen vom Menschen ist bis jetzt noch schlechterdings kein einziges unbezweifeltes Petrefakt gefunden worden. Die Krankheit, welche hier diese sonderbare Erscheinung an einem Menschenschedel hervorgebracht hat, ist eine der ungewöhnlichsten gewesen, nämlich ein Überfluß von wucherndem Knochensaft, oder Knochenstoff, wodurch bei Lebzeiten des unglücklichen Individuums die Theile des Schedels zu einer unförmlichen Gestalt angewachsen sind, und ihn allmälig aller Sinnorgane beraubt haben müssen. Dabei ist es vorzüglicher Aufmerksamkeit werth, daß die Nervenlöcher doch verhältnißmäßig nur wenig verengt worden sind. Man hat bereits in d'Argenville's Oryktologie die Abbildung eines dem hiesigen vollkommen ähnlichen Schedels, und unser Sömmerring besitzt einige, auf eben dieselbe Art unförmlich angequollene Hünerknochen.
Ich will mir den Glauben nicht nehmen lassen, daß diese wissenschaftlichen Ansichten, welche Dich gewiß sehr lebhaft beschäftigen werden, eine Seite haben, an der sie auch eine weniger vorbereitete Wißbegierde befriedigen können. Es kommt eines Theils nur darauf an, diese allgemein interessirende Seite herauszukehren; und andern Theils müßte der Zuhörer nur eine gewisse Thätigkeit der eigenen Geisteskräfte und einen richtigen Sinn besitzen, um überhaupt alles Neue, sobald es nicht in Kunstwörtern verborgen bleibt, unterhaltend, richtig und anwendbar zu finden. Je reicher die Ausbildung unseres Zeitalters, je größer die Anzahl unserer Begriffe, je erlesener ihre Auswahl ist, desto umfassender wird unser Denk- und Wirkungskreis, desto vielfältiger und anziehender werden die Verhältnisse zwischen uns und allem was uns umgiebt. Daß wir uns auf diesem Punkte der Geisteskultur befinden, das beweist der gegenwärtige Zustand der Erziehungsanstalten, der Universitäten, der belletristischen und ernsten Litteratur, der politischen und statistischen Verfassungen, der physischen und hyperphysischen Heilkunde, ja sogar der raisonnirten Schwelgerei und raffinirten Sinnlichkeit, worin alles auf einem encyklopädischen Inbegrif und Zusammenhang aller möglichen Zweige der Erkenntniß beruhet. Dieser nunmehr in allen Fächern aufgesuchten und mit so vielem Glück verfolgten Verwebung und Verbindung der verschiedenartigsten Kenntnisse sind wir es schuldig, daß der Gang unserer Erziehung sich beflügelt und daß unsere sechszehnjährigen Jünglinge ein vollständigeres, zusammenhängenderes System von nützlichen, praktischen Begriffen inne haben, als man sich zu Locke's Zeiten mit dreißig Jahren erwerben konnte. Die Spreu ist besser von reinem Korn geschieden, und wir genießen, wenigstens in gewisser Rücksicht, die Frucht des Schweißes von Jahrtausenden. Unsere Frauenzimmer selbst finden es leicht und anmuthig, alle Gefilde des Wissens zu durchstreifen, sie wie Gärten geschmückt zu sehen, und ihre Blumen in einen Strauß zusammenzubinden, den man im bunten, gesellschaftlichen Kreise nicht ohne Selbstgefallen jedem zur Erquickung darreichen kann. Wir wollen uns über diese oberflächliche Weisheit nicht entrüsten; denn sie ist reeller, als man denkt, und als es mürrische oder pedantische Sittenrichter zugeben mögen. Alles ist gewonnen, wenn es zur Gewohnheit wird, die Geisteskräfte zu beschäftigen und die Vernunft, die man dem größten Theile des Menschengeschlechts so lange und so gern abgeläugnet oder auch wohl unmenschlich entrissen hat, in ihrer Entwickelung überall zu begünstigen. Nur der Geist, welcher selbst denkt, und sein Verhältniß zu dem Mannichfaltigen um sich her erforscht, nur der erreicht seine Bestimmung. Wie wir anfingen, so endigen wir dann: durch die Wirbel aller möglichen Zusammensetzungen hindurch, kehren wir, reich in uns selbst und frei, zu der ursprünglichen Einfalt zurück! –
Du weißt, ich kenne auch die Rückseite des schönen Gepräges, welches unsere Einbildungskraft den Weltbegebenheiten aufdrückt; allein jede Ansicht hat nur Einen, ihr eigenen Gesichtspunkt, und wer ihn verrückt, der hascht nach einem Schatten, über welchen das Wesentliche selbst ihm entgeht. Wenn wir uns am heitersten Frühlingsmorgen des Lichtes freuen, dessen milder Strom den Himmel und die Erde verjüngt und Lebenswonne in der ganzen Schöpfung anzündet – was kümmert uns der Sonnenstich oder die Donnerwolke, die möglichen Folgen der Einwirkung jenes wohlthätigen Elements in einen unvollkommenen, ungleichartigen Planeten?
IV
Kölln
Wir gingen in den Dom und blieben darin, bis wir im tiefen Dunkel nichts mehr unterscheiden konnten. So oft ich Kölln besuche, geh ich immer wieder in diesen herrlichen Tempel, um die Schauer des Erhabenen zu fühlen. Vor der Kühnheit der Meisterwerke stürzt der Geist voll Erstaunen und Bewunderung zur Erde; dann hebt er sich wieder mit stolzem Flug über das Vollbringen hinweg, das nur Eine Idee eines verwandten Geistes war. Je riesenmäßiger die Wirkungen menschlicher Kräfte uns erscheinen, desto höher schwingt sich das Bewußtseyn des wirkenden Wesens in uns über sie hinaus. Wer ist der hohe Fremdling in dieser Hülle, daß er so in mannichfaltigen Formen sich offenbaren, diese redenden Denkmäler von seiner Art die äußeren Gegenstände zu ergreifen und sich anzueignen, hinterlassen kann? Wir fühlen, Jahrhunderte später, dem Künstler nach, und ahnden die Bilder seiner Phantasie, indem wir diesen Bau durchwandern.
Die Pracht des himmelan sich wölbenden Chors hat eine majestätische Einfalt, die alle Vorstellung übertrift. In ungeheurer Länge stehen die Gruppen schlanker Säulen da, wie die Bäume eines uralten Forstes: nur am höchsten Gipfel sind sie in eine Krone von Ästen gespalten, die sich mit ihren Nachbaren in spitzen Bogen wölbt, und dem Auge, das ihnen folgen will, fast unerreichbar ist. Läßt sich auch schon das Unermeßliche des Weltalls nicht im beschränkten Raume versinnlichen, so liegt gleichwohl in diesem kühnen Emporstreben der Pfeiler und Mauern das Unaufhaltsame, welches die Einbildungskraft so leicht in das Gränzenlose verlängert. Die griechische Baukunst ist unstreitig der Inbegrif des Vollendeten, Übereinstimmenden, Beziehungsvollen, Erlesenen, mit einem Worte: des Schönen. Hier indessen an den gothischen Säulen, die, einzeln genommen, wie Rohrhalme schwanken würden und nur in großer Anzahl zu einem Schafte vereinigt, Masse machen und ihren geraden Wuchs behalten können, unter ihren Bogen, die gleichsam auf nichts ruhen, luftig schweben, wie die schattenreichen Wipfelgewölbe des Waldes – hier schwelgt der Sinn im Übermuth des künstlerischen Beginnens. Jene griechischen Gestalten scheinen sich an alles anzuschließen, was da ist, an alles, was menschlich ist; diese stehen wie Erscheinungen aus einer andern Welt, wie Feenpalläste da, um Zeugniß zu geben von der schöpferischen Kraft im Menschen, die einen isolirten Gedanken bis auf das äußerste verfolgen und das Erhabene selbst auf einem excentrischen Wege zu erreichen weiß. Es ist sehr zu bedauren, daß ein so prächtiges Gebäude unvollendet bleiben muß. Wenn schon der Entwurf, in Gedanken ergänzt, so mächtig erschüttern kann, wie hätte nicht die Wirklichkeit uns hingerissen!
Ich erzähle Dir nichts von den berüchtigten heiligen Drei Königen und dem sogenannten Schatz in ihrer Kapelle; nichts von den Hautelissetapeten und der Glasmalerei auf den Fenstern im Chor; nichts von der unsäglich reichen Ciste von Gold und Silber, worin die Gebeine des heiligen Engelberts ruhen, und ihrer wunderschönen ciselirten Arbeit, die man heutiges Tages schwerlich nachzuahmen im Stande wäre. Meine Aufmerksamkeit hatte einen wichtigeren Gegenstand: einen Mann von der beweglichsten Phantasie und vom zartesten Sinne, der zum erstenmal in diesen Kreuzgängen den Eindruck des Großen in der gothischen Bauart empfand und bei dem Anblick des mehr als hundert Fuß hohen Chors vor Entzücken wie versteinert war. O, es war köstlich, in diesem klaren Anschauen die Größe des Tempels noch einmal, gleichsam im Widerschein, zu erblicken! Gegen das Ende unseres Aufenthalts weckte die Dunkelheit in den leeren, einsamen, von unseren Tritten wiederhallenden Gewölben, zwischen den Gräbern der Kuhrfürsten, Bischöfe und Ritter, die da in Stein gehauen liegen, manches schaurige Bild der Vorzeit in seiner Seele. In allem Ernste, mit seiner Reizbarkeit und dem in neuen Bilderschöpfungen rastlos thätigen Geiste möchte ich die Nacht dort nicht einsam durchwachen. Gewiß entsetzest Du Dich schon vor dem bloßen Gedanken, wie ihm selbst davor graute.
Ich eilte mit ihm hinaus ins Freye, und sobald wir unsern Gasthof erreicht hatten, erwachte die beneidenswerthe Laune, womit er, durchdrungen vom Genuß der lieblichen Natur, schon auf der ganzen Fahrt von Koblenz her, die einförmigen Stunden uns verkürzt hatte. Noch kann ich mir den großen Zweifel nicht lösen, ob es befriedigender sei, Bilder des Wirklichen unmittelbar aus der umgebenden Weite zu schöpfen, oder sie von zahllosen Anschauungen bereits überallher gesammlet, erlesen, geordnet, zusammengesetzt, zu schönen Ganzen vereinigt, aus einer reichen Menschenseele, unserm Wesen schon mehr angeeignet, in uns übergehen zu lassen? Beides hat seinen eigenthümlichen Werth, und beides haben wir seit unserer Abreise schon reichlich gekostet. Lebendiger wirkt die unmittelbare Gegenwart der beseelten Natur; tief und scharf bestimmt und alle Verhältnisse erschöpfend, graben sich die Bilder des Daseyns, das unabhängig von dem Menschen, ohne sein Zuthun ist und war und seyn wird, ins Gedächtniß ein. Dagegen gesellen sich, von einer menschlichen Organisation aufgefaßt, die mannichfaltigsten Formen aus allen Welttheilen zugleich, aus der Vergangenheit und – darf ich es sagen? – aus der Zukunft, zum Gegenwärtigen, und verweben sich mit ihm zu einem die Wirklichkeit nachahmenden Drama. Wir selbst, ich fühle es wenigstens, können nicht immer so richtig, so ins Wesentliche eingreifend empfangen, so die unterscheidenden Merkmale der Dinge uns selbst bewußt werden lassen, wie sie uns auffallen, wenn ein Anderer sie vom Außerwesentlichen abgeschieden und in einen Brennpunkt vereinigt hat. Zum Beweise brauchte ich nur an das schwere Studium des so vielfältig und so zart nüancirten Menschencharakters zu erinnern. Je feiner die Schattirungen sind, wodurch sich so nahe verwandte Geschöpfe unterscheiden, desto seltener ist sowohl die Gabe der bestimmten Erkenntniß, als die Kunst der treuen Überlieferung ihres Unterschiedes.
Der Genuß eines jeden, durch die Empfindung eines Andern gegangenen und von ihm wieder mitgetheilten Eindrucks setzt aber eine frühere, wenn gleich unvollkommene Bekanntschaft mit dem bezeichneten Gegenstande in uns voraus. Ein Bild, wäre es auch nur Umriß, müssen wir haben, worin unsere Einbildungskraft die besonderen Züge aus der neuen Darstellung übertragen und ausmalen könne. Die bestimmte Empfänglichkeit des Künstlers für das Individuelle erfordert daher, wenn sie recht geschätzt werden soll, einen kaum geringeren Grad der allgemeinen Empfänglichkeit des Kunstrichters: und die Seltenheit dieses Grades ist ohne Zweifel der Grund, weshalb die höchste Stufe der Kunst, in allen ihren Zweigen, so leicht verkannt werden, oder auch beinahe gänzlich unerkannt bleiben kann. Was der große Haufe an einem Gemälde, an einem Gedicht oder an dem Spiel auf der Bühne bewundert, das ist es wahrlich nicht, worauf die Künstler stolz seyn dürfen; denn diesem Haufen genügt die Täuschung, die ihm Erdichtetes für Wahres unterschiebt; und wer weiß nicht, wie viel leichter sich Kinder als Erwachsene, gewöhnliche Menschen als gebildete, täuschen lassen? Darum kann auch nicht die Illusion, als solche, sondern es muß die ganze Vollkommenheit der Kunst der letzte Endzweck des Künstlers seyn, wie sie allein der Gegenstand der höchsten Bewunderung des Kenners ist, der sich nicht mehr täuschen läßt, außer, wenn er mit dem feinen Epikurismus der Kultur eben gestimmt wäre, im Beschauen eines Kunstwerks nur den Sinn des Schönen zu befriedigen, und wenn er auf das erhöhte, reflektirte Selbstgefühl, welches aus der Erwägung der im Menschen wohnenden Schöpferkraft entspringt, absichtlich Verzicht thäte.